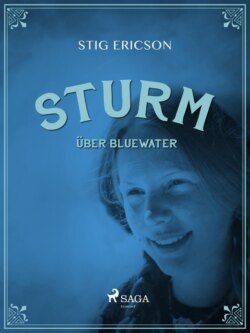Читать книгу Sturm über Bluewater - Stig Ericson - Страница 4
Onkel Charles
ОглавлениеIch weiß nicht, ob ich nur Angst hatte vor meinem Vater oder ob ich ihn wirklich haßte. Bis zu dem Sommer, in dem ich vierzehn Jahre alt wurde, hatte ich ihn meistens als eine Schreckfigur erlebt. Meine Gefühle für ihn umfaßten alles außer Gleichgültigkeit – und Liebe.
Aber trotz allem kam es manchmal vor, daß ich ihn bewunderte, daß ich stolz darauf war, seine Tochter zu sein.
Meine Gedanken kreisten ständig um Vater.
Er beherrschte meine ganze Kindheit und Jugend.
Mein Vater war eine starke Persönlichkeit, im Guten wie im Schlechten, eine Führergestalt. Und trotz seines Eigensinns, trotz aller seiner kindischen Einfälle und gewalttätigen Ausbrüche wurde er von den Siedlern in der ganzen Gegend um Bluewater respektiert. Er muß so ungefähr 25 Jahre alt gewesen sein, als er seine ersten 160 Ar auf dem Plateau westlich des Flusses absteckte, aber es hat nicht lange gedauert, bis man ihn „Onkel“ Charles nannte. Es gab in der Gegend mehrere Siedler, die Charles hießen, aber mein Vater hatte den wildesten Bart und den schärfsten Blick. Er war auch der erste, der den Spaten in die schwarze Erde zwischen dem Fluß und den Sandhügeln stieß.
Ich sehe es förmlich vor mir, wie er gebeugt zwischen den wilden Sonnenblumen hockt. Die Hosen sind so kaputt, daß die Knie herausschauen. Er zerkrümelt die schwere Erde zwischen seinen groben und doch merkwürdig gefühlvollen Fingern und brummelt etwas in sehr gebrochenem Englisch oder vielleicht auch auf schwedisch. „Wo die Sonnenblumen so hoch wachsen, da muß man auch Mais anbauen können.“
Der erste wirkliche Bauer. Der dickköpfige Schwede. Der Rücksichtslose. Derjenige, zu dem man zuerst ging, wenn es zu trocken war, wenn die schneidenden Winde über das Plateau fegten oder wenn die Viehkönige, die Ranchbesitzer, den Siedlern mit Mord und Totschlag drohten, weil sie Stacheldraht um ihre neuen Besitztümer zogen.
Mein Vater. Mr. Charles J. Lind from Sweden.
Onkel Charles.
Einmal schlug er mich fast tot.
Es war im Spätsommer, die grünen Äpfel wurden reif, ich war vielleicht vier, fünf Jahre alt. Die Äpfel goren in meinem Bauch, es stach wie mit Messern, und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich weinte und jammerte, und da kam Vater hochgerannt und fing an zu schlagen ...
Kindergeschrei war das Schlimmste für ihn. Es war Sache der Frau, die Kinder ruhigzuhalten.
Er schlug immer weiter. Mutter versuchte, ihn davon abzuhalten. „Ach Charles ...“
Meine Mutter war Deutsche. Sie war einige Jahre nach Vater mit einem ihrer Brüder nach Bluewater gekommen, aber der Bruder starb durch einen Schlangenbiß, und dann kam es, wie es kommen mußte: Sie traf den Eigenbrötler aus Schweden und heiratete ihn. Es war keine Liebe. Es war noch nicht einmal Zugeneigtheit oder Sympathie. Es war eine Möglichkeit zu überleben. Was sollte eine alleinstehende Frau denn sonst tun in dieser primitiven Gesellschaft, wo man entweder Verwandte haben mußte, übermenschliche Kräfte oder Geld, wenn man nicht untergehen wollte, wenn der erste Schnee fiel?
Und vielleicht wusch Vater sich damals auch öfter.
Wenn meine Mutter aufgeregt war, fing sie alle Sätze mit „Ach“ an – wie an diesem Morgen, als Vater mich bewußtlos schlug.
„Ach Charles, du bist ja ganz verrückt ...“
Mutters schrille Stimme. Vaters graugesprenkelter Bart und sein wild starrender Blick. Das Weiße der Augen in der kalten Morgendämmerung. Schmerz, Schmerz und kein Ende des Schmerzes – und dann eine befreiende Dunkelheit.
Das sind Erinnerungen, die ich behalten werde, solange ich lebe. Meinem Vater merkte man nichts an nach dieser schrecklichen Nacht. Als ich aufwachte, hörte ich ihn Geige spielen. Dann setzte er vermutlich seinen alten Hut mit der abgeschnittenen Krempe auf und ging in seinen geliebten Garten hinaus.
Das erstaunte mich nicht, damals noch nicht. Vater schien eine erstaunliche Fähigkeit zu haben, alles abzuschütteln, woran er nicht denken wollte, alles, was ihn nicht interessierte. Und Kinder waren völlig uninteressant – außer als Arbeitskraft.
Ich erinnere mich an die spröden Geigentöne und daß Mutter auf der Bettkante saß und nach sauberem Leinen roch. Das tat sie immer, ich weiß nicht, wie sie das schaffte. Sie gab mir einen Becher warme Saftsuppe. Der Rand des Bechers war warm und glatt. Mutter sagte fast nichts, aber ihre Augen glänzten und waren gerötet. Danach ging ich Vater wochen- und monatelang aus dem Weg. Ich wünschte mir, daß er sterben würde, daß er verschwinden würde und nie mehr zurückkäme. Allein sein Geruch jagte mir Schrecken ein: Kautabak, alter Schweiß und irgend etwas Süßes, Scharfes, was eingetrocknetes Tierblut gewesen sein muß. Vater war ein eifriger Jäger, und obwohl Mutter protestierte, hatte er immer die gleichen Kleider an, bis sie ihm fast vom Leib fielen.
Die Jagd war ein wichtiger Teil unserer Versorgung. Den ersten Winter wären meine Eltern bestimmt verhungert, wenn Vater nicht so sicher mit dem Gewehr gewesen wäre.
Er trainierte gegen einen Sandabhang hinter dem Haus.
Aber das war nicht das einzige Mal, daß ich meinem Vater den Tod gewünscht hatte, keineswegs.
Ich werde nie den Tag im Spätwinter acht oder neun Jahre später vergessen. Ich war gerade vierzehn geworden, und ich saß in der Schule und buchstabierte mich durch eine Seite in einem Lesebuch mit grünen Deckeln. Ich hatte eine große Warze am Nagel des Zeigefingers, an der ich immerfort knabbern mußte.
Ich ging das erste Jahr in die Schule – davor hatte es noch keine Schule gegeben – und ich hatte gerade mal eben lesen gelernt. Die Sonne schien, und das Schmelzwasser tropfte vom Dach. Es war ganz still in der kleinen Torfhütte und stickig. Viele Kinder in jedem Alter drängten sich auf den drei langen Bänken.
Mrs. Ryan, die Lehrerin, hatte ihr rotes Kleid an. Es hatte einen runden Kragen und 15 Knöpfe, die wie kleine Sonnen glänzten. Das Kleid raschelte auf eine ganz bestimmte Art, wenn sie sich bewegte. Ich bewunderte sie grenzenlos. Sie gehörte einer anderen Welt an.
Mrs. Ryan hatte gerade ein großes Q an die Tafel gemalt, als wir draußen Pferde hörten.
Dann wurde die Tür aufgemacht, und Vater kam herein mit einigen der ältesten Siedler und einem großen, gebeugten Mann, den ich noch nie gesehen hatte. Ein Neuankömmling. Er hatte bestimmt viele Kinder. Er sah zumindest so aus.
Vater hatte seinen alten Militärmantel an, und die Haare hingen in grauen Strähnen unter der zerrissenen Fellmütze hervor. Er sah schrecklich aus. Primitiv. Er glich irgendwie einem Tier. Es war peinlich. Wenn er wenigstens nicht diese furchtbare Mütze aufgehabt hätte.
Aber Mr. Charles J. Lind nahm für niemanden die Mütze ab, nicht einmal für Mrs. Ryan.
Das Schlimmste war der Blick, den er mir zuwarf, als er auf die Lehrerin zuging. Er war böse und gemein. Durchdringend. Ich begann zu ahnen, was los war.
Vater war der Meinung, daß die Schule unnötiger Luxus sei, und diese Meinung verheimlichte er auch nicht. Zuerst und vor allem sollten alle dabei helfen, das neue Land zu bebauen, sein Land. Vielleicht träumte er davon, König in einem mächtigen Land mit wogenden Maisfeldern und blühenden Gärten zu werden. Aber ich weiß es nicht. So einfach war das nicht mit meinem Vater.
Einmal habe ich gesehen, wie er Lindsdorf mit dem Gewehrkolben in den Sand hinter dem Haus gemalt hat. Der Ort, der sich im Entstehen befand, hatte noch keinen Namen, der Fluß hieß Bluewater. Und er hatte jede Menge Briefe an die Behörden geschrieben, um die Erlaubnis zu bekommen, ein Postamt zu eröffnen. Ich erinnere mich an das Kratzen der Feder und an Mutters unruhige Augen. Es mußte totenstill im Haus sein, wenn Vater schrieb: Weh dem Kind, das es wagte, den Mund aufzumachen. Und wenn Vater die Erlaubnis bekommen würde, die Post zu verwalten, hätte er auch die Möglichkeit, den neuen Ort zu taufen. Lindsdorf.
Warum nicht?
Ich glaube nicht, daß jemand etwas dagegen gehabt hätte.
Wir Schulkinder wurden hinausgeschickt, und dann waren die Männer allein mit Mrs. Ryan. Nach einer Weile kamen sie heraus. Mrs. Ryan hatte rote Flecken auf den Wangen. Vater kam zu mir und sagte: „So, Jenny, so wird es also gemacht.“
Er schaute mich wieder so an, schwer, grau, aus halbgeschlossenen Augen. Und dann setzten die Männer sich in den Wagen und rollten davon.
Mrs. Ryan schaute mich nicht an, als sie alles erklärte: Wir wüßten ja alle, wie eng es im Schulhaus war, und jetzt hatte eine neue Familie sich ganz in der Nähe niedergelassen, eine Familie mit vielen Kindern. Es gab ganz einfach nicht genug Platz für alle, und deswegen konnte sie diejenigen, die es am weitesten hatten, nicht mehr aufnehmen. Es tat ihr so schrecklich, schrecklich leid, aber es war ja am praktischsten so, und man konnte das Haus auch nicht vergrößern. Im Herbst vielleicht ... Diejenigen, die es am weitesten hatten – das waren ich und mein Bruder Daniel.
Ich weiß nicht mehr, wie es mir gelang, die Tafel und die anderen Sachen in der Felltasche zu verstauen und wegzukommen. Ich weiß nur, daß ich so weinte, daß ich mich in den weichen Schnee setzen mußte, und mich vorbeugte, damit ich nicht erstickte.
Mein Bruder Daniel versuchte, mich zu trösten.
Daniel war vier Jahre jünger als ich. Er war klein und krummbeinig und hatte Mutters hellbraune, milde Augen. Er war bestimmt nicht sehr traurig: Er würde wieder mehr Zeit haben, hinter den Büschen am Fluß zu sitzen und Katzenfische zu angeln – zumindest dann, wenn Vater nicht zu Hause war.
Aber das Angeln war meistens nur eine Ausrede, ein Vorwand, um allein sein zu können und über das Wasser zu schauen.
Er war ein Träumer, mein Bruder, und der netteste Mensch, den es gab. Er war fast zu nett und nachgiebig, wenn das möglich ist.
Er strich mir hilflos über die Haare und sagte, daß ich nicht traurig sein sollte, daß ich auf jeden Fall „nicht so eine verdammte Lehrerin aus Boston“ werden würde.
Das waren Vaters Worte. So nannte er alle Frauen, die nicht mit der Erde arbeiteten, ganz egal, von wo sie kamen.
„Du wirst ganz bestimmt heiraten“, sagte Daniel. „Und einen eigenen Hof bekommen.“
Das war nun wirklich das Schlimmste, was er in diesem Moment hätte sagen können.
Ich war vierzehn Jahre alt, ich war kein Kind mehr, ich schaute mich ab und zu im Spiegel an. Der Spiegel war das blanke Blech auf der Innenseite des Deckels einer schwarzen Blechkiste, die Vater aus Schweden mitgebracht hatte. Ich nannte sie die Schweden-Kiste, und ich erinnere mich, daß Vater immer einen ganz bestimmten Gesichtsausdruck bekam, wenn er sie anschaute.
Sie schien ihn zu bedrücken. Aber er sagte nichts.
Ich spiegelte mich im Deckel und tat mir leid. Niemand hatte so strähnige Haare, so ungleiche Zähne, ein so kantiges Gesicht. Niemand war so dünn und mager und knochig, auf jeden Fall kein anderes Mädchen.
Das Spiegelbild im Deckel zeigte mir auch, wie ich angezogen war. Das Kleid war geflickt und abgetragen, Mutter hatte den Stoff schon mehrmals gewendet, und wenn ich nicht barfuß war, trampelte ich in alten Männerschuhen umher. Sie waren so groß, daß ein Ei hinter die Ferse gepaßt hätte. Kein Mann würde sich jemals nach mir umdrehen, und das war mir gerade recht.
Es gab nämlich tiefere Gründe dafür, daß ich nicht ans Heiraten denken wollte.
Ich wollte nicht werden wie Mutter.
Ich wollte nicht so unterdrückt werden wie sie, so gebeugt und verbraucht, so voller Sorgen und Not. Und mir wurde schlecht, wenn ich nur an das Allergeheimste dachte, das mußte sie mindestens viermal gemacht haben: Außer Daniel hatte ich noch zwei jüngere Geschwister.
Nach der letzten Geburt hatte sie außerdem noch zwei Zähne im Unterkiefer verloren. Das Kind hatte den Kalk aus ihrem Körper gezogen, sagte sie, wie immer das auch zugehen mochte. Die wenigen Male, die sie lächelte oder lachte, hielt sie die Hand vor den Mund.
Ich weiß nicht mehr, was ich zu Daniel sagte, als er mich zu trösten versuchte. Vermutlich sagte ich nichts. Ich war verzweifelt. Ich liebte es, in die Schule zu gehen. Und das hatte viel mit der Sprache zu tun: Der richtigen Sprache – nicht der, die bei uns zu Hause gesprochen wurde.
Vater behauptete manchmal, er sei der einzige gebildete Mensch am Bluewater, der einzige, der etwas vom Anbau verstand, der einzige, der wirklich kapierte, was eigentlich los war. Aber wenn Mutter fragte, in welche Schule er gegangen war, zog er eine mürrische Grimasse und spuckte auf den Boden.
„Sie wollten einen feinen Herrn aus mir machen, einen Arschkriecher, aber das ist ihnen nicht gelungen.“
Mehr sagte er nie.
Aber auch wenn Vater ein gebildeter Mensch war, so unglaublich das auch klingen mochte, er war auf jeden Fall Schwede – und er sprach schlecht englisch.
Mutter stammte aus einem Dorf in der Nähe von Bremen in Deutschland und sprach noch schlechter englisch.
Wenn meine Eltern, was selten genug vorkam, wirklich versuchten, miteinander zu diskutieren, dann taten sie das in einer verkürzten und primitiven Mischsprache, die auch zu meiner Sprache und der meiner Geschwister wurde. Aber die meiste Zeit wurde zu Hause gar nicht gesprochen, und wir hatten selten Gelegenheit, mit anderen Leuten zu reden. Es war weit zwischen den Häusern, und man war immer auf der Hut vor Fremden. Ich wuchs also auf mit einem inneren Schweigen, einer Leere, einer Wortlosigkeit, und um für alle die Gedanken und Gefühle, die mich bedrängten, Ausdruck zu finden, erfand ich eigene Wörter.
Wenn ich in einer bestimmten Stimmung war, dann fühlte ich mich „muddrig“, ich weiß nicht, woher ich das Wort hatte. Ich pflückte „Gelbblumen“ und „Rotblumen“.
Ich fluchte und sagte oft auf schwedisch „bitte“, wenn ich um etwas bitten wollte.
Aber in Mrs. Ryans Schule war diese Leere allmählich mit Wörtern ausgefüllt worden, Wörter, immer neue Wörter. Ich erinnere mich, wie ich die neuen Ausdrücke, die ich gelernt hatte, ausprobierte, wie ich versuchte, so viele Reimwörter wie möglich zu finden. Tuch, Fluch, Buch ...
So reihte ich Wörter aneinander. Ich lutschte an den neuen Wörtern wie an Kandiszucker oder Eiszapfen, versuchte, sie so oft wie möglich zu verwenden.
Hat sie das wirklich gemacht? Ist das wirklich wahr? Nein, das hätte ich wirklich nicht gedacht...
Und es kam natürlich vor, daß die Kinder mich wegen meiner überdeutlichen Aussprache hänselten, oder daß sie mich auslachten, wenn ich in der Aufregung eines meiner selbsterfundenen Wörter benutzte. Aber die meisten Kinder in der Schule waren Neuankömmlinge, ich hielt es also gut aus. Was die Schule betraf, war ich wie Unkraut.
Ich wollte eine richtige Sprache haben. Ich wollte ordentlich lesen lernen – nicht wie manche Erwachsenen: Sie hielten sich die Zeitung vor die Nase und machten komische Bewegungen mit dem Mund und taten nur so, als ob sie lasen ...
Ich saß im Schneematsch und heulte, Daniel spielte irgendwo, und dann kam der Wagen zurück. Vater saß nicht mehr drin. Der Mann mit den Zügeln hielt das Pferd an. Ich spürte, wie er mich anschaute.
„Ist es so schlimm?“ fragte er.
„Ja, es ist so schlimm“, sagte ich und versteckte meine rotgeweinten Augen in der Armbeuge. „Wirklich und wahrhaftig ...“