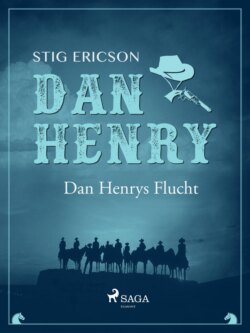Читать книгу Dan Henrys Flucht - Stig Ericson - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеWenn ich an diese Nacht denke, kann ich kaum verstehen, wie ich das alles auszuhalten vermochte: Da war zuerst der lange Tag im Regiment, abends das Konzert im Restaurant, dann die Schlägerei, die Flucht, die Fahrt im Ruderboot, der Besuch in Tante Elins Wohnung, der Marsch durch die Stadt.
Aber wenn man jung ist, hält man mehr aus, als man denkt. Und ich hatte ja keine andere Wahl, ich mußte mich nicht erst lange entscheiden.
Denn das ist ja oft das Lästigste — sich zu entscheiden. Als ich da im Ruderboot saß und die Lokomotive pfeifen hörte, war die Sache für mich klar.
Ich war vierzehn Jahre alt, gesund und kräftig und, genaugenommen, allein auf der Welt. Und ich steckte voller Unruhe und Lebenslust.
Meine Mutter starb am selben Tag, an dem ich sieben Jahre alt wurde. Am vorhergehenden Abend hatte ich vor Aufregung nur schwer einschlafen können, und ich erinnere mich noch, daß sie meinen Arm streichelte und sagte:
»Die Zeit vergeht schneller, wenn man schläft, mein kleiner Dan. Wenn du brav einschläfst, ist es bald morgen.«
Aber als ich am nächsten Morgen aufwachte, kam niemand, um mir zu gratulieren, und ich bekam auch keine Geschenke. In der Wohnung wimmelte es von fremden Menschen, die alle sehr ernste Gesichter machten. Mutter war schwer krank. Ich durfte nicht zu ihr. Am Abend war sie tot.
Das ganze Haus roch nach Teer. Damals kochte man in Cholerahäusern Teer, um weitere Ansteckung zu verhüten.
An die Beerdigung kann ich mich nicht erinnern. Aber ich weiß, daß ich mich dazwischenwarf, als sie kamen und Mutters Kleider holen wollten. Ich konnte es nicht fassen, daß sie die nie mehr brauchen würde.
Danach zogen wir fort, Vater und ich. Ich weinte, als wir das Haus verließen, und da sagte er:
»Es wird schon alles wieder gut werden, Dan. So ist es besser für uns. Wir müssen von allem wegkommen, was uns an Mutter erinnern könnte.«
Später erzählte er mir, daß ich antwortete:
»Aber ich bin doch noch da. Du sagst doch so oft, daß ich an Mutter erinnere.«
Das Laub färbte sich schon gelb. Die Sonne schien, das Pferd, das unsere Fuhre zog, war braun, und Vater hatte einen seiner milden Tage. Wir saßen nebeneinander auf dem Kutschbock, und er hielt meine Schultern fest umfaßt.
»Alles wird wieder gut werden, mein Junge.« Und dann gab er mir ein gelbes, klebriges Bonbon.
Wenn Vater seine milden Tage hatte, gab es keinen sanftmütigeren Menschen auf der Welt. Er hätte seine Jacke verschenkt, wenn ihn jemand darum gebeten hätte. Seine Augen waren liebevolle Schlitze, das ganze Gesicht ein seliges Grinsen, und er traute allen Menschen nur Gutes zu. Er roch nach Punsch und liebte die Welt.
Nach Mutters Tod hatte er viele solche Tage.
Er war Musiker, Geiger. Er spielte im Opernorchester, und darauf war er sehr stolz.
»Dein Vater ist königlicher Kammermusiker, Dan«, sagte er oft. »Du verstehst es jetzt vielleicht noch nicht, aber das ist das Beste, was man sein kann.«
Für mich bedeutete es jedenfalls viele Stunden Einsamkeit. Ich kann mich nicht erinnern, womit ich mich die ganzen Tage und langen Abende eigentlich beschäftigte. Spielgefährten hatte ich auf jeden Fall keine. Als ich in die Schule kam, wurde es etwas besser. Da war ich wenigstens nicht allein. Aber wir hatten einen Lehrer, der nach Bier und Schnupftabak roch und uns mit einem Bambusstock auf die Finger schlug, wenn wir die Buchstaben nicht schön genug formten. Ich spüre immer noch, wie weh es tat.
Aber die Abende waren schön. Wir hatten immer viele Bücher zu Hause, und ich las viel und träumte.
Als ich die Schule beendet hatte, gingen Vater und ich zur Ersten Leibgarde, wie die Svea Leibgarde damals noch hieß. Dort trafen wir viele energisch dreinblickende Männer mit großen Schnurrbärten und dunkelblauen Uniformen mit blanken Knöpfen. Sie waren sehr freundlich und sagten, daß es nach dem König nichts Besseres auf dieser Erde gebe als einen Leibgardisten. Übrigens war der König auch Leibgardist, er war der oberste Chef des Regiments.
»Möchtest du nicht auch gerne so eine schöne Uniform haben, Dan?« sagte Vater. »Und königlicher Leibgardist werden und im Musikkorps spielen?«
Ich erhielt meine blaue Uniform. Und ich lernte, den Mund zu halten und Prügel einzustecken.
Es war unbeschreiblich, wie die Älteren uns Buben quälten. Wir waren nicht einmal den Dreck wert, auf den sie traten. Wir waren ihre Sklaven.
Aber wenigstens war ich nicht allein, sondern einer von vielen, und das gefiel mir.
Wie gesagt wohnte ich nicht in der Kaserne, sondern bei Tante Elin. Sie war Volksschullehrerin, eine schwarzgekleidete, ernste Frau mit schmalen Händen, Über der Nasenwurzel hatte sie zwei steile Falten, und ihre Augen waren groß und grau, genau wie bei Mutter. Ich hatte großen Respekt vor ihr. Wir sprachen nicht viel miteinander. Sie war Witwe und hatte drei Kinder, lauter Mädchen.
Ab und zu kam Vater und besuchte mich. Er roch meistens nach Punsch und war sehr liebevoll und sagte immer:
»Es wird schon alles gut werden, Dan.«
Aber für Vater wurde nicht alles gut, er mußte seine Stellung bei der Oper aufgeben. Wahrscheinlich war der Punsch daran schuld. Er wurde Restaurantmusiker.
Ich trug meine dunkelblaue Uniform und übte die verschiedenen Trommelwirbel auf nassen Trommelfellen, daß mir das Gefühl in den Armen bis zum Ellbogen hinauf abstarb. War ich mit den Trommelwirbeln fertig, so kamen Tonleitern und lange Tonfolgen auf einer alten Klarinette dran.
Allmählich vergrößerten sich die Abstände zwischen Vaters Besuchen bei Tante Elin immer mehr. Schließlich kam er gar nicht mehr. Heute glaube ich, daß Tante Elin ihn einfach bat, wegzubleiben.
Und ich glaube, daß sie recht daran tat.
Eines Tages, ungefähr ein Jahr vor den Ereignissen, die zu meiner Flucht führten, erhielt ich Besuch im Regiment. Es war ein Pfarrer, ein kleiner, dicker Mann mit glänzenden Wangen und heiserer Stimme, und er bat, ungestört mit mir sprechen zu dürfen. Dabei sah er sehr bedeutend und feierlich aus.
Der Pfarrer bestritt den größten Teil der Unterhaltung. Er sagte, daß Vater zu seiner Gemeinde gehöre und daß er leider den schmalen Pfad der Tugend verlassen habe. Vater war in schlechte Gesellschaft geraten und hatte sich an einem Gelddiebstahl beteiligt. Die Polizei hatte ihn erwischt, und jetzt erwartete ihn eine lange Gefängnisstrafe.
Als der Pfarrer zu Ende gesprochen hatte, war es sehr still im Zimmer. Am liebsten wäre ich sofort hinausgestürzt.
»Folge immer den Wegen Gottes, mein Junge«, sagte der Pfarrer.
Dann sagte er, daß er dafür sorgen wolle, daß ich benachrichtigt würde, wenn die Gerichtsverhandlung stattfinde; dann ging er.
Ein paar Wochen darauf erhielt Vater sein Urteil, aber weder ich noch Tante Elin noch sonst ein Verwandter waren anwesend. Er wurde zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Wenn er sich zu seinen Taten bekannt hätte und nicht versucht hätte, alles wegzuleugnen, dann wäre das Urteil milder ausgefallen, stand in einer Benachrichtigung, die wir hinterher erhielten.
Sie kannten Vater eben nicht.
Ich konnte es nicht fassen, glaubte nicht, daß es wahr sei.
Ich weinte viel und träumte viel und hielt mich meistens abseits. Die anderen im Regiment wunderten sich, was denn mit mir los sei. Ich gab ausweichende Antworten und bemühte mich, vergnügt und normal zu wirken. Manchmal gelang es.
Aber dann kam der Pfarrer zurück und sagte, daß er alles geregelt habe, damit ich meinen Vater im Gefängnis besuchen könne.
Hinterher haßte ich den Pfarrer deswegen. Zwar kann ich nicht behaupten, daß ich alle Gedanken an Vater verdrängt hatte, aber wenn ich an ihn dachte, war er königlicher Kammermusiker und sagte:
»Es wird schon alles gut werden, Dan.«
Nach dem Besuch im Gefängnis sah ich ihn als einen gebrochenen Mann. Er trug graue Gefängniskleidung und hatte eine große Wunde auf der Stirn. Er sagte nicht viel und vermied es, mir in die Augen zu sehen.
Und aus irgendeinem Grund bildete ich mir ein, an seinem Mißgeschick schuld zu sein.
Es dauerte nicht lange, bis es im Regiment durchsikkerte, daß mein Vater im Knast saß. Daß er ein Dieb war. Und dieser lange Leutnant, mein besonderer Quälgeist, gab sich redlich Mühe, damit ich es nur nie vergaß.
Daß ich die Stadt so leichten Herzens verließ, lag sicher nicht nur daran, daß ich eine lebhafte Phantasie hatte und mir meine Hinrichtung in der Dämmerung oder meine lebenslange Festungshaft ausmalte. Ich hatte viele Gründe.
Und trotz meiner Angst vor der Polizei glaube ich, daß ich selten so gut geschlafen habe wie in jener Scheune südlich von Stockholm.