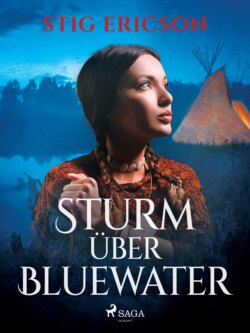Читать книгу Sturm über Bluewater - Stig Ericson - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Unerwarteter Besuch
ОглавлениеEinige Tage später hörte man am Abend Hufgetrappel auf dem verschneiten Platz vor dem Haus.
Vater konnte es nicht sein, er war auf einer seiner Jagdtouren und würde vermutlich die ganze Woche wegbleiben. Vielleicht hatte er ein schlechtes Gewissen, aber davon war ich gar nicht überzeugt. Was meinen Vater betraf, so konnte man sich auf gar nichts verlassen.
Mutter sah ängstlich aus. Sie zeigte stumm auf das Gewehr in der Ecke neben dem Herd, eine von Vaters vielen Winchesters, eine ziemlich neue 73er, die immer geladen war.
Ich holte das Gewehr herunter und erinnerte mich noch daran, wie schwer es war. Ich schoß sonst immer mit einer kleinen 22er, die nicht entfernt so schwer war. Mutter stand unbeweglich hinter einem Hocker und starrte auf die Tür. In der einen Hand hatte sie einen kaputten Strumpf, in der anderen eine Stopfnadel.
Und sie hatte auch allen Grund, Angst zu haben. Vater hatte viele Feinde, vor allem unter den großen Ranchbesitzern, die Vieh züchteten. Er war ja so etwas wie ein selbsternannter Führer der Kleinbauern, der Farmer, die Stacheldraht um ihre Grundstücke zogen.
Die Rancher haßten Stacheldraht ‒ außer dem, den sie unrechtmäßig auf dem freien Feld ziehen ließen. Ihre ganze Wirtschaft gründete sich darauf, daß die riesigen Herden frei über große Gebiete ziehen konnten. Und es ging um unglaublich große Summen. Deshalb konnten sie diese ,Weichlinge‘, die aus dem Osten kamen, nicht ausstehen, die neuen Farmer, die immer mehr von dem bis dahin freien Land nahmen. Und es war ihnen auch egal, daß die Siedler das Recht auf ihrer Seite hatten, daß ihre Grundstücke registriert waren. Es war weit bis zum Sheriff in Rushville, und für Geld konnte man alles kaufen ‒ auch Polizisten.
Gedungene Cowboys mit lose sitzenden Halftern und schnellen Pistolen unternahmen alles, um die Siedler zu verjagen. Der Stacheldraht wurde durchgeschnitten. Höfe angezündet. Schüsse hallten in der Nacht, Leute wurden tot aufgefunden. Zeugen wurden gekauft ‒ oder zum Schweigen gebracht.
Die wenigen, die das Geld hatten, besaßen auch die Macht.
Vater und viele andere hatten sich richtige Feuergefechte mit fremden Reitern geliefert, die dann schnell in der Dunkelheit verschwunden waren.
Wir hatten also wirklich allen Grund, an diesem Abend Angst zu haben.
In letzter Zeit hatte man sich Sorgen gemacht wegen der Oglalas, der Siouxindianer aus dem Pine-Ridge-Reservat, das einen knappen Tagesritt nördlich lag.
Es gab wenig zu essen da oben, hieß es. Die Roten hungerten. Und sie hatten damit begonnen, ihre wilden Kriegstänze zwischen den Hügeln nördlich des Reservats zu tanzen. Vielleicht würde bald wieder ein großer Indianerkrieg ausbrechen wie damals vor vierzehn Jahren, als Custer und seine Leute oben in Montana erschlagen worden waren. Da würde das Skalp schon lose sitzen, wenn man nicht aufpaßte.
Ich verstand das Ganze nicht so recht. Als ich klein war, hatten wir im Sommer oft Besuch von Indianern aus Pine Ridge. Sie hatten ihre Zelte so nah aufgestellt, daß wir sie vom Haus aus sehen konnten. Sie waren völlig friedlich. Ich war sogar in einem Tipi dringewesen, so nannten die Indianer ihre Zelte. Ich hatte mit Indianerkindern gespielt. Vater war mit den Indianern auf der Jagd gewesen.
Aber jetzt hatten wir seit langem keine Indianer mehr gesehen. Vater war nicht zu Hause, und draußen war es ganz still.
Dann hörte man leichte, schnelle Schritte.
Jemand klopfte an die Tür.
Mutter warf mir einen steifen Blick zu, ehe sie die Tür öffnen ging, und ich nahm das Gewehr hoch . . .
Aber es war kein gedungener Cowboy, der in der Türöffnung auftauchte, und auch kein hungriger Indianer – es war Mrs. Ryan, meine vergötterte Lehrerin Mrs. Ryan!
So im nachhinein kann man die Szene komisch finden: Ich sehe mich selbst, mager und jämmerlich, ich muß mich zurücklehnen, um das Gewehr hochhalten zu können; Mutter hat rote Flecken auf den Wangen und ist steif wie ein Besenstiel, und in der Tür steht die dunkel gekleidete Mrs. Ryan mit einem blauen Tuch über den Schultern und weiß nicht, wie sie dreinschauen soll.
„Ach . . .“, brachte Mutter heraus. „Ach, Mrs. Ryan . . .“
Sie machte ein paar Schritte rückwärts und wäre beinahe über den Hocker gefallen.
Ich weiß noch, daß ich kichern mußte. Mutter starrte in meine Richtung und versuchte gleichzeitig, ein Lächeln hervorzupressen, ohne den Mund zu öffnen.
„Man kann schließlich nie wissen . . . aber so kommen Sie doch herein. Bitte ...“
Mrs. Ryan kam herein. Sie schaute sich rasch um.
„Onkel . . . Mr. Lind ist also nicht zu Hause?“
Mutter schüttelte den Kopf. Sie hatte immer noch den Strumpf in der Hand. Ich fand, daß Mrs. Ryan erleichtert zu sein schien, aber das kann auch Einbildung gewesen sein. Die ganze Situation war so unerwartet, so verwirrend.
Aber in mir stieg auch eine neue Spannung auf, eine Hoffnung. Warum war sie gekommen? Sollten Daniel und ich doch wieder . . .? Ich wagte nicht, den Gedanken zu Ende zu denken.
Mutter rieb sich die Hände.
„Eine Tasse Kaffee? Es ist ja so kalt.“
„Nein danke.“
Mrs. Ryan machte die Tür hinter sich zu und trat in das ärmliche Zimmer ein. Der Rock raschelte. Sie war wirklich eine Erscheinung aus einer anderen Welt. Sie setzte sich ganz unten an den großen Tisch. Sie hatte ein Paket unterm Arm. Sie legte das Paket auf den Schoß und schaute erst mich und dann Mutter an.
„Ich habe mir gedacht, daß ich doch noch ein paar Worte sagen muß zu dem, was neulich vorgefallen ist. Ich habe gehört, wie traurig Jenny ist. Und der kleine Daniel. Er schläft wohl schon . . .“
Sie erklärte, daß nicht sie „solche Fragen“ entschied. Sie war nur ein Werkzeug im Dienste der Allgemeinheit. Von sehr niedrigem Rang . . .
Rang, Klang, Zwang . . .
Die Wörter hallten in mir nach. Ich bewunderte sie grenzenlos: Die Art, wie sie die Lippen bewegte, wie sie jede Silbe formte.
Sie sagte noch, daß es im Schulhaus ja wirklich eng sei, sehr eng sogar, aber daß die Rede davon sei, ein größeres zu bauen, im Nachsommer, ehe die Erntearbeiten alle Zeit in Anspruch nahmen . . .
Mutter betrachtete die Lehrerin mit schmalen, braunen Augen. Sie entspannte sich jetzt etwas. Ich sehe sie immer noch vor mir. Sie beugt sich ein wenig vor. Sie sieht hilflos aus, ebenso hilflos wie der löchrige Strumpf, den sie auf den Hocker gelegt hat. Aber was konnte sie denn schon machen? Nichts.
Ich weiß noch, wie traurig sie war, als Daniel und ich an jenem Tag nach Hause kamen. Sie sagte nicht viele Worte, aber sie sprach durch ihr Schweigen, ihre Blicke und ihren Gesichtsausdruck, durch die Art und Weise, wie sie sich bewegte.
Aber sie schwieg nicht nur, weil sie machtlos war. Das Schweigen war auch ein Ausdruck ihrer unwahrscheinlich großen Solidarität: Sie sprach selten oder nie über jemanden, der nicht anwesend war, vor allem nicht, wenn es Vater betraf.
Wenn sie, was ganz selten vorkam, einmal auszudrücken versuchte, was sie dachte und meinte, dann wandte sie sich direkt an ihn. Und wenn er dann etwas brummte von „Frauen sollten sich nicht in Dinge einmischen, die sie nicht verstehen“, dann schaute sie ihn so lange unbeweglich an, bis er hinaus in den Garten floh.
Manchmal folgte sie ihm.
Mrs. Ryan öffnete das Paket. Ich hatte mir schon gedacht, daß Bücher mit grünen Umschlägen drin sein würden. Lesebücher. „Ich habe den ersten und den zweiten Teil dabei“, sagte sie, während sie das Papier mit ihren schmalen Händen faltete. „Bücher haben wir auf jeden Fall genügend ...“
Dann sagte sie noch, daß ich bestimmt Daniel viel helfen würde, und wenn Mrs. Lind mal ein Stündchen erübrigen könnte, dann könnte sie vielleicht die Lehrerin ersetzen.
Mutter nahm schnell die Hand vor den Mund. Sie schien peinlich berührt zu sein, beinahe verlegen. Lesen, doch, das konnte sie schon. Aber ach, die Aussprache. Die Aussprache.
Mrs. Ryan lachte.
Sie war vielleicht vierzig Jahre alt, hatte ein fein gezeichnetes Gesicht und sehr ebenmäßige, weiße Zähne. In diesem Moment fand ich, daß sie schön war. Und möglicherweise habe ich in diesem Moment einen wichtigen Beschluß gefaßt.
Ich würde versuchen, Lehrerin zu werden, genau wie sie. Ich würde alles machen, wirklich alles, um so weit zu kommen wie sie. Ich würde niemals Siedlerfrau werden. Ich würde Miss Lind werden, „so eine verdammte Lehrerin“ ‒ aber nicht aus Boston, sondern aus Bluewater oder Lindsdorf oder wie immer der Ort in Zukunft heißen würde.
Das würde Vater recht geschehen. Das hatte er dann davon. „Das mit der Aussprache wird schon werden“, sagte Mrs. Ryan. „Das kommt mit der Zeit. Das Verstehen der Wörter ist wichtig. Und die Übung im Lesen.“
Dann nahm sie Mutters Hand, lächelte wieder und sagte, daß es schon spät sei, aber daß sie gerne bei einer anderen Gelegenheit „auf eine Tasse Kaffee hereinschauen würde“.
An der Tür schaute sie zu mir.
„Bringst du mich zum Wagen, Jenny?“
Erst da merkte ich, daß ich immer noch das Gewehr in der Hand hatte.
Ohne Mrs. Ryan anzuschauen, hängte ich die Winchester auf. Dann schlüpfte ich in die Schuhe und zog mir ein Tuch um die Schultern. Wenn es draußen kalt war, so spürte ich es nicht. Meine Wangen glühten. Da hatte ich mit dem Gewehr in der Hand dagestanden und dumm geschaut und noch nicht einmal danke gesagt. Aber ich weiß noch, daß es klar und windstill war und daß man im Nordwesten eine dunkle Wolkenwand sehen konnte.
Mrs. Ryan ging zum Einspänner und holte etwas hervor, was unter der Decke auf dem Sitz lag. Das Pferd stand unbeweglich da und hatte das Maul tief im Futtersack.
„Hier . . .“
Sie reichte mir ein Buch, das in Zeitungspapier eingeschlagen war. „Das ist eine Bibel“, sagte sie. „Ich wollte sie nicht mit hineinnehmen, weil ich ja nicht wußte, ob Onkel Charles . . . aber das weißt du ja viel besser als ich.“
Ich war außerstande, das Paket entgegenzunehmen. Ich schlug die Augen nieder und sah Mrs. Ryans glänzende, schwarze, spitze Stiefel vor meinen Kisten von Schuhen im sternhellen Schnee stehen.
Ich hatte Tränen in den Augen. Diese unerwartete Freundlichkeit . . . Und ich verstand nur zu gut, was Mrs. Ryan mit ihren Andeutungen über Vater und die Bibel meinte.
Alle in der ganzen Gegend wußten, daß er seinen Fuß nicht in eine Kirche gesetzt hatte, seit er nach Nordamerika gekommen war. Er gab sogar damit an. Die Natur‒ das war sein Heiligtum, sein einziges Heiligtum, und wenn es einen Gott gab, dann war er da und sonst nirgends.
Alle Leute wußten auch, daß er Priester und Prediger nicht ausstehen konnte, und vielleicht ahnte ich damals schon, daß das etwas mit seinen Studien in Schweden zu tun hatte, seinen „feinen“ Studien. Er nannte sie manchmal „Himmelslotsen“ und fügte hinzu, daß man vor allem hier auf Erden praktische Führung brauchte. Das Himmelreich konnte warten, je länger, desto lieber.
Und er selbst war so etwas wie ein „praktischer Führer“.
Da alles bebaute Land am Fluß entlang abgesteckt war, hatten die Neuankömmlinge es schwer, wenn sie noch freie Grundstücke finden wollten. Vater suchte ihnen geeignetes Land, oft in einem großen, unbewohnten Gebiet, das wir die Sandhügel nannten und das sich westlich vom Fluß weithin erstreckte. Eine solche Tour dauerte oft drei oder vier Tage, und er verlangte dafür fünfundzwanzig Dollar, die „bei Gelegenheit“ bezahlt werden sollten.
Vater war der Freund der Siedler und der Feind der Prediger.
„Ihr habt doch bestimmt keine Bibel im Haus, oder?“ fragte Mrs. Ryan.
Ich schaute auf meine Schuhe und kämpfte mit dem Weinen im Hals. „Keine englische.“
Mutter hatte eine deutsche Bibel, aber sie hatte sie meines Wissens schon lange nicht mehr aufgeschlagen. Vielleicht las sie darin, wenn Vater weg war und wir Kinder schliefen. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, daß sie die Kirche vermißte, und ich hatte einige Male gehört, daß sie zu Gott bat, er solle doch machen, daß Vater nett würde.
„Nimm sie jetzt“, sagte Mrs. Ryan. „Ich möchte, daß du sie bekommst. Verstehst du? Ich will es.“
„Ich bin nicht wie mein Vater“, sagte ich, und jetzt wußte ich, daß ich nicht anfangen würde zu weinen.
Es war so still auf dem Hof, daß ich sie atmen hörte. Sie steckte mir die Bibel unter den Arm, ich schaute schnell auf, und sie strich mir leicht über die Wange und sagte leise:
„Kleine Miss Jenny Lind. Ich weiß es. Du bist nicht wie dein Vater.“
Dann stieg sie in den Einspänner und wickelte sich in die Decke. „Und jetzt hilf mir bitte mit den Zügeln.“
Jetzt hatte sie wieder ihre normale Stimme. Ich machte die Zügel vom Haltepflock los und reichte sie ihr mit einer Bewegung, die wohl eine Verbeugung darstellen sollte.
Mrs. Ryan schaute Richtung Nordwesten. Die Wolkenwand war näher gekommen.
„Ich muß zusehen, daß ich nach Hause komme, ehe das Unwetter da ist. Viel Glück, kleine Jenny. Und grüße deinen Bruder.“
Sie trieb das Pferd an, und der kleine Einspänner rollte Richtung Fluß davon.
Miss Jenny Lind.
So hatte mich noch nie jemand genannt.
Jetzt faßte ich noch einen Entschluß ‒ einen der eine mehr direkte Wirkung hatte. Ich würde Mutter die Bibel nicht zeigen, noch nicht. Ich würde ein Geheimnis haben.
Ich machte das Zeitungspapier ab, faltete es zusammen und stopfte es in den einen Schuh. Platz genug war da. Dann versteckte ich die Bibel unter ein paar Sachen neben der Tür und ging hinein.
Ich saß am Tisch und blätterte im zweiten Lesebuch, als Hanna zu schreien anfing. Hanna war erst neun Monate alt. John, der Dreijährige würde bestimmt auch aufwachen. Ich spürte Mutters Blick. Es war meine Aufgabe, eine meiner vielen Aufgaben, mich um meine kleineren Geschwister zu kümmern. Meine ganze Kindheit und Jugend war ein einziges langes Kinderhüten. Ich konnte keinen Schritt gehen, ohne ein Kind auf der Hüfte zu haben, und ein anderes, das mit hinterherstolperte.
Das Schreien hörte nicht auf, aber ich tat so, als ob ich nichts hörte.
Schließlich erhob sich Mutter vom Hocker. Sie brummte etwas von „feinen Büchern“ und ging mit müden Schritten die Treppe hinauf in die Dachkammer, wo wir Kinder schliefen. Ich schlich schnell weg und holte die Bibel. Später würde ich sie an einem besseren Ort verstecken. Ich weiß noch, daß ich erst an ihr roch, ehe ich sie aufschlug. Auf dem hellbraunen Papier auf der Innenseite des Deckels stand etwas mit Tinte geschrieben. Es dauerte einige Zeit, bis es mir gelang, in dem schwachen Licht die Buchstaben zu deuten, aber ich werde nie vergessen, was da stand:
Mary Elisabeth Finerty
Johannes 3,16
Omaha, den 4. Juni 1863
Ich wußte, daß Mrs. Ryan Witwe war, und daß sie bei ihrem Bruder wohnte, der Arzt war und ein Holzbein hatte. Er hatte im Krieg gegen die Indianer gekämpft. Und der Bruder hieß Finerty. James Finerty.
Sie hatte mir ihre eigene Bibel geschenkt!
Ich schaute auf die Jahreszahl und rechnete mit den Fingern. 1863. Das war siebenundzwanzig Jahre her. Sie muß ungefähr so alt wie ich jetzt gewesen sein, als sie sie bekam, vielleicht zum Schulabschluß.
Sie hatte mir ihre eigene erste Bibel geschenkt. Das war mehr, als ich begreifen konnte.
Normalerweise habe ich noch nicht richtig den Kopf aufs Kissen gelegt, und schon bin ich eingeschlafen.
Aber an diesem Abend war nichts wie sonst. Ich dachte an Mrs. Ryan, wie sie wohl ausgesehen hatte, als sie so alt war wie ich, was für Kleider sie angehabt hatte. Bestimmt ein weißes Kleid mit vielen Spitzen. Und einen Hut mit roten und blauen Seidenbändern.
„Nimm sie jetzt. Ich möchte, daß du sie bekommst. Verstehst du? Ich will es.“
Genau das hatte sie gesagt. Sie mußte etwas damit gemeint haben, etwas Bestimmtes, etwas, was nur mich betraf.
Es mußte bedeuten, daß sie ein Vertrauen in mich setzte. Genau das Wort tauchte in meinen verwirrten Gedanken auf: Vertrauen.
Und das machte die Bibel, die sie mir geschenkt hatte, zu mehr als nur einem Buch: Sie war der Schlüssel zu etwas, was ich noch nicht kannte. Etwas Großem. Hellem. Schönem.