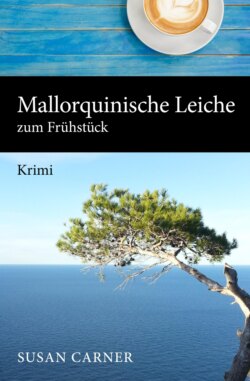Читать книгу Mallorquinische Leiche zum Frühstück - Susan Carner - Страница 4
Sonntag, 6. November
ОглавлениеIhr erster Tag auf Mallorca. Und schon eine Leiche. Verschlafen quälte sich Mercédès Mayerhuber durch den Verkehr von Palma de Mallorca nach Paguera. Wie hatte ihr neuer Kollege Miquel den Weg beschrieben, der sie mit seinem Telefonanruf aus dem Schlaf gerissen hatte? Auf der Ma-1 immer Richtung Andratx fahren und bei Paguera die Ausfahrt ›La Romana‹ nehmen. Es könne nichts schiefgehen, hatte er gelacht. Und wahrlich, gegen den Verkehr in Madrid war Autofahren hier das reinste Kinderspiel.
Trotzdem, so hatte sie sich ihren ersten Tag nicht vorgestellt. Sie wollte endlich einmal ausschlafen, schließlich war Sonntag. Ohne irgendeine Verpflichtung. In Madrid hatte sie immer ein schlechtes Gewissen, wenn sie einen Tag nur für sich beanspruchte. Ihrer kranken Mutter gegenüber, ihren Freunden, für die sie sowieso nie genug Zeit hatte bei ihrem Beruf.
Müde rieb sich Mercédès die Augen. Sie war gestern erst spät am Abend in ihrem Hotel ALMVDAINA eingetroffen, das nicht weit entfernt von ihrer neuen Wirkungsstätte lag. Dem Hauptquartier der Polizei-Palma in der Carrer de Simó Ballester, in dem die neugegründete Abteilung untergebracht war, der sie ab sofort vorstand.
Nichts würde es jetzt mit einem gemütlichen Bummel durch die Avinguda de Jaome III werden, in der ihr Hotel sich in die lang gezogenen Häuserblocks eingliederte, hinunter zum Plaza Rei Joan Carles I. Ihr persönliches Willkommens-Gläschen Cava in der berühmten Bar Bosch fiel ebenfalls ins Wasser. Wie die Erkundung Palmas, auf die sie sich wie ein Kind gefreut hatte. Einmal nur ziellos durch die Stadt schlendern. Sie liebte es, sich Städte zu erwandern. Laut seufzte sie auf bei diesen Gedanken, schlug heftig auf ihr Lenkrad ein. Warum kam immer alles anders? Warum konnte ihr das Leben nicht mal Zeit geben? Ständig überstürzten sich die Ereignisse. Und wie immer, wenn sie Dampf ablassen wollte, stieß sie ein paar Mal einen richtig lauten Schrei aus. Das hatte sie bei einer Superversion gelernt und festgestellt, dass es ihr half. Allerdings praktizierte sie diese Therapie nur noch beim Autofahren, denn als sie das einmal in ihrer winzig kleinen Wohnung in Madrid angewandt hatte, hatte die Nachbarin die Polizei gerufen ...
Eigentlich wäre erst morgen ihr erster Arbeitstag. Eigentlich ... Sie hätte es nicht so eilig gehabt mit ihrem Dienstantritt, dachte sie frustriert. Warum nur hatte man sie auf diese gottverdammte Insel versetzt, die von Ausländern beherrscht wurde? Sie aus ihrem geliebten Madrid verbannt?
Abgelenkt von ihren Gedanken hätte sie fast die Abzweigung nach La Romana verpasst. Kaum zwanzig Minuten hatte sie für die Strecke gebraucht. Und musste trotz ihrer Vorurteile zugeben, dass die Fahrt sie durch eine reizvolle Landschaft geführt hatte. Links von ihr das Meer, das hin und wieder durchblitzte. Die Küste dürfte von größeren und kleineren Buchten durchsetzt sein, an denen sich die Orte wie auf einer Perlenschnur aufreihen mussten, wenn sie an die vielen Abfahrten und Hinweise auf diverse Ortschaften dachte. Könnte spannend werden, diese zu erforschen, überlegte Mercédès. Auch die rechte Seite ins Landesinnere reizte sie. Je weiter sie sich von Palma entfernte, desto näher rückten die Berge ans Meer. Anscheinend hatte die Insel doch mehr zu bieten, als sie sich durch ihre Aversionen wegen Ballermann eingestehen mochte.
Das Urlaubs-Resort, das Miquel als Ziel genannt hatte, war gut ausgeschildert und sie parkte ihren kleinen Mietwagen vor der Rezeption. Sie brauchte nicht zu fragen, wo die Leiche zu finden war. Polizisten in Uniform in verschiedenen Farben markierten den Weg Richtung Tatort. In Spanien gab es zur Überraschung vieler Ausländer neben der » Policía Local« noch die »Guardia Civil« und die » Policía Nacional«. So blieben Überschneidung von Zuständigkeiten, Kompetenzgerangel und Verzögerungen nicht aus, dachte Mercédès wieder einmal amüsiert. Wie oft hatte sie sich über diese Zustände schon echauffiert.
Die schwarz uniformierte Policía Local übernahm vorzugsweise Ordnungsfunktionen. Sie regelte den Verkehr, bat Verkehrssünder zur Kasse, trat bei Einbrüchen und Diebstählen in Aktion. Auch bei Streit, Körperverletzung und Nötigung schritt die Policía Local ein. War aber ein Messer im Spiel, war die grün gekleidete Guardia Civil zuständig. Die durften, im Gegensatz zur Policía Local, bei Delikten wie Raub oder Vergewaltigung die Täter beziehungsweise Verdächtigen verhaften. Wurde das Opfer allerdings bedroht, verfolgt und fürchtet um sein Leben, war die blau gekleidete Policía Nacional für die Aufklärung zuständig. Da lag es auf der Hand, dass alle drei Polizeisektionen ständig überprüfen mussten, ob ein Fall in ihre oder in eine andere Kompetenz fiel. Wenn sich die Policía Local nicht sicher war, rief sie die Guardia Civil, die rief bei Gewaltverbrechen die Policía Nacional ... Deshalb hatte man sie heute Morgen geweckt.
Rund um den Tatort wimmelte es von Neugierigen. Mercédès musste schmunzeln, als sie die vielen Menschen wahrnahm, die sich ihre Nasen an den riesigen Glasscheiben platt drückten, hinter denen das Hallenbad erkennbar war, um etwas von der Sensation mitzubekommen, die sich hier buchstäblich vor ihrer Nase abspielte.
Ein junger, schwarz uniformierter Polizist der Policía Local stand vor der Glasfassade und wies sie ein, nachdem sie ihren Ausweis gezeigt und sich knapp vorgestellt hatte. »Wissen wir schon, wer das Opfer ist?«, erkundigte sie sich. Miquel hatte am Telefon nur angemerkt, sie hätten eine weibliche, schwimmende Leiche.
»Senyora Sabrina Schneider. Seit Ende Oktober Gast in der Anlage. Sie bewohnt Apartment 920. Laut Resortleiter wollte sie ihr neuestes Buch fertigstellen.«
»Eine Schriftstellerin? Interessant. Welche Art von Literatur?«, fragte Mercédès neugierig.
»Erotische«, antwortete der junge Polizist leicht errötend.
»Olala«, konnte sich die Comissària ein Lächeln nicht verkneifen. »Wer hat sie gefunden?«
Der Kollege deutete auf das ältere Ehepaar, das, in seine abgewetzten Bademäntel gewickelt, in einer Ecke des Hallenbades stand und dem geschäftigen Treiben fassungslos zusah. Wobei, fassungslos war eher er. Sie schien die Situation zu genießen. Bevor Mercédès ins Gebäude verschwand, bat sie den Kollegen, die Schaulustigen zurückzudrängen, denn auch eine Tote hatte Privatsphäre verdient.
»Das habe ich versucht, Comissària. Aber die wollen einfach nicht hören! Die Herbstmonate sind immer sehr, sehr ruhig. Anfang November schließen viele Läden und Cafés, es werden kaum noch Aktivitäten angeboten. Nur hin und wieder ein bisschen Klatsch und Tratsch. Und jetzt ist endlich etwas los. Da wollen sie nichts versäumen. Außerdem soll die Tote die letzte Woche die Hauptperson des allgemeinen Interesses gewesen sein«, zwinkerte er ihr zu.
»Versuchen Sie´s trotzdem noch mal, ja?«
Er nickte Gott ergeben.
Die Kommissarin näherte sich dem Paar, das die Tote gefunden hatte. Die Dame wirkte leicht gehässig, machte sich mit bissigen Bemerkungen über die Tote her.
»Buenos días«, grüßte Mercédès freundlich, »ich bin Comissària Mercédès Mayerhuber und leite die Ermittlungen. Wer sind Sie?« Wie immer, wenn Sie sich mit ihrem ausgefallenen Namen vorstellte, wanderten zuerst einmal erstaunte Augen in ihre Richtung. Wie hatte sie das satt!
»De ausgschamte Person, die häd no gar ned so fria im Pool sei derfa. De sperrn jo east um achte auf«, keifte die Frau gleich los.
»Bisd stad, Mutti, die Frau Kommissarin interessiad des ned.« Mit einem entschuldigenden Blick auf seine Frau drehte er sich der Kommissarin zu. »Rosmarie und Josef Fichtelhuber aus Rosenheim. Mia überwintern do. Wia jeds Joar.«
Auch eines dieser deutschen Paare, die es sich leisten konnten, den Winter im wärmeren Mallorca zu verbringen und den Einheimischen die Preise ruinierten, dachte Mercédès leicht verbittert, ließ es sich aber nicht anmerken.
»Kannten Sie Frau Schneider?«
»Kenna is zvui gsogt. Obwoi sie a Stammgast is. Gseng hom mia sie a boh moi. Oiwei mid andern Mannsbuidern«, keifte Frau Fichtelhuber los. »De war aa aus Rosenheim. Friaha. Bevoa sie noch Berlin ganga is. War oiwei so a ausgschammts Luada. Nia fahairad, aba oiwei oan, der um sie herumgschwanzelt is.«
Die Comissària hob leicht die Augenbraue. »Herumgschwanzelt?«, versuchte sie zu formulieren.
»Na, Männa hoid, de ihr nachglaffa san.«
»Aha. Sind ihr hier auch Männer nachgelaufen?«
»Na sicha. Auf 602 wohnt a ältera Mo mid seina krankn Frau, der hod si öfta mit ihr unterhoidn. Ma munkelt, dass do wos g´laufon is. Jo, und seid a pooa Tog is auf 115 so a junga Mo, der wos do allon wohnt. Der sull ogeblich ihr Liabhobr aus Berlin sei. Und da Resoatleita, da do drend so vaschdoanart städ, da Herr Hoffmann, soi aa a Aug auf ihr g´woafa hom.«
»Mutti, jetzt hear scho auf damit. Des san ois grod Vamutunga. Mia wissn gar nix«, wieder mit einem entschuldigenden Blick zur Kommissarin.
Diese lächelte leicht und meinte: »Danke vorerst, wenn wir noch Fragen haben, wo können wir Sie finden?«
»Mia wohna im Heisl 8, auf 815«, antwortete Herr Fichtelhuber, hakte seine Frau unter und zog die protestierende Rosie hinter sich her. Mercédès schaute den beiden nach, bevor sie sich an den Manager des Hotels wandte.
„Buenos días. Herr Hoffmann, wenn ich nicht irre?“, fragte Mercédès den immer noch wie versteinert dastehenden Geschäftsführer.
»Ja, der bin ich«, und wunderschöne, bernsteinfarbene Augen in einem markant geschnittenen Gesicht richteten sich auf die Kommissarin. Ein Blick, der Mercédès unter die Haut ging und ein eigenartiges Kribbeln in ihr hervorrief. Nicht nur, weil sie nicht mit einem dermaßen attraktiven Mann gerechnet hatte, sondern sie war überrascht über den Schmerz in seinen Augen. Und das Zucken seiner Augenlider verwirrte sie. War er nervös?, überlegte sie.
»Comissària Mayerhuber, ich leite diesen Fall. Kannten Sie die Tote näher?“
»Warum näher?«, fragte er aufgewühlt.
Oh oh, dachte Mercédès, der hat etwas zu verbergen.
»Wie man mir erzählt hat, war Frau Schneider Stammgast in dieser Ferienanlage. Da ist es naheliegend, dass Sie die Tote kannten.«
»Ähm, ja, natürlich. Sie kam seit einigen Jahren regelmäßig im Herbst zu uns, um sich zu entspannen. Wir haben hin und wieder geplaudert.«
Sie konnte seinen Gesichtszügen entnehmen, dass sie mehr als nur geplaudert hatten. Erneut sah sie Schmerz darin. Ja, sogar Erschütterung.
»Können Sie uns etwas zum Umstand ihres Todes sagen oder gibt es irgendwelche Besonderheiten, die Sie bemerkt haben?«
»Äh, nein, nicht das ich wüsste.«
»Warum sind Sie so nervös?«
»Ich … äh, bin nicht nervös.«
»Doch, das sind Sie.« Mercédès war überrascht, denn er schien eher der Typ eines selbstsicheren Managers zu sein. Was war mit ihm los?
»Ich … nein, ja …«
»Also, was jetzt?«, fragte sie hart.
»Sie sehen doch, was hier los ist. Die ersten Gäste beschweren sich bereits, dass sie nicht ins Hallenbad dürfen, obwohl normalerweise die wenigsten am Vormittag den Pool nutzen. Die anderen beklagen sich über den Lärm, den die Bauarbeiter vom Nachbarhotel veranstalten. Keiner hat uns informiert, dass dort Renovierungsarbeiten durchgeführt werden«, kam es genervt vom Manager. »Brauchen Sie mich noch? Ich habe alle Hände voll zu tun, um die Gäste zu beruhigen.«
War es nur das?, überlegte die Kommissarin und meinte: »Vorerst nicht. Wo kann ich Sie finden, wenn ich noch Fragen habe?«
»In meinem Büro an der Rezeption«, damit marschierte er in weit ausholenden Schritten davon, wie es großgewachsenen Männern eigen war. Mercédès schaute ihm fasziniert nach, fühlte Blicke auf sich gerichtet und drehte sich nach diesen um.
Am Beckenrand standen zwei männliche Personen. Ein schlaksiger Mit-Zwanziger mit kurzen dunklen Haaren, die wie dichte Borsten in die Höhe ragten, und der sie interessiert musterte. Der andere war älter, Ende Fünfzig, Anfang Sechzig, mit einem beachtlichen Leibesumfang. Seine Augen wanderten gemächlich über Mercédès´ Gestalt. Es war unschwer zu erkennen, dass ihm gefiel, was er sah.
Wahrscheinlich mein neuer Kollege und der Gerichtsmediziner, überlegte Mercédès und bekam sofort ein schlechtes Gewissen, weil sie sich zuerst mit den Zeugen unterhalten hatte, anstatt die Kollegen zu begrüßen. Dabei hatte sie sich geschworen, an ihrer neuen Dienststelle die Arbeitskollegen mehr in ihre Ermittlungen einzubinden. Sie schob ihre widerspenstigen Locken hinter die Ohren, wie sie es immer tat, wenn sie sich ertappt fühlte oder nervös war. Und ärgerte sich gleichzeitig darüber, dass es ihr nicht gelang, diese Gewohnheit abzulegen.
Mercédès ging auf die beiden zu, die ihr erwartungsvoll entgegenblickten. Der ältere Kollege sagte leise etwas wie ›Una dona guapa‹ auf Mallorquinisch, was so viel bedeutete wie ›schöne Frau‹, und grinste breit.
Ich sollte schnellsten den Dialekt dieser Inselsprache lernen, dachte Mercédès, sonst würde das hier nichts werden, denn die würden ständig versuchen, mich auszuspielen. Wo ihnen doch eine Frau vom Festland vor die Nase gesetzt worden war. Warum änderte sich die Einstellung der Männer einfach nicht? Immer noch Frauen gegenüber skeptisch.
Aber sie war das gewohnt. Zierlich wie sie war, traute man ihr ohnedies nicht viel zu. Doch es gefiel ihr, unterschätzt zu werden. Da machten vor allem Mörder gerne Fehler. Trotzdem nervte es sie, dass attraktive Frauen es nach wie vor schwer hatten, für ihre Kompetenz anerkannt zu werden. Innerlich seufzend und mit einem Blick auf die bereits aus dem Wasser gezogene und mit einem Tuch bedeckte Leiche meinte sie zu dem jüngeren Kollegen: »Ich hab noch nicht gefrühstückt!«
Der junge Mann lachte. »Leiche zum Frühstück. Kommt doch öfter vor, oder?«
»Jetzt, wo Sie das sagen. Nein, eher selten. Meistens werden sie als Mitternachtssnack serviert«, fügte sie lakonisch an. »Sie sind wohl Miquel, der mich so unsanft aus meinen Träumen gerissen hat? Freut mich«, und sie schüttelte ihrem neuen Kollegen die Hand.
»Miquel Coll, die Freude ist ganz meinerseits«, lächelte dieser sie entwaffnend an.
Konnte sie ihm das glauben? Sie wusste, dass gegen sie interveniert worden war. Allerdings nicht von wem.
»Wir haben uns ebenfalls noch nicht kennengelernt«, und sie reichte dem Gerichtsmediziner ihre Hand. »Mercédès Mayerhuber«, lächelte sie entschuldigend.
Dieser lachte dröhnend auf. »José Munar. Nennen Sie mich José. Und sorry, wenn ich lachen muss. Aber Ihr Name ist mehr als bemerkenswert.«
»Wem sagen Sie das ...«, stöhnte Mercédès. »Mein Vater war aus Bayern und ein riesengroßer Mercedes-Fan. Ich denke nicht, dass er zeit seines Lebens je ein anderes Auto gefahren ist«, und musste lächeln bei dem verständnisvollen Blick, den Munar ihr schenkte, deshalb rückte sie mit der Geschichte ihrer Namensgebung heraus. »Mein Vater eiferte dem österreichisch-ungarischen Geschäftsmann Emil Jellinek nach, dessen Tochter ebenfalls Mercédès geheißen hat und die Namensgeberin der Marke Mercedes ist. Jellinek hat 1899 an einem Autorennen in Nizza mit einem Rennwagen aus der Daimler-Motoren-Gesellschaft teilgenommen, den er zu Ehren seiner damals zehnjährigen Tochter Mercédès getauft hatte. Und hat das Rennen gewonnen. So wurde der Vorname von Jellineks Tochter bekannt. Als er Geschäftspartner Daimlers geworden ist und eine neuartige Fahrwerks- und Motorkonstruktion entwickelt hat, erhielt die den Namen ›Daimler-Mercedes‹. Später wurde der eingedeutschte Name ›Mercedes‹ als Warenzeichen angemeldet und gesetzlich geschützt. So bringt heute den Namen ›Mercedes‹ kaum noch einer mit einem Mädchennamen in Verbindung. Außer mein Vater.« Der Frust war ihr deutlich anzumerken, trotzdem fügte sie hinzu: »Dabei ist es ein typisch spanischer Vorname, auch wenn meiner nach der französischen Variante geschrieben wird. Was in Spanien immer wieder zur Verwirrung führt ...«
»Das glaube ich gerne. Doch ich finde den Namen ausgesprochen hübsch, wie die Trägerin«, lächelte José.
Dankbar lächelte sie zurück. »Aber jetzt zu dem eigentlichen Grund, der uns hier zusammengeführt hat. Was haben wir?«
»Die Tote wurde um acht Uhr von dem Ehepaar, mit dem Sie sich vorhin unterhalten haben, mit dem Gesicht nach unten im Pool treibend gefunden. Der Bademeister hat sie herausgezogen und versucht, sie wieder zu beleben. Allerdings vergeblich.«
»Todesursache?«
»Vermutlich Ertrinken.«
»Herbeigeführt wodurch?«, und Mercédès kniete sich neben die Leiche, schlug das dünne grüne Tuch zurück, blickte in das aufgequollene Gesicht einer einstmals wahrscheinlich attraktiven Frau, das von verfilzten, langen rotblonden Haaren eingerahmt war.
»Kann ich noch nicht sagen. Aber es war höchstwahrscheinlich kein Unfall durch Herzinfarkt oder dergleichen, sondern Fremdverschulden. Zumindest lassen die Abdrücke an ihren Schultern darauf schließen, die auf den ersten Blick frisch aussehen. Deshalb sind Sie gerufen worden.«
»Bis wann können Sie sagen, woran sie tatsächlich gestorben ist?«
»Hängt davon ab, wie schnell ich sie auf meinem Tisch in der Pathologie habe. Dann mach ich mich gleich an die Arbeit. In der Nebensaison hat auch die Gerichtsmedizin ein bisschen Luft«, lächelte José.
»Können Sie schon etwas zur Todeszeit sagen?«
»Zwischen sieben und acht Uhr«, antwortete Miquel Coll statt des Gerichtsmediziners.
Mercédès blickte erwartungsvoll zu ihm auf, denn sie kniete immer noch neben der Toten und untersuchte die Spuren an den Schultern.
Also fuhr Miquel fort: »Der Bademeister hat sie kurz nach sieben Uhr das Bad betreten sehen, und wie bereits erwähnt, wurde sie um acht Uhr gefunden. Also ein klares Zeitfenster.«
»Danke Herr Kollege«, lächelte Mercédès. »José, denken Sie, dass Sie das näher eingrenzen können?«, und erhob sich.
»Ich werde mein Bestes geben«, antwortete dieser gut gelaunt. »Aber nur, wenn Sie mich in der Pathologie besuchen.«
»Abgemacht! Miquel und ich werden Sie aufsuchen. Ich muss ja ohnedies alles kennenlernen. Sollten Sie eher etwas Bahnbrechendes herausfinden, freue ich mich über einen Anruf«, und reichte ihm zum Abschied die Hand.
»Jetzt brauche ich einen Kaffee«, seufzte Mercédès in Richtung ihres neuen Kollegen. »Hatte keine Gelegenheit, in meinem Hotel das Frühstück zu genießen.«
»Hier in der Anlage? Da hätten wir die Bar Luna 81 anzubieten oder das Restaurant Tentación.«
»Nein, nicht beim Tatort. Gibt es hier in der Nähe nicht ein Café, wo man sich ungestört unterhalten kann?«
»Eine Bucht weiter, in der Platja del Torà gibt es ein paar nette Bars«, meinte Miquel fröhlich.
»Klingt gut, lassen Sie uns dorthin gehen.«
»Sie wohnen im Hotel?«, wollte der Kollege überrascht wissen, als sie außerhalb der Hörweite der Schaulustigen waren, die nach wie vor sensationssüchtig vor dem Bad herumstanden.
»Ja, ich bin erst gestern angekommen und wollte mir ein bisschen Zeit lassen mit der Suche nach einer geeigneten Wohnung. Können Sie mir etwas empfehlen?«
»Nein, leider. Aber leicht wird es nicht werden, bei den Preisen hier.«
»Das habe ich mir schon gedacht.« Und dabei schaute sie mürrisch auf das Hotel Lido Park, das auf einem Felsvorsprung, den sie soeben auf einem breiten Promenadenweg umrundeten, der die Buchten La Romana und Torà verband, in die Höhe ragte. Da hat der Bürgermeister sicher gut verdient, dachte sie sarkastisch.
»Gefällt Ihnen wohl nicht, was Sie sehen, oder?«
»Nein, ich bin kein Freund von Hotelkomplexen in Strandnähe, die die Natur völlig missachten. Und wenn ich da hinüberblicke, wird mir schlecht«, und dabei deutete sie auf die gegenüberliegende Bucht und die Häuser, die sich bis zur Bergkuppe in enger Bebauung dicht an den Hang drängten und kaum etwas vom Grün der Insel durchblitzen ließen.
»Das ist Cala Fornells. Von den Häusern bietet sich ein wunderbarer Ausblick auf das Meer. Ist eine teure Gegend.«
»Das glaube ich gerne. Trotzdem möchte ich um nichts in der Welt in einem derart dichten Gewirr von Häusern wohnen. Wie kann so etwas in dieser herrlichen Umgebung genehmigt werden? Gibt es keine Bauvorschriften?«
»Ist ohnedies nicht unsere Preisklasse«, antwortete Miquel brüsk, der einer Diskussion über bauliche Verschandelung seiner Insel aus dem Weg gehen wollte. Alle fingen damit an, kaum hatten sie einen Fuß auf die Insel gesetzt. Zumindest, wenn sie mehr interessierte als nur billig Bier oder Sangria zu saufen. Überall schossen Bungalows aus dem Boden, wo man eine schöne Aussicht auf das Meer genießen konnte. Trotz Baustopps. Außerdem standen an den wundervollsten Orten noch immer die hässlichsten Bettenburgen. Aber er war nicht der Verantwortliche dafür. Sollten sich andere den Kopf darüber zerbrechen.
Mittlerweile waren sie vor einer schmalen Häuserzeile am Platja del Torà angekommen, die ausschließlich aus diversen Bars und Cafés bestand. »Dafür können wir uns die Bars hier leisten. Wo wollen wir einkehren?«
»Was empfehlen Sie als Einheimischer?«
»Sind alle nett.«
»Dann nehmen wir gleich die Beach Bar hier. Ein bisschen die Sonne ins Gesicht scheinen lassen tut gut.«
Mercédès bestellte einen café con leche. Darauf freute sie sich, seit sie in Palma in ihr Auto gestiegen war.
Worauf Miquel meinte: »Wenn Sie sich hier willkommen fühlen wollen, dann sollten Sie mallorquinische Ausdrücke benutzen. Bringen Sie uns dos cafès amb llet«, und zwinkerte der Kellnerin zu.
Die antwortete in holprigem Spanisch: »Kaffee versteh ich in allen Sprachen. Ansonsten ist mir deutsch lieber«, und zog von dannen.
Mercédès musste herzlich über Miquels Gesichtsausdruck lachen.
»Deshalb steht wohl ›Peguera‹ und nicht ›Paguera‹ auf den Straßenschildern? Hat mich leicht verwirrt bei der Anfahrt ...«, lenkte sie ihn von seiner Verblüffung über die Kellnerin ab.
»Ja, auf mallorquinisch heißt die Stadt ›Peguera‹.«
»Sie legen Wert darauf, Mallorquiner zu sein und nicht Spanier?«
»Nein, ich bin beides. Doch zuerst stolzer Mallorquiner und in zweiter Linie Spanier. Ich bin hier geboren, in Calvià und würde die Insel freiwillig nie verlassen. Und Sie? Fühlen Sie sich als Deutsche oder als Spanierin?«
»Ich bin in Deutschland aufgewachsen, lebe jedoch seit fast zwanzig Jahren in Spanien. Also bin ich Spanierin, auch wenn ich meine deutschen Wurzeln nicht leugne. Das wäre somit geklärt, oder haben Sie noch Fragen?«, lächelte sie Miquel herausfordernd an. Ihre deutsche Abstammung war höchstwahrscheinlich vielen im Kommissariat ein Dorn im Auge.
Als die große Tasse Kaffee mit Milch vor ihr stand, umschloss sie diese mit den Händen, als wollte sie sich daran wärmen. Dabei hatte die Sonne eine unheimliche Kraft.
Sie konnte gar nicht glauben, dass bereits der sechste November war. Lehnte sich zurück, schloss die Augen, genoss einen Augenblick nur die Strahlen der Sonne und versuchte, sich wie eine Touristin zu fühlen, die einfach nur hier saß und das Leben auskostete. Doch leider gelang ihr das nicht. Sie musste an den erschrockenen Gesichtsausdruck der Toten denken.
»Was denken Sie, war das ein Unfall oder Mord?«, und blickte direkt in das intelligente Gesicht von Miquel. Kurz fügte sie noch an: »Übrigens, ich heiße Mercédès.«
»Miquel«, und sie stoßen symbolisch mit ihren Kaffeetassen an.
»Also, was denkst du?«
Der junge Kollege überlegte. Er war erst seit Kurzem bei der Sonderkommission, die extra gebildet worden war, um für Einsätze wie diese gerüstet zu sein, wenn Urlaubsgäste betroffen waren. Da vierzig Prozent der Gäste deutsche Urlauber waren, hatte man der Kollegin aus Madrid den Vorzug gegeben, da sie deutscher Abstammung war. Niemand wollte freiwillig mit der Neuen arbeiten, die ihnen vom Festland vor die Nase gesetzt worden war. Ihr eilte der Ruf voraus, sehr eigenwillig zu sein und die Ermittlungen gerne alleine durchzuziehen. Doch er hatte auch gehört, dass ihre Aufklärungsrate hoch war. Und er wollte lernen. Schließlich hatte er ehrgeizige Pläne. Polizeichef der Insel zu werden. So hatte er sich beworben und war überglücklich, dass er den Job ergattert hatte. Ausschlaggebend waren wahrscheinlich seine perfekten Englischkenntnisse, denn die zweite große Gruppe an Urlaubern waren Engländer. Man hatte ihn noch schnell zu einem Kursus zum FBI geschickt, um gerüstet zu sein. Vielleicht als Bonus für seine freiwillige Bewerbung, denn es wurde lange nach einem einheimischen Polizisten als Unterstützung für die nicht Ortskundige gesucht ...
»Ich habe mir die Abdrücke auf ihren Schultern genau angesehen. Es scheint, dass sie jemand mit den Händen unter Wasser gedrückt hat. Und wenn ich an ihren Gesichtsausdruck denke ...«
»Ja, der ist mir ebenfalls aufgefallen. Erschrocken. Überrascht. Aber auch leicht ärgerlich. Vielleicht konnte sie nicht glauben, dass die Person es ernst meint«, sinnierte Mercédès.
»Doch wer hätte Interesse, eine Schriftstellerin zu töten? Noch dazu in einem so eleganten Resort, wo es immer zivilisiert zugeht und wir dort praktisch keine Einsätze haben«, seufzte Miquel.
»Was wissen wir von der Toten?«
»Sabrina Schneider lebt, besser gesagt, lebte in Berlin. Einundfünfzig Jahre alt. Sie hat einige sehr erfolgreiche Bücher auf den Markt gebracht und sich als Erotikschriftstellerin weltweit einen Namen gemacht. Ihre Bücher wurden ins Englische, Französische und Italienische übersetzt. Leider noch nicht ins Spanische. Sie war Millionärin und konnte sich jedes Luxusdomizil auf Mallorca leisten. Trotzdem hat sie diese Anlage gewählt.«
»Die ist wahrscheinlich auch nicht billig, oder?«, wandte Mercédès ein.
»Nein, sie gehört ebenfalls zu den gehobenen Anbietern, aber hier steigt an und für sich gutbürgerliche Klientel ab und nicht Millionäre. Warum also war sie hier?«
»Gut Frage! Seit wann kam sie in das Resort?«
»Seit genau fünf Jahren. Sie hatten gestern Abend Jubiläum gefeiert.«
»Wer ›sie‹?«, bohrte Mercédès nach.
»Herr Hoffmann, der Manager, hatte ein Abendessen für Frau Schneider im resorteigenen Restaurant ausgerichtet. War ursprünglich nur für die beiden gedacht, aber dann kam überraschend ihr Freund aus Berlin. Hoffmann und unsere Leiche scheinen nicht begeistert davon gewesen zu sein.«
»Sagt wer?«, warf Mercédès ein und lenkte ihren Blick, der sich über dem Meer verloren hatte, interessiert Richtung Miquel.
»Frau Fichtelhuber, die hast du ja schon kennengelernt.«
»Und woher weiß Frau Fichtelhuber das so genau?«, fragte sie spöttisch.
»Sie saß mit ihrem Mann am Nebentisch und hat das Gespräch zufällig mitangehört.«
»Zufällig ... wer´s glaubt. Was hat sie gehört?«
»Wie Sabrina Schneider den jungen Mann angefaucht hat, was er hier verloren habe. Er wisse doch genau, dass sie auf Mallorca ihre Ruhe haben möchte und sich entspannen wolle. Und dabei soll sie dem Hoffmann schöne Augen gemacht haben, sagt die Fichtelhuber.«
Mercédès lachte herzlich auf. »Wie gut, dass es Menschen gibt, denen das eigene Leben nicht genug ist und die ihre Nase in fremde Angelegenheiten stecken. So helfen sie uns bei unseren Ermittlungen. Dann werde ich mal Herrn Hoffmann auf den Zahn fühlen, ob Frau Schneider ihm ›schöne Augen‹ gemacht hat und erkunden, was es mit dem jungen Mann aus Berlin auf sich hat. Und nach dem älteren Mann fahnden, der laut Frau Fichtelhuber ›etwas mit ihr laufen hatte‹. Seine Apartmentnummer ist mir ja dank Rosie Fichtelhuber bekannt.«
»Und was mache ich?«
»Du wirst die anderen Gäste befragen, von denen wir die Personalien aufgenommen haben, ob sie am Morgen etwas Verdächtiges bemerkt haben. Und das Personal, das Frau Schneider kannte. Allerdings gehen wir von einer Unfall-These aus. Sollte es doch Mord sein, wiegt sich der Täter in Sicherheit.«
»Alles klar. Wo treffen wir uns wieder?«
»Am Nachmittag im Büro. Ich nehme an, unsere Dienststelle ist auch am Wochenende besetzt«, lächelte sie.
»Weißt du denn schon, wo die ist?«, lachte Miquel verschmitzt.
»Ich werd´s finden«, antwortete Mercédès lakonisch.
Mercédès stand einige Zeit vor dem Gebäude, in dem Rezeption und Büros der leitenden Angestellten untergebracht waren, und betrachtete Werner Hoffmann durch das Fenster. Erneut fiel ihr seine außergewöhnliche Attraktivität und seine besondere Ausstrahlung auf, obwohl sein Gesichtsausdruck verkniffen wirkte und er irgendwie in sich gekehrt zu sein schien. Sie konnte sich seiner Aura trotz Glasscheibe nicht entziehen. Ein bemerkenswerter Mann, überlegte sie. Wie alt er wohl war? Anfang/Mitte vierzig? Sie musste unbedingt herausfinden, ob sein Gemütszustand mit dem Tod von Sabrina Schneider zusammenhing.
Sie betrat das Haus, schlüpfte an der Rezeption an einer verblüfften, ausgesprochen hübschen jungen Frau vorbei, klopfte an seine Tür und trat ohne Aufforderung ein.
»Herr Hoffmann, ich hätte noch einige Fragen«, begann sie sofort, ohne Begrüßung.
Übellaunig erhob sich der Manager hinter seinem Schreibtisch. »Womit kann ich dienen?«
Der Ausdruck ›dienen‹ zauberte ein Lächeln in ihr Gesicht. Neugierig fragte sie: »Wo kommen Sie denn her?«
»Aus Wien«, sagte er kurz angebunden.
»Und wie lange leben Sie auf Mallorca?«
»So an die zwölf Jahre. Aber ich denke nicht, dass Sie hier sind, um über meine Mallorca-Erfahrung mit mir zu plaudern«, meinte er eisig.
»Nein, da haben Sie recht. Ich möchte mir das Apartment der Toten ansehen.«
»Äh, natürlich. Aber Ihre Kollegen von der Spurensicherung waren bereits da.«
»Ich weiß. Doch ich mache mir gerne selbst ein Bild. Und ich hätte ein paar Fragen an Sie. Würden Sie mich begleiten?«
»Wie Sie wollen«, meinte er höflich. »Ich gehe voraus.«
Sie folgte dem großgewachsenen Mann durch die liebevoll gestaltete Anlage, vorbei am glasverschalten Restaurant, das über einige Stufen direkt vom gepflegten Strand aus erreichbar war. Aus dem Inneren konnte man wahrscheinlich einen herrlichen Blick auf das Meer genießen, sinnierte Mercédès. Kein schlechter Platz für eine Auszeit vom täglichen Trott. Die ausladende, mit Steinen gepflasterte Terrasse davor wirkte einladend, nur etwas kahl, jetzt, in den Herbstmonaten. Vereinzelt saßen Gäste mit Zeitungen an den Tischen, erfreuten sich an den Sonnenstrahlen und tranken Kaffee. An einer Seite der Terrasse wurde gerade eine Art Podium für den Winter »eingepackt«, vermutlich die Bühne, wo in der Hauptsaison die abendlichen Belustigungen für die Gäste stattfanden. Nichts für sie. Sie verabscheute diese Art der Unterhaltung.
Sie kamen am Hallenbad vorbei. Alles war wieder ruhig, die Leiche war weggebracht worden, das Absperrband vor dem Eingang wehte leicht im sanften Wind, der vom Meer her blies. Der hintere Teil der Häuserwand von dem Gebäude, in dem neben dem Bad auch die Wäscherei untergebracht war, wie sie im Vorbeigehen bemerkte, war von bunten Bougainvilleas bewachsen, die in der Sonne leuchteten. Doch Mercédès hatte keine Zeit, sich an den herrlichen Blüten zu erfreuen, denn Werner Hoffmann holte weit aus mit seinen Schritten und sie hatte Mühe, ihm zu folgen. Schweigend trotteten sie hintereinander die Stufen zu den Apartment-Häusern hinauf. Eine schmale Treppe führte in den zweiten Stock von Haus 9 zu Apartment 920.
Er öffnete die Tür, ließ ihr aber den Vortritt. Ein prachtvoller Ausblick über Palmen direkt auf das Meer bot sich durch die großzügige Fensterfront auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes, den sie betraten.
»Was für eine Aussicht!«, rief sie überwältigt aus. Doch dann stutze sie. Wo war die Spurensicherung?
»Ist die Spurensicherung schon abgezogen?«, drehte sie sich überrascht zu Hoffmann um.
Der sagte nichts, starrte nur auf den Esstisch, der hinter der Küchenzeile, die durch eine Art Bar vom restlichen Zimmer getrennt war, an der Wand stand, umgeben von vier Sesseln. Weiter hinten im Raum, knapp vor den bodentiefen Fenstern, befand sich eine Couch mit einem kleinen Tischchen davor. Sie beobachtete Hoffmann aufmerksam, der immer noch fasziniert auf den Esstisch stierte.
Hier habe ich sie das erste Mal geliebt, dachte dieser traurig. Vor ziemlich genau fünf Jahren. Bei ihrem allerersten Besuch hatte sie mich gebeten, ihr die Koffer auf das Zimmer zu tragen. Er tat dies normalerweise nie, aber ihre grauschimmernden Augen hatten ihn von Anfang an fasziniert und in seinen Bann gezogen. Nachdem sie das Apartment betreten hatten, hatte sie sich lasziv an diesen Tisch gelehnt.
»Wollen Sie mir Gesellschaft leisten und einen Begrüßungsschluck mit mir trinken?«, hatte sie ihn herausfordernd angelächelt.
Er hätte ablehnen sollen. Nie trank er mit Gästen einen Begrüßungsschluck. Er war Manager der Anlage und nicht persönlicher Betreuer. Doch er war in die Küche gegangen, hatte den Begrüßungswein geöffnet und zwei Gläser eingeschenkt.
»Salud!«, hatte sie bemerkt und mit ihm angestoßen. Nie würde er ihre Augen dabei vergessen. Spöttisch hatten sie sich in seinen verfangen. Er vergaß, dass er der Manager war, er vergaß alles. Er war auf sie zugetreten, hatte ihr das Glas abgenommen, sie einfach in seine Arme gezogen und leidenschaftlich geküsst. Und dann war es passiert. Gleich auf dem Tisch.
Es war nicht bei dem einem Mal geblieben. Fast täglich hatte er sie besucht und sie hatten sich geliebt. Überall im Apartment. Im Bett. Auf dem Esstisch. Auf der Küchenarbeitsplatte. Auf der Couch. In der Dusche. Er war ihr regelrecht verfallen.
Nach ihrer Abreise war er in ein tiefes Loch gefallen. So süchtig war er nach ihr gewesen. Also war er ihr nach Berlin gefolgt, aber sie hatte ihn vor ihrer Tür abgewiesen. »Ein wunderbarer Urlaubsflirt, aber nicht mehr«, hatte sie nur gesagt und die Tür geschlossen. Er war sich wie ein Esel vorgekommen.
Ein Jahr später war sie erneut im Resort aufgetaucht. Er war wie elektrisiert, als er sie an der Rezeption gesehen hatte und war sofort aus seinem Büro geeilt. »Wollen Sie mir wieder mit den Koffern helfen, lieber Herr Hoffmann?« Er wollte. Und abermals war es der Tisch, der für die erste Leidenschaft herhalten musste.
Sie war nun das fünfte Mal bei ihnen abgestiegen, und nichts hatte sich am Begrüßungszeremoniell geändert. Auch fand sich nach wie vor jeden Tag eine Gelegenheit, ihrer Leidenschaft nachzugehen. Und nach wie vor war er süchtig nach ihr. Erst heute Morgen hatten sie in diesem Bett da … Sein Blick wanderte Richtung Schlafzimmer.
»Ist Ihnen nicht gut?«, fragte Mercédès, da Hoffmann geistesabwesend wirkte. Sie registrierte, wie er zusammenzuckte und sich ihrer anscheinend erst wieder besinnen musste. »Sie sehen plötzlich so bleich aus.«
»Alles in Ordnung. Es ... es hat mich nur etwas mitgenommen. Wir hatten noch nie eine Tote bei uns im Resort«, meinte er entschuldigend.
Mercédès glaubte ihm nicht, irgendetwas ging in dem Mann vor. Sie konnte seine Verzweiflung direkt fühlen. »Laut Aussage einer Zeugin hatten Sie ein Auge auf die Verstorbene geworfen?«, fragte sie beiläufig.
»Ein Auge auf ...? Wer sagt denn so was?«, erkundigte er sich verstört. Er war überzeugt, dass sie diskret vorgegangen waren. Wobei, wenn er an gestern Nachmittag dachte … da hatten sie alle Vorsicht außer Acht gelassen und sich hinter dem Resort auf den Klippen unter freiem Himmel geliebt. Aber er hatte sich vorher vergewissert, da war niemand gewesen, der sie hätte beobachten können.
Mercédès ließ ihn nicht aus den Augen. Sie hatte eine wunde Stelle getroffen, das spürte sie. »Sie mochten Frau Schneider, richtig?«, stellte sie sachlich fest.
»›Mochten‹ ist nicht der passende Ausdruck«, antwortete er nach einer kleinen Weile. »Ich bewunderte sie für ihren Mut. Wie offen sie mit ihrer schriftstellerischen Tätigkeit umgegangen ist. Bei dem Thema nicht immer leicht.«
»Warum nicht?«, wunderte sich Mercédès.
»Weil es Männer gab, die dachten, sie lebe so, wie sie es in ihren Büchern beschrieb. Sie wurde öfter bedrängt.«
»Hat Frau Schneider Ihnen das erzählt?«
»Ja, manchmal beklagte sie sich darüber. Deshalb kam sie so gerne zu uns. Sie meinte immer, hier seien lauter alte Ehepaare, da wolle keiner was von ihr.« Er lachte angestrengt.
»Sind Sie sicher, dass keiner etwas von ihr wollte?«, fragte sie gespannt nach. Du zum Beispiel?, überlegte sie.
»Die Leute tratschten zwar über sie, aber das war es auch schon. Ich habe zumindest niemanden beobachtet, der ihr zu nahe getreten ist. Außer ...«, unterbrach er sich grübelnd.
»Außer?«
»Außer dem jungen Mann, der vor ein paar Tagen auf 115 eingezogen ist. Ich bin mir nicht sicher, aber angeblich war er ihr Geliebter.«
Er wusste, dass es so war. Er hatte sie gestern mit dem Kerl im Bett erwischt. Sie war fürchterlich wütend geworden, dass er mit seinem Zentralschlüssel einfach ihre Tür aufgesperrt hatte, als sie auf sein Klopfen nicht geöffnet hatte. Es hatte ihn wie ein Faustschlag im Magen getroffen, als er den Burschen über ihr knien gesehen hatte und aus ihrem Mund das gleiche Stöhnen gekommen war wie wenn er …
Fluchtartig hatte er das Apartment verlassen. Wütend auf sie. Aber mehr noch auf sich. Warum konnte er die Finger nicht von ihr lassen? Seine Umgebung war bereits misstrauisch, für ihn stand alles auf dem Spiel. Wenn jemand erfuhr, dass er seit Jahren mit einem Gast …
Er hatte sich vorgenommen, die Affäre zu beenden, als er aufgelöst in seinem Büro saß und die Szene aus dem Apartment Revue passieren ließ. Er musste sich von ihr lösen, sonst stürzte sie ihn ins Verderben. Da sah er sie über die Treppen zur Bar Luna 81 hinaufsteigen, und er war ihr gefolgt. Sie hatte das Resortgelände hinter den letzten Häusern Richtung offenem Pinienwald verlassen und sich auf den ovalen Tisch gesetzt, der hoch über den Klippen für Picknicks bereitstand mit einem traumhaften Ausblick auf das Meer.
Leise war er hinter sie getreten, hatte die Hände um ihren Hals gelegt. »Ich könnte dich jetzt töten!«, und seine Stimme hatte rau geklungen.
»Das tust du aber nicht, viel lieber vögelst du mich«, hatte sie lachend geantwortet. Und anstatt sich von ihr zu trennen, hatte er sie auf diesem Tischchen geliebt, auf dem sonst Coladosen, Bier oder Weinflaschen standen. Sie war so leidenschaftlich gewesen, hatte ihn in einen totalen Rausch versetzt. Da wusste er, dass er nicht mehr von ihr loskommen würde.
»Morgen vor dem Schwimmen?«, hatte sie ihm nachgerufen, als er trunken vor Leidenschaft von ihr gelassen und in sein Büro gelaufen war, um sich zu beruhigen. Doch ihr Lachen verfolgte ihn. Sie wusste, dass er wieder antanzen würde. Und er hatte es kaum erwarten können. Und jetzt, jetzt war sie tot. Nie mehr würde er ihre Stimme hören, wenn sie verführerisch flüsterte ›Komm doch‹, und ihren hingebungsvollen Körper spüren.
»Herr Hoffmann? Hören Sie mich?«, drängte ein Geräusch laut und deutlich an sein Ohr.
»Äh, was haben Sie mich soeben gefragt?«, sagte Werner Hoffmann entschuldigend.
»Ich wollte wissen, wie der junge Mann heißt.« Verwundert blickte Mercédès auf den Manager. Er war verstört. Eindeutig. Und so, wie er sich über die Augen fuhr, wollte er Erinnerungen aus seinem Gedächtnis löschen. Hatte es mit der Toten zu tun?
»Ah, da müsste ich nachschauen. Bei über 170 belegten Apartments kann ich mir nicht alle Namen merken. Er ist außerdem das erste Mal bei uns.« Jens Meinfeldt war sein Name, Maler, der auf Kosten von Sabrina gelebt hatte. Aber das sollte die Kommissarin selbst herausfinden. »Wollen wir in mein Büro gehen? Da kann ich dann gleich nach dem Namen des Gastes sehen.«
»Haben Sie nicht gestern Abend mit ihm und Frau Schneider gefeiert? Da sollten Sie doch seinen Namen kennen ...«
Hoffmann war bleich geworden. »Woher wissen Sie ...«
»Herr Hoffmann, denken Sie wirklich, in einem Resort wie diesem bleibt geheim, wenn Sie mit einer schönen Frau und einem jungen Mann, die die Aufmerksamkeit der Gäste auf sich ziehen, zu Abend essen?«, fragte sie spöttisch.
»Ich hatte Frau Schneider zu ihrem fünfjährigen Jubiläum zu einem Abendessen in unserem Restaurant Tentación eingeladen. Herr Meinfeldt, Jens Meinfeldt, begleitete uns. Sabrina war nicht begeistert davon.«
»Sabrina?«, lächelte Mercédès unschuldig.
Er hätte sich auf die Zunge beißen mögen. »Ja, so nannte ich sie, wenn wir alleine waren. Schließlich war sie seit fünf Jahren Gast in unserem Haus.« Er musterte Mercédès kühl.
»Und Frau Fichtelhuber nennen Sie Rosie? Wenn ich das richtig verstanden habe, kommt sie bereits mehr als zehn Jahre mit ihrem Mann hierher«, grinste Mercédès.
Er antwortete nicht.
»Warum war Frau Schneider nicht begeistert?«
»Das weiß ich nicht genau. So gut kannten wir uns dann auch nicht, dass sie mir persönliche Dinge anvertraut hätte. Da müssen Sie Herrn Meinfeldt schon selbst danach fragen.«
Kühl und distanziert blickte er auf sie herab.
Ich kauf dir deine Unwissenheit nicht ab, sagte sich Mercédès. Du spielst hier nur den taffen Manager, innerlich bist du bis ins Tiefste getroffen. Und sie empfand so etwas wie Mitleid mit Hoffmann. Sympathie, denn er war genau der Typ Mann, bei dem sie schwach werden konnte. Selbstsicheres Auftreten, Kompetenz ausstrahlend, aber trotzdem verletzlich. Am meisten faszinierte sie allerdings, dass er sein gutes Aussehen einfach hinnahm und nicht damit kokettierte oder angab. Es einsetzte, um andere zu beeindrucken. So verloren, wie er dastand, hätte sie ihn am liebsten in die Arme genommen und getröstet.
»Gut. Dann werde ich das tun. Hier kann ich im Moment nichts mehr ausrichten. Außer abwarten, was die Spurensicherung herausgefunden hat.« Und sie ließ ihre Augen noch einmal durch das Apartment schweifen, aber es fiel ihr nichts auf, was sie weitergebracht hätte. Stirnrunzelnd betrachtete sie das Schlafzimmer. Irgendetwas war da, aber sie konnte es nicht greifen. Sie wandte sich um, als sie einen zufriedenen Ausdruck in Hoffmans Gesicht ausmachte.
Der hatte beim Inspizieren des Schlafzimmers durch die Kommissarin ängstlich überlegt, ob Maria seiner Aufforderung nachgekommen war, die Bettwäsche zu wechseln, wie er ihr nach dem Auffinden der Leiche aufgetragen hatte. Sein Blick war auf das Bett im Schlafzimmer gewandert, was ihn zufrieden aufseufzen ließ. Alles sah sauber und frisch überzogen aus. Keine Spur mehr von dem Schlachtfeld, das sie heute Morgen zurückgelassen hatten nach einer liebestollen Stunde.
Er fing den Blick der Kommissarin auf, spürte, dass ihren Augen nichts entging. Er richtete sich zu seiner vollen Größe auf. »Können wir dann? Ich habe noch anderes zu tun«, meinte er betont desinteressiert.
Mercédès konnte sich keinen Reim auf sein Verhalten machen, nickte und sie verließen das Apartment. Sie klebte an die Tür noch ein Siegel und schärfte Hoffmann ein, dass niemand die Wohnung betreten oder etwas verändert werden dürfte.
An der Rezeption befragte Mercédès noch die anderen Angestellten, aber keiner konnte ihr Näheres über Sabrina Schneider mitteilen.
»Ich hätte dann noch gerne den Namen von dem Ehepaar auf 602«, bat sie höflich.
Die Rezeptionistin schaute fragend auf ihren Chef, der nickte zustimmend.
»Bärbel und Dirk Ackermann«, meinte das attraktive Mädchen.
Mercédès entschied sich, zuerst mit Jens Meinfeldt zu sprechen, und ließ sich den Weg zur Nummer 115 zeigen. Unterwegs rief sie Miquel an. »Sag mal, war die Spurensicherung in Sabrina Schneiders Apartment?«
»Ja, ist schon alles fertig.«
»Und warum haben sie es nicht versiegelt?«, fragte sie ärgerlich.
Schweigen auf der anderen Seite.
»Bist du noch da?«
»Vielleicht wegen der Unfallthese ...«, kam es zögerlich aus dem Telefon.
»Die sollen nicht denken, sondern ihre Arbeit machen. Das muss mit mir abgesprochen werden. Oder dir. Die Spurensicherung kann nicht entscheiden, ob etwas versiegelt werden soll oder nicht«, fuhr sie ihn wütend an. Vielleicht hätte sie mit Miquel keinen Kaffee trinken gehen sollen, sondern die Spurensicherung beaufsichtigen, dachte sie zynisch. In Madrid wäre das nicht nötig gewesen.
»Hoffentlich gehen uns dadurch nicht wertvolle Spuren verloren«, und legte einfach auf. Sie war stinksauer!
Mittlerweile stand sie vor Apartment 115, das im letzten Haus direkt über den Klippen unter dichten Pinien lag. Zwar ein etwas beschwerlicher Aufstieg bis dorthin, aber lohnenswert. Eine wundervoll gepflegte Anlage, stellte Mercédès fest. Da sind viele fleißige Hände am Werk.
Sie musste mehrmals klopfen, bis sich die Tür öffnete.
»Ja?«, fragte ein verschlafener Strubbelkopf mit zerzaustem Vollbart und beharrter Brust.
Ganz untypisch für die Jugend von heute, dachte sie. Ist behaarte Brust nicht out? Aber ihr gefiel, was sie sah. Ein toller Körper. Und erst sein … schnell ließ sie ihre Augen Richtung Gesicht wandern und wies sich als Polizistin aus.
»Jens Meinfeldt?«
Er nickte. »Polizei? So früh am Morgen?«
»Es ist Mittag vorbei. Darf ich hereinkommen?«
»Bitte«, und er gab die Tür frei.
Ungeniert stand er nackt vor ihr. »Möchten Sie sich nicht etwas anziehen?«
»Nicht unbedingt. Wenn es Sie nicht stört …«
»Nein, mich stört es nicht«, lächelte sie. Ganz und gar nicht, dachte sie noch und riskierte einen weiteren Blick. Doch dann besann sie sich auf ihre Aufgabe.
»Sie kennen Sabrina Schneider?«
»Ja. Was ist mit ihr?«
»Frau Schneider ist tot.«
»Was? Aber das gibt´s doch nicht. Wir haben heute Nacht noch …«, verstummte Meinfeldt verstört.
»Sie haben heute Nacht noch was?«, wollte Mercédès wissen.
»Wir hatten Sex. Tollen Sex. Sabrina ist … war eine leidenschaftliche Frau«, antwortete er traurig.
»Wo hatten Sie Geschlechtsverkehr? Hier in Ihrem Apartment oder bei Frau Schneider?«
»Bei Sabrina. Sie stand danach nicht so gerne auf ...«, lachte er.
»Das heißt, sie blieben nicht die gesamte Nacht zusammen?«
»Nein, Sabrina sagte immer, sie möchte nur neben dem Mann aufwachen, den sie wirklich liebt.«
»Sie hat Sie also nicht geliebt?«
»Nein. Ich war nur ihr Spielzeug. Ich gab ihr, was sie wollte. Und sie gab mir, was ich wollte.«
»Und was wollten Sie?«
»Abgesehen vom Sex, meinen Sie?« Ein neckisches Lachen war in seinen Augen erkennbar.
Mercédès nickte.
»Sabrina finanzierte mein Leben. Ich war die Muse für ihre Bücher, sie für meine Bilder. Da die aber nicht so erfolgreich sind wie ihre Bücher, also …«
»… haben Sie auf ihre Kosten gelebt«, beendete Mercédès den Satz.
»Ja«, gab er unumwunden zu.
»Frau Schneider soll nicht sehr erbaut gewesen sein, dass Sie hier auf Mallorca aufgetaucht sind?«
»Wer sagt das? Der Kriecher von einem Manager? Der war doch nur selbst scharf auf sie«, kam es verächtlich von Jens.
Mercédès wurde hellhörig. Schon wieder jemand, der meinte, Werner Hoffmann hätte mehr von Sabrina Schneider gewollt, als er zugegeben hatte. »Wie kommen Sie darauf?«, fragte sie deshalb nach.
»Na, wie er sie angesehen hat. Richtig angehimmelt. Und gestern Nachmittag stand er plötzlich in ihrem Schlafzimmer, als wir gefickt haben. Sabrina war tierisch wütend.«
»Was wollte Herr Hoffmann?«
»Keine Ahnung. Sabrina hat mich nie in ihr Leben eingeweiht. Ich fand´s komisch, dass er die Tür selbst aufgesperrt hat. Aber Sabrina wollte mir nicht sagen, ob sie was am Laufen hat mit ihm. Dafür hat sie mich dann weggeschickt. Deshalb bin ich bei dem Abendessen aufgetaucht. Wollte herausfinden, was zwischen den beiden so ablief.«
»Und, haben Sie´s herausgefunden?«
»Nein. Sie waren höflich zueinander, fast zu höflich. Sabrina ist normal charmanter, flirtet gerne. Aber gestern gab sie sich richtig langweilig. Lag vielleicht auch an dem Ehepaar, das am Nebentisch saß. Die Alte steckte ihren Kopf ständig in unsere Richtung, ließ ihre Augen flink über uns huschen. Man fühlte sich richtiggehend beobachtet. Aber mich kümmerte es nicht. Ich genoss das kostenlose Abendessen und trank zu viel von dem mallorquinischen Wein. Und ging dann mit Sabrina auf ihr Apartment. Für Sex«, fügte er grinsend wie ein Lausbub an.
Mercédès wurde es heiß, bei dem Blick, den der Junge über sie laufen ließ. Der war sicher keine fünfundzwanzig Jahre alt, aber selbstsicher und sich seiner Wirkung auf Frauen sehr bewusst.
»Sie gingen also mit Frau Schneider direkt nach dem Abendessen in ihr Apartment. Was tat Herr Hoffmann?«
»Keine Ahnung. Er schaute unglücklich drein, wie ich mit Sabrina abgezogen bin. Ich denke, er ging in seine Wohnung.«
»Wohnt er denn auf dem Gelände?«
»Soviel ich weiß, hat er irgendwo eine Dienstwohnung im Resort«, antwortete er uninteressiert.
»Wann verließen Sie Frau Schneider in der Nacht?«
»Kurz nach Mitternacht. Sabrina bestand auf ihren Schönheitsschlaf. Und sie stand ja jeden Tag um sieben Uhr auf, um schwimmen zu gehen.«
»Da haben Sie sie das letzte Mal gesehen? Als Sie sie nach ... nach dem Geschlechtsverkehr verlassen haben?«
»Ja. Was sollen die Fragen? Woran ist Sabrina denn gestorben?«
»Sie ist beim Schwimmen ertrunken.«
»Ertrunken? Doch nicht Sabrina. Die schwamm wie ein Weltmeister. Zog eine Bahn nach der anderen, ihr Fitnessprogramm. Die ertrinkt doch nicht.«
»Wir untersuchen die Todesursachen noch. Wo waren Sie heute Morgen zwischen sieben und acht Uhr?«
»Ich? Im Bett. Wo sonst?«
Mercédès musste sich ein Lachen verkneifen bei dem überraschten Gesichtsausdruck, den Meinfeldt bei dieser Frage an den Tag legte.
»Kann das jemand bezeugen?«
»Nein, aber warum sollte das jemand bezeugen können? Ich hätte Sabrina doch nie was getan, schließlich lebte ich von ihr. Ich werde doch nicht den Ast absägen, auf dem ich sitze. Außerdem standen wir uns nahe. Auch wenn es nicht die große Liebe war, so vertrauten wir uns und waren gegenseitig für einander da.« Er verschwieg allerdings, dass er deshalb in Paguera war, weil Sabrina ihm den Laufpass gegeben und angekündigt hatte, ihn aus ihrem Testament streichen zu lassen. Er wollte sie umstimmen. Denn sonst hätte er einpacken können und seine schicke Wohnung in Prenzlauer Berg aufgeben müssen. Aber mehr noch hätte ihn getroffen, seinem süßen Leben ade sagen zu müssen. Und all den willigen Mädels. Jetzt brauchte er sich nicht mehr zu sorgen.
»Sie haben mir noch nicht verraten, warum Frau Schneider nicht erbaut über Ihr Auftauchen war?«
»Ich denke, dass sie mit dem Hoffmann was am Laufen hatte. Und ich sie in ihren Bemühungen gestört habe. Aber sie hatte nichts dagegen, dass ich hier war, glauben Sie mir.« Und sein dreckiges Grinsen überzeugte Mercédès.
»Danke für Ihre Bereitschaft, meine Fragen zu beantworten. Bitte reisen Sie nicht ab, es kann sein, dass ich noch einige mehr an Sie habe«, und sie ließ ihren Blick ein weiteres Mal an eine bestimmte Stelle des jungen Mannes wandern, bevor sie das Apartment verließ. Nicht übel, dachte sie.
Jens lächelte vor sich hin. Nein, so schnell würde er nicht abreisen. Erstens hatte er grad das hübsche Zimmermädchen aufgerissen, das ihm die Nacht versüßt hatte, nachdem Sabrina ihn hinausgeworfen hatte. Er konnte nicht verstehen, warum Sabrina nach einem Quickie genug von ihm hatte. Sie hatten es doch sonst mehrmals in einer Nacht getrieben. Aber die letzten Tage war sie irgendwie eigenartig. Ob es mit Hoffmann zusammenhing? Er nahm sich vor, dem auf den Grund zu gehen.
Nach dem Besuch bei Jens Meinfeldt wollte Mercédès noch Dirk Ackermann aufsuchen, um zu überprüfen, ob sich Ackermann und Sabrina Schneider wirklich gekannt hatten, wie es Frau Fichtelhuber behauptet hatte. Sie orientierte sich an dem Resort-Plan, den ihr die Rezeptionistin vorausschauend mitgegeben hatte.
Die Anlage war um die Bucht La Romana gruppiert und zog sich die Hügel hinauf, die teilweise von dichtem Pinienwald bewachsen waren. Im Moment befand sie sich am höchsten Punkt. Sie kletterte also die Stufen wieder hinunter, denn Haus 6, in dem die Ackermanns wohnten, lag gleich hinter der Rezeption, die in der Mitte des Resorts am tiefsten Platz lag, wenn man vom Meer absah. Sie hatte Muße, die Häuser, in denen die Apartments untergebracht waren, genauer in Augenschein zu nehmen. Fand es hübsch, dass alle in verschiedenen warmen Farben strahlten und in unterschiedlicher Bauweisen errichtet waren. Nicht so nullachtfünfzehn, wie das sonst bei vielen Anlagen der Fall war. Manche der Gebäude lagen versteckt unter Pinien, andere direkt an den Klippen, wie Meinfeldts Haus.
Sie kam an der Bar Luna 81 vorbei, dann am Pool, der beim Schwimmen einen herrlichen Ausblick auf die Bucht bieten musste, denn beides, Bar und Pool, waren terrassenförmig in den Hang eingelassen. Sie blickte hinunter auf den Spielplatz und den Strand dahinter, an dem nur wenige Leute spazierten. Als sie unten angekommen war, überquerte sie den Parkplatz, schlenderte an der Rezeption vorbei, nicht ohne einen Blick durch das Fenster auf Werner Hoffmann zu werfen. Dann schlug sie den Weg zwischen Restaurant und Rezeption ein, der sie erneut bei einem Pool vorbei führte, hinter dem Haus 6 lag.
Sie klopfte an die Apartmenttür 602, laut Plan eines der drei Apartments, die für Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung geeignet waren. Hatte die Fichtelhuber nicht etwas von einer kranken Frau erwähnt?
Ein Mann Mitte Siebzig mit einem gewaltigen Bierbauch öffnete und schaute sie mit eisgrauen Augen hinter randlosen Brillengläsern abschätzend von oben herab an.
Sie musterte den Mann kühl zurück und überlegte, dass er einmal eine imposante Erscheinung gewesen sein musste, mit einer Größe von fast 1,90 Meter und dem charakteristisch geschnittenen Gesicht. Doch jetzt ließen ihr der mürrische, fast aggressiv abweisende Ausdruck einen Schauer über ihren Körper laufen. Die feinen Äderchen, die seine rote Nase durchzogen, verrieten ihr, dass sie hier einen Trinker vor sich hatte.
»Ja? Was wollen Sie?«, fragte er angespannt. Automatisch auf Deutsch.
Wieder einmal ärgerte sich Mercédès, dass diese deutschen Touristen gar nicht auf die Idee kamen, es wenigstens aus Höflichkeit mit Spanisch zu probieren. Sie seufzte und wusste in dem Moment, warum man sie auf die Insel versetzt hatte. Sie sprach deutsch und spanisch wie ihre Muttersprache.
»Ich bin Comissària Mayerhuber und untersuche den Tod von Sabrina Schneider. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich Sie, Herr Ackermann, heute in der Menge vor dem Schwimmbad ausgemacht, in dem wir die Tote gefunden haben.«
Sie beobachtete ihn dabei genau, denn ihr war sein gequälter Gesichtsausdruck aufgefallen, und sie hatte gehofft, diesen Mann zu finden, aber nicht damit gerechnet, dass das so schnell und so einfach war.
»Ja und, weshalb kommen Sie da zu mir? Ich war nicht der Einzige dort.« Seine kalte Stimme ließ sie erneut einen Schauer spüren.
»Aber Sie kannten Frau Schneider. Wie uns berichtet wurde, haben Sie des Öfteren mit ihr gesprochen.«
»Ich kannte diese Frau nicht«, und die Betonung von ›diese Frau‹ ließ Mercédès aufhorchen.
»Sie haben sich also nie mit Frau Schneider unterhalten?«
»Was heißt unterhalten? Wir haben hin und wieder ein Wort gewechselt, wie das in solchen Resorts der Höflichkeit geschuldet ist. Doch mehr als ein ›Grüß Gott‹, ›schöner Tag heute‹ war das nicht. Ich kannte nicht einmal ihren Namen.«
»War es das?«, fügte er noch schroff hinzu, da ihn Mercédès nur interessiert beobachtet hatte.
Mercédès überlegte kurz. Doch was sollte sie ihn befragen, wenn er abstritt, sie zu kennen? Mehr als das bösartige Geschwätz der alten Fichtelhuber hatte sie nicht. »Danke, ja, das war´s. Aber es könnte sein, dass sich noch Fragen ergeben. Sie haben nicht vor, in nächster Zeit abzureisen?«
»Ich bin noch bis Januar hier eingesperrt«, antwortete er grimmig und schloss ohne Abschiedsgruß die Tür.
Mercédès wandte sich kopfschüttelnd ab.
»Warum hast du der Kommissarin nicht erzählt, dass du das Luder kennst?«, kam es hasserfüllt aus dem Nebenzimmer, nachdem er die Tür geschlossen hatte.
»Halt dein Schandmaul«, gab er laut und kalt zurück und schenkte sich einen doppelten Schnaps von seinem Selbstgebrannten ein. Nicht den ersten an diesem Morgen. Das ist das Einzige, was mir noch bleibt, dachte er grimmig. Meine Schnapsbrennerei. Und ich bin selbst mein bester Kunde. Dann holte er sein Smartphone aus der Brusttasche, öffnete seine Musik-App und gleich darauf erklang das Lied As Time Goes By.
»Schalt das verdammte Lied aus«, keifte seine Frau bissig.
Er schlug ohne ein Wort die Tür zum Nebenzimmer zu, und begab sich auf die Terrasse seines Apartments. Nicht, ohne den Schnaps mitzunehmen.
Auf dem Weg durch den Pinienhain zu ihrem Auto musste Mercédès an ihren typisch bayrischen Vater denken, von dem sie die Sturheit und Durchsetzungskraft geerbt hatte. Von ihrer spanischen Mutter die Zierlichkeit und ihre oft widerspenstigen Locken, die sie zeitweise hasste. Vater hätte es hier gefallen. Er liebte den Duft von Pinien. Doch über eines hatte sie sich zeitlebens mit ihm gezankt. Warum nur war Vater so ein Mercedes-Liebhaber? Schon in Grundschulzeiten in München hatte sie unter diesem Vornamen gelitten. Ihr Vater hatte sie bei Klagen tröstend in die Arme genommen und geflüstert: »Mercédès ist ein wunderschöner Name für ein wunderhübsches Mädchen. Wer das nicht einsieht, ist deiner nicht wert.« Sie lächelte bei dem Gedanken an ihn. Leider war er viel zu früh verstorben, an plötzlichem Herztod. Noch heute kann sie sich an den Augenblick erinnern, als der Polizist ihnen damals die Mitteilung überbrachte. Daher konnte sie sich gut in die Menschen einfühlen, denen sie so eine Hiobsbotschaft überbringen musste.
Sie war nach dem Tod des Vaters mit ihrer Mutter zurück nach Spanien gegangen, hatte ihren Abschluss in Córdoba, der Heimatstadt ihrer Mutter, erlangt, bevor sie sich an der Polizeiakademie in Madrid eingeschrieben hatte. Ihre ersten Dienstjahre hatte sie in Sevilla verbracht, dann hatte man sie nach Madrid geholt, wo sie die letzten Jahre mit ihrer Mutter gelebt hatte.
Doch jetzt hatte man sie nach Mallorca versetzt, ihre erste leitende Stelle.
›In der Provinz ist es leichter, als Chefin anzufangen‹, hatte ihr Vorgesetzter ihr mit auf dem Weg gegeben. Doch sie hatte ihn in Verdacht, sie bewusst für diesen Außenposten vorgeschlagen zu haben, da sie seinem Werben, welches immer aggressiver geworden war, tapfer widerstanden hatte.
Andere beneideten sie um diese Stelle im sonnigen Mallorca. Sie allerdings liebte die laute, lebendige Großstadt und wäre außerdem gerne in der Nähe ihrer Mutter geblieben, die gesundheitlich angeschlagen war. Aber vielleicht hole ich sie nach. Die Sonne würde ihr guttun, überlegte Mercédès, als sie in ihren Wagen einstieg, um in ihre neue Dienststelle nach Palma zu fahren.
»Was haben die Gespräche mit den Gästen und den Angestellten ergeben?«, war Mercédès´ erste Frage, als sie ihr Büro betrat. Kein Willkommensgruß, nichts. Wenn sie sich in einen Fall verbissen hatte, vergaß sie ihre guten Manieren schon mal.
»Bon dia, liebe Mercédès. Willkommen in deiner neuen Wirkungsstätte«, und dabei zeigte Miquel auf einen bunten Blumenstrauß, der in einer Glasvase auf ihrem Schreibtisch stand. »Soll ich dich herumführen und den anwesenden Kollegen vorstellen?«, fügte er noch hinzu.
Mercédès blickte sich um. Wie hasste sie diese Glaskäfige. Wer nur hatte die Idee, dass alle modernen Bürogebäude wie Aquarien aussehen mussten? Null Privatsphäre. Immer unter Beobachtung. Sie waren doch keine Fische. Seufzend dachte sie an ihren ersten Besuch hier vor vier Wochen, bevor sie ihren Urlaub angetreten hatte.
Sie war am frühen Morgen für einen Tag hergeflogen, um sich mit ihrem zukünftigen Chef, Doctor Lluc Bibiloni, einem trockenen Juristen, zu treffen, um Einzelheiten zu besprechen und ihren Ausweis entgegenzunehmen. Der hatte sie genauso misstrauisch beäugt wie sie ihn. Sie wollte nicht nach Palma, er wollte sie nicht. Aber die Entscheidung war gefallen, an höherer Stelle. Sie musste sich glücklich schätzen, dass sie im männerdominierten Spanien die Chance für eine leitende Stelle bei der Policía Nacional bekommen hatte. Sie machte sich nichts vor. »MANN« würde sie genau beobachten ...
»Nein, lass mal. Mich interessiert mehr, was wir haben. Außerdem hat das bei meinem ersten Besuch hier unser Boss erledigt«, grinste sie. Berichtete dann kurz und bündig von ihren Befragungen. Danach schaute sie fragend auf Miquel.
Der räusperte sich. Und dachte still, dass doch viel deutsches Blut in ihr fließen musste. Kein Spanier würde so reagieren.
»Zuerst einmal sorry wegen des Nicht-Versiegelns des Apartments. Es war mein Fehler. Die Spusi hat mich deswegen kontaktiert. Ich habe mich vergewissert, ob sie alle relevanten Dinge berücksichtigt, beziehungsweise mitgenommen haben für die Beweissicherung. Und gemeint, das Versiegeln können sie sich schenken.«
»Okay, Anfängerfehler. Doch ich kann nur für dich hoffen, dass die Spurensicherung nichts übersehen hat. Ich habe Hoffmann angewiesen, nichts zu ändern. Und mein Siegel von Madrid angeklebt«, schmunzelte sie schon wieder.
»Danke«, lächelte Miquel einnehmend.
Ein Greenhorn, auch das noch, seufzte Mercédès innerlich. Er war wohl als einziger zu überzeugen gewesen, mit einer deutschen Frau vom Festland zusammenzuarbeiten.
»Und jetzt zu deinen Ergebnissen«, wurde sie langsam ungeduldig.
»Also, von den Gästen habe ich praktisch nichts Nützliches erfahren. Keiner hat etwas gehört oder gesehen. Zumindest wenn ich sie richtig verstanden habe. Für eine Befragung muss ich definitiv mein Deutsch verbessern. Das Resort ist fest in deutscher Hand. Außer einem Pärchen aus England und zwei Damen aus der Schweiz habe ich nur Landsleute von dir getroffen«, zwinkerte er ihr zu. »Gewundert haben sich die meisten allerdings, dass Sabrina Schneider bereits vor acht Uhr im Hallenbad war, da dieses normalerweise erst um acht Uhr aufsperrt. Ansonsten scheinen sie sich nicht für die berühmte Schriftstellerin interessiert zu haben. Die meisten behaupteten sogar, sie nicht zu kennen.«
»Glaubst du ihnen?«
Miquel zuckte mit den Schultern. »Also, bei einigen kann ich mir das vorstellen. Aber so mancher Mann wusste sehr wohl, wer Frau Schneider war und welche Art von Literatur sie schrieb. Allerdings würden sie das vor ihren Ehefrauen nie zugeben.«
»Dann sollten wir sie getrennt voneinander befragen«, lachte Mercédès.
»Denkst du, das Motiv könnte mit ihrer schriftstellerischen Tätigkeit zu tun haben?«
»Wir wissen noch nicht einmal, ob es tatsächlich Mord war. Auch wenn es wahrscheinlich ist. Vielleicht haben jemanden ihre Bücher nicht gefallen? Oder eine verschmähte Liebe? Lass uns abwarten, was die Obduktion ergibt und jetzt mal schauen, wo wir stehen, bevor wir über Motive und Täter spekulieren. Was hast du sonst noch so in Erfahrung gebracht?«
»Andreu, der Bademeister, hat mir unter dem Siegel der Verschwiegenheit erzählt, dass für Sabrina Schneider das Hallenbad um sieben Uhr fertig sein musste. Sie wollte alleine schwimmen, ohne durch die anderen Gäste gestört zu werden.«
»Wer hatte das genehmigt?«
»Der Hotelmanager. Der arme Andreu hat mir das Versprechen abgenommen, dass ich seinem Chef nicht verrate, von wem ich das habe.«
»Wieder Hoffmann. Er scheint doch sehr an Sabrina Schneider interessiert gewesen zu sein, auch wenn er das nicht zugibt. Interessant!«
»Außerdem habe ich mit der Rezeptionistin gesprochen, die Dienst hatte, als Fichtelhuber in die Rezeption stürmte. Sie konnte mir aber so gut wie nichts sagen. Wirkte eher verschüchtert und sehr entsetzt. Ja, und dann gibt es da noch eine Margit ...«, und er blätterte in seinen Notizen. »Wo habe ich das denn notiert? Irgend so ein Doppelname«, fluchte er leise. »Egal, es gibt eine Stellvertreterin für Werner Hoffmann, die gleichzeitig die Finanzen unter sich hat. Die ist zurzeit allerdings in Zürich bei der Muttergesellschaft.«
»Gut, die können wir außen vorlassen. Die kann uns nichts zum Tod von Sabrina Schneider sagen, wenn sie die letzten Tage nicht im Resort war. Und sonst? Spusi? Gerichtsmedizin?«
»Die Gerichtsmedizin ist noch bei der Arbeit. Wie die Spusi auch.«
Wie auf Kommando betrat in diesem Augenblick ein hübsche Frau Mitte zwanzig mit einem ähnlichen Lockenkopf wie Mercédès das Büro. »Hola Miquel«, strahlte sie diesen an, bevor ihre Augen neugierig über Mercédès streiften.
»Hola Mayte«, begrüßte dieser das Mädchen herzlicher, als er das als Kollege tun sollte und stellte die beiden Kolleginnen einander vor.
»Spurensicherung also«, lächelte Mercédès höflich und reichte der Kollegin die Hand. »Schon was Brauchbares?« Ihr entging nicht der zärtliche Blick, den Miquel über Mayte gleiten ließ und dachte bei sich, olala, ein heimliches Verhältnis?
»Wir sind dabei, die Spuren aus dem Poolbereich und dem Zimmer auszuarbeiten. Im Hallenbad gibt es tausende von Fingerabdrücken, die werden uns nicht weiterhelfen. Praktisch jeder Gast hat dort irgendwo seine Spuren hinterlassen ...«
»Wie schaut es mit fremden Spuren aus?«, unterbrach Mercédès.
Mayte schaute sie mit großen Augen an. »Wir müssen erst mal alle Spuren mit denen der Gäste und der Angestellten abgleichen, bevor wir überhaupt feststellen können, ob es Spuren von Personen gibt, die nicht mit dem Resort in Verbindung gebracht werden können. Das dauert ...«
»Was ist mit ihrem Apartment?«, fragte Mercédès ebenso ungeduldig nach.
»Wir haben alles mitgenommen, was uns wichtig erschienen ist. Konnten unterschiedliche Fingerabdrücke sicherstellen. Auswertungen laufen. Ihr Handy ist entschlüsselt, da hat uns Doktor Munar geholfen.«
»Wie das?«, fragten Mercédès und Miquel wie aus einem Mund.
»Er hat ihren rechten Daumen an den Fingerabdruckscanner ihres Handys gedrückt«, lächelte sie. »Allerdings konnten wir nichts von Bedeutung finden. Hier, das Protokoll ihrer Anrufliste«, und sie legte Mercédès eine ausgedruckte Liste auf den Schreibtisch. »WhatsApp hat sie nicht verwendet, auch kaum SMS geschrieben. Die letzte SMS liegt Monate zurück. Ein Mailprogramm hat sie auf ihrem Smartphone nicht benutzt. Genauso wenig wie Instagram, Twitter oder Facebook.«
»Sympathisch. Hat das Telefon also tatsächlich nur zum Telefonieren benutzt«, zeigte sich ein Lächeln des Verständnisses auf Mercédès´ Gesicht. »Doch ist das bei einer Schriftstellerin nicht ungewöhnlich?«
»Nicht alle suchen die Öffentlichkeit«, antwortete Mayte kryptisch.
»Miquel, könntest du im Internet recherchieren, wie das mit Webseite und sozialen Medien aussieht?« Er nickte. Mercédès wandte ihre Aufmerksamkeit wieder Mayte zu.
»Bei den Bildern sind es nur die üblichen Urlaubsschnappschüsse, die wir gefunden haben. Keine Alben, keine älteren Fotos als die der letzten Woche. Sie war allerdings nicht viel auf der Insel unterwegs. Die meisten Fotos stammen aus dem Resort.«
»Wen oder was zeigen diese Fotos?«, wollte Mercédès wissen.
»Sonnenuntergänge ...«, lachte Mayte.
»Keine Menschen? Männer zum Beispiel?«, hinterfragte Mercédès.
»Doch, ein gutaussehender junger Typ ist hin und wieder zu sehen, auch bei Selfies mit ihr zusammen. Ihr Sohn?«
»Nein«, lachte jetzt Mercédès, »ihr Lover.«
Mayte schaute leicht konsterniert drein. »Ein bisschen jung, findet ihr nicht?«
Mercédès zuckte ihre Schulter. »Jedem das seine«, meinte sie lakonisch. »Miquel, kannst du die Fotos auswerten? Damit wir sehen, wo auf der Insel sie unterwegs war? Da hast du Heimvorteil«, grinste Mercédès.
Miquel nickte auch zu dieser Aufgabe zustimmend.
»Der Laptop ist noch nicht geknackt«, fuhr Mayte fort. »Frau Schneider hat wohl ein komplizierteres Passwort als die meisten Menschen sonst benutzt«, seufzte sie.
»Also kein übliches 1,2,3,4 oder das Geburtsdatum?«, lachte Miquel.
Mayte schüttelte resigniert den Kopf. »Dafür habe ich hier eine Adresse für euch, die bei Notfall zu verständigen ist. War in ihrem Portemonnaie. Und die Nummer darauf hat sie fast täglich angerufen.«
Interessiert blickte Mercédès auf den kleinen, ziemlich zerfledderten Zettel mit einer Berliner Adresse. Den musste Sabrina Schneider schon lange mit sich herumgetragen haben.
»Danke«, sagte sie nebenbei und blickte gedankenverloren aus dem Fenster. Es war nicht die Adresse von Jens Meinfeldt, also stand er ihr nicht so nah, wie er versucht hatte, ihr weiszumachen.
Aus den Augenwinkeln sah sie, wie Miquel verstohlen einen Kuss auf Maytes Wange drückte. Hoffentlich gab das keine Schwierigkeiten bei den Ermittlungen, dachte sie, denn sie wusste, welche Verwicklungen eine Liebesgeschichte am Arbeitsplatz mit sich bringen konnte. Ihre letzte Ermittlung wäre beinahe gescheitert, weil sie sich mit ihrem Kollegen, mit dem sie eine leidenschaftliche Affäre verband, nach einem heftigen Streit so in den Haaren gelegen war, dass eine Zusammenarbeit nicht mehr möglich war. Auch ein Grund, warum sie jetzt auf dieser Insel gelandet war. Zum hundertsten Mal nahm sie sich vor, ihre Gefühle in Zukunft besser in Zaum zu halten. Und ärgerte sich, als die bernsteinfarbenen Augen von Werner Hoffmann vor ihr auftauchten.
»Alles klar bei dir?«, wollte Miquel besorgt wissen, dem ihr bekümmerter Gesichtsausdruck aufgefallen war.
»Ja, ja«, antwortete sie zerstreut und strich über ihre Augen, um das Bild von Werner Hoffmann zu verdrängen. »Seid ihr ein Paar?«
Miquel nickte nur, eher abweisend.
Auch gut, dachte Mercédès, dann will er nicht darüber sprechen. Ist mir ohnedies lieber. »Wir sollten diese Berliner Nummer wählen.« Auf sein erneutes Nicken tippte sie die Zahlen in das Festnetztelefon, das auf ihrem Schreibtisch stand.
Laut erklang Tuten aus dem Telefon, denn Mercédès hatte auf Lautsprecher gestellt, damit Miquel dem Gespräch lauschen konnte.
»Renate Hartig«, meldete sich eine spröde Stimme.
»Buenos días. Hier spricht Comissària Mayerhuber von der Polizei Mallorca.«
»Oh Gott, ist was mit Sabrina?«, wurde Mercédès von der Frau erschrocken unterbrochen.
»Wie kommen Sie darauf, Frau Hartig?«
»Na, ich weiß doch, dass Sabrina meine Adresse für Notfälle mit sich führt.«
»Ich muss Ihnen leider die traurige Mitteilung überbringen, dass Frau Schneider heute Morgen verstorben ist.«
Statt einer Antwort hörten sie nur lautes Schluchzen. Miquel bedeutete ihr, sie solle den Hörer an das Ohr nehmen, er könne ohnedies nur wenig verstehen und setzte sich an seinen Computer für Recherchen über soziale Medien in Zusammenhang mit der Toten.
Als sich Renate Hartig beruhigt hatte, wollte sie als erstes wissen, was passiert war. Auch sie konnte auf Mercédès Erklärung hin nicht glauben, dass Sabrina ertrunken war, da Schwimmen eine Leidenschaft von ihr war. Höchstens ein Herzinfarkt oder dergleichen könnte einen solchen Tod verursachen, aber so viel sie wusste, war Sabrina bei bester Gesundheit.
»In welchem Verhältnis stehen – Entschuldigung – standen Sie zu Sabrina Schneider?«
»Ich bin ... war ihre beste Freundin«, antwortete Frau Hartig traurig. »Wir haben uns vor vielen, vielen Jahren in Berlin angefreundet und waren wie Schwestern.« Und wieder schluchzte sie los.
»Hat Frau Schneider Verwandte, Angehörige oder Freunde, die ihr nahestanden?«, schnitt Mercédès den Tränenfluss ab.
Renate Hartig schniefte ins Telefon: »Nein. Keine Verwandten. Einige Freunde, aber wenige. Sie wissen, wie das ist, wenn man berühmt und reich ist ...«
Nein, Mercédès wusste es nicht. Konnte es sich aber vorstellen.
»Es gibt da noch eine alte Schulfreundin aus Rosenheim, mit der sie regelmäßig Kontakt hatte. Eine Manuela. Mehr weiß ich nicht.«
»Aus Rosenheim?«, fragte Mercédès hellhörig geworden nach.
»Ja, Sabrina stammt ursprünglich aus Rosenheim. Ging dort weg, wohl nach einer unglücklichen Liebesgeschichte. Aber sie hat nie darüber erzählt. Obwohl wir uns jetzt über zehn Jahre kennen.«
Mercédès konnte der Stimme die Verbitterung anhören, weil Sabrina sich der Freundin gegenüber nie geöffnet hatte. Also musste in Rosenheim etwas Schwerwiegendes vorgefallen sein. Ob man das noch eruieren konnte? Aber war das überhaupt interessant für den Fall?
»Kennen Sie einen Jens Meinfeldt?«
Kurz zögerte sie. »Ja, warum?«
»Der ist hier auf Mallorca in demselben Resort wie Frau Schneider ...«
»Jens ist auf Mallorca?«, wurde Mercédès überrascht unterbrochen. »Was macht er denn da?«
»Er ist wohl Frau Schneider gefolgt.«
»So ein Mistkerl«, spie die Hartig gallig hervor.
»Warum?«, fragte Mercédès verblüfft.
»Sabrina hat ihn doch vor die Tür gesetzt. Sie wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben.«
So ein Bürschchen, dachte Mercédès. Davon hatte er ihr nicht ein Sterbenswörtchen erzählt. »Warum hat Frau Schneider das getan?«
»Weil Jens sie ständig mit jüngeren Frauen betrogen hat. Sie hatte es satt, von ihm hinten und vorn hintergangen zu werden. Einen Tag vor ihrer Abreise hat sie ihm mitgeteilt, dass sie sein Apartment in Prenzel Berg gekündigt habe, dass er seine Sachen packen solle und verschwunden sein müsse, wenn sie aus Mallorca zurückkomme.«
»Er hat nicht bei Frau Schneider gewohnt?«
»Nein, das wäre ihr zu viel Nähe, hat sie gemeint. Sie brauchte ihren Freiraum. Aber sie war ihren Lovern gegenüber immer großzügig.«
»Ihren Lovern?«
Ein lautes Lachen erklang auf die verstörte Frage von Mercédès. »Sabrina liebte die Liebe. Nicht nur in ihren Büchern. Glauben Sie mir, sie war kein Kind von Traurigkeit.«
»Gab es neben Herrn Meinfeldt aktuell noch andere?«
»Nicht soviel ich weiß. Doch ich denke, auf Mallorca muss was sein ...«
»Warum?«
»Weil Sabrina nicht der Typ war, fünfmal hintereinander ein und dasselbe Feriendomizil aufzusuchen. Es musste sie dort etwas besonders gereizt haben. Leider weiß ich nicht, was oder wer es war ...«, seufzte die Hartig.
Mercédès musste lächeln. Frauenfreundschaften. So ganz ohne Eifersüchtelei lief das wohl nie ab. Deshalb hatte sie auch keine beste Freundin, dafür einen besten Freund. Josef, ein schwuler Richter aus München, den sie seit Kindertagen kannte. Der Nachbarsjunge, von dem alle erwartet hatten, sie werden mal heiraten, weil sie immer so unzertrennlich waren. Auch ihr Weggang aus München hatte an der Freundschaft nichts geändert. Ihr hatte er als erste seine Homosexualität anvertraut. Aber sie hatte es schon früher gespürt. Denn er war der einzige Junge in der Schule, der nicht versucht hatte, sie an ihren gut entwickelten Brüsten zu berühren.
»Gibt es sonst etwas, dass Ihnen in letzter Zeit aufgefallen ist? Oder hat Frau Schneider irgendetwas erwähnt, dass Sie stutzig werden ließ?«
»Bei unserem letzten Gespräch vor zwei Tagen meinte sie, die Vergangenheit habe sie eingeholt. Aber mehr wollte sie dazu nicht sagen.
»Die Vergangenheit habe sie eingeholt?«, echote Mercédès und schwieg dann eine Weile. »Können Sie sich vorstellen, was sie damit gemeint hat?«
»Nein, keine Ahnung. Hat wohl mit ihrem Leben vor Berlin zu tun«, kam es leicht bitter.
»Gut Frau Hartig, das wäre es erst mal. Doch es könnten sich noch weitere Fragen ergeben.«
»Kein Problem. Ich helfe gerne. Wann kann ich Sabrina beerdigen?«
»Sie?«
»Ja, wir haben gegenseitig vereinbart, unseren letzten Willen zu unterstützen. Und ich werde mein Wort natürlich halten.«
»Was ist denn der letzte Wille von Frau Schneider?«
»An Ort und Stelle verbrannt und über ein Meer verstreut zu werden. Das dürfte ja wohl kein Problem werden. Das Mittelmeer bietet sich an ...«
»Ich lasse Sie wissen, wenn es soweit ist«, und Mercédès legte gedankenverloren auf. Sabrina Schneider und sie hatten viele Ähnlichkeiten. Nicht nur den letzten Willen.
»Und?«, wollte Miquel neugierig wissen. Kurz berichtete sie über das Erfahrene.
»Dann hätte unser junger Lover also ein Motiv?«
»So schaut´s aus. Den werde ich mir noch mal vornehmen.«
Nach einer Weile fügte sie an: »Die Fichtelhubers sind doch auch aus Rosenheim, oder?« Denn mitten im Gespräch mit der Hartig war ihr eingefallen, dass die Fichtelhubers Sabrina aus Rosenheim kannten. »Wir sollten mit ihnen sprechen. Vielleicht kennen sie ja diese Manuela oder wissen was über eine unglückliche Liebe von Sabrina Schneider. Frau Fichtelhuber ist doch die typische Klatschtante, der nichts entgeht.«
Miquel nickte mit dem Kopf und lachte. »Seh ich wie du. Aber dafür ist morgen Zeit. Wir wissen ja noch gar nicht, ob definitiv Fremdverschulden vorliegt.«
»Doch du bist genauso davon überzeugt wie ich, stimmt´s?«
Wieder nickte er nur mit dem Kopf. Doch diesmal lachte er nicht.
»Herr Meinfeldt, ich hätte da noch ein paar Fragen an Sie«, sagte Mercédès, als Jens Meinfeldt die Tür seines Apartments nur ein Stück öffnete, an die Mercédès am späteren Nachmittag erneut geklopft hatte. »Darf ich hereinkommen?«
»Ich wollte gerade einen Spaziergang machen. Kommen Sie mit?«, und er schlüpfte geschwind aus der Tür und zog sie sofort wieder zu und drehte den Schlüssel zweimal im Schloss um. Diesmal war er bekleidet. Mit einer hautengen Jeans, die mindestens genauso ein Hingucker war wie beim ersten Gespräch sein ...
Von dem Haus, in dem sein Apartment lag, führte ein schmaler Trampelpfad direkt durch den Pinienwald auf die Klippen. Es stand zwar ein Schild am Eingang zum Resort, dass dieser Bereich nur für Gäste zugelassen war, aber jeder konnte ungehindert und ungesehen in das Resort gelangen, registrierte Mercédès. Doch sie vergaß das sofort wieder, als sie oben angekommen war und den herrlichen Ausblick auf nichts als Meer und Pinienwald wahrnahm. Prachtvoll. Ein kleiner ovaler Tisch mit Steinmosaiken, der von einer weißen, gemauerten Bank mit Rückenlehne umgeben war, lud zum Verweilen ein. Mercédès und Jens ließen sich dort nieder. Niemand sagte etwas, Mercédès war von dem Ausblick so gefangen, Jens hing seinen Gedanken nach. Er wirkte unruhig. Zerstreut.
»Was wollen Sie von mir?«, eröffnete er das Gespräch dann doch.
»Wir haben mit Frau Hartig in Berlin gesprochen.«
»In Berlin?«, fragte er überrascht nach.
»Ja, wo denn sonst?«, war Mercédès verblüfft.
»Nichts, nur so. Was hat sie gesagt?«
»Dass Frau Schneider die Beziehung zu Ihnen beendet hat. Sie gebeten hat, aus Ihrem Apartment auszuziehen und auch Ihre persönlichen Sachen aus Ihrer Wohnung zu entfernen. Warum haben Sie das heute Morgen nicht erwähnt?« Ein schräger Blick traf ihn.
»Weil ich dabei war, Sabrina umzustimmen. Sie konnte doch nicht ohne mich sein. Nicht ohne den wundervollen Sex, das hat sie mir immer wieder versichert. Nein, Sabrina hätte mich nie gehen lassen.« Dabei schüttelte er den Kopf, wie zur Bestätigung.
»Frau Hartig meinte, dass Sabrina Schneider genug von Ihren Affären mit jungen Frauen hatte und sie nicht weiter hintergangen werden wollte.«
»Das ist doch Bullshit. Sabrina hatte gar nichts gegen meine Liebesbeziehungen mit jungen Mädels. Ganz im Gegenteil«, begehrte Jens auf.
»Wie darf ich das verstehen?«
»Ich brachte hin und wieder eine Freundin für Spielchen zu dritt mit, wenn Sie verstehen, was ich meine. Das nahm Sabrina als Anregung für ihre Geschichten. Sie animierte mich sogar, mich mit anderen einzulassen und ihr dann davon zu erzählen. Vor allem, wenn sie unter einer Schreibblockade litt.«
»Warum dann jetzt das Aus?«, war Mercédès verwirrt.
»Weil ich mit Renate Hartig ein Verhältnis begonnen hatte.«
Interessiert hob Mercédès den Kopf. Davon hatte die Hartig nichts erwähnt.
»Sabrina war auf einer längeren Lesereise. Mir ging das Geld aus. Ich wusste, dass Renate verrückt nach mir war. Also habe ich sie besucht«, grinste er. »Und als ich sie am Morgen verließ, war ich um ein paar Hunderter reicher. Und so wurden meine Besuche häufiger.«
»Und als Sabrina zurückkam von der Lesereise?«
»Lief alles noch gut. Ich besuchte die Damen abwechselnd, manchmal hintereinander. Doch Renate setzte mir immer mehr zu, ich solle doch Sabrina verlassen. Sie würde gut für mich sorgen. Ich könne auch bei ihr einziehen. Doch Renate bedeutete mir nicht das Geringste. Sie ging mir mit ihrer klettenhaften Art immer mehr auf die Nerven. Und eines Tages servierte ich sie ab.«
»Und?«, fragte Mercédès gespannt.
»Und sie informierte Sabrina. Erzählte von der großen Liebe zwischen ihr und mir und dass Sabrina uns nicht im Wege stehen sollte. Sabrina war wütend, dass ich sie mit ihrer besten Freundin betrogen habe, wütend auf mich, aber keineswegs auf Renate. Können Sie das verstehen?« Er blickte sie mit großen Augen an. Doch Mercédès reagierte nicht. »Sabrina gab mir einen Monat, alles zu klären und reiste nach Mallorca ab. Ich konnte sie doch nicht ziehen lassen. Sie bedeutete mir mehr, als ich gedacht hatte. Also reiste ich ihr nach.«
»Und Frau Hartig?«
»Renate? Die kann Sabrina nicht das Wasser reichen. Kein Selbstwertgefühl, keine Klasse, nicht annähernd so vermögend wie Sabrina. Eine vertrocknete, alte Frau, obwohl sie in gleichem Alter wie Sabrina ist.«
»Trotzdem haben Sie mit ihr geschlafen«, warf Mercédès vorwurfsvoll ein.
»MANN muss ja von was leben. Und was ist falsch daran, eine Frau glücklich zu machen?« Wieder sein unwiderstehliches Grinsen.
Ja, sie konnte sich vorstellen, dass Jens Meinfeldt wusste, wie er mit Frauen umzugehen hatte. Vor allem mit älteren, betuchten. Oder jungen zum Zeitvertreib.
»Aber warum interessiert Sie das überhaupt? Sabrina ist doch eines natürlichen Todes gestorben, oder?«, fragte er lauernd.
»Routine. Es gibt kleine Ungereimtheiten. Aber nichts zum Beunruhigen.«
»Sind Sie sicher?«, und ein eigentümlicher Blick traf sie aus grünen, schillernden Augen.
Der Junge hatte entschieden etwas an sich, dass Frauen schwach werden ließ, erkannte Mercédès. »Ja, da bin ich sicher. Werden Sie jetzt zu Frau Hartig zurückkehren?« Neugierig war ihr Blick auf ihn gerichtet.
»Zurückkehren? Wie meinen Sie denn das?«, fragte er erschrocken.
»Na, nachdem Frau Schneider tot ist, ist ja Ihre Geldquelle versiegt«, meinte Mercédès sarkastisch.
»Nein. Renate halte ich nicht aus. Sollten Sie ihre Leiche finden, komme ich definitiv als Täter in Frage«, und lachte laut und lange über seinen nicht wirklich gelungenen Scherz. Fügte nach einer Weile geheimnisvoll an: »Es gibt noch andere Einnahmequellen!«
Mercédès beobachtete ihn interessiert. Woran dachte er?
»Sonst noch was?«, schaute er sie herausfordernd an.
»Ja, eine Kleinigkeit noch. Frau Hartig hat verlauten lassen, dass Frau Schneider von der Vergangenheit eingeholt worden war. Wissen Sie etwas darüber?«
»Nee, keine Ahnung. Sie war ein bisschen durch den Wind. Das stimmt schon. Aber ich habe das auf den wechselnden Hormonspiegel bei reiferen Damen geschoben«, und grinste breit. »Kann ich jetzt abhauen?«
Als Mercédès bejahend mit dem Kopf nickte, trottete er von dannen.
Sie blieb noch eine Zeit lang sitzen und dachte über das Gehörte nach. Konnte eine Frau so einsam sein, dass sie sich einen jungen Lover nahm und ihn für die Liebe bezahlte? Sabrina Schneider hatte Jens Meinfeldt als Anregung genommen, ihn ausgehalten, aber das machten ältere Männer auch mit jungen Frauen. Sie war nicht von ihm abhängig. Aber Renate Hartig? Die hatte sich regelrecht an Jens geklammert. Wenn sie nicht in Berlin wäre, würde sie unweigerlich als Verdächtige eingestuft werden.
Mercédès seufzte. Vergiss den Fall und genieße den schönen Abend, nahm sie sich vor und schritt die Stufen hinunter zur Panorama-Bar Luna 81, die wie ein Nest im Felsen hockte und einen herrlichen Ausblick auf die Bucht La Romana bot und die Sonne, die gerade im Untergehen begriffen war.
Sie ließ sich an einem der Tischchen direkt am Rand der Terrasse nieder, die von einer niedrigen Brüstung mit Geländer begrenzt wurde. Ob das vor Abstürzen schützen konnte?, überlegte sie, lehnte sich in dem bequemen Stuhl zurück, stütze sich mit den Beinen an der Steinmauer ab. Vielleicht doch nicht so schlecht, Dienst auf dieser wunderschönen Urlaubsinsel leisten zu dürfen, flimmerte durch ihren Kopf. Sie war bereits gespannt, wie sich Mallorca im Sommer präsentieren würde. Im Herbst fand sie es schon mal bezaubernd. Da ließ eine Stimme ihr einen wohligen Schauer über den Rücken laufen.
»Darf ich Sie auf ein Glas von unserem einzigartigen Sangria einladen?«, erklang der warme und dunkle Tonfall von Werner Hoffmann.
Sie blickte in seine einnehmenden Augen, die das erste Mal lächelten. Eine innere Stimme warnte sie, doch sie sagte mechanisch: »Gerne«, und lächelte ihn dümmlich an.
Kurz darauf kam er mit zwei Gläsern zurück, ließ sich neben sie in einen Stuhl fallen und meinte: »Was für ein Tag!«
Sie konnte ihm nur zustimmen. Werner Hoffmann prostete ihr zu, dann blickten sie schweigend dem feuerroten Ball zu, der allmählich im Meer versank. Mercédès war sich seiner Nähe bewusst, spürte, wie seine Aura sie nach und nach umschloss. Sie wehrte sich nicht, ließ es geschehen. Noch nie war sie während eines Falles einem Mann begegnet, der sie dermaßen faszinierte. Trotzdem hörte sie die Stimme von Jens Meinfeldt im Kopf, der meinte, Werner Hoffmann sei auf Sabrina Schneider scharf gewesen. Und wenn? Was ging es sie an?
»Verspüren Sie Hunger?«, schlich sich Hoffmanns Stimme durch die Gitarrenklänge, die seit einer Weile erklangen. Juan Lamas verwöhnte an diesem Abend die Gäste live mit seiner stimmungsvollen Gitarren-Musik. Zumindest stand dieser Name auf den Kärtchen, die am Tischchen zu Werbezwecken auslagen.
»Hören Sie meinen Magen knurren?«, versuchte sie mit einem Scherz, den Kloß in ihrem Hals Herr zu werden.
»Laut und deutlich«, lächelte er auf sie herab, als er sich erhob und ihr seine Hand reichte. Sie streckte ihm ihre entgegen, er umschloss sie fest und zog sie mit sich die schmalen Stufen durch den Pinienwald hinunter in die Bucht. Sie stolperte mehr hinter ihm her, als dass sie ging, so verwirrt war sie über ihre eigenen Gefühle. Sie konnte sich nicht erinnern, dass nur ein gemeinsam erlebter Sonnenuntergang sie schon mal so durcheinandergebracht hatte, und Sehnsüchte in ihr weckte, die sie nicht einmal zu träumen wagte.
Unten in der Bucht angekommen drehte er sich zu ihr um. »Entspricht unser Restaurant Ihren Vorstellungen?«
Sie nickte nur.
Der Restaurantleiter wies ihnen einen Tisch für zwei in einer verschwiegenen Ecke zu. Aus den Augenwinkeln fiel Mercédès Frau Fichtelhuber auf, die ihren Mann in die Seite boxte und in ihre Richtung deutete. Morgen bin ich hier Gesprächsstoff, grübelte Mercédès. Aber sie konnte ja sagen, dass sie noch einige Fragen an Werner Hoffmann stellen wollte. Was sie auch vor hatte.
»Darf ich für Sie unser Willkommensmenü bestellen? Jeden Sonntag lässt sich unser Restaurantchef etwas Besonderes für die neu ankommenden Gäste einfallen.«
»Gerne«, sagte sie, wieder nur mit einem Lächeln. Sie mochte es, wenn Männer die Initiative ergriffen. So taff sie beruflich war, privat liebte sie es, wenn sie sich fallen lassen konnte und ihr jemand Entscheidungen abnahm.
Während Werner Hoffmann die Bestellung aufgab, schenkte die Kellnerin bereits Rotwein ein. Wann hat er den bestellt?, überlegte Mercédès. Oder war das sein üblicher Wein, den er hier beim Essen konsumierte? Hatte er den gestern Abend auch mit Sabrina Schneider getrunken?
»Schön, dass Sie Zeit haben, mir beim Abendessen Gesellschaft zu leisten«, und er stieß mit ihr an. »Zwar bedauere ich die Umstände, durch die wir uns kennengelernt haben, aber nicht die Tatsache an und für sich.«
Sein leicht wienerisch gefärbtes Deutsch lullte sie endgültig ein. Es klang allerdings nicht so derb wie bei den meisten Wienern, sondern er betonte manche Wörter in besonderer Weise. Es hatte einen weichen, runden Klang, nicht das lang gezogene ›Naaa, heaarst, Waaabler‹ mit dem ihr Vater Wiener stets nachgeahmt hatte.
»Sie sagten, dass Sie aus Wien stammen. Von wo genau?«
»Ich bin in Hietzing aufgewachsen. Gleich neben Schloss Schönbrunn«, und seinem Gesichtsausdruck war abzulesen, dass es angenehme Erinnerungen waren, die ihn mit seiner Heimatstadt verbanden. Seine schönen Augen strahlten.
Vielleicht sprach er das berühmte Schönbrunner Deutsch?, ging es Mercédès durch den Kopf. Denn so hübsch hatte das Wienerische noch nie in ihren Ohren geklungen.
»Kennen Sie Wien?«, wollte Werner Hoffmann wissen.
»Natürlich. Als geborene Münchnerin war ich mit meinen Eltern viel in Österreich unterwegs, auch in Wien.«
»Münchnerin«, lächelte Hoffmann sie interessiert an, »deshalb das perfekte Deutsch mit der leicht bayrischen Färbung. Ich habe mich schon gewundert, wie eine Frau, die Spanisch wie ihre Muttersprache spricht und äußerlich alle Vorzüge einer Spanierin besitzt, zu dem eher deutschen Nachnamen und dem interessanten Vornamen kommt.« Er zwinkerte ihr dabei mit seinen wunderschönen Bernsteinaugen zu, sie verliebte sich auf der Stelle in die feinen Fältchen, die die Augenpartie beim Lächeln umgaben.
»Ja, mein Name«, seufzte sie, »Fluch und Segen zugleich.« Und erzählte die Geschichte ihrer Abstammung und warum sie diesen besonderen Vornamen trug.
»Einer schönen Frau ein schöner Vorname. Ihr Vater hat gut gewählt«, lächelte er sie warm an.
Sie musste ihre Augen abwenden. Dieser Mann wird doch nicht mit mir flirten?, überlegte sie. Mit der ermittelnden Polizistin? Aber er wusste nicht, dass sie schon mal wegen Mordes ermittelten. Für ihn war es bisher einfach ein Unfall. Ein tragischer Unfall.
Trotzdem hatte er sich seit heute Morgen stark verändert. Die Nervosität und Unsicherheit waren gänzlich von ihm abgefallen. Er hatte sich gefangen und im Griff. Doch sie verlor sich allmählich ...
»Und warum sind Sie ausgerechnet Polizistin geworden?«
»Warum nicht?«, antwortete sie schnippisch. Immer diese unvermeidliche Frage. Wie hatte sie es satt. Aber wenigsten hat er nicht wie all die anderen gemeint, eine so hübsche Frau und Polizistin ...
»Entschuldigen Sie, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Aber die Berufswahl sagt auch viel über Menschen aus. Ich denke, dass Ihr Beruf sehr interessant ist, denn Sie lernen dabei die unterschiedlichsten Menschentypen kennen. Und wahrscheinlich nicht immer nur sympathische.«
»Das hängt davon ab. Ich habe schon charmante Mörder hinter Gitter gebracht, die dachten, sie können mich mit ihrem Charme einwickeln.« Wie kam sie nur auf diese Antwort? Wollte sie ihm zeigen, dass er es erst gar nicht bei ihr versuchen sollte? Mercédès fühlte sich völlig verwirrt. Auch durch den Alkohol. Sangria und jetzt bereits das zweite Glas Wein auf praktisch nüchternen Magen, das konnte nicht funktionieren. Gott sei Dank wurde in dem Moment der erste Gang serviert. Das knusprige Weißbrot hatte sie längst ganz alleine verzehrt.
Werner Hoffmann bedeutete der Kellnerin, dass sie das Körbchen auffüllen sollte. Dabei fiel ihr seine Hand auf. Sie starrte auf diese. Fühlte ein eigenartiges Kribbeln. Warum machte sie seine Hand nervös? Eine sehr schön geformte Hand, philosophierte sie. Schlank mit langen Fingern. Und ohne Trauring.
»Dann hatten diese Typen keine Menschenkenntnis. Ich schätze Sie überaus geradlinig ein. Sie kämpfen für die Gerechtigkeit, daher sind Sie Polizistin geworden. Aber warum nicht Anwältin oder Richterin?«
Woher wusste er, dass sie zwischen den Berufen geschwankt hatte? War sie so leicht zu durchschauen?
»Mein Vater war Polizist. Und als er uns so früh verlassen hatte, da dachte ich einfach, um ihm nahe sein zu können, trete ich in seine Fußstapfen ...«
Eine Weile aßen sie schweigend, Mercédès fühlte wieder Boden unter den Füßen. Sie liebte Tapas, und diese Auswahl mundete hervorragend. Ihr absoluter Favorit waren Datteln im Speckmantel und sie wurde gewahr, dass nur sie von diesen gegessen hatte. Mochte Werner Hoffmann keine oder hatte er aus Höflichkeit alle an sie abgetreten? Weil sie sich so darauf gestürzt hatte? Sie beschloss, sich ein wenig zurückzunehmen, knabberte an einigen gebratenen Pimientos de Padrón, griff sich eine Garnele im Knoblauchöl, probierte noch ein köstliches Albóndigas. Die Hackfleischbällchen in Tomatensauce erinnerten sie an das deutsche zu Hause, an München und die Fleischpflanzerl. Auch wenn diese nicht in Tomatensauce serviert wurden. Mit einigen Papas arrugadas, den berühmten Kartoffeln mit Salzkruste, fühlte sie sich nun fürs Erste gesättigt.
Als er ihr erneut Wein nachschenken wollte, hielt sie ihre Hand über das Glas. »Ich muss noch fahren«, wehrte sie ab. Er akzeptierte ohne Einwand. Auch das gefiel ihr. Denn meistens wurde versucht, sie doch noch zu einem weiteren Glas zu überreden.
»Wasser?«, fragte er stattdessen.
Sie nickte dankbar.
»Und Sie? War Ihr Kindheitstraum Hotelmanager auf Mallorca zu werden?«
»Nein. Ich wollte Löwendompteur werden.«
»Löwendompteur?«, fragte sie perplex nach.
»Löwendompteur!« Und beide prusteten zur selben Zeit los.
»Wie das?« Es interessierte sie. Der Mann interessierte sie.
»Ich war als Kind fast täglich im Schönbrunner Zoo, verliebt in die Löwen. Und habe mir vorgestellt, wie ich bei ihnen im Käfig stehe und sie dazu bringe, durch Reifen zu springen.«
»Und warum ist daraus nichts geworden?«, schmunzelte sie.
»Weil die Liebe nachgelassen hat und die Angst gewachsen ist«, lachte er.
Sie stimmte ein. »Dafür zähmen Sie jetzt Ihre Gäste.«
»Wenn das so einfach wäre ...«, seufzte er und blickte zu den Fichtelhubers.
»Kann ich mir gut vorstellen, dass es nicht immer leicht ist. Manche Menschen stellen eine Herausforderung dar. Wie war Sabrina Schneider so?«
»Wollen wir jetzt über den Beruf sprechen oder ihn mal außen vorlassen und uns amüsieren?«
Wich er ihr aus oder wollte er wirklich nur abschalten?
Sie lächelte ihn hintergründig an. »Amüsieren hört sich gut an«, und hielt ihm ihr Weinglas doch wieder hin. Dieses hervorragende Wolfsbarschfilet auf Tomatenrisotto mit Olivennage verdiente einen guten Wein und nicht das einfache Wasser, dachte Mercédès. Verträumt beobachtete sie ihn beim Nachschenken des Rotweins.
Amüsiert zog er eine Augenbraue fragend in die Höhe.
Lächelnd erklärte sie: »Ich musste gerade an einen Sommerurlaub mit meinen Eltern in Südfrankreich denken. Mein Vater hat in einem eleganten Restaurant in Menton Fisch bestellt, dazu Rotwein, weil meine Eltern nicht gerne Weißwein tranken. Daraufhin meinte der Kellner ausgesprochen höflich: ›Monsieur, Fisch verlangt Weißwein!‹« Dabei imitierte sie den etwas überheblichen Gesichtsausdruck und die leicht näselnde Stimme des Kellners.
Hoffmann brach in schallendes Gelächter aus, was die Aufmerksamkeit Rosie Fichtelhubers nach sich zog. »Ja, das hab ich in der Tourismusschule Kleßheim auch noch gelernt. Aber Gott sei Dank sind die Regeln nicht mehr so streng.« Erhob sein Glas und prostete ihr zu.
Im Hintergrund erklang This is My Song, eine alte Aufnahme von Petula Clark, und obwohl das keines von Mercédès Lieblingsliedern war, ergriff sie eine eigenartige Stimmung. Warum war ihr Herz plötzlich so leicht?, fragte sich nicht nur Petula Clark.
»Wie lange leben Sie bereits in Spanien?«, nahm er das Gespräch nach ein paar Minuten Schweigen mit einem Räuspern wieder auf. Gespannte Augen trafen sie.
Hatte er die knisternde Atmosphäre ebenso empfunden?, überlegte Mercédès.
»Ich war sechzehn, als wir München verlassen haben. Also eine ganze Weile«, schmunzelte sie. Sollte er doch raten, wie alt sie war. Sie musste ihm ja nicht auf die Nase binden, dass sie jetzt schon die gleiche Anzahl von Jahren in Spanien lebte wie damals in München.
»Haben Sie München nie vermisst?«
»Am Anfang. Aber es war ja mein Vater, der das Bayrische ausgemacht hat. Meine Mutter hat sich dort ohnedies nie wohlgefühlt und so war es naheliegend, nach seinem Tod nach Spanien zurückzukehren. Und wenn ich ehrlich bin, fühle ich mich mehr als Spanierin denn als Deutsche, obwohl ich deutsche Staatsbürgerin bin.«
»Warum nicht beides?«, fragte er überrascht.
»Weil ich mich noch entscheiden musste ... erst seit 2014 dürfen Kinder mit einem ausländischen Elternteil in Deutschland die Staatsangehörigkeit des anderen Elternteils behalten.«
»Und warum haben Sie sich für die Deutsche entschieden?«
»Sie sind aber neugierig, das klingt ja fast wie ein Verhör«, wies sie ihn leicht tadelnd zurück.
»So war das nicht gemeint. Aber Sie interessieren mich!« Und wieder richteten sich erwartungsvolle Augen auf sie. Doch es lag mehr in dem Blick ...
Verwirrt schloss sie für einen Moment ihre Augen, drehte ihr Weinglas in den Händen. »Weil meine Mutter das für besser befand ...« Wie oft hatte sie sich seither überlegt, ob das der richtige Schritt gewesen war. Sie lebte in Spanien, trotzdem war sie Deutsche. Aber irgendwie war es das Vermächtnis ihres Vaters, dem es wichtig war, dass sie Deutsche, Bayerin, war. Auch wenn sie dadurch in Spanien des Öfteren mit Vorurteilen zu kämpfen hatte, trotz ihres spanischen Aussehens und ihrer typischen spanischen Art.
Er betrachtete sie aus halbgeschlossenen Augen. Trank einen Schluck Wein. »Und, fühlen Sie sich auch als Mallorquinerin?«
»Ich bin erst seit gestern Abend hier ...«, und sie strich ihre widerspenstigen Locken zurück. Eine Geste, die er unheimlich anziehend fand.
»Oh, dann hatten Sie heute Ihren ersten Arbeitstag?« Die Überraschung war ihm deutlich anzumerken. Aber auch Freude.
»Eigentlich hätte ich den erst morgen ...«, seufzte sie.
»So traurig und pietätlos das wahrscheinlich klingen mag. Aber da muss ich Sabrina direkt dankbar sein. Sonst hätten wir uns vielleicht nie getroffen.« Er beugte sich bei diesen Worten vor, sein Arm streifte fast ihre Schulter.
Sie wollte ihm scharf ins Wort fallen, denn wie kann man einen Todesfall als glückliche Fügung ansehen? Besann sich aber anders. Sah sie es nicht ebenso? Und schloss erneut für einen Moment verwirrt die Augen über die widersprüchlichen Gefühle in ihrem Bauch.
»Lassen Sie uns auf Ihren Dienstbeginn auf der Insel anstoßen und es als Schicksal betrachten, das uns zusammengeführt hat.« Er blickte ihr tief in die Augen, legte kurz seine Hand auf ihre.
Sie zuckte zurück, dieser sanfte Druck fuhr wie ein Blitz durch ihren Körper, versuchte sich zu sammeln, obwohl sie das Gefühl höchst angenehm empfand. Winzig kleine Lustimpulse hatte diese eine sanfte Berührung bei ihr ausgelöst. Nein, schimpfte sie mit sich. Reiß dich zusammen. Du willst keine Affäre!
»Ich hoffe, wir sehen uns noch sehr oft«, fügte er weich hinzu. Vielleicht öfter, als dir lieb ist, dachte sie nun wieder klarer geworden. Wenn du etwas mit Sabrina Schneiders Tod zu tun hast. Doch diesen Gedanken verwarf sie sofort. Nein, dieser Mann war kein Mörder. Und ihr Tod hatte ihn getroffen, das hatte sie heute Morgen in Sabrinas Apartment deutlich gespürt. In Sabrinas Apartment ...
»Können wir noch einmal in Sabrina Schneiders Apartment gehen?«, fragte sie unvermittelt.
»Was wollen Sie denn da?«, entgegnete er verblüfft.
»Mir ist gerade etwas eingefallen. Das würde ich gerne überprüfen.«
»Wollen Sie mir verraten, worum es sich dreht?«
»Nein«, meinte sie kurz angebunden.
»Gut, dann lassen Sie uns gehen. Auch wenn ich es sehr bedauere, den wunderbaren Abend so abrupt zu unterbrechen«, flüsterte er dicht vor ihrem Gesicht.
Sie fürchtete schon – oder hoffte? – er würde sie küssen, doch er tat es nicht. Aber sie konnte ihn riechen. Er roch gut. Ein sehr männliches, dezentes Rasierwasser. Ihr Herz schlug heftig. »Vor allem wenn ich sehe, mit welchen Argusaugen wir von Frau Fichtelhuber beobachtet werden.« Und er lächelte in Richtung der Fichtelhubers beim Verlassen des Restaurants.
»Sie hat Sie ja gestern Abend schon belauert, oder?« Die kühle Nachtluft brachte sie etwas zur Besinnung.
»Wie kommen Sie darauf?« Er blieb stehen, warf ihr einen raschen Blick über seine Schulter zu.
»Jens Meinfeldt hat so was angedeutet.«
»Und, ist das wichtig?«, fragte er mit einem Achselzucken und ging weiter.
Sie folgte ihm die Stufen hinauf. »Sagen Sie es mir.«
Es dauerte, bis er antwortete. »Für mich spielt es keine Rolle mehr. Ich bedauere den Tod von Frau Schneider außerordentlich und er ist mir heute Morgen extrem nahegegangen. Aber ich habe daraus auch eine Erkenntnis gewonnen.«
»Ja, und welche?«, fragte sie neugierig. Mittlerweile waren sie beim Apartment angekommen.
»Das Siegel?«, schaute er sie fragend an. Und dieser Blick ging ihr durch und durch, jagte einen Schauer über ihren Rücken.
»Brechen Sie es auf.«
Er schnitt es mit seinem Schlüssel durch, sperrte auf und ließ ihr abermals den Vortritt. Der Blick durch die Panoramafenster auf das im Mondlicht glitzernde Meer und das Spüren seiner Nähe raubten ihr fast den Atem. Als er nach dem Lichtschalter tastete, hielt sie ihn zurück, indem sie ihre Hand auf seine legte. Und fühlte sich erneut wie vom Blitz getroffen.
»Nein, lass. Diese Stimmung ...«, und sie schritt durch den Raum auf die Terrasse, versuchte dieses Gefühl, das über ihren Körper kroch, abzuschütteln. Doch es gelang nicht. Trotz der Wärme, die sich in ihr ausbreitete, fröstelte sie und sie legte ihre Arme schützend um sich.
Werner folgte ihr, trat hinter sie, umschloss sie wärmend mit seinen Armen, zog sie eng an sich. Sie lehnte sich mit jedem Zentimeter ihres Körpers an seinen, ihr Herz klopfte bis zum Hals.
»Es ist wunderschön«, flüsterte er in ihr Haar und drückte ihr einen sanften Kuss auf den Haaransatz. »Du bist wunderschön.«
Ihre Knie wurden weich. Und eine Gänsehaut überzog ihren Körper. Aber nicht der Kälte wegen.
Eine Weile wiegte er sie in seinen Armen, während sie den Sternenhimmel betrachteten und einem vorbeiziehenden Kreuzfahrtschiff nachschauten, dessen Lichter in der Ferne tanzten. Und sie ertappte sich beim Summen von This is My Song. Weil die Sterne auch heute Nacht so hell schienen? Als würden sie nur für sie leuchten? Sie konnte nachfühlen, warum Charlie Chaplin einen derart sehnsuchtsvollen Text verfasst hatte.
Da drehte Werner Hoffmann sie zu sich um, hob ihren Kopf mit einem Finger an und senkte langsam seine Lippen auf ihre, ohne sie dabei aus den Augen zu lassen. Ein zarter Kuss zuerst nur. Wie ein Versuch. Wollte er ihre Reaktion testen? Dann ein zweiter. Ihr wurde schwindlig. Sie schloss die Augen, gab sich dem dritten, intensiveren Kuss hin und verdrängte die warnenden Signale in ihrem Kopf. Hörte lieber auf den imaginären Song: Wie konnte die Welt verkehrt sein, wenn es ihn in dieser Welt gab?