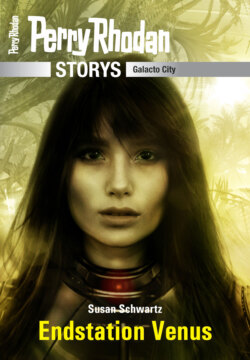Читать книгу PERRY RHODAN-Storys: Endstation Venus - Susan Schwartz - Страница 6
Оглавление1.
Paris, 6. Arrondissement
Universität Paris V
September 1972.
»Mademoiselle Lefebre!« Die Sekretärin rief sie von ihrem Arbeitsplatz auf.
Aufzustehen, herauszukommen und die Besucherin höflich hereinzubitten, galt nicht für Studierende. Selbst wenn sie eigentlich soeben ihren zweiten Abschluss summa cum laude gemacht hatten. Louanne Lefebre wusste das seit Beginn ihres Studiums. Nicht nur diese Sekretärin gab sich so herablassend. Aber sie wollte sich nie daran gewöhnen, und genau deshalb war sie gekommen: um etwas zu ändern.
Wortlos erhob sie sich, strich kurz über ihre mittellangen schwarzen Haare, zog den Rock glatt und schritt selbstbewusster, als sie sich fühlte, in den Vorraum des Dekans.
Die Wände bis zur hohen Decke waren vollgestellt mit prall gefüllten Regalen, in denen Akten vor sich hin staubten, die vermutlich noch aus der Zeit der Sorbonne stammten und seit der Aufsplitterung der Universitäten an diesen Ort transportiert worden waren, um weiterhin ein optisch beachtliches und inhaltlich unbeachtetes Dasein zu fristen.
Die Sekretärin hatte den Hörer in der Hand und war dabei, die Drehscheibe des Telefons zu betätigen. Sie beachtete die junge Frau nicht weiter. Wer keinen Titel besaß, war Luft.
Louanne klopfte an die massive, vertäfelte Eichentür, nicht sicher, ob das überhaupt gehört werden konnte.
Doch ein gedämpftes »Herein!« drang heraus. Entschlossen drückte sie die Klinke, zog die Tür auf und trat hinein.
Das Büro des Dekans war nicht so groß, wie man es von anderen Fakultäten kannte. Doch es hatte Stil. Der Boden war ausgelegt mit jahrhundertealtem Parkett, das gepflegt glänzte, die Wände waren holzgetäfelt, an zwei aneinandergrenzenden Wänden standen halbhohe offene Regale, zwischen denen eine kleine Sitzgruppe arrangiert war. Sonnenlicht fiel durch hohe Sprossenfenster, die karierte Muster auf den Parkettboden zauberten.
Der Dekan saß hinter einem elegant-wuchtigen Louis-seize-Schreibtisch, davor waren zwei Louis-quinze-Stühle arrangiert.
Der Fakultätsleiter kritzelte eifrig mit seinem Montblanc-Füller auf einem Papier und bedeutete Louanne mit einem Wink, sich zu setzen, ohne dabei aufzusehen.
Sie nahm Platz und wartete notgedrungen etwa eine Minute, bis der Dekan den Füller endlich beiseitelegte und ihr seine Aufmerksamkeit widmete.
»Es ist Ihnen also ernst, Mademoiselle Lefebre«, begann er ohne Begrüßung und Einleitung.
»Oui, Monsieur le Doyen«, bestätigte sie. Ihre Aufregung legte sich schlagartig. Nun war es so weit, ihre Zukunft entschied sich. Sie würde daran festhalten, egal welche Argumente er vorbringen mochte. Sie hatte Zeit gehabt, sich vorzubereiten.
Der Dekan zog eine dicke Aktenmappe zu sich und schlug sie auf. »Sie haben fast nur Bestnoten«, stellte er fest. »Gute bis sehr gute Bewertungen.«
»Und einen Eintrag«, wies sie sie hin. »Zu Unrecht.«
Er blickte kurz über seinen Brillenrand auf. »Ich dachte, das wäre beigelegt worden?«
»In der Weise, dass Monsieur le Professeur weiterhin wie bisher unterrichtet und keinen Eintrag bekommen hat, ich aber schon, und überhaupt nur unter der Bedingung weiterstudieren durfte, meine Vorwürfe zurückzuziehen.« Louanne setzte sich aufrecht hin. Ihre gesamte Unsicherheit war völlig verflogen. »Ich weiß, dass ich offiziell zu den fünf Jahrgangsbesten gehöre, aber eigentlich bin ich die Beste, Monsieur le Doyen, denn ich muss mehr als doppelt so hart arbeiten und doppelt so viel Leistung erbringen. Ich bin die einzige Frau dieses Jahrgangs, die überhaupt noch dabei ist. Meine übrigen Kommilitoninnen haben längst aufgegeben, weil sie den Druck und die Ungleichbehandlung nicht mehr ausgehalten haben.«
»Und deswegen wollen Sie nun ebenfalls kneifen und Ihre Doktorarbeit woanders schreiben?«
»Ich kneife nicht! Ich finde, ich habe mit summa cum laude Besseres verdient. Beispielsweise bei den Aufstiegschancen. Mein jahrelanger extremer Einsatz muss sich irgendwann auszahlen.«
»Und Ihr Ehrgeiz verlangt sein Übriges.« Der Dekan lehnte sich zurück. Er war Mitte sechzig, und während es ihm an Haarfülle auf dem Kopf fehlte, trug er um die Hüften zu viel Körpermasse mit sich. Aber er war einer der wenigen, die Louanne immer fair behandelt hatten – bis auf die Sache mit ihrer Anzeige gegen ihren Professor, aber das war Politik, und sie trug es ihm nicht nach. Immerhin war sie durch ihn zum Studium aufgenommen worden, was keineswegs selbstverständlich gewesen war. Schon gar nicht im verstaubten Frankreich, das Frauen das Tragen von Hosen per Gesetz verbot. Dass sich keine Frau darum scherte und kein Mann deswegen Anzeige erstattete, bedeutete nicht, dass die Verhältnisse modern wären.
»Mademoiselle Lefebre, tatsächlich hätte ich in Ihnen das Potenzial gesehen, die erste Professur als Frau an dieser Universität zu erhalten«, sagte der Dekan ruhig.
Das verschlug ihr für einen Moment die Sprache und nahm ihr den Wind aus den Segeln. Damit hätte sie am wenigsten gerechnet. »T-tatsächlich?«, stotterte sie.
»Es ist mein Ernst. Wenn Sie so weitergemacht hätten, hätten Sie die besten Aussichten gehabt ...«
»... in fünfzehn? Zwanzig? Dreißig Jahren? Falls überhaupt, denn bis es so weit gewesen wäre, wären Sie als Befürworter längst pensioniert, bei allem Respekt. So lange möchte ich nicht warten und im Ungewissen bleiben. Und vor allem ... nicht an einem einzigen Ort mein gesamtes wissenschaftliches Leben verbringen. Als Lehrerin sehe ich mich nicht.«
»Sie möchten also hinaus ins Feld.«
»Ja! Ich werde nach meinem Fachabschluss in Zoologie im Fachgebiet Verhaltensforschung meine Doktorarbeit machen.« Tatsächlich war der zweite Abschluss einfacher gewesen als der erste in Biologie. Das hatte die größte Hürde dargestellt – nicht vom Lernen her, sondern vom Umfeld. Allein wenn sie an die Kämpfe um ein Praktikum für die praktischen Scheine dachte, an die Dutzende Absagen, weil sie eine Frau war ... sie konnte verstehen, dass ihre Mitstudentinnen aufgegeben hatten, aber das war nicht ihr Weg, und das hatte sie damals deutlich gemacht. Die Kommilitoninnen hatten Louanne vorgeworfen, nicht zu wissen, wann Schluss sei – und damit völlig recht. Wenn Louanne sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hatte, zog sie es durch, auf Gedeih und Verderb.
»Damit wären Sie bei Konrad Lorenz am Max-Planck-Institut am besten aufgehoben«, meinte der Fakultätsleiter. »Sie brauchen dazu nur nach Deutschland ...«
»Das ist eine Möglichkeit«, unterbrach ihn Louanne lächelnd. »Ich hatte mich sogar schon bei ihm beworben. Aber dann ... kam mir eine andere Idee. Ich muss ohnehin Felderfahrung sammeln. Also warum nicht gleich die größte aller Chancen ergreifen?«
Der Dekan musterte sie aus klugen blauen Augen. »In der neuen Welt, die gerade in der Gobi aufgebaut wird. Von einem amerikanischen desertierten Major, der als Erster den Mond betreten hat und dort havarierte Außerirdische vorfand. Mit einem weiblichen Raumschiffskommandanten.« Er zwinkerte. »Einer Kommandantin.«
»Wo es außerirdische Intelligenzen wie die Arkoniden gibt, gibt es auch außerirdische Tiere. Und das ist meine Berufung: Zoologin zu sein und das Verhalten der Tiere zu erforschen, diese Vielfalt des Lebens zu ergründen.« Wie immer, wenn sie auf dieses Thema zu sprechen kam, leuchteten Louannes Augen geradezu auf vor Begeisterung. Seit der weltbewegenden Nachricht, dass auf dem Mond ein Erstkontakt stattgefunden hatte, war der Gedanke in ihr gereift, an dieser Zukunft teilzuhaben.
Es war die größte Sensation aller Zeiten gewesen, die die Gemüter nach wie vor bewegte und erhitzte. Louanne hatte gebannt vor dem Fernseher gesessen, als die ersten Bilder von diesen faszinierend fremd und doch so menschlich aussehenden Gestalten namens Crest und Thora übertragen worden waren. Als sie deren erste Worte gehört hatte. An diesem Tag hatte sich ihr Schicksal entschieden: Sie wusste nun, dass ihr Heimatland und selbst die ganze Welt zu klein für sie geworden war.
Inzwischen waren noch mehr außerirdische Völker bekannt geworden: die Individualverformer und die Fantan-Leute ... wobei diese in der Öffentlichkeit kaum bekannt waren, es gab mehr Gerüchte als Wissen. Was wohl stimmte, war, dass der Anführer der Dritten Macht beide Male Invasionen zu verhindern gewusst hatte. Aber darüber wollte Louanne sich nicht den Kopf zerbrechen – beide Krisen waren gut ausgegangen, und mehr brauchte sie nicht zu wissen. Sie wollte keine Völker studieren, sondern Tiere.
Der Dekan schüttelte verständnislos den Kopf. »Unsere Welt wird möglicherweise von einem Krieg dieser Dritten Macht, die ein Deserteur gegründet hat, gegen die Großmächte, allen voran China, überzogen ... und Sie denken daran, außerirdische Tiere zu erforschen?«
»Was macht das für einen Unterschied, ob es irdische oder extraterrestrische Tiere sind?«, konterte Louanne. »Ich weiß, viele hier in unserem beschaulichen Frankreich halten diesen Perry Rhodan für größenwahnsinnig und nicht wenige sehen in ihm sogar den künftigen Weltdiktator. Aber ... haben Sie sich die Bilder von seiner Stadt mal angesehen? Dort findet die Zukunft bereits statt – und zwar friedlich!«
»Galacto City«, spottete der Dekan. »Allein der Name ... Größenwahnsinn. Erinnern Sie sich nicht mehr an den Diktator in unserer Nachbarschaft, der vom tausendjährigen Reich schwadronierte? Nein, natürlich nicht. Sie sind zu jung ... aber wer garantiert uns, dass in der Gobi nicht bald wieder Hakenkreuzbanner wehen?«
»Sie werden doch nicht allen Ernstes einen solchen Vergleich anstellen wollen! Dieser Rhodan mag Fehler machen, aber er ist kein Diktator, er sucht keine Eroberungen, keinen Krieg! Er mordet nicht wie ...«
Der Dekan lehnte sich nach vorne. »Für jemanden, der mit Politik wenig zu tun hat, haben Sie eine fundierte Meinung. – Nein, ich erkenne im Gebaren des Deserteurs keine Ähnlichkeit zum ehemaligen Wehrmachtsgefreiten. Aber viele andere tun das. Es wird gefährlich sein, kurz- und vielleicht sogar langfristig. Wenn Sie sich entscheiden, nach Galacto City zu gehen, werden Ihnen Ihre Heimat und eine angemessene Karriere womöglich verschlossen bleiben. Ich will Sie warnen, Mademoiselle.«
Louanne schluckte. Sie wusste nicht recht, was sie sagen sollte. Der Dekan schien wirklich viel von ihr zu halten und sich Sorgen zu machen. Er klang eher väterlich-fürsorglich, gar nicht wie der Mann, der an der Universität die Fäden zog. Obwohl er das zweifellos war. Aber sie brauchte keinen Vater, keinen Ratgeber, keinen Beschützer, aber sie wollte ihn auch nicht vor den Kopf stoßen.
»Dort telefoniert man nicht mehr mit Wählscheibe, sondern drahtlos, und man kann seinen Gesprächspartner sogar sehen«, plapperte sie drauflos. »Und allein wenn ich an unser Fernsehen denke ... die haben etwas, das sie Trivid nennen, mit starker Sendeleistung und Bildern, als wäre man mitten darin! Ich gehe davon aus, dass selbst Europa sich diesem Fortschritt, den wir den Außerirdischen zu verdanken haben, nicht mehr lange verschließen wird. Die Vereinigten Staaten fangen schon damit an, und bald werden die Leute auch hier die ganzen technischen Annehmlichkeiten haben wollen, vor allem, was Telefon und Fernsehen betrifft. Das kann niemand mehr aufhalten.«
Er lächelte traurig, als schien er zu akzeptieren, den Kampf verloren zu haben. »Und Sie wollen von Anfang an dabei sein. Können es gar nicht erwarten. Das war der Grund, dass Sie sich für die Fachprüfung ganz besonders ins Zeug gelegt haben?«
»Ohne Bestnote keine steile Karriere, das wissen Sie. Und jetzt ist mir sogar noch das Schicksal zu Hilfe geeilt. Es gibt eine Ausschreibung.« Louanne konnte kaum mehr stillsitzen vor Aufregung. Sie hatte seit jener Fernsehsendung im vergangenen Jahr alles inhaliert, was mit der wachsenden Dritten Macht in der Wüste Gobi zusammenhing. »Man will eine Forschungsexpedition auf die Venus zusammenstellen!«
»Venus? Nun machen Sie aber einen Punkt!« Die Gesichtszüge des Dekans entgleisten. Zuerst Galacto City, dann die Venus! Das überforderte ihn sichtlich. Er zog das Taschentuch aus der Brusttasche seines Jacketts und tupfte sich die Stirn. »Mademoiselle ...!«
Aber Louanne war nicht mehr zu bremsen. »Perry Rhodan ist im Mai erfolgreich dort gelandet. Auf einem Kontinent gibt es eine sehr alte Festung der Arkoniden. Wir Menschen haben dadurch einen Stützpunkt ... auf der Venus! Ist das nicht überwältigend?
Vor Rhodans Rückkehr vom Mond haben wir alle beschaulich gelebt und romantisch von den Sternen geträumt ... und jetzt, gerade mal vierzehn Monate später, sind wir mitten in der Zukunft mit der Weltraumfahrt und einem Stützpunkt auf unserer Schwesterwelt! Die Venus hat uns doch schon immer beschäftigt, fragen Sie nur Ihre Kollegen aus der Astrophysik! Viele Spekulationen und Rätsel, wie es dort sein mag, seit der Antike.
Jetzt können wir hin! Dort gibt es unendlich viel zu erforschen. Vor allem die Flora und Fauna der Venus ist ... teils der unseren ähnlich, und dann wieder nicht, nach all dem Spärlichen, was bisher bekannt ist! So wie einst David Livingstone, Roald Amundsen, Robert Peary und wie sie alle heißen, werden wir unbekanntes Land erforschen!«
»Aber nicht als Erste aus der zivilisierten Welt betreten, wie den Nord- oder den Südpol oder gar den Mond«, spottete der Dekan.
»Das nicht, wir haben in dem Fall Glück und können bereits vorhandene Ressourcen der Arkoniden nutzen. Aber unsere Erkenntnisse werden wegweisend sein und nicht nur die Zoologie, sondern die gesamte Biologie und Medizinwissenschaft revolutionieren. Und dazu werde ich meinen bescheidenen Beitrag leisten – zunächst im Rahmen meiner Doktorarbeit, aber sicherlich später mit erheblich mehr. Ich weiß, dass ich das schaffe!«
Der Dekan ließ die Hand mit dem Taschentuch sinken uns hielt ihren Blick aus. »Sie meinen es wirklich ernst«, stieß er hervor. »Ich dachte eigentlich, Sie wollten mich auf raffinierte Weise zu einer Festanstellung als Dozentin erpressen. Allein das wäre schon eine Revolution gewesen ...«
Louanne lachte. »Sie sollten mich besser kennen. Wenn ich mich mal in etwas verbissen habe ...«
»Nun gut. Das ist also Ihr ehrgeiziges Vorhaben. Ich bewundere Ihre Gewissheit, auch Erfolg zu haben. Aber wurden Sie denn nach der Ausschreibung bei der Auswahl überhaupt berücksichtigt?«
»Das ist genau der Punkt, weswegen ich hier bin.« Louanne schluckte. Sie war wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. »Ich habe meine Ergebnisse noch nicht schriftlich und keine Urkunde, bisher ist nur offiziell verlautbart, dass und wie ich bestanden habe. Und ... und die Frist läuft ... diese Woche ab. Deshalb wollte ich Sie bitten, ob ich schon vorab ... etwas bekommen könnte, um es vorzuweisen ... wenigstens halb offiziell und ... und ...« Sie geriet ins Stottern, aber sie durfte nicht innehalten. Einen späteren Zeitpunkt gab es nicht. »... eine Empfehlung«, fügte sie leise hinzu.
Daraufhin herrschte Schweigen.
Louanne und der Dekan wussten beide genau, dass Louannes ehrgeizige Zukunft nun von ihm abhing. Sollte er sich weigern, konnte sie die Voraussetzungen für die Ausschreibung nicht erfüllen und ihren Traum begraben. Wahrscheinlich für immer. Was bliebe dann als Plan B? Zu Konrad Lorenz zu gehen, der bereits Interesse signalisiert hatte? Oder in die Vereinigten Staaten? Wobei sie auch da als Frau vermutlich kaum eine Anstellung bekäme, die ihrem Abschluss entsprach, und ganz unten anfangen müsste, als Spülerin von Erlenmeyerkolben.
»Sie wissen nicht, ob Sie ausgewählt werden, selbst wenn Sie alle Voraussetzungen erfüllen«, meinte der Dekan nach einer Weile. »Wenn Sie abgelehnt werden – was dann?«
Dieselbe Überlegung wie zuvor.
»Dann werde ich entweder zu Konrad Lorenz gehen, er ist eine großartige Alternative ... oder trotzdem nach Galacto City.« Sprachhürden gab es keine, sie war dreisprachig – Französisch, Englisch, Deutsch – in einem kostspieligen Schweizer Internat aufgewachsen. Dafür dankte sie ihren Eltern im Stillen, dass sie ihr zumindest hinsichtlich ihrer Schulausbildung alles ermöglicht hatten. Obwohl sie es wahrscheinlich seit Louannes Studienbeginn bereuten.
»Wissen Sie«, fügte sie hinzu, »in Galacto City findet sich nicht nur die moderne Stadt der Zukunft. Dort ... dort kann jeder Mann und jede Frau einfach alles werden und alles machen. Es gibt so viele neue Berufe, neue Möglichkeiten, eine große Universität ist im Aufbau, es gibt einen ganzen Stadtbezirk nur für die Wissenschaft ... da werden Leute gebraucht, die bereit sind, etwas zu riskieren.«
Sie zuckte die Achseln. »Ich bin alleinstehend, weil ich mich in den vergangenen Jahren nur auf mein Studium konzentriert habe. Ich habe nicht mal mehr Freunde, weil ich nie Zeit für sie hatte. Meine Eltern haben mir nie verziehen, dass ich nicht zum Vorteil von zwei Firmen den Sohn der Konkurrenz geheiratet habe und mich auf mein Dasein als Ausstellungsstück besinnen wollte. Die Wohnung ist zur Miete. Ich lasse also nichts zurück, nicht einmal einen Hamster.«
»Sie wollen die Universität also in jedem Fall verlassen?«
»Ja.«
»Und ich könnte Sie mit nichts locken?«
Louanne sah dem Dekan offen in die Augen. »Nein«, sagte sie weich, dennoch unnachgiebig.
Der Dekan seufzte. »Mademoiselle, mit ihrer Sturheit, oder sagen wir es höflicher, eisernen Entschlossenheit und Ihrem enormen Ehrgeiz, hätten Sie es bis zur Dekanin gebracht, dessen bin ich sicher. Der Universität und ihren überholten Regeln hätte das gutgetan. Auch hier gibt es eine Zukunft zu gestalten.«
Louanne richtete den Blick auf ihre Hände, deren Finger sich ineinander verknoteten, bevor sie wieder aufsah. »Aber ich will mehr als das. Major Rhodan ...«
»Ex-Major!«
»... hat etwas getan, was kaum jemand wagen würde.«
»Er hat Verrat begangen!«
»Nein. Er hat das Richtige getan. Er hat die Chance erkannt und sie genutzt. Er hat sich gegen die ganze Welt gestellt, um etwas Gutes zu erschaffen.«
»Und Sie? Wollen Sie eine Karriere oder auch dieses Gute, für das viele Ihrer Mitmenschen Sie verurteilen werden, weil sie es nicht verstehen?«
»Ich kann in meinem bescheidenen Rahmen Gutes bewirken.«
Sehr zu ihrer Überraschung lächelte der Dekan daraufhin. »Mademoiselle Lefebre, als ich Dekan wurde, habe ich mich dazu verpflichtet, das Bestmögliche für meine Studenten und Doktoranden zu tun. Sie zu fördern, ihnen zur Seite zu stehen, sie zu unterstützen. Manchmal hat mich das in echte Schwierigkeiten gebracht, weil es letztendlich stets um Politik, Macht und Geld geht.
Ich denke aber, man wird froh sein, Sie loszuwerden, und meiner Entscheidung keine Steine in den Weg legen. Für mich ist es ein sehr großer Verlust. Aber ich verstehe Ihren Wunsch und denke, dass Sie das Richtige tun. Ein bisschen beneide ich Sie sogar. Wäre ich in Ihrem Alter, würde ich das Gleiche erwägen. Aber auch an der Sorbonne wird Ihr Ex-Major Unterstützung brauchen, eine Stimme, die seine Verdienste würdigt. Deswegen bleibe ich – und werde Ihnen alle Unterlagen zukommen lassen, die Sie benötigen, einschließlich meiner Empfehlung. Kommen Sie morgen früh um acht Uhr sine tempore und holen Sie das Paket ab.«
Louanne saß für einen Moment wie erstarrt, blinzelte, ihre Hand zuckte zum Ohr, ob sie richtig gehört hatte.
Der Dekan wandte sich wieder seinen Schriftstücken zu und griff nach dem Füller. Ohne aufzusehen, sagte er: »Das wäre dann alles, Mademoiselle Lefebre. Bonjour.«
»Bonjour, Monsieur le Doyen«, stieß sie mit piepsiger Kleinmädchenstimme hervor, stand auf und wankte wie in Trance hinaus.