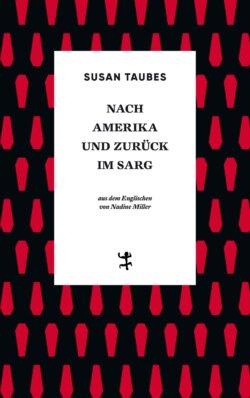Читать книгу Nach Amerika und zurück im Sarg - Susan Taubes - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorwort
ОглавлениеAls Susan Taubes’ faszinierender Roman 1995, vor 26 Jahren, erstmals in deutscher Übersetzung in diesem Verlag veröffentlicht wurde, war die Autorin gänzlich unbekannt. Um sie dem deutschsprachigen Publikum nahezubringen, wurde sie damals als erste Frau des jüdischen Religionswissenschaftlers Jacob Taubes vorgestellt. Weitere 26 Jahre zuvor war der Roman in New York unter dem Titel Divorcing herausgekommen. Der Verlag hatte sich für diesen Titel entschieden, entgegen dem von der Autorin favorisierten, der nun für diese Neuausgabe gewählt wurde. Divorcing erschien eine Woche vor dem Freitod der Autorin und zwei Jahre nach Abschluss ihres eigenen Scheidungsverfahrens. Insofern war es naheliegend, den Roman als autobiografisches Zeugnis zu lesen. Dem widerspricht jedoch die in jeder Hinsicht radikale Schreibweise, die alle genreüblichen Konventionen durchbricht und ein intelligentes Spiel mit etablierten Erzählmustern und mit den Rollenreden traditioneller sozialer Rituale treibt. Denn Taubes’ Roman ist aus der Perspektive einer Toten gestaltet, der Erzählerin Sophie Blind: »Es ist eine Tote, die erzählt.« Mit diesem Satz erläutert Sophie im zweiten Kapitel ihrem früheren Geliebten Ivan das Buchprojekt, an dem sie gerade arbeitet, und kommentiert dessen Konzeption mit den Worten: »Jetzt, da ich tot bin, kann ich endlich meine Autobiografie schreiben.« Da der Roman mit dem Erwachen von Sophie Blind nach ihrem tödlichen Unfall einsetzt, sind wir als Leser mit den Erfahrungen, Träumen und Schrecknissen einer Untoten konfrontiert. »Der Schmerz des Erwachens ist unverwechselbar.«
Bei Roland Barthes heißt es zur »Schreibweise des Romans«: »Der Roman ist ein Tod; er macht aus dem Leben ein Schicksal, aus der Erinnerung einen nützlichen Akt und aus der Dauer eine gelenkte bedeutungsvolle Zeit.« Dementsprechend wäre Susan Taubes’ Buch ein Anti-Roman, der die Struktur des autobiografischen Romans verkehrt: nicht Erinnerung der Lebensgeschichte als Vermächtnis der Erzählerin, sondern deren Tod als Voraussetzung des Romans. Eine ähnliche »Lösung« entwirft Ingeborg Bachmanns am Ende ihres zwei Jahre später erschienenen Romans Malina als Konzeption für das Erzählen der »Todesarten«, wenn das Ich am Ende verschwindet und Malina das Erzählen überlässt. Wie Bachmanns namenlose Ich-Figur ist auch Sophie Blind Schriftstellerin, philosophisch geschult und mit Fragen der Psychoanalyse vertraut. In beiden Romanen ist deren Leben eine permanente Zerreißprobe zwischen intellektueller und sexueller Existenz, scheitert die Erfüllung von Liebesbeziehungen am Willen zur Selbstbestimmung und umgekehrt: »[U]nd um sie herum lauter Erinnerungen an verlorene Freuden«, wie es in Taubes’ Roman heißt.
Aus der subtilen Poetologie einer verkehrten Autobiografie folgt allerdings nicht der Verzicht auf die Bearbeitung individueller Erinnerungen. Doch entsprechen diese nicht der beliebten Logik einer Ableitung der Lebensgeschichte aus Herkunft und Kindheit. Vielmehr werden in Divorcing erst im letzten der drei großen Kapitel, denen nur noch ein kurzer Ausblick mit Momentaufnahmen aus dem Leben einer sogenannten freien Frau in New York folgt, Erinnerungen an eine Kindheit im Budapest der Dreißigerjahre erzählt, – nachdem man bereits vom Unfalltod der Sophie Blind erfahren hat, an ihrer Beerdigung und an einem Gespräch des hinterbliebenen Ehemanns Ezra, eines Gelehrten und Rabbiners, mit seinem Schüler an ihrem Totenbett teilgenommen hat, nachdem man zahllose Auftritte aus ihrer Ehe und verzweifelten Trennungsversuchen gelesen hat und nachdem einem eine Fülle fantastischer Szenarien vor Augen geführt worden ist, die einem surrealen Theaterstück entstammen könnten.
Buch, Leben und Traum – das sind die drei konkurrierenden Existenzräume der Sophie Blind. Wenn sie dem Buch darin den Vorteil gibt, weil man im Buch stets wisse, wo man ist, dann gilt das für die Leser ihrer Geschichte gerade nicht. Denn die Darstellung wechselt zwischen Traumszenen, Erinnerungsbildern, fantastischen und satirischen Szenarien und sehr realistischen Erzählungen aus dem Alltag einer Intellektuellen mit drei Kindern. Vor allem mit den Schauplätzen ereignen sich ebenso fantastische wie bedeutungsvolle Entstellungen, beispielsweise die Verwandlung des Schauplatzes einer Hochzeit in den einer Beerdigung, eines wissenschaftlichen Kongresses in ein Verhör und eine Gerichtsverhandlung. In diesen Szenen werden nicht nur die Handlungs- und Sprachregister verschiedener gesellschaftlicher Rituale überblendet, sondern auch Sophies Aufenthaltsorte (vor allem Paris, Manhattan, Budapest, Jerusalem) ebenso wie verschiedene Personen aus ihrer Lebensgeschichte. So wie im Traum – womit sich eine weitere Nähe zu Bachmanns Roman Malina auftut, auch wenn dort dem Schauplatz und der Sprache des Traums ein gesondertes Kapitel vorbehalten ist: mit Alpträumen, in denen die Ich-Erzählerin die ihr vorgeschriebenen Rollen spielen muss.
Bei Taubes halten die meisten Szenen die Schwebe zwischen Traum und Erinnerungsbildern: »Ezra stand immer auf der Bühne: manchmal trat Sophie mit ihm auf und sagte ihren Text auf, manchmal war sie wie ein Gassenjunge, der durch die Bühnenbretter späht, um den Auftritt des großen Komödianten zu erhaschen.« Die Selbstwahrnehmung in dieser Beobachtung scheint der Autorin ihr Skript vorgegeben zu haben: die Darstellung eines Lebens als Abfolge von teils tragischen, teils komischen Szenen, deren Drehbuch dem eigenen Auftritt als Akteurin vorausgeht. Wie Bachmanns Ich reflektiert Sophie Blind die emotionale Ökonomie, mit der die Frau in diese Rollen hineingerät und aus der die eigene Verletzlichkeit entsteht: »[U]nd immer war da eine Frau, die wartete […] eine Frau, die wartete, dass er wortlos im Dunkeln zu ihr käme; eine Frau, die etwas von diesem Mann wollte, das nur er ihr geben konnte und das er nur ihr allein geben konnte.«
Wie sehr es in Susan Taubes’ Roman um die Bearbeitung der eigenen Erfahrungen, Sehnsüchte und Verluste geht, hat die jüngst publizierte Susan-Taubes-Biografie von Christina Pareigis zeigen können. Wer sich für die »verlorenen Freuden« und Verluste der Autorin interessiert, braucht nur den Briefwechsel zwischen ihr und Jacob Taubes aus den Anfängen ihrer Liebe in den Jahren 1950–1952 zur Hand zu nehmen: das außergewöhnliche, in seiner Mehrsprachigkeit besonders lebendige Zeugnis einer leidenschaftlichen intellektuellen und erotischen Beziehung, ein Austausch, in dem Liebe und Philosophie, das Ringen um ein jüdisches Leben nach dem Zivilisationsbruch und mit den Rissen in der Überlieferung unentwirrbar miteinander verflochten sind. Und dennoch ist ihr Roman kein Schlüsselroman, der Rückschlüsse auf Details und konkrete Ereignisse ihres Lebens und ihrer Ehe erlaubte, auch wenn Susan Taubes sich weniger in der Technik des Spurenlöschens übt als Bachmann, die bereits auf einschlägige Erfahrungen im und mit dem Literaturbetrieb zurückblickte.
Denn ein Kurzschluss zwischen Roman und Leben, zwischen Autobiografie und Herkunftsdiskurs ist für jüdische Autoren so prekär wie für Schriftstellerinnen, insofern er einer nahezu unausweichlichen Fixierung auf Identität in die Hände spielt. In den Jahren, in denen Divorcing und Malina erschienen, mussten Schriftstellerinnen noch damit rechnen, dass sich der Literaturbetrieb ihre Werke vom Halse hielt, indem sie als »lady novelists« abgekanzelt wurden. So die damalige vernichtende Kritik von Divorcing durch den bekannten Kritiker Hugh Kenner in der New York Times Book Review. Die Tatsache, dass New York Review Books kürzlich in ihrer Reihe »Classics« eine Neuauflage des Romans publiziert haben, zeigt dass diese Art Ressentiments heute glücklicherweise nicht mehr tonangebend sind. Dass darüber aber über ein halbes Jahrhundert vergangen ist, zeugt zugleich davon, welche Widerstände gerade literarisch anspruchsvolle Texte von Schriftstellerinnen, die keine einfachen Opfergeschichten oder Heldenmythen präsentieren, zu überwinden hatten.
Es ist kein Zufall, dass der einzige Teil des Romans, den Hugh Kenner positiv hervorhebt, das dritte Kapitel ist, das von der Kindheit in Budapest erzählt: bis zur Trennung der Eltern und zur Emigration gemeinsam mit dem Vater in die USA, dem »Tag, an dem alles anders wurde«. Taubes durchbricht hier das Muster von Kindheitserinnerungen, indem das Sentiment eines Blicks zurück konterkariert: im Gegeneinander zwischen einem sentimentalen Begehren, das durch die Stimme des Vaters vertreten wird – »Papi redete gern von den Dingen, die Sophie tat, als sie noch in einem Apartmentgebäude in Pest, auf der anderen Flussseite, wohnten« – und dem schwierigen Vorhaben, Perspektive und Sprache des Kindes zu vergegenwärtigen: »Es war für Sophie Blind ein seltsames Unterfangen, darüber zu schreiben, wie es als Kind in Budapest war. Die Person, die es hätte schreiben sollen, war nicht da, nicht so, wie sie jetzt da war. Sie schrieb auf Englisch in einem Apartment in New York. Das Kind befand sich in einem anderen Land, in einer anderen Sprache.«
Die historische und personelle Distanz der Schreibenden zum Gegenstand der Erzählung wird hier durch die Differenz der Orte und Sprachen verschärft. Aus einer mehrfachen Differenz heraus – damals-heute, Budapest-New York, ungarisch-englisch – wird der »Doppelverlust einer Welt und einer Person, die dieser Welt angehörte«, beschrieben. »Der Tag, an dem alles anders wurde«, gibt dem zuvor fraglosen Bewusstsein, Jüdin zu sein, eine neue, feindliche Bedeutung: »Und all dies sollte für sie die Bedeutung verlieren, weil sie Jüdin war!« Es geht um die Enteignung einer ohnehin fragilen Zugehörigkeit, die das Kind von seiner heimischen Fremdheit in der Welt des osteuropäischen säkularisierten Judentums abtrennt: »Religion war peinlich, aber man war stolz darauf, jüdisch zu sein. Warum? Der Vorzug, ein Jude zu sein, war für alle so offensichtlich, dass Sophies Frage in der Familie völlig sprachlose und missbilligende Blicke auslöste. Juden waren anders als andere Leute, konnte sie das denn nicht sehen?«
Mit dem Tag, an dem alles anders wurde, hat dieses Anderssein seine Unschuld verloren. Während es zuvor Zugehörigkeit zur anderen Kultur inmitten der Mehrheitskultur bedeutete, führt es nun zur Aberkennung von Zugehörigkeit überhaupt. Aus dieser Position heraus, von jenseits des Bruchs, hat jeder Rekurs auf ein Genre, das sich im Muster von Herkunft und Entwicklung bewegt, seinen Geltungsanspruch eingebüßt. Das Genre kann allenfalls noch zitiert oder in seiner Zwangslogik vorgeführt und entstellt werden. Beispielsweise in jener Szene, deren Sprache zwischen den Schauplätzen von Konferenz, Tag des Gerichts, Einwanderungsbehörde und Morgue wechselt:
»Sie wollen, dass ich Zeugnis ablege. Hier ist alles hervorragend organisiert. Mein Kopf liegt weit weg auf dem Tisch des Präsidenten. Liest die Zeitung. Ein Fehler, wenn man glaubt, Gott sei altmodisch. […]
Aus meinem Mund kräuseln sich kilometerlange Lochstreifen. Der ganze Boden ist davon bedeckt. […] Es ist unwichtig; trotzdem könnten Sie doch die Gefälligkeit haben, mich zu übersetzen […]
Sie haben doch all meine Papiere, Pass, carte de séjour, Versicherungspolice, Einbürgerungsurkunde, Geburtsurkunde, Volksschulzeugnisse und medizinische Untersuchungsergebnisse, Röntgenbilder des Brustkastens, Sie haben meinen Körper – können dessen Zustand besser beurteilen, als ich es kann –, fast hätte ich meine Veröffentlichungen vergessen, die Seminararbeiten, Dissertation usw., in der Kartei. Lassen Sie Ihren Sekretär nach dem Koffer suchen, in dem sich all meine Aufzeichnungen befinden und der – bei wem? – hinterlegt ist … Sie können von mir nicht erwarten, dass ich mich an alles erinnere. Ich muss wiederholen, ich habe nichts Persönliches anzugeben, alles über mich ist öffentlich, es liegt Ihnen vor. […]
[W]as die eigentlichen Erinnerungen betrifft, die Sie angefordert haben, die Originalprägung kann nicht entfernt werden. Alles, was ich Ihnen hier sage, die Worte, meine Herren, die Sprache selbst ist ein Geschenk von Ihnen; ich danke Ihnen dafür, zutiefst verpflichtet, Ihre ergebene Tochter usw.«
Hier spielt die Autorin nicht nur auf die vorgeprägte Sprache der autobiografischen Rede und deren Verbindung zum religiösen Geständnis und polizeilichen Fahndungsdiskurs an. Sie thematisiert auch in ungewöhnlicher Weise das Verhältnis von öffentlicher und verborgener Person, von offener und versteckter Schrift. Während Bachmann in ihrem Roman Malina die Ich-Erzählerin, eine Schriftstellerin, vor ihrem Verschwinden ein Versteck für ihre Liebesbriefe suchen lässt, um diese in ihren Hinterlassenschaften vor dem Blick des Erzählers zu verbergen, scheint sich das Verhältnis von versteckten und öffentlichen Schriften für Susan Taubes’ Hauptfigur anders darzustellen. Denn es sind offensichtlich gerade ihre Veröffentlichungen, die vergessen wurden, während ihr Persönliches bereits der Öffentlichkeit preisgegeben war. »Ich habe nichts Persönliches anzugeben, alles über mich ist öffentlich.«
Dieser Satz verweist auf den Autornamen Taubes und die Konnotationen, mit denen er besetzt ist – noch vor jedem Roman. Durch ihre Ehe mit dem berühmten und streitbaren Religionsphilosophen Jacob Taubes war ihr Name nicht neutral und ihr Privatleben nicht unbekannt. Die Theatralität in der Schreibweise von Susan Taubes’ Roman gilt – neben der Reflexion vorgeschriebener Rituale, Rollen und Szenen – auch der Darstellung eines Lebens, das partiell auf der Bühne stattfand.
Susan Feldmann, die 1928 geborene Enkelin des Oberrabiners von Budapest, die 1939 zusammen mit ihrem Vater, einem Psychoanalytiker, in die USA emigriert war, hat während ihres Philosophiestudiums den fünf Jahre älteren, in Wien geborenen und 1936 nach Zürich übersiedelten, promovierten Philosophen und Rabbiner Jacob Taubes kennengelernt und ihn 1949, als sie einundzwanzig war, geheiratet. 1961, zwölf Jahre später, als ihre beiden Kinder acht und vier Jahre alt waren, hat sie sich von ihm getrennt. Bevor sie sich dem literarischen Schreiben zuwandte, war die Philosophin als Lehrende aktiv. Susan Taubes lehrte nach Abschluss ihrer Dissertation über Simone Weil von 1957 bis 1964 Religionsphilosophie an der Columbia University in New York und veröffentlichte in dieser Zeit zahlreiche Beiträge über negative Theologie, Gnosis, Philosophen wie Heidegger und Nietzsche, die griechische Tragödie und zeitgenössisches Theater. Von ihren literarischen Texten wurde zu Lebzeiten nur weniges veröffentlicht, während ihre umfangreichen Hinterlassenschaften zahlreiche Erzählungen, Gedichte und Fragmente enthalten, u. a. das Fragment eines zweiten Romans, der inzwischen in deutscher Übersetzung in dem Band Prosa vorliegt.
Sigrid Weigel