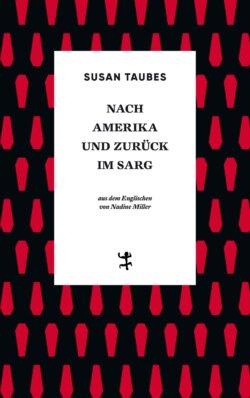Читать книгу Nach Amerika und zurück im Sarg - Susan Taubes - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
ОглавлениеMit größter Anstrengung öffnet sie die Augen, aber es ist in einem anderen Zimmer; dann eilt sie durch eine belebte Straße, an feinen Geschäften vorbei, die Auslagen an der Place Vendôme erregen ihre Aufmerksamkeit, Uhren so flach wie Münzen; aber sie weiß, es kann nicht stimmen, sie weiß, sie muss in einem Zimmer im Bett liegen, wenn sie die Augen aufschlägt. Immer wieder schließt und öffnet sie ihre Augen, jetzt liegt sie im Bett; sie erkennt das Zimmer; das Licht im oberen Stockwerk eines Hauses am Hudson River. Aber sie kann die Augen nicht lang genug offenhalten; mit jedem Augenaufschlag verändert sich das Zimmer, mal ist das Fenster auf einer anderen Seite, mal verstellt eine dunkle Masse den Blick. Jetzt erkennt sie die Gestalt eines Mannes, erinnert sich an den Schmerz, der sie zerriss, den ihr Körper nicht erwartet hatte – ist er ihr Liebhaber? –, im Mantel steht er an ihrem Bett, sie fragt sich, ob sie wie eine Wilde gebrüllt hat, ob er das wüste Rasen und Lästern gehört hat, das über ihrem hervorsprudelnden Blut ausbrach. Und wenn, er tut, als habe er nichts gehört, aus Gleichgültigkeit oder Güte, weil er das, was er sah oder hörte, lieber nicht wahrhaben will. Schön und würdevoll will er sie in Erinnerung behalten.
Sie beginnt zu sprechen, sie ist jetzt weit weg, ihre eigene Stimme wie von ferne, überraschend schnell und flüssig. Sie lacht. Noch nie hat sie so gelacht. Die Form des Mannes ist verschwommen, eine dunkle leblose Masse, die ein wenig pendelt; jetzt erblickt sie das Weiß seiner nackten Sohlen – er hat sich erhängt!
Sophie Blind glaubt es natürlich nicht, sie weiß, dass man etwas nicht glauben muss, nur weil es einen erschreckt hat; sie hat Philosophie und Epistemologie studiert, über das Problem der Verifizierung veröffentlicht. Außerdem sieht sie jetzt nichts mehr. Vielleicht war es nur ein aufgehängter Mantel, der, als das Flugzeug schwankte, mitschwang. Oder stroboskopisches Sehen.
Der Schmerz ist vergangen, hat sich buchstäblich gehoben. Zuerst konnte sie nicht sehen. Was bedeutete dieses weiße Streicheln? Gott malte mit dem allerweichsten Pinsel die Welt auf ihre Netzhaut; Sterne, fallende Flocken, Blüten, Alleen blühender, wilder Kastanien, jedes Blatt ein grünes Kitzeln. So hatte sie noch nie gelacht. Aber auch das war nicht glaubhaft. Nur weil dich etwas in Verzückung versetzt, ist es nicht unbedingt glaubwürdig.
Sie liegt in einem Zimmer im Bett; an dieser vertrauten Vorstellung hielt Sophie Blind auch während ihrer wildesten Träume fest.
Aber träumt sie denn?
Sie sitzt in einem Zimmer und schreibt. Das einzige Problem dabei ist, dass alle Seiten des kleinen Blocks bereits beschrieben sind mit Worten einer fremden Sprache. Sie setzt sich im Bett auf. Sie kennt das Zimmer nicht, ein hoher Raum – ein Marmorwaschtisch mit Krug, der Schrank, französische Provinz – ein altmodisches Hotelzimmer erster Klasse in einem Badeort in der Normandie. Offenbar ein Traum, denn jetzt erinnert sie sich an den Mailänder Industriellen, in dessen Alfa Romeo sie die Küste entlangsausten – Ort und Zeit wären damit bestimmt, aber was ist aus ihm geworden? Sie muss sich das alles notieren – schnell, bevor er kommt – auf dem Papierspitzendeckchen des Frühstückstabletts. Das Zimmer hat sich wieder verändert, aber daran ist sie gewöhnt. An unvertraute Zimmer ist Sophie Blind gewöhnt. Sie ist ihr ganzes Leben gereist.
Dieses Zimmer mit den am Fensterrahmen befestigten bedruckten Musselingardinen, den Vorhängen von unbestimmbarer Farbe, dem hochaufgetürmten Bettzeug könnte in der Budapester Wohnung ihrer Großmutter gewesen sein. Bildnisse bärtiger Männer in Silberrahmen bedecken die Wand. Da ist Betriebsamkeit von Lieferanten am Dienstboteneingang; das Klopfen von Teppichen über der Brüstung, das Schrubben von Steinfliesen; Gäste werden empfangen und hinausgeleitet; die Tür der Kredenz knarrt jedes Mal, wenn ein weiteres Weinglas entnommen wird.
Sie betrachtet eine Seite der bebilderten Bibel von Doré, eine Ansicht der Sintflut: unten im Bild wirbelndes Gedränge nackter Leiber, die Toten wollüstig über die Klippen hingebreitet, die große, weiße Arche nähert sich von oben; im nächsten Augenblick blättert jemand um: ein Hirtenidyll. Die schattenhafte Figur, die im Zimmer herumtapst und Dinge aus den Truhen hervorzieht, könnte ein Vetter oder Onkel sein. Seltsam, das kitschige Zubehör – Stiefel, Unterröcke, Hüte und Fächer aus den zwanziger und neunziger Jahren. Die rasche, sichere Grazie, mit der er die Dinge handhabt, lässt auf ihren Liebhaber schließen; ihr Liebhaber, der sie neckt, der sich den Pelzkaftan ihres Urgroßvaters überzieht, dann die Silberfuchsstola der Tante; seine Nachahmung geht zu weit. Aufhören, bettelt sie, aber da zieht er sich schon das glitzernde Paillettenkleid ihrer Mutter über den Kopf: ein geschminktes Frauengesicht erscheint, ein vollkommenes Ebenbild mit blonden Locken und dem schwarzen Schönheitspflästerchen knapp unterhalb des linken Mundwinkels; sie sitzt im engen, tief dekolletierten Kleid da, die Beine übereinandergeschlagen à la Marlene Dietrich. – Irgendwer schüttelt das Zimmer wie ein Kaleidoskop; Kronleuchter erblühen und welken in spiegelgetäfelten Ballsälen, ein Zuviel an blendendem Licht und Widerschein. Jetzt ist sich Sophie Blind nicht mehr sicher, ob sie träumt. Eine andere Frage beschäftigt sie: Wenn du unter der Wirkung ihrer teuflischen Droge stehst, kannst du dich erinnern, sie eingenommen zu haben – angenommen, sie haben sie dir nicht heimlich in den Tee gekippt, die Dreckskerle, angenommen, es war kein fauler Trick –, du Idiot hast dich freiwillig dafür hergegeben, kannst du dich unter Einfluss der Droge noch daran erinnern? Sophie Blind erinnert sich nicht.
Sie schaut zu ihrem Geliebten auf, überrascht von seiner Redewendung: »… jenes Glück, so unwahrscheinlich, welches wir Liebe nennen …« Er sitzt an ihrem Bettrand und raucht mit ernster Miene. Den Kopf zurückgeworfen, blickt er in die Ferne; warum nur, fragt sie sich, sie möchte seine Augen sehen. »… weil du tot bist, Sophie«, hört sie eine Stimme sagen wie aus einem Brief. »Tot.«
»All dies haben wir schon einmal durchgemacht –«, will sie sagen. Stattdessen schnellen ihre Augen hoch, um einen letzten flüchtigen Blick auf sein liebes Gesicht zu werfen. Es ist weg. Wohin? Verschwunden. In den Wandbehang? Eine mittelalterliche Jagdszene auf verblichen grünem Hintergrund; oben links schwebt in blasser Skizze eine Burg. Im Vordergrund, en face dargestellt, springen gefleckte Dalmatiner auf ihren Hinterbeinen aus dem Bild heraus – welche Virtuosität der Verkürzung im Mittelalter, erstaunlich! Moderne, Reformation, Renaissance sind also doch nur Pennälerwitze, wie sie schon immer vermutet hat – die Welt ging, wie vorgesehen, im Jahre 1274 unter, wenn man es nur geglaubt hätte. »… Warum musste es ein zwanzigstes Jahrhundert geben?« Eine ihr vertraute Stimme wiederholt die Frage eines Studenten mit schwerfälligem, deutschem Akzent. Das war in einem anderen Traum. Jetzt kann sie nichts mehr sehen. Eigentlich sieht sie zu viel und zu schnell. Es ist ganz gleich, ob sie die Augen öffnet oder schließt. Ihr Liebhaber ist im Zimmer und möchte, dass sie ganz ruhig ist. Wer veranstaltet in ihrem Kopf diese Jagdpartie? Vögel werden im Flug abgeschossen und fallen bleischwer und dunkel von allen Seiten herab, während ebenso schnell neue hineingeworfen werden, mit schrill durchdringendem Schreien.
Sie weiß, es ist vorbei. Sie kann jetzt nicht aufhören. Sie wird sich an ihre neue Stimme gewöhnen müssen.
Ja, ich bin tot. Schon als ich ankam wusste ich, dass ich tot bin, aber ich wollte es nicht als Erste sagen. Nicht gleich bei meiner Ankunft. Ich war mir nicht ganz sicher, weißt du. Alles sah so neu aus, die Wassertanks auf den Dächern, die breiten Straßen, die schweren Glastüren; auf dem Gehsteig Fußball spielende Buben. Als sei ich das erste Mal in New York. Meine Wahrnehmung ist manchmal verzerrt. Aber noch nie habe ich mich so quicklebendig gefühlt wie eben jetzt. Das ist das Verwirrende. Und deine Gegenwart, lauschend. Oder du betrachtest mein Gesicht im Schlaf, so friedlich, sagtest du immer. Wo ich doch weiß, dass du weit weg bist … Vielleicht sprichst du jetzt gerade die Worte, die alles klären, vielleicht sind Worte auch überflüssig. Die Frauen suchen im Grunde nur das Glück, sagtest du, das Glück eher als Macht oder Wahrheit. Mir aber liegt an der Wahrheit. Jetzt, wo ich tot bin, liegt mir allein an der Wahrheit.
Ich starb an einem Dienstagnachmittag, von einem Auto überfahren, als ich gerade die Avenue George V überquerte. Es regnete stark. Ich kam gerade vom Friseur. Dem Verkehr nach zu urteilen, der an Heftigkeit zunahm, aber noch keinen Stau hatte, muss es kurz vor achtzehn Uhr gewesen sein. Ich entdeckte ein freies Taxi, winkte ihm zu. Ich trat vom Bordstein und versuchte nach Möglichkeit, die Straße zu überqueren. Da sah ich den Portier des Hotels gegenüber mit einem übergroßen Regenschirm auf das Taxi zusteuern und schrill in seine Pfeife blasen. Ich stürzte drauflos. Ich wurde auf die Mitte der Fahrbahn geworfen und sofort überfahren. Der Rest der Geschichte ist verschwommen. Weil es regnete, sammelten sich nur wenige Zuschauer. Die Polizei und der Krankenwagen waren in Minutenschnelle da. Und der Verkehrsstrom hatte sich binnen einer halben Stunde normalisiert.
Es geschah so plötzlich, außerdem dachte ich gerade an etwas anderes. Aber mit ziemlicher Sicherheit bin ich tot. Es steht in der Zeitung. Der Arztbericht liegt bei der Polizei auf dem Schreibtisch, obwohl ein offizieller Totenschein erst morgen früh ausgestellt werden kann; »femme décapitée dans le XVIIIe arrondissement« hieß es im France Soir, und das Gefühl, wie mein Kopf vom Rumpf gerissen wird, lebt noch nach. Mein Körper wächst ins Unermessliche, Billionen von Zellen sind plötzlich freigesetzt, dehnen, beschleunigen, drängen sich jubelnd, eilen zu den sieben Toren von Paris hinaus: Porte de Clichy, Porte de la Chapelle, Porte d’Orléans, Porte de Versailles; die Finger meiner ausgestreckten Arme tauchen ein in die Wälder von Boulogne und Vincennes.
Liebster,
ich komme. Lass Dich von dem Crillon-Briefpapier nicht verwirren. Ich bin schon unterwegs, heute Nacht fliege ich von Paris ab. Fünf Tage Amsterdam (ich schrieb Dir von der Konferenz); vielleicht kann ich es auf drei Tage beschränken, dann bin ich am Sonntag, dem Elften, morgens in New York mit Icelandic Airlines. Ich telegrafiere, sobald ich es genau weiß. Leg für alle Fälle einen Schlüssel unter den losen Stein. Hoffentlich bekommst Du dies noch rechtzeitig. In den letzten Wochen konnte ich unmöglich schreiben. Arbeitstermine, die Kinder mussten für den Sommer bei meiner Schwägerin untergebracht werden, und dann der endgültige Auszug – eine deprimierende Ansammlung von Zeug. Aber jetzt ist es geschafft. Endlich bin ich frei, die Schlüssel den Nachmietern übergeben, mein einziger Koffer in der Gepäckaufbewahrung am Flughafen. Ich bin den ganzen Tag spazieren gegangen, nur mit meinen Papieren und Deinem Bild in meiner Tasche, ganz wunderbar leicht.
Bin über verschiedene Straßenmärkte gelaufen, begaffte die ewiggleichen Käsesorten und das appetitlich zur Schau gestellte Obst, sogar die grünen Bohnen liegen ordentlich in Reih und Glied; verirrte mich auf dem Blumenmarkt. Saß fast eine Stunde lang in der Empfangshalle des Crillon und versuchte, Dir zu schreiben. Dann spazierte ich an der Place Vendôme herum und besah mir die Auslagen in den Schaufenstern. Erst als die Geschäfte alle zu Mittag schlossen, fiel mir ein, dass ich mir vielleicht für den Nachmittag etwas vornehmen sollte – einkaufen, Besuch des Musée Grévin, um mir die neue Ausstellung altchinesischer Kalligrafien anzuschauen oder einen letzten Blick auf die Kykladenköpfe im Louvre zu werfen. Aber ich ging wie betäubt weiter, an Châtelet vorbei, besah mir jeden Trödelladen entlang des Quai, ganze Straßenzüge voller Sportartikel, teurer tropischer Vögel und Zierfische, und wieder auf der anderen Seite des Flusses angekommen, empfand ich plötzlich die Sinnlosigkeit dieses ganzen Vergnügens, dazu noch der schöne blaue Himmel, und beim Anblick von Frauen, die mit ihren kleinen Kindern von den Spielplätzen heimkehrten und vor Metzgerläden und Bäckereien Grüppchen bildeten, stiegen jäher Zorn und Ungeduld in mir auf. Raffte mich zu der unumgänglichen Touristen-Flussfahrt auf der Seine bei Sonnenuntergang auf, die Fähre war vollgepackt mit irgendeiner deutschen Jugendgruppe, der »Pfadfinder«. Und jetzt wird’s Zeit.
Verzeih mir diesen verspäteten und eiligen Schrieb; ich wollte ihn eigentlich schon früher abgeschickt haben; jetzt kann ich ihn ebenso gut am Flughafen einwerfen. Habe noch keine Ahnung, was ich in meinem Vortrag über Spinoza sagen werde. Verlass’ mich ganz auf den Genius loci. Es ist meine erste Reise nach Amsterdam.
Alles Liebe, Sophie
Wenn sie verreiste, führte Sophie Blind alles, was sie in etwa 35 Jahren angesammelt hatte, mit sich in Kisten, Kästen, Koffern, Frachtkartons usw. Nicht persönlich, auch nicht unbedingt als Reisegepäck. Sie selbst trug nur das Nötigste bei sich, was von der Art der Reise – ob per Schiff, Bahn oder Bus, mit dem Flugzeug oder zu Fuß –, von Reisedauer und Ziel und letztlich von der Anzahl der Mitreisenden abhing.
Es leuchtete ihr ein, so mit den Dingen umzugehen: packen, auspacken, neu packen, wenn man wieder verreiste, und Sophie Blind war ihr ganzes Leben gereist. Als sie heiratete, setzte sie das Reisen an der Seite ihres Mannes fort. Ezra Blind arbeitete an einem Buch, welches ihn wahrscheinlich sein ganzes Leben lang beschäftigen würde, zumindest aber für die nächsten zwanzig Jahre; seine Arbeit machte Bibliotheksbesuche und Treffen mit Wissenschaftlern vieler Länder erforderlich. Glücklicherweise gelang es Ezra, von guten Universitäten beidseits des Atlantiks und sogar nach Jerusalem als Gastprofessor eingeladen zu werden. So hatten sie in vielen Städten gelebt, manchmal nur für wenige Monate, manchmal sogar zwei Jahre lang, und hatten zwischendurch auch andere Reisen unternommen. Sophie reiste gern. Sie führte immer gern einige liebgewonnene Gegenstände mit sich, liebte es, ein paar vertraute Dinge um sich zu haben, wo immer sie sich gerade aufhielt, abgesehen von dem mehr oder minder gleichbleibenden Himmel mit seiner ewiggleichen Sonne und seinem Mond und den sich mehr oder weniger gleichenden Wänden. Sophie reiste gern. Sophie hatte sich anstelle des Pelzmantels als Hochzeitsgeschenk von ihrem Schwiegervater eine Verlängerung ihrer Hochzeitsreise gewünscht. Einen Pelzmantel nicht haben wollen? Ihre Schwiegertochter musste aber einen Pelzmantel haben. Der Pelz, der bei der Geburt eines Sohnes erstanden wurde, war für die jeweiligen Familienfotos. Sie trug den Mantel für die Familie. Sie war schließlich ihre Schwiegertochter. Aber musste sie den Mantel auf all den Reisen mitnehmen, die sie mit ihrem Mann unternahm? Sie musste es, weil Ezra ihn mitbezahlt hatte. Sein Vater hatte gesagt: »Ich will für Sophie einen Fünfhundertdollarmantel kaufen.« Ezra sagte: »Kauf ihr einen für siebenhundert Dollar. Ich kenne jemanden, der uns einen Neunhundertdollarmantel für siebenhundert beschafft. Ich zahle die zweihundert, wir sparen vierhundert, und Sophie hat den besten Mantel.« Wenn sie mit Ezra zusammen war, trug Sophie den Pelzmantel und den Schmuck, den Ezra ihr kaufte. Jedes Mal, wenn Ezra um ihre Zukunft bangte, kaufte er Sophie einen schweren Silberschmuck.
Es gefiel ihm, wenn sie Schwarz trug. Sie hatte Schwarz getragen, als er ihr seinen Antrag machte, es stand ihr am besten und passte auch am besten zu dem Schmuck, den er für sie kaufte. Er kaufte Sophie jederzeit gern ein neues schwarzes Ausgehkleid. Ein gutes Schwarzes hat man fürs Leben. Was Sophie sich erträumte, war ein weißes Nachthemd, lang und weich, aus feinstem Batist oder Flanell. Aber Ezra konnte nicht verstehen, warum sie so etwas wollte. Nacktheit stand ihr besser. Manchmal wollte er, dass sie mit dem Pelzmantel ins Bett kam. Ein Nachthemd? Das war ein Luxus.
Nicht alles, was Sophie laufend sammelte, konnte ihr in Kisten und per Frachtladung in Kartons und Schrankkoffern folgen: das war schwierig, teuer und kompliziert.
Außerdem, wenn sie in südliche Länder zogen, brauchten sie nicht all ihre Mäntel und Wollsachen, obwohl vielleicht im nächsten Jahr oder irgendwann in der Zukunft, denn sie wussten nie, wohin sie als Nächstes ziehen würden. Ebenso hob sie zu klein gewordene Kinderkleidung auf, die sie für das nächste Kind würde brauchen können. Natürlich konnte sie das meiste von dem, was sie unterwegs gesammelt hatte, nicht mit sich führen, sondern verstaute es bei sesshaften Freunden und Verwandten, je nachdem, wo sie sich gerade aufhielten. Alles musste im Hinblick auf eine Zeit verwahrt werden, in der sie sich endgültig niederzulassen gedachte und ein großes Haus mit vielen Stockwerken und Flügeln besitzen würde, mit einem Keller zum Speichern und einem Dachboden für all die Haustiere, die sie ihren Kindern versprochen hatte. In ihrem Kopf bestand das alles schon, sie befand sich immer in dem Haus ihrer Einbildung, traf Vorbereitungen für eine Reise und suchte ein paar Sachen zusammen, die sie mitnehmen wollte. Aber vielleicht wünschte sie sich im Grunde nur dieses imaginäre Haus, und sie würde immer so weitermachen: reisen und Dinge sammeln und überall wohnen. Mittlerweile kam sie ganz gut damit zurecht, brachte hier eine Kiste, dort einen Koffer bei etablierten Freunden oder Verwandten unter. Wenn sie dann über ein Jahr lang an einem Ort wohnhaft war, konnte sie sich bestimmte Dinge zuschicken lassen, obwohl es ja nie endgültig war. Sie wünschte sich immer, es im Voraus wissen und im Hinblick auf künftige Umstände packen zu können.
Es war eine Schwäche, das wusste sie, Dinge anzusammeln, aufzubewahren und sich erinnern zu müssen, wo man sie hinterlassen hatte. Vieles ging verloren, aber das gehörte mit zum Reisen. Nicht nur einzelne Gegenstände, sondern Pakete, ganze Koffer gingen unerklärlich verloren. Sie gab sich größte Mühe, auf die Sachen zu achten, und wenn sie all ihren Bemühungen zum Trotz verloren gingen, fand sie sich eben damit ab, ganz anders als Ezra, der die Erinnerung an den verlorenen Gegenstand immer wieder aufs Neue beschwor. Ganz gleich, ob ihm ein Stück teuer gewesen war oder er es nur gerade benötigte, mit der Entdeckung jedes neuen Verlusts zählte er bekümmert alle Dinge auf, die ihnen seit dem Tage ihres gemeinsamen Reiseantritts verloren gegangen waren. Dies tat Sophie nicht, oder sie behielt es für sich. Man entdeckte den Verlust und empfand ihn als schmerzlich, aber einmal reicht; das war Sophies Einstellung. Verlorene Dinge verlangten, dass man sie beklagte. Ach ja, man konnte nie genug um die Ohrringe trauern, die man in irgendeiner Seitengasse in Genua erstanden hatte. Aber es widersprach Sophies Prinzipien, den Verlust einer Sache mehr als einmal zu erleiden. Wie konnte Ezra nur für Dinge Partei ergreifen? Ganz sicher war sich Sophie dabei allerdings nicht. Trotz ihrer Prinzipien machten ihr diese verlorenen Stücke zu schaffen, und es half auch nichts, dass sie sich sagte: Ein Glück, die bin ich los! Unmöglich, so etwas heute noch zu tragen! Sie sandten ein geisterhaftes Phantom aus: dort, auf dem Frisiertisch irgendeines Hotelzimmers. Dies musste wohl im Wesen der Dinge liegen, schloss Sophie daraus, und ihrem Wesen als Frau mit Prinzipien oblag es, sich dem zu widersetzen. Wenn mich dieses Ding noch immer verfolgt, überlegte sich Sophie, muss es daran liegen, dass ich seinen Verlust nicht so tief und schmerzlich empfunden habe, wie es sich gehört hätte. In dem Fall kann man aber nichts mehr tun: ich habe den Moment verpasst, oder das Ding hat seinen Moment verpasst; darum kehrt es immer wieder. Was aber den Verlust von Dingen betraf, die sie wahrhaftig schmerzten, diesen trug sie zutiefst in ihrem Innern, mit ihm verschmolzen. Hätte sie einmal die Gesamtsumme der verlorenen Gegenstände wissen wollen, so hätte sie nur den letztverlorenen erwähnen müssen, und Ezra würde zu rechnen begonnen haben, heute dies, gestern das, den ganzen Weg zurück. Aber Sophie interessierte das nicht. Rechnen war Männersache. Das taten ihr Vater sowie ihre beiden Großväter.
Ja, sie liebte das Reisen. Es ist die einzige Art zu leben, sagte Sophie immer, die einzige Art, in der Zeit zu leben: mit ihr zu entfliehen. Sophie wurde unruhig, wenn sie zu lange an einem Ort verweilten.
Sophie versuchte mit allen Mitteln, Auseinandersetzungen aus dem Wege zu gehen, aber es klappte nicht immer, weil sich Ezra mit bloßem Jammern und Nörgeln nicht zufriedengab: er suchte den Streit. Überdies hatte Sophie auch ihre eigenen Kümmernisse, die sie nicht immer schweigend übergehen konnte. Also stritten sie sich.
Ezra gewann immer die Oberhand. Egal, worum es ging oder wer den Streit begonnen hatte, es gelang Ezra immer, sie ins Unrecht zu setzen. Sophie konnte nicht begreifen, wie er das anstellte. Er besaß wohl ein besonderes Talent dazu. Und immer endete es damit, dass er ihr sagte, sie sei die beste Frau der Welt.
Ezra begann immer mit einer winzigen Kleinigkeit. So winzig, dass Sophie gar nicht begriff, dass er auf einen Streit aus war. Nebensache, dachte sie, das hat man in einer Minute erledigt; oder eine Nichtigkeit, an der man sowieso nichts ändern kann, die man nach einer Minute wieder fallenlässt. Ezra aber setzte es fort und ritt auf seinem Thema so lange herum, bis es Sophie dämmerte, dass es gar nicht um den Schlips ging, den er gerade nicht finden konnte, weil sie es versäumt habe, ihn einzupacken, so wie sie schon vordem andere Gegenstände zu packen versäumt habe, oder etwa um ihre Gleichgültigkeit gegenüber seinem Aussehen oder ihrem eigenen Aussehen – ihre Missachtung der äußeren Erscheinung überhaupt. Es ging eigentlich um sämtliche Folgen, die ihre Einstellung für ihr gemeinsames Leben hatte und auch weiterhin haben würde. Das Problem war eigentlich riesengroß.
Ezra entwickelte sein Thema mit steigendem Pathos; mal lief er schweren Schrittes auf und ab, mal hielt er inne, um nicht von seinem rhetorischen Höhenflug abzulenken oder um eine dramatische Pause zu unterstreichen. Sophie beobachtete seinen Zeigefinger: er zeichnete Luftkreise oder rührte in einer unsichtbaren Brühe. Im Steilflug schoß er auf das Erhabene zu, vollführte eine Schlaufe und verhielt, waagrecht auf sie gerichtet. Der Zeigefinger wedelte sie mit zunehmender Bedrohlichkeit an, als ob er nicht wisse, was er mit sich anfangen solle. An diesem Punkt holte sie tief Luft, entweder um Ezra zu entgegnen oder um aus dem Zimmer zu stürzen.
Sophie hasste Auseinandersetzungen. Zumeist behielt sie ihren Kummer für sich. Oder er brach plötzlich aus ihr hervor. Oft überlegte sie noch, ob sie eine Angelegenheit überhaupt erwähnen und wie sie dies am besten anstellen solle, und während sie noch innerlich mit der Frage des Wie und Ob beschäftigt war, brach es aus ihr hervor, zu ihrer beider Überraschung – wobei Sophie wahrscheinlich die Überraschtere war, denn Ezra war es von Haus aus gewohnt, angebrüllt zu werden; für Sophie dagegen war es ungewohnt, sich selbst schreien zu hören.
Ezra lehnte sich dann zurück, hörte ihr ganz ruhig und aufmerksam zu. Machte er sich den Augenblick, in dem Sophies Aufmerksamkeit ganz von ihrer Wut eingenommen war, zunutze, um sich aufs Sofa sinken oder ins Bett gleiten zu lassen, oder war das der Ausgangspunkt für ihren Streit? Ezra im Bett, Sophie auf den Beinen, alles Mögliche musste erledigt werden, allein schafft sie das nie. Sophies blitzartige Einsicht, dass ihr Leben zu der Aussichtslosigkeit, je etwas erledigen zu können, zusammengeschrumpft ist. Ezra zurückgelehnt, sich räkelnd und gähnend – womöglich war dieses Bild der wahre Auslöser für ihre Wut.
Sophie Blind konnte es gar nicht fassen, was da für verheerende Worte aus ihrem Mund hervorbrachen oder dass sie solche Worte aussprach. Außerdem ließ sich Ezra weder Bestürzung, Unglauben noch Erschütterung anmerken. Sie sah an ihm vielmehr einen Ausdruck von Zufriedenheit: er saß jetzt aufrecht, sah sie mit großen Augen an, nickte Zustimmung: es tobt das Weib nach Weiber Art; ein ziemlich erfolglos unterdrücktes Lächeln auf den Lippen, seine Miene deutlich besänftigt, eine Maske von Strenge oder auch nur von Erschrecken aufgesetzt, verschwindet er unter der Bettdecke, als ihre vorschießenden Arme mit krallenden Fingern sich anschicken, den Inhalt ihrer Worte auf seiner zarten Haut auszutragen, und versteckt sich, bis der Sturm sich gelegt hat. In seiner Deckung hat er wenig zu befürchten, es ist bloß eine Frau, die ihr Gewicht auf ihn wirft, deren Fäuste meist nur auf Wand, Luft oder Matratzen trommeln; schlimmstenfalls ein kleiner Rippenstoß, wenn ihre Faust einmal die Sperre von Armen und Knien durchbricht. Nur eine Frau, die jetzt vor Wut kochend ganz fließend und formbar geworden ist: seine eigene geliebte Ehefrau, er weiß schon, wie er’s mit ihr anstellen muss, und neun Monate später ist ein Kind da.
Oder wenn sie sich nicht auf ihn stürzte, wartete er eben ab, bis der Sturm sich ausgetobt hatte, was ja unweigerlich früher oder später geschehen musste. Wartete ab, bis aus dem wild peitschenden Regen ein dünnes Nieseln geworden war, um es dann mit dem letzten schwachen Tröpfeln aufzunehmen, Sophie Blinds ermattetes Wiederholen: »… immer muss ich alles selber machen …« Dann, von der leisesten Andeutung eines Vorwurfs in tiefster Seele getroffen, hub Ezra mit der Aufzählung an, erinnerte sie an die Situationen, in denen er ihr geholfen, die Last von den Schultern genommen, ihr Geschenke gekauft hatte; in schöner Reihenfolge folgten alle guten Taten, die er je für sie vollbracht, freilich nur wenige Beispiele aus dem unerschöpflichen Vorrat, bis sie den Kopf nicht mehr heben konnte, von der Fülle seiner Wohltaten, so ausführlich und rührungsvoll vorgetragen, schier überwältigt. Die Schwere der Rücksicht, Hingabe und Fürsorge so vieler Jahre flößt Sophie ein Gefühl von Ohnmacht und Benommenheit ein. Sie weiß nicht mehr, ob sie sitzt, steht oder liegt, ihr ist zum Ersticken. Als sie sich endlich von seinem Körper umgeben, von seinem Gewicht erdrückt fühlt, empfindet sie Erleichterung. Und neun Monate später ist ein Kind da.
Wenn Sophie ein Kind austrug, war sie glücklich; nichts konnte sie dann aus der Ruhe bringen. Sie aß, schlief und lief spazieren, wann es ihr passte. Sie hörte Ezra meistens gar nicht, wenn er sie um etwas bat. Sie war schwanger. Meine Frau ist schwanger, pflegte Ezra vielsagend zu erklären, wenn man sie auf Gesellschaften vermisste oder ihre abwesende Art bemerkte. Sophie mochte sich während ihrer Brutzeit nicht mit gesellschaftlichem Unsinn abgeben, und in der Still- und Ziehperiode noch weniger. Sie hatte keinen Spaß an kneifenden Schuhen oder Argumenten für und wider. Sie blieb daheim und ölte sich den Bauch oder ihr Baby oder beides.
Ezra sah, wie glücklich Sophie in ihren Schwangerschaften war, und schenkte ihr noch ein Kind. Sie badete gern ausgiebig in der Wanne. War ein Baby da, so nahm sie es mit, sie nahm alle Kinder mit in die Wanne, und sie spielten zusammen mit all den Wasserhähnen und der Dusche oder bespritzten sich mit Wasser. Als sie größer wurden, gab sie ihnen Farben und Lehm, Holzperlen und alte Lappen zum Spielen und Basteln.
Ezra beschwerte sich; er fand Holzperlen, Lehm, Lappen, Malfarben und alten Plunder ganz abscheulich, vor allem aber Kinder, die die Wände bemalten. Es ist ja abwaschbar, versicherte ihm seine Frau und bewies ihm dies mittels eines Schwammes. Ezra aber entsetzte die Idee von Wände bemalenden Kindern an sich. Es war das Allerletzte. Es war sündhaft. Ezra verkündete, dass er in seinem Hause Ordnung wünsche. Sophie sah zu, wie sein Zeigefinger sich drohend erhob, seine Lippen sich zu einem dünnen Strich zusammenpressten. Sie weigerte sich lange Zeit, an Ezras Verwandlung zu glauben. Wie konnte das Ezra sein, der wie sein Vater zu näseln begonnen hatte? Er legte sich einen Schmerbauch zu, litt an seltsamen Unpässlichkeiten, brüllte los, wenn er in der Wand Risse entdeckte, wenn etwas verschüttet wurde, wenn ein Knopf fehlte; es hatte auf der Stelle repariert zu werden.
Ezra befahl ihr, die Fußböden wachsen zu lassen. Aber die Kinder werden darauf ausrutschen, wandte sie dagegen ein. Diese hätten still auf ihren Zimmern zu bleiben und gewachste Fußböden mit Vorsicht zu betreten, herrschte er sie an. Aber es wäre doch sinnlos, da sie sowieso in ein paar Monaten verzögen, und noch dazu sei es teuer – sie versuchte ihm mit Vernunft beizukommen. Wir können es uns nicht leisten, plädierte sie und berief sich auf die unbezahlten Haushalts- und Arztrechnungen. Dann werden die Kinder eben weniger Spielzeug bekommen, meinte Ezra abschließend und verschwand mit einem Stoß ausländischer Zeitungen im Bad.
Sophie war mit den Kindern glücklich; sie bastelten weiter, auch wenn sie das Haus dabei verwüsteten. Ezra war meistens nicht da, und wenn er wie immer unerwartet kam, gab es einen lauten Streit; das gehörte zum Familienleben mit dazu. Nur, über die Jahre und mit dem Heranwachsen der Kinder wurden die Kämpfe immer schlimmer, und Sophie konnte die Art, in der sie unterlag und er siegte, nicht länger hinnehmen. Denn jetzt rechnete er für sie alle, für sie und für die Kinder, merkte sich, was jeder von ihnen verschlampte oder falsch gemacht hatte und, da sie alle ständig schlecht abschnitten und versagten, gewiss auch weiterhin tun würden. Nicht nur, dass er dauernd an vergangene Fehler erinnerte, er sagte ihnen auch all die künftigen, noch nicht begangenen voraus. Seiner Ansicht nach würden sie bis zu ihrer Volljährigkeit am Galgen und in der Gosse gelandet sein. Sophie Blind, die sich bisher nicht einmal zu ihrer eigenen Verteidigung hatte aufraffen können, musste auf einmal zwei oder drei oder noch mehr gegen Worte, manchmal auch gegen Schläge verteidigen, vor allem gegen die Worte, da diese länger nachwirkten. Überdies verfügte Ezra mit der wachsenden Kinderzahl auch über ein längeres Inventar der erwiesenen Wohltaten und Gefälligkeiten und Bemühungen um ihretwillen seit dem Tage ihrer Geburt, welches er ihnen bei Gelegenheit in seiner ganzen unerbittlichen Länge aufsagte, bis die einen fast in Ohnmacht, die anderen in Stampfen und Schreien verfielen und Sophie nicht mehr wusste, was sie tat, geschweige denn, was sie tun sollte; nur, es war unverkennbar, dass man dies nicht auf die bisherige Art lösen oder überstehen konnte und dass sie jetzt auf keinen Fall in Ohnmacht fallen oder schreien durfte, sosehr sie auch dazu neigte, sondern alles andere tun musste als das. Sie musste so vieles tun: beschützen oder widersprechen, manchmal einfach zur unbeweglichen Statue erstarren oder die Kinder mit der Aufforderung, ihrem Vater zu gehorchen, aus dem Zimmer schicken oder versuchen, ihn loszuwerden und nachher zu trösten und aufzumuntern. Wenn sie Jahre später daran dachte, was sie eigentlich getan hatte oder was sie hätte tun können oder sollen, war es ihr noch genauso unklar wie damals. Sie wusste nicht, was sie tat oder tun sollte, und trotzdem ging es weiter von Tag zu Tag. Und von Land zu Land, einpacken, auspacken, immer häufiger auf eigene Faust verreisen, bis sie das Leben in abgelegenen, rückständigen Gegenden satthatte – Inseln, wo die Fähre einmal in der Woche anlegte, weglose Gebirge, die nur einem Fußgänger oder einem Maultier zugänglich waren. Sie war reisemüde oder einfach nur müde und sehnte sich nach einem bisschen Stadtleben. Mit der Zeit begannen sie wie auch die Kinder ihre eigenen Sachen zu vermissen und zu entbehren – Bücher, Spielzeug, Kleider, all die netten Dinge, die sie sich verschiedentlich gekauft und da und dort auch benutzt hatten, dann in Kisten und Koffern verstaut an diversen Plätzen untergestellt, vielleicht auch verloren hatten. (Der Koffer, der an Ezras Schwester gegangen war, der all ihre Aufzeichnungen aus Italien enthielt, und die zierlichen Gläser aus Venedig.) Sie war die Schäbigkeit und anderer Leute schlechten Geschmack leid und sehnte sich nach einem Platz, an dem sie ein für alle Mal alles beisammenhätten, ohne ständig umziehen, umpacken, sich Sorgen machen zu müssen; ein eigenes Heim, um ihre Kinder großzuziehen, und Ruhe und Frieden, um vielleicht einmal eines der Bücher zu schreiben, die sie schon immer hatte schreiben wollen.
Dazu bräuchte sie eigentlich nur Geld und eine glückliche Liebesaffäre, hatte ihr auf Ibiza ein pensionierter Brite geraten.
Sophie fiel ein, dass sie noch immer das Geld besaß, das ihr Vater bei ihrer Heirat auf der Bank für sie deponiert hatte, »für den Fall, dass …« – sie hatte ihn nie ausreden lassen; es war am Vortag ihrer Hochzeit gewesen, und Sophie befürchtete, ihr Vater könne etwas sagen, was alles zerstören würde, deshalb weigerte sie sich, hinzuhören. In ihrem Leben würde es keinen solchen »Fall« geben; alles würde in Ordnung gehen, und mit seinem Zynismus und Zweifel wollte sie am Tage vor ihrer Hochzeit nichts zu tun haben.
Sophie traf Anstalten, sich in Paris niederzulassen. Ezra protestierte zunächst, dann willigte er ein. Ezras Freude darüber, dass ihre Wahl auf Paris gefallen war, sowie seine ironischen Kommentare überraschten sie keineswegs. Vor ihren Freunden prahlte er damit, dass er seiner Frau den Wunschtraum jeder Frau erfülle: in Paris zu leben. Seinem Schwiegervater schrieb er voll bitteren Vorwurfs, dass er seiner Tochter ermögliche, ihrem Mann davonzulaufen mit den Kindern. Über Sophie mokierte er sich, aber eigentlich gefiel ihm die Aussicht, sie in Paris zu besuchen und einige Wochen oder Monate im Jahr in seiner Lieblingsstadt verbringen zu können. Endlich sei sie zu einem vernünftigen Entschluss gekommen.
Ezra bestand darauf, dass die Kinder bei seiner Schwester Renata in Bern untergebracht würden, damit Sophie alles in Ruhe einrichten könne.
»Aber, Ezra, ich verlasse dich doch«, sagte Sophie.
»Ich will es dir ja nur erleichtern«, gab Ezra zurück, »du bist schließlich immer noch meine Frau und die Mutter meiner Kinder«, fügte er pathetisch hinzu. »An den Tatsachen kann man nichts ändern. Die Kinder sind in Bern bestens aufgehoben, und du hast freie Hand. Sie bleiben so lange bei Renata, bis du alles geregelt hast.«
Im Frühjahr dieses Jahres fuhr Sophie nach New York, um ihre dort verbliebenen Sachen zu packen und zu verschiffen und um ihre Finanzen zu regeln. War dies etwa der rechte Zeitpunkt für eine glückliche Liebesaffäre?
Sie hatte sich ereignet.
Sophie kehrte nach Europa zurück und verbrachte einige Wochen mit den Kindern am Meer, bis ihre Pariser Wohnung fertig war. Auf dem Flug von New York, unterwegs zu ihren Kindern, wirbelten ihre Gedanken in seliger Verwirrung durcheinander. Sie würde noch viele glückliche Affären haben. Oder vielleicht nur noch eine einzige, die bis an ihr Lebensende anhielte. Aber vielleicht wurde so etwas nur einmal im Leben bewilligt, und sie hatte es gehabt. Es machte nichts, dass sie mit dem Packen nicht ganz fertig geworden war.
Sie landen im üblichen grauen Nieselregen am Flughafen Orly. Sophie Blind in ihrem Reisecape, links und rechts tänzelt je ein Kind, das älteste stürmt mit einem riesigen Korb voran, in dem sie die schweren Stücke untergebracht haben – Messer, Muscheln, Campingausrüstung, die Schreibmaschine, das in noch strandfeuchte Badetücher eingeschlagene Bügeleisen. Mit welchem Flugzeug fliegen wir weiter?, fragen die Kinder. Swissair? Pan Am? Air France? Lufthansa? Warum fliegen wir nie mit Air India? Wir fliegen gar nicht weiter. Wir bleiben hier. Wir bleiben jetzt für immer hier. Die Stimme der Mutter, müde und fern, im Taxi den Kai entlangrasend, während um sie herum die Sehenswürdigkeiten von Paris auftauchen.
Sie halten vor einem Gebäude, an dem noch gebaut wird. Sie zeigt auf das oberste Stockwerk, da, wo die Fenster neu eingesetzt sind. Fünfter Stock und kein Aufzug. Wusst’ ich’s doch! Das hab’ ich mir doch gleich gedacht!, meint Joshua, der den Korb hinaufschleppt. Es ist gut für dein Herz, sagt Toby. Warum fangen sie denn oben an?, fragt Jonathan.
Die Wohnung ist noch nicht ganz fertig; die Arbeiter verlegen gerade den Bodenbelag. Nein, sie können noch nicht rein, bis die Arbeiter am Abend fertig sind, aber eine Menge Gepäck ist schon eingetroffen – Kisten und Koffer neben der Tür entlang der Wand aufgestapelt, obenauf einige Briefe. Hat Papa geschrieben? Warum macht sie den Brief nicht auf? Doch nicht im Treppenhaus!
Sie gehen hinaus auf den Boulevard: tabac, boulangerie, Kioske, die mit den Konzertansagen des letzten Monats vollgeklebt sind, die Crédit Lyonnais Bank, die Pissoirs; im Gänsemarsch durch enge Seitengassen; défense d’afficher an narbigem Gemäuer; alles noch wie gehabt, Bäche laufen den Rinnstein entlang, und der kleine Mann im blauen tablier steuert den Müll mit seinem Strohbesen in Richtung Kloake; um die nächste Ecke tritt Notre-Dame in Erscheinung. Und was machen wir jetzt? Wenigstens hat der Regen aufgehört. Sollen wir ins Kino gehen?
Sie schreibt an ihren Liebhaber, während sie im Café am Eck sitzen und warten, dass die Arbeiter fertig werden. Liest seinen Brief noch mal, zerreißt ihren eigenen. Heute früh im üblichen grauen Nieselregen gelandet und Deinen Brief vorgefunden … Sie beginnt ein neues Blatt. Können wir jetzt gehen, Mama? … Paris ist nicht mehr, wie es war. Sie streicht das Geschriebene durch und zerknüllt das Papier.
Ja, unter dem braunen Packpapier ist tatsächlich ein Teppich. Die Kinder haben ihren Spaß beim Abreißen und Einrollen. Goldfarben, meinetwegen, wenn Jonathan unbedingt meint. Der Ton hieß moutarde, als sie sich im vorigen Jahr dafür entschied. Keine Möbel? Wer braucht schon Möbel! Sie schlafen, spielen und essen auf einem goldenen Teppich. Wie gut, dass sie ihren Campinggaskocher mitgebracht haben, bis die Gasleitungen verlegt und vom inspecteur du gaz endlich abgenommen worden sind …
Die Kinder sind neugierig. Von wem ist dieser dicke Brief aus New York, den sie beim Spaghettikochen liest? Wer ist Ivan?, fragen sie. Hat er Geld? Sieht er gut aus? Wirst du ihn heiraten? Ich will einen reichen Mann heiraten, sagt Toby. Bist du vielleicht reich?, sagt Jonathan. Joshua will überhaupt nicht heiraten. Essen auf dem Boden wie die Japaner, wer sind sie nur, diese kleinen Leute? Ein paar Möbel werden wir aber doch brauchen, findet Toby. Für Gäste. Was glaubst du denn, wir werden hier Partys feiern! Es stimmt schon, man kann Leute nicht richtig einladen, solange nicht wenigstens ein paar Stühle da sind.
Die Leute kommen aber auch so. X hat gehört, dass sie nicht mehr mit Ezra zusammenlebt. Y hat von Ezra erfahren, dass sie jetzt in Paris leben. Z hat es von X. Sie warten alle schon seit Jahren darauf. Entschuldigungen sind zwecklos. Je ne me suis pas encore installée. Der Teppich ist völlig ausreichend. Es kommt gar nicht infrage. Sie kann nicht, die Kinder könnten aufwachen. Sie kann nicht, sie ist völlig erledigt. Sie kann nicht, muss auspacken. Sie kann nicht, muss fünfzig Briefe schreiben. Nein, sie kann nicht, sie muss an ihrem Buch arbeiten; sie kann ihnen auch nicht erzählen, wovon es handelt. Sie muss schlafen. Sie muss wirklich all diese Briefe schreiben. An Ezra. Kann nicht. Geschäftliches. Kann nicht. An ihren Liebhaber in New York. Kann nicht. Zu Ende auspacken. Kann nicht. Kann nicht schlafen. Kann nicht arbeiten. – Wie wird man am besten ein Hochzeitskleid los, das man weder an seine Tochter noch an eine Schwiegertochter weitergeben kann? Gar nicht.
Der Putz ist immer noch nicht trocken. Wie soll er auch bei dieser Feuchtigkeit trocknen … »Quartier pittoresque et malsain«, wie es im Guide Bleu heißt. Nach Mitternacht läuft sie noch lange im Pelzmantel auf und ab.
Wo gehst du hin, Mama? Joshua kommt von der Toilette, steht blinzelnd im Flur. Im Nachthemd auf einen Ball, wohin denn sonst? Sie wartet, bis er im Nebenzimmer unter das Betttuch gekrochen ist, bevor sie alle Lichter löscht.
*
Das Zimmer ist überfüllt mit geputzten Leuten. Sie gehen ein und aus. Einige trinken draußen auf der Terrasse. Man hat die Türflügel weit aufgetan, das Sonnenlicht flutet herein.
Aufwachen, es ist Hochzeitssonntag!, kreischt eine aufgeregte Blondine. Sie fegt durch den Raum wie ein General, der seine Soldaten um sich schart, eine wehende Chiffonschärpe an ihrem erhobenen, auffallend geäderten nackten Arm, eine Mänade mit einem Gefolge von heruntergekommenen europäischen Intellektuellen. Sie werfen verstohlene Blicke auf die Silberplatten mit garnierten Schinken, die auf die Terrasse hinausgetragen werden, und registrieren gleichzeitig die Unordnung, die im Zimmer herrscht: das ungemachte Bett, die alten Zeitschriften, ungewaschene Kleider, schmutzige Tassen und volle Aschenbecher auf dem Boden und dem Mobiliar. Es ist eine Künstlerbude, sagt jemand zur Erklärung. Kleine Mädchen stehen um den Schreibtisch herum und wühlen in einem Haufen von Papieren und Notizheften. Sie tragen Rouge auf den Wangen und blaue Lidschatten. So junge Mädchen und schminken sich schon!, bemerkt einer der Gäste mit missbilligendem Lachen. Sie fangen an, die Papiere in die Luft zu werfen, während von der Terrasse leise die Anfangstakte eines Klavierstücks herüberklingen.
Da erscheint der Bräutigam in Schwarz im Gefolge seiner Sippe, ein lärmender Aufmarsch bärtiger Männer bis ins siebente Glied. Sie taumeln stolzierend und prahlerisch einher, von ihren Stiefeln behindert, rot im Gesicht und schwitzend unter ihren Kaftanen, und drängen sich ins Zimmer hinein. Die Luft ist zum Ersticken, aber die Frauen bringen trotzdem noch mehr Kristallvasen mit riesigen wachsartigen, duftenden Blumen herbei.
Die Braut wird hereingeführt, tiefverschleiert. Ihre Handgelenke und Arme sind mit scheppernden Silberreifen beschwert. Sie kommt barfüßig wie eine Sklavin herein, umhüllt von Äthergestank. Die Sippe des Bräutigams hat sich wie für ein Klassenfoto aufgestellt, die Jüngsten knien in der vordersten Reihe, die kleingewachsenen Patriarchen stehen dahinter auf Hockern. Die Braut kniet nieder, die Hände auf dem Rücken verschränkt, in Erwartung ihrer Enthauptung, während der Bräutigam in einer hohen Fistelstimme singt: »Du bist mein Stolz und meine Pracht! Ohne dich bin ich ein Bettler …« Die Sippenangehörigen marschieren einzeln an ihr vorüber, mit beifälligem Gemurmel. Jeder von ihnen legt ihr einen eisernen Kragen um den Hals, bis ihr der Kopf umknickt. Der Bräutigam stimmt in den Singsang seiner Sippe ein.
Man legt die Braut in einen mit rosa Satin gefütterten Sarg. Der Bräutigam lädt die Männer ein, sich ihrer reihum zu erfreuen. Die Kinder drängen sich alle um den Sarg, um zuzuschauen. Die Männer in ihren Stiefeln steigen mühsam hinein, als Erster der Patriarch bis hin zum jüngsten Neffen, einem mädchengesichtigen Knaben mit dem Lächeln eines sanften Clowns, während der Bräutigam Rauchringe an die Decke bläst. Weich wie Seide, sagt der junge Neffe, und sie müssen ihn fortzerren. Empörte Frauen legen den Sargdeckel wieder auf. Die Ehe ist vollzogen worden. Die Gäste begeben sich auf die Terrasse, wo ein Empfang für eine berühmte Schauspielerin stattfindet.
Die Kinder haben den Sargdeckel mit dem Stiel eines Gartenrechens aufgestemmt. Jetzt klettern die kleinen Mädchen darin herum. Plötzlich kommt aus dem Sarg ein Kopf hervor, der eine Ansprache hält: »Die Frau ist zum Teil weniger als ein Mensch, zum Teil mehr als ein Mensch und zum Teil Mensch.«
Braut und Bräutigam spielen im Garten Fangen. Unsicher, mit verbundenen Augen taumelt sie einher, die Arme von sich gestreckt, und umarmt voll Leidenschaft einen Baumstamm.
*
Ziemlich hoch in der Wandtäfelung zu ihrer Linken, fast schon hinter ihr, schreibt ein Schriftgelehrter oder Engel; vielleicht nur eine Reproduktion aus einem Buch, ihr Auge erhascht lediglich die Geste einer Hand, übergroß und heftig … einer der Evangelisten? Ein Engel, der ihr eine Botschaft bringt – an dieser Vorstellung hält sie fest wegen seiner beunruhigenden Gegenwart, gar nicht wie aus einem Buch; er fuchtelt und schneidet Grimassen, um ihre Aufmerksamkeit zu fesseln. Es ist ein bärtiger Engel mit einem komischen Judengesicht, die Bibel in der Hand; jetzt verwandelt er sich in ein Renaissanceputtchen auf einem Springbrunnen, dann in einen Faun …
Wie ist Ezra bloß reingekommen?
Wie machte Ezra das bloß?, fragt sie sich verwundert, noch halb im Schlaf auf ihrem Weg in die Küche. Es ist vier Uhr vorbei. Sie wird einen Tee trinken.
Wie ist Ezra bloß hereingekommen, durch welche List, Täuschung oder Zauberei, wo ihre Tür doch verschlossen war? Sie verweigerte sich immer, allen Männern; auch Ezra. Ihr Blick, ihr Gang, ihre Art, sich zu kleiden, zu sprechen oder auch zu schweigen, drückten das deutlich genug aus. Sie wartete auf einen anderen. Vielleicht auch auf gar keinen. Sie hatte es völlig ernst gemeint, als sie Ezra erklärte, sie könne ihn nicht heiraten, da sie gerade dabei sei, etwas zu entscheiden, sich aber noch nicht entschieden habe. Ezra hatte verstanden; es war sein gutes Recht zu versuchen, sie vom Gegenteil zu überzeugen, ihr abzuraten, diesen Weg allein zu gehen, wohin er auch führen mochte – sie gäbe ja zu, dass sie im Zustand von Unwissenheit nicht überblicke, wohin sie ihre Wege führen würden. Aber Ezra war sich sicher. Sie erinnert sich nur, dass er die ganze Zeit ihre Worte wie auch ihr Schweigen in eine andere Sprache übertrug, brillant, polyglott, fremde Ausdrücke aus dem Griechischen, Deutschen, Lateinischen, Hebräischen, Französischen; Verse des Alten Testaments. Sie versuchte dabei, seine Züge im Dunkeln zu erkennen: das Gesicht veränderlich wie Spiegelung auf dem Wasser; mal die Hände in ihrem Haar, mal tastende Finger zwischen Bluse und Rock, Rock und Unterrock, dann sachte an ihrem Schenkel hinauf; die Stimme, atemverflochten, streift ihre Wange, Hals und Ohr; Finger schleichen wie auf Samtpfoten durch ihr Gebüsch, und bevor sie wusste, was sie tat, hatte sie schon ihre Hand auf die seine gelegt und gesagt, ich will alles.
Und lächelnd dagelegen, als wäre es schon geschehen, während er sie besorgt fragte: Bist du denn sicher, dass du das wirklich willst? Und: Was ist, wenn ich dir ein Kind mache? Beim ersten Mal tut es weh. Und dringt bereits in sie ein, nachdem er sie aufgerichtet und in Stellung gebracht hat, und flüstert ihr ins Ohr, während sie seinen Kopf umklammert. Es ist ein ganz schönes Stück Arbeit, eine Frau zu deflorieren, meint er. Dann lässt sie ihn los, ihre Hände fallen von ihm ab, ihr Kopf rollt zur Seite, und das Zimmer kreist an ihren offenen Augen vorbei: links, in ihrer Blickrichtung auf dem Boden sein Schuh mit darinsteckendem Portemonnaie; im Fenster ganz rechts der Lichtfleck der anbrechenden Dämmerung und in der Mitte Ezra, rittlings aufsitzend, seine Knie dicht an ihre Rippen gepreßt, hoch aufgerichtet Ausschau haltend in weite Fernen, viele Reitermeilen Steppe zurücklegend und noch immer vorstoßend, sie glaubte, er bricht ihr noch durchs Schädeldach; dann noch ein Atemzug, und atmet jetzt gemächlich, voller Genuss, warme Flüssigkeit rieselt an ihrem Schenkel hinab, sein Glied, hinausgeschlüpft, liegt ruhend auf ihrem Schenkel, nachdem Reiter und Reittier gestrauchelt und gemeinsam hingeschlagen sind, und beide schliefen sie ein.
Sie wollte eigentlich etwas anderes. Sie kämpften beide gegen die eigenen Träume und Neigungen an. Ezra wollte ungewöhnlich sein, und sie wollte vielleicht einfach aufhören zu träumen, jungfräulich zu warten; seine Lüge, sie zu begehren, begehrte aber nur, wovon er sich nicht losreißen konnte; er wollte es selber glauben und sie glauben machen: dass er sie begehre; belog sich selbst, bis er es glaubte. Sie hielt, schweigend, die Wahrheit noch immer für ihr kostbarstes Gut wie eine letzte Münze in ihrer Hand – vielleicht war sie wertlos –, und im Handumdrehen hatte sie sie fortgeworfen und stand mit leeren Händen da, so dass es Ezra möglich war.
Szenen aus einem anderen Leben überspielt, jetzt von keinem Wert, denkt sie beim Teetrinken. Sie liegt im Bett, beobachtet still das Fenster. In zwei Stunden wird der Wecker läuten.
Die Täuschung ist endlos. Lachen. Weinen. Fluchen. Bestenfalls schafft sie es noch zu atmen, mehr auch nicht. Die Nacht verblasst. Bald wird es dämmern. Der Tag wird anbrechen. Das trübe Licht, erst ganz dicht, klärt sich, bis es ganz schwerelos geworden ist; es gibt nur noch die reine Oberfläche des Tages, die Stadt von Straßen und Gebäuden, die Wände innen und außen; alles wird nur aus Oberfläche bestehen, auf welcher die scharf umrissenen Schatten anderer Oberflächen erscheinen.
*
So grauenhaft, frivol oder sinnlos, wie es Sophie vorkommt, kann es in Paris eigentlich gar nicht sein. Nichts von dem, was sie tut, kann sie ernst nehmen. Obwohl sie endlich ausgepackt hat und sogar ein Zimmer für ihre Tochter mit Vorhängen ausgestattet und ein teures Sofa erstanden hat. Unwichtig. Ebenso die Verhältnisse, die sie mit verschiedenen Männern hat. Es liegt einfach in der Natur der Sache: einem verheirateten Mann einmal die Woche als Mätresse zu dienen, kann man nicht ernst nennen. So wie Roland immer sagt, es wäre katastrophal, wenn sie sich in ihn verlieben würde. Er bringt ihr Paradiesvogelblumen und Exemplare von Kunstbüchern begrenzter Auflagen (er hat eine führende Stellung in einem Verlagshaus und kann ihr wertvolle Beziehungen verschaffen); hinterher feiern sie immer mit Austern und erlesenem Weißwein, und er ist ein großer Mann, und wie er aussieht, wenn er von seinem kleinen Sohn spricht – das alles gefällt ihr zwar, aber was soll sie in der Zwischenzeit, von Dienstag bis Dienstag, damit anfangen? Besser, es nicht ernst zu nehmen. Hatte sie denn nicht den Fehler begangen, ihre eigene Ehe ernst zu nehmen? Aber offenbar ist sie auch nicht für die Rolle der »petite maîtresse« geschaffen. Sie spielt die Rolle der »anderen Frau« ebenso schlecht wie die der »Einen«, es ist nur die Kehrseite der ohnehin schlechten Medaille. Die meisten Männer wollen getäuscht werden. Dagegen ist ein perverser Schmutzfink und Widerling wie Gaston geradezu erfrischend. Für ihn muss eine Frau Hure sein, er zieht das ganze Zubehör aus seiner Schublade und demütigt dich; keiner spricht hier von Liebe oder wechselseitigem Glück, es gibt eine Rauferei, und seltsamerweise wird die Widrigkeit zum Genuss. Pervers? Es ist schon eine Leistung, mit Gaston überhaupt fertigzuwerden, aber ernst zu nehmen ist es bestimmt nicht. Alain dagegen ist ein Langweiler, aber sie braucht ihn, um die Runden zu machen. Dann, unter den ehemaligen Verehrern, ist da noch Nicholas, der gerade mit seiner schwangeren Frau und Zwillingen nach Rom umzieht und sich einbildet, immer noch in sie verliebt zu sein. Er würde sie sich gern als seine Pariser Mätresse halten, und Sophie findet den Gedanken widerwärtig, aber die alte Bindung ist nun einmal da. Und genaugenommen, wenn sie sich nun wirklich auf Lebenszeit in Paris niederlassen sollte, wäre es wahrscheinlich auf Dauer gesehen gar nicht so schlecht, seine Pariser Mätresse zu sein: eine nette, verlässliche Einrichtung wie etwa die jährlichen Auftritte des Budapester Streichquartetts oder des russischen Balletts … Um die Lücken in ihrem Leben auszufüllen. Ein abscheulicher Gedanke. Was aber den jungen Mann in New York betrifft, so ist es überhaupt nicht klar, weshalb sie diesen merkwürdigen Briefwechsel fortsetzt, es sei denn, sie wäre tatsächlich dem Schicksal oder einem aberwitzigen Wahn in die Klauen geraten. Absurd und zum Verrücktwerden, dass sein Bild sie noch immer verfolgt, wo sie sich doch gerade auf ihr neues Leben in Paris einrichten sollte. Es geht einfach ums Überleben, sagt sie sich immer wieder; einen Teil ihrer Selbst in Briefform zurückzugewinnen. Denn es kann ja nichts daraus werden. Er ist einfach viel zu jung und viel zu versponnen. Sie muss an ihre Kinder denken. Es war einfach lachhaft, von einer Zukunft zu reden. In diesem Einvernehmen hatten sie sich auch getrennt. Aber jetzt diese Briefe, die seine und ihre Trauer und Resignation ausdrückten, allein schon die Tatsache, dass diese Briefe geschrieben wurden … Es ist schon teuflisch, denn sooft sie glaubt, es ist vorbei, dass sie nie wieder von ihm hören wird, am ersten Tag, an dem sie sich von seinem Phantom befreit fühlt, trifft unweigerlich ein Brief von Ivan ein. Sie beantwortet ihn natürlich auch. Es dauert eine ganze Woche, bis sie ihn aus allen Einzelheiten wieder zusammengeflickt, seine Zeilen mit früheren Briefen und Erinnerungen verglichen hat, um ihn dann in einem verschlossenen, gestempelten Umschlag in den Schlitz des CTP-Kastens auf den Weg zu schicken. Dann die Phase von Schmerz, Hoffnungslosigkeit, Erholung. Bis sein nächster Brief, allein schon die Schriftzüge auf dem Umschlag, das Vexierbild wieder aufsteigen lassen, und wieder vergießt sie Tränen der Wonne und des Jammers und verwünscht ihn im gleichen Moment, da sie sich hinsetzt, um den Zeremonialgegenstand zu rekonstruieren, damit er wie ein Brief aussieht.
Und trotzdem sind auch die Briefe an Ivan nicht ernst. Jeder ein elliptischer Entwurf zwischen zwei unmöglichen Extremen: zu ihm eilen oder ihn vergessen.
Sie muss praktisch, vernünftig denken. Eine Frau braucht Geld und einen Mann. Einen Mann braucht sie, damit sie anfangen kann, Geld zu verdienen. Einen Mann, der mit ihrem Geld umzugehen weiß. Sie muss wissen, wie sie mit Männern umgehen muss.
Eigentlich macht sie ihre Sache recht gut. Sie ist ja erst seit drei Monaten in Paris.
Eigentlich ist sie ziemlich verrückt.
Nimmt sie wenigstens ihr Buch ernst?
*
Es stimmt gar nicht, wie ihr Vater behauptet, dass Joshua ein hirnloser Rüpel oder dass ihre Tochter kalt wie ein Fisch ist, oder Joshuas Beschreibung seiner Schwester: sie habe eine natürliche Begabung, lästig zu sein – warum herrscht so wenig Liebe in der Familie?
Jonathan ist gar nicht doof, wie sein Bruder behauptet und ihm brüllend an den Kopf wirft oder wie er, spätabends mit seiner Mutter allein, ihr in einem Ton von betrübter Vertraulichkeit, der an seinen Vater erinnert, mitteilt: Ich sage es ja ungern, aber ich glaube, YoYo ist einfach dumm. Er soll ihn nicht YoYo nennen; er lässt sich bloß Zeit, und in der Schule kommt er gut mit … Besser als du damals, wenn du’s unbedingt hören willst. Na ja, er zuckt verächtlich mit den Achseln – die professionelle Gebärde seines Vaters –, er wurde ja in einer fortschrittlichen Schule eingeschult, ich musste ja – wenn ihr mich nicht dahin geschickt hättet – Genug, es reicht, jetzt gehen sie alle auf die gleiche Schule, und außerdem ist es Zeit, dass er ins Bad geht. Um Mitternacht ist es vielleicht so weit, sagt er, den Boiler prüfend, vorausgesetzt, der Gasdruck bleibt konstant. Allerdings, zwei Fingerbreit Wasser sind warm, der Rest des Tanks ist eiskalt. Sie bügelt weiter. Er bleibt hartnäckig beim Thema sein Bruder (nicht mehr die Schwester, das ergibt einen Abend für sich). Unter uns gesagt (er deutet in Gesten an, was er meint), du weißt schon, was ich sagen will – Er ist pummelig, schlägt sie vor. Das ist es nur zum Teil, ich meine das Ganze: seine Dusseligkeit und wie er lächelt und sich von allen herumschubsen lässt. Ich glaube, er ist wirklich blöd. Sophie weiß, dass Jonathan weder dumm noch einfältig ist. Er trifft nur in aller Ruhe seine Entscheidung oder versucht es wenigstens. Ob er es wohl schafft, bei diesem älteren Bruder, der eine Mischung aus einem Jago und einer Bombe ist? Was schaust du mich so wütend an?, fragt Joshua unschuldig. Wenn du dich nur halb so viel mit dir selbst beschäftigen würdest wie mit anderen Leuten … Und jetzt ab ins Bett, schneidet sie seinen nächsten Satz ab. Du kannst in der Früh baden. Was, ein heißes Bad vor dem Rausgehen? Bei den Schweden macht man das immer so. Jetzt sind wir also schon Schweden. Unter Darbietung seiner schmutzigen Füße krabbelt er unters Laken. Gerade will er ihr noch den Ausschlag auf seinem Hintern vorführen, aber dies kann sie mit fester Umarmung und Gutenachtkuss verhindern. Schlaf gut, mein Schatz. G’Nacht, Mama; sie entzieht sich; listig öffnet sich ein Auge: Ich merke immer, wenn du dich ärgerst.
In die Küche zurückgekehrt, läuft Sophie vor sich hin murmelnd auf und ab, bevor sie ihre Arbeit wieder aufnimmt. Ein Fluch. Eine Strafe. Auf sie ist die undankbare Aufgabe gefallen, der Ezra Blinds Mutter nicht gewachsen war. Aus ihrem Schoß ein zweiter Ezra. Aber nachdem sie ausgiebig geflucht und gebetet hat, Gott möge verhüten, dass ihr Zorn dieses unschuldige Kind treffe – lieber solle ein zweiter Ezra Blind zu ihr ins Bett kommen, auf dass sie ihn gegebenenfalls erwürge –, nachdem sie also genug geflucht und gebetet hat, weiß sie, dass Joshua keine böse Reinkarnation seines Vaters ist. Und wenn Jonathan auch ein bisschen aussieht wie Onkel Joske, der zum Landstreicher wurde … Und Toby, sie weiß schon, dass sie ihre Tochter durch zu viel Nachsicht verwöhnt hat. Sie hat fürchterliche Ängste, dass sie eines Tages vergewaltigt wird, auf einem weißen Pferd reitend, in ihrem Sonntagskleid, wie in diesem gräßlichen schwedischen Film. Aber sie weiß, dass das alles Unsinn ist. Sie weiß, dass Toby schon ganz in Ordnung ist. Sie weiß –
*
Das Heft liegt auf der ersten leeren Seite aufgeschlagen – leer bis auf den Fleck, den ein moskitoähnliches Insekt bildet, das spät in den Herbst hinein überlebt hat. Das aufs Blatt gefallen war und zitternd auf gebogenen Beinen dasteht, durchsichtig fast, blasser als sein Schatten. Natürlich kann man mit einem Insekt auf dem Blatt nicht schreiben. Man will es wegpusten, schüttelt das Heft, schnippt geschickt mit dem Finger, aber das todgeweihte kleine Monster lässt sich nicht entfernen, es haftet weiter, fest angewurzelt, mit winzigen, für das nackte Auge unsichtbaren Klauen in die poröse Substanz des Papiers verkrallt. Es gibt nur eine Lösung: eine Hand unter den harten Heftdeckel geschoben, ihn anheben und fest zuschlagen. Fest zugedrückt halten und bis zehn zählen. Es passiert so schnell, es kann gar nichts gefühlt haben, man weiß das. Sobald es richtig getrocknet und in das Papier eingezogen ist, kann man anfangen zu schreiben. Gut gelungen. Der Schlag hat das Insekt in einer überaus anmutigen Haltung fixiert; die Beine hängen wie im Flug herab, eins ausgestreckt, etwas länger als die anderen, die Flügel engelhaft gefaltet. Von einer schönen bräunlich-goldenen Färbung wie auf alten Stichen.
… Bewusstwerdung, ein lebenslanger Kampf. Weil ungezählte Aufbrüche, selten ein Ankommen – meistens irrig. Als Ausgangspunkt kann das zwar nicht belegte, dennoch folgenschwere Ereignis dienen, da die Kinderhand zum ersten Male Sophie Alexandra Landsmann (eigentlich Landsmann Sophie Alexandra, wie es bei den Ungarn üblich ist) auf den Deckel ihres Schulheftes schrieb; oder auch eines der ersten Male, als die Kinderhand diesen Namen schrieb, denn ohne Zeit kann es keine Erinnerung geben. Ein Kind, das seinen Namen auf sein Schulheft schreibt, bezeichnet den Ausgangspunkt für einen Kampf und nicht für eine Bewusstwerdung. Das Kommen und Gehen des Bewusstseins verläuft ohne Bezeichnung. Kein erstes Mal, kein Unterschied zwischen Kommen und Gehen. Unzählbar: Tropfen eines undichten Wasserhahns in einem verlassenen Haus. Der Kampf findet in der Zeit und gegen die Zeit statt, so viel ist gewiss. Das Ziel ist weniger klar. Die Start- und Ziellinien ziehen. Einen Kurs bestimmen. Aus dem Morast der Erinnerung und der Zersplitterung der Gegenwart etwas bergen – aber was?
*
Sie denkt an ihre glückliche Liebesaffäre in New York.
Seine Zunge ergießt unter ihren Lidern einen Regen von wolligen Mammutherden, Bisons, springenden Rentieren, einen wilden Eber mit Stoßzähnen. Ihr Kopf füllt sich und wird so schwer, dass er von allein davonrollt.
Wie würdest du unsere Beziehung definieren?, fragt er. Technisch gesehen sind wir ein Liebespaar, sagt sie nach einer Weile. Und nichttechnisch? (Ihr fällt kein Ausdruck ein, der umfassend genug wäre.)
Sie hat sich schon ganz gut daran gewöhnt, wie er herumhüpft und über die Möbel klettert. Normalerweise benehme ich mich nicht so, sagt er und schleudert mit den Füßen die Bettdecken in die Luft. Nicht doch, spricht sie im Schlaf, du lässt das ganze Wasser auslaufen. Und hat sich aus Protest zum Ball zusammengerollt. Hast du nicht noch mehr Decken? Er hat alles, was sich im Schrank befand, auf sie gehäuft. Er neckt sie mit einer Haarbürste. Aber sie weiß, dass er das nicht ist, greift nach seinem Handgelenk und zieht ihn hinein. Sie sehen ein, dass all dies sehr albern ist. Sie werden aufstehen und Zeitung lesen.
Der Tag hängt in der Schwebe – ein mattgoldenes Gewebe, auf welchem der Pinsel eines impressionistischen Meisters in willkürlicher Anordnung die vertraute Einrichtung eines New Yorker Apartments skizziert hat: die Whiskyflasche, die Nescafe-Dose, Dosensuppen und Gewürze auf dem Regal, eine aufgerissene Zuckerpackung, Aschenbecher, Zeitschriften und eine Obstschale auf dem Boden. Ein tropischer Garten auf Luft gemalt. Das Bewusstsein, zur Zeit ein wanderndes Organ, das tief im Rumpf eingebettet ist, passiert die pulsierenden Herzklappen und die Bauchhöhle, den Eingeweiden entgegen; das Bewusstsein, von außerordentlicher Schärfe, stellt in diesem Moment überrascht und belustigt fest, wie ein altes Rätsel sich in einer einfachen Darstellung entfaltet. Willkürlich oder unwillkürlich stürzt der Arm in den leeren Raum, streckt die Hand sich vor, um eine Birne zu ergreifen, und bleibt, ebenso grundlos, auf der Frucht liegen. Das Bewusstsein, inzwischen bequem in der Leber versunken, findet darin eine wundersame Bedeutsamkeit. Gern würde es sich davon Notiz machen; tut es aber nicht; genauso wenig wie etwa ein dicker Mann, von heißem Badewasser bedeckt, von seiner Offenbarung Notiz macht. Er kann es nicht. Das Papier würde ja nass werden. Außerdem ist es undenkbar, dass er seinen Arm aus dem Wasser hebt: es würde seine Einsicht beeinträchtigen.
Woran denkst du, fragt er, du bist so schweigsam. Sie lächelt. Alle Gedanken sind aus ihrem Kopf vertrieben. Ihr Gesicht ist nur noch Fleisch. Außerhalb, auf dem Bücherbord hockend oder von der Decke hängend wie eine kleine Harpyie, ringt die Sorge ihre Hände.
Sie lacht. In einem kurzen, phosphoreszierenden Aufflackern erblickt sie über die herabgesunkene Schulter des Geliebten das lächelnde, gezierte Haupt der Göttin, durch deren Laune sie ruiniert worden ist, und lacht zurück. Diese Visionen dienen nur der Zerstreuung.
Er hat ihr versprochen, ihr heute beim Verschnüren der Pakete zu helfen. Stattdessen lieben sie sich, nach dem Baden, wie vorauszusehen war. Es ist schrecklich, verliebt zu sein. Er ist schon aufgestanden, duscht schon wieder. Weinst du?, fragt er sie. Er hat sich gerade rasiert, legt sich neben sie und fragt: Willst du dich nicht anziehen? Und sie liegen da und sehen sich schweigend an, und das Schweigen wird weder lang noch schwer. Er setzt ihr Gesicht aus lauter Halbmonden zusammen.
Es ist ihm offensichtlich egal. Alle Stühle sind zerbrochen. Es gibt keinen Platz für das saubere Geschirr und die Wäsche. Sie wird eben selber Regale anbringen. Damit wenigstens –, sie beendet den Satz nicht. Alles hängt davon ab, aber sie kann es nicht erklären. Er spielt mit einem silbernen Maßband; zieht das stählerne Band hervor. Es springt von allein zurück, in sein winziges Metallgehäuse zurückschnellend, sobald er es loslässt. Er spannt das Stahlband um ihre Schultern: achtzehn Inch. Sie verlangt es jetzt, um sein Rückgrat zu messen; dann wickelt er es ihnen um die Taille, um den Hals. Gibt die Messwerte so schnell an, dass es unmöglich ist, sie festzuhalten. Warum muss es so sein?
Er misst jetzt Abstände, Entfernungen. Zwischen seinem rechten Ellbogen und ihrer Nase. Ihrem Bauchnabel und seinem linken Hüftknochen, ihrer rechten Brustwarze und seinem linken Auge. Der Rest ist Mutmaßung, sagt er. Drei, zwei, eins. Null. Minus vier, minus sechs, minus zehn.
Es ist mir egal, sagt sie. Mir ist es auch egal.
*
Schon beinahe Zeit, die Kinder abzuholen, und sie hat noch nicht einmal die Betten gemacht. Sie mag gar nicht dran denken, was sie ihnen zum Essen vorsetzen soll. Die Anstrengung des Schuheanziehens ist schon zu viel. Sie entsinnt sich, wie anders das alles einmal war – bei Sonnenaufgang aufgestanden, aufs Fahrrad geschwungen, vorn das Baby, Wäsche und Einkäufe am Lenker baumelnd, hinten noch ein Kind. Sie erinnert sich an die junge Ehefrau, stoisch und unschuldig. Es war schön, immer beschäftigt, immer überlastet zu sein; aufgebraucht zu werden, darum ging es im Leben, sie war damals schon fast durchsichtig geworden. Aber jetzt saß sie mit sich selbst fest, ein schmuddeliges Phantom, das sich an ihren Tagen mästete.
Es ist wie früher, das unverheiratete Mädchen, das Haar voller Knoten, groß wie ein Elefant – das alte unförmige Leid, lechzend nach einem Manne, der irgendeine Verwendung für sie findet. Quatsch. Sie war die Klassenbeste in … Sie hat die Salome gespielt in … Und wenn Ezra nicht gewesen wäre, dann … Quatsch.
»Also, was essen wir heute Abend?« Anstehen am Fleischmarkt am Place Maubert; auf Platten hochaufgeschichtet die glänzenden Organe, Herz, Hirn, Leber. Aufgereiht die gerupften Hühner, alle in derselben schüchternen Haltung: Hintern in die Höh’, Hälse verdreht und unter die Brust gesteckt, so dass der Kopf unter einem Flügel vorschaut. Reihenweise gehäutete Hasen, in ihren Fellstiefeln auf dem Rücken liegend, die Vorderpfoten über dem Kopf zusammengebunden, die Flanken gespreizt. – »Und, Mama, was kaufst du jetzt?« So also ging die Welt zu Ende.
»Heute soll Toby entscheiden … Wir wechseln uns jetzt immer ab –«, bringt sie mit Mühe hervor, aber die Kinder spielen nicht mit.
»Nein, Mama, du musst entscheiden; wir wollen, dass du es entscheidest.«
Sie kann ihnen doch nicht schon wieder Spaghetti vorsetzen … »Wie wär’s mit ›le Self-Service‹?«
»O ja, da gibt es einen Flipper.«
»Dann können wir Spaghetti essen!«
»Ja, ich will mit dem Flipper spielen.«
»Nein, es gibt heute einen Braten«, verkündet sie. Aber die Kinder zerren sie schon aus der Schlange fort, tanzen vor ihr her, ganz aufgeregt, und Joshua nimmt sie beim Arm, feierlich, wohlwollend, überlegen. »Lass es doch, Mama, ich weiß schon, du glaubst, das Flippern verdirbt den Charakter. Aber du verstehst nicht, dass man dazu einer gewissen Geschicklichkeit bedarf … also ist es eigentlich ein ganz pädagogisches Spiel«, folgert er und fügt hinzu, »komm schon, Mama, schau nicht so. Du solltest dir wirklich mehr Spaß am Leben gönnen …«
*
»Aber warum?« japst Ezra.
Er steht benommen im Flur, die Überschuhe noch an den Füßen, den Mantel halb aufgeknöpft, die Nachtreise im Zug ist noch auf seinem Gesicht zu lesen.
»Ich will nicht mehr mit dir verheiratet sein«, sagt sie zum zweiten Mal.
»Aber warum, Sophie?«
Der Ausdruck völliger Verblüffung auf seinem Gesicht straft die leiseste Vermutung eines Zerwürfnisses zwischen ihnen Lügen. Mit erstarrter Miene, den Pfeifenstiel zwischen den Zähnen, kämpft er mit sich um Gelassenheit. Ein gebrochener Mann, aber noch hat er seinen Stolz. Es ist schwierig, sich nicht davon rühren zu lassen. Sogar Ezra hat Momente der Schönheit: wie er jetzt dasteht, ausdruckslos vor sich hin starrend, wie ein von einem plötzlichen Schlag betäubtes Tier, einsam und verlassen – ein Fremder, als ob sie ihn bereits im Stich gelassen, auf die Straße geworfen, aus ihrem Leben entfernt hätte. Wenn er jetzt, ohne ein Wort zu sagen, ginge – sie könnte es nicht ertragen.
»So«, sagt er und holt noch einmal tief Luft, »so etwas muss ich mir also anhören, wenn ich zu dir komme, nach einer zwölfstündigen Reise.« Er legt ein kleines, längliches Schmuckkästchen auf den Tisch. »Ein Geschenk. Bitte nimm es an, du brauchst dich nicht bei mir zu bedanken. Na ja. Ich bin ein Narr«, sagt er trocken und kaut an seinem Pfeifenstiel.
»Wir haben das alles doch schon besprochen«, sagt sie, »und ich habe dir geschrieben …«
»Ich dachte, es sei erledigt, ich hab’ gedacht – Was ist denn nur in dich gefahren?« Er spricht stockend, weinerlich, aber mit vollkommener Fassung davon, wie sie im letzten Frühjahr, in den drei Tagen, die er sie in Paris besuchte, diese Sache besprochen und erledigt hätten – sie hatten die Fragen geklärt, ihre Schwierigkeiten aus der Welt geschafft: Paris war die Lösung.
»Ich glaube, ich habe dich mehr als großzügig behandelt. Was glaubst du denn, welcher Mann gestattet seiner Frau schon, in Paris zu leben?« Was die Auflösung ihrer Ehe betraf, das nahm er nicht ernst, natürlich nicht, das habe er nie ernst genommen, sagt er streng, jetzt mit bitterer Überlegenheit; zieht seinen Mantel, seine Galoschen aus und redet weiter. Ein verantwortungsbewusster Mann, der unter großem Druck steht, ein vernünftiger, geduldiger Mann redet zu einer Frau, die seine Geduld nicht verdient, eine verantwortungslose, kindische Person, überfließend vor Bosheit und Rachsucht, von unerreichbaren Träumen getrieben, jedem Realitätssinn abhold, eine Frau, die er wohl einmal geliebt habe und vor deren Torheiten er jetzt sein Heim, seine Familie schützen müsse. Zu dieser grausigen Pflicht sei er verdammt. »Es ist bitter«, sagt er. Sie sagt nichts. Man ist nie darauf gefasst, wie seltsam und grauenvoll sich diese Dinge dann tatsächlich abspielen. Es ist unerträglich.
»Kannst du uns nicht einen Tee machen?«, bittet er sie. Sie ist in der Küche. Sie kocht wirklich gern für ihn Tee. Es ist beruhigend. Verrückt, aber es ist so. Die kleinen Annehmlichkeiten, die einem das Leben erträglich machen. Vielleicht hat Ezra recht, und sie ist verrückt. Vielleicht hat Ezra unrecht, und sie ist trotzdem verrückt. Das Ganze einfach fallenlassen, alles nur dummes Gerede. Ihn mit eingeheiztem Bad, Frühstück und einem sauberen Bett empfangen, einfach weil sie es so will – er will es ja gar nicht, er macht ihr lieber Vorhaltungen und sucht Streit –, auch wenn sie Verachtung für ihn empfindet, sie tut es, ihrem eigenen seelischen Gleichgewicht zuliebe. Er kommt in die Küche.
»Gibt es etwas zu essen?«, fragt er und öffnet den Kühlschrank. »Wie üblich nur Kinderessen.« So war es schon immer. Ihr Hang zur Askese. Sie hat die alten Vorwürfe so satt, dass sie am liebsten einen Gänsebraten mit Knödeln kochen würde. Aber es ist einfach zu spät. Sie will ihn loswerden. Sie will ihn wirklich loswerden. Er weint in seinen Tee hinein. »Wir werden es nicht überstehen. Ich weiß, dass ich das nicht überlebe.« Also hat er es vielleicht doch akzeptiert. Sprachlos und erschöpft wartet sie darauf, dass er mit dem Weinen aufhört. In einer Stunde kommen die Kinder aus der Schule. Sie muss ihn dazu bringen, die Papiere zu unterschreiben, so sinnlos alles in diesem Augenblick auch erscheint. Ja, es ist einfach für alles zu spät, auch zu spät, um diese Ehe zu beenden. Aber es muss trotzdem getan sein.
»Also«, sagt er und greift nach ihrer Hand, »es ist erledigt. Lass mich doch bitte deine Hand halten. Du trägst den Ring nicht mehr, ich sehe es schon; aber wir sind noch immer verheiratet. Wir müssen uns beide bemühen. Ach, Sophie! Warum nur, Sophie!«
»Warum?« Sie ist aufgestanden und klammert sich an die Stuhllehne. »Ich habe es dir in New York gesagt und auf Ibiza, in Genua und in Paris, letztes Jahr und in diesem Sommer wieder; ich habe es dir wieder und wieder und wieder erklärt, und jetzt sage ich es dir zum letzten Mal: Die Ehe ist aus. Vorbei. Die Ehe ist vorbei.« Sie schreit die Worte.
»Bitte nicht«, protestiert er und hält sich die Ohren zu.
»Ich schreie, damit du mich endlich hörst, jawohl, ich schreie: Die Ehe ist aus!«
Er eilt zur Tür, murmelt vor sich hin; sie läuft ihm nach. »Du wirst dich jetzt nicht einfach verdrücken.«
»Das tu’ ich doch gar nicht. Nur, die Kinder …«
»Die Kinder sind in der Schule, und es ist mir egal, ob das ganze Haus mich schreien hört, DIE EHE IST AUS!«
»Bitte reiß dich doch zusammen, setz dich, lass uns in Ruhe darüber sprechen wie vernünftige, erwachsene Leute.« Der vernünftige Mann zu seiner verrückten Frau. »Es ist schließlich eine Lebensentscheidung, die das Leben von immerhin drei Kindern betrifft!«
»Wir diskutieren darüber seit sieben Jahren, Ezra, wir reden doch schon so lange darüber – ich habe nichts mehr zu sagen.«
»Es tut mir leid«, sagt er verunsichert, »du musst es mir nachsehen. Ich hatte die Situation ganz anders verstanden. Wir waren doch das letzte Mal so nett zum Essen aus, im Coupoie, mit den ganzen alten Freunden.« Die Sprache versagt ihm. »Vielleicht kann ich es wirklich nicht verstehen. Verzeih mir, aber ich brauch’ jetzt was zu trinken. Es ist mir alles zu viel.« Er nippt an dem Whisky, den sie ihm gebracht hat. »Ich will dich doch nur verstehen, ich werde dir überhaupt nicht im Weg stehen, dich gegen deinen Willen zu halten versuchen – was würde mir das nützen?« Die Stimme des Liebhabers, des Freundes. »Du bist ein aufrechter und edler Mensch. Die Frau meines Lebens. Ich weiß, dass ich versagt habe – bitte lass mich ausreden, ich erwarte nicht, dass du mir verzeihst. Ich habe mich damit abgefunden. Du sollst deine Freiheit haben, ich werde dir nicht im Weg stehen, das verspreche ich dir, aber ich muss es verstehen. Warum? Warum gerade jetzt, nach all den Jahren?«
»Sieben Jahre, Ezra«, sagt sie und starrt zum Fenster hinaus, »seit sieben Jahren rede ich schon davon.«
»War es denn wirklich so schrecklich mit mir?«, fragt er sie anlächelnd und gießt sich ein zweites Glas ein. »Sag es mir, Sophie, ich will die Frau, die ich geheiratet habe, verstehen – die Frau, von der ich mich scheiden lasse. Sprich mit mir, wir sind doch Freunde.«
»Nein«, antwortet sie kalt.
»Aber warum denn, Sophie?« Er ist beleidigt. »Gibt es vielleicht einen anderen Mann … Schau, es ist mir egal, mit wem du dich herumtreibst, aber unsere Ehe ist heilig. Wir haben es einander gelobt. Ich weiß schon, es ist wegen Nicholas. Aber das ist doch auch nichts Richtiges. Vielleicht gefällt dir plötzlich meine Nase nicht mehr. Ich traue dir jeden Leichtsinn zu. Nein, ich kann nicht in die Scheidung einwilligen, solange kein anderer da ist, der dich heiratet. Ich bin für dich verantwortlich. Du hast überhaupt keinen Grund, dich scheiden lassen zu wollen. Du willst einfach diese Ehe zerstören. Warum? Bist du im Wesen schlecht? Bist du darauf versessen, mich zu vernichten?«
»Ich will nicht mehr mit dir verheiratet sein.«
»Aber du musst mich doch gar nicht sehen. Wir leben in verschiedenen Städten. Ich lass’ dir doch völlige Freiheit. Von Zeit zu Zeit besuche ich dich, wir verbringen im Jahr einige Wochen miteinander wegen der Kinder – schau, Sophie, ich hab’ es weiß Gott nicht leicht mit dir, aber Ehe ist nun mal Ehe. Du kannst leben, wie du willst und mit wem du willst. Was verlangst du denn noch? Welchen Vorteil brächte dir die Scheidung?«
»Der Gedanke, mit dir verheiratet zu sein, treibt mich in den Wahnsinn.«
»Dann musst du einen Therapeuten aufsuchen. Ich kann meine Zeit nicht mit solchen Diskussionen verplempern. Wir haben wichtigere Dinge zu besprechen. Wann kommen die Kinder nach Hause?« Er schaut auf seine Uhr. Er will den Nachmittag mit den Kindern verbringen. All dies hat ihn sehr angestrengt; eigentlich müsste er jetzt etwas schlafen, aber er muss jemanden im Deux Magots treffen. Er wird rechtzeitig zurück sein, um die Kinder zum Essen abzuholen. Sie haben wichtige Dinge miteinander zu besprechen …
*
Bald ist es Weihnachten. Sophie versucht noch immer, mit der Zukunft klarzukommen. Mit dem Tatbestand oder mit der Vorstellung? Sie weiß es nicht, was das ist, die Zukunft. Ein Pseudoproblem, beschließt sie bei einem Spaziergang durch die Höfe des Louvre, infolgedessen nicht ernst zu nehmen. Außerdem vergeht die Zeit von allein, sie läuft ohne Benzin weiter, kann gar nicht anhalten.
Sie schlendert auf sandigen Fußwegen durch die Tuilerien und zermartert sich das Hirn mit der Frage nach der möglichen Beziehung der Schwerkraft zum Fluss der Zeit, wodurch diese ganze spektakuläre Masse einschließlich des Louvre auf den nächsten Augenblick zurast; da bemerkt sie, dass der Mann, der vor einem weißen Alfa Romeo stand und der ihr schon beim Betreten der Gärten am Carrousel-Eingang aufgefallen war, jetzt am Rue-de-Tivoli-Tor steht und sie beim Verlassen des Parks beobachtet. Es ist derselbe Mann in demselben teuren Kaschmir-Kamelhaarmantel, dem karierten Schal, der Baskenmütze und den schweinsledernen Handschuhen, der seinen weißen Alfa Romeo in sichtbarer Nähe des Tores geparkt hat. Er beobachtet sie beim Näherkommen: der Jägerblick des kultivierten Mannes. In derartigen Situationen (bevor man direkt angesprochen wird, sich aber der großen Wahrscheinlichkeit bewusst geworden ist) verfügt eine Frau über eine ganze Reihe von geheimen Kunstgriffen, die es ihr ermöglichen, ohne ihren lässigen Schritt oder ihren unscharfen Blick zu verändern, ohne dass sie abzuschätzen scheint.
… Es freut sie, die Aufmerksamkeit eines offenbar gutbetuchten und gutgewachsenen Herrn noch im besten Alter auf sich gelenkt zu haben, und, wer weiß, vielleicht befindet sich unter dem geckenhaften Äußeren – vermutlich lässt er sich das Gesicht massieren, und warum auch nicht? vielleicht findet sich da sogar eine Seele? Obwohl, mit größerer Wahrscheinlichkeit nur ein Trinker, der eine Frau mit Herz sucht. Klar, wieder einmal hat sie ein schwachsichtiger Weltmensch entdeckt.
Wo möchte sie gern hingehen? Städtische Umgebung ist bei diesen Vorverhandlungen immer ein Problem, es sei denn, der Mann selbst ist der Reiz, aber es gibt im Bois de Boulogne ein Lokal, das sie an Sonntagen mit den Kindern verträumt wahrgenommen hat. Sie ist nur begrenzt zum Selbstbetrug fähig; im Lederpolster zurückgelehnt, ist es ihr schon klar, dass sie dieser Mann höchstens als Reisebegleiter bei einer Spazierfahrt interessieren könnte, obwohl ein Spaziergang am Strand genauso angenehm wäre – in der Stadt braucht es ein dickes Portemonnaie. Er ist entzückt, dass sie ihn an einen so angenehmen Platz führt; über dem weißen Tischtuch und der silbernen Bouillonschale schaut sie hinaus auf die kahlen Äste. Sie nimmt ihr Lächeln von der feinen Zeichnung der Äste, die sich im Dunst verliert, und entlockt ihm damit eine Bemerkung, wie un-Parisienne sie doch sei, nordisch, geheimnisvoll – Zum Glück setzt die Sprachschranke – ihr beschränktes, sein unverständliches Französisch – dem Austausch von Hohlheiten bald Grenzen. Es beginnt mit den üblichen Scherzen (Sind Sie Fotomodell? Haben Sie das Auto und die Aufmachung gemietet?) und erweist sich als Variante der ewiggleichen Geschichte. Wohnt in der Nähe von Mailand; besitzt ein paar Fabriken. Frau und Kinder. Die Familie ist schon in Ordnung, nur er ist irgendwie nicht der Familientyp. Weiß gar nicht, was er ist. Interessierte sich einmal fürs Bergsteigen und für indische Philosophie.
… Kaffee und Dessert woanders einnehmen? Nein, sie will lieber den Wein austrinken, er ist wunderbar. Sie sollte sich den Namen merken – nein, besser nicht. Es ist herrlich, gerade einmal nicht Sophie Blind sein zu müssen. Es ist schon herrlich, im Auto diese andere Person zu sein. Warum sie lächelt, will er wissen. Ihre Antwort ein erneutes Lächeln, aus dem ein Kuss wird. Sie denkt daran, was ihre Tante zu ihr sagte, als sie zwölf Jahre alt war: du musst immer darauf achten, dass du saubere Unterwäsche anhast, auch wenn du nur über die Straße gehen willst; du weißt nie, ob du nicht von einem Auto überfahren wirst und die Leute dann deine Unterwäsche sehen. Während sie an einer Kreuzung stehen, hört sie ihn von der Garage reden; sie ist drei Häuserblocks vom Hotel entfernt, macht es ihr etwas aus, zu Fuß zu gehen? Er könnte den Portier bitten, aber er will seinen Wagen nicht n’importe qui überlassen. Es macht ihr nichts aus zu laufen; seine Zärtlichkeit für sein Auto findet sie ganz verständlich, es ist ein so heikles, empfindliches, kraftvolles Tier – sie ist auch schon ganz darin verliebt. Sie reden von Autos. Ihre Begeisterung für Maschinen, er findet das außergewöhnlich, Frauen interessieren sich meistens nicht für – natürlich, sie hat bisher keine Gelegenheit gehabt. Sie plappert von Schreibmaschinen, Plattenspielern, einem Motorroller, den sie einmal gehabt hat. Wie lange diese Euphorie wohl anhalten wird?, fragt sie sich. Ob sie wohl damit durchkommt? Im Fahrstuhl trübt der Gedanke, eine Hure zu sein, ihre Euphorie ein wenig (vielleicht durch die blöde Situation bedingt: in diesem aufsteigenden Sarg mit ihm eingesperrt zu sein, einer beliebigen Person, die ihr nichts bedeutet); er stört aber keineswegs ihre Leichtigkeit, ändert nur deren Tönung, was ja zum Besten sein könnte. Mit derselben Leichtigkeit geht sie weiter, ohne sich etwas vorzumachen, und er hindert sie nicht in ihrem Vergnügen. Als sie wieder zu sich kommt, empfindet sie keine Reue; die ganze Weinseligkeit im Akt der Lust abgeflossen, abgeleitet, völlig klar im Kopf, allein und auf seltsame Weise geläutert; nach einer Weile dann einfach leer und allmählich unruhig werdend. Sie entsinnt sich anderer Zimmer an anderen Orten … anderer Männer … Es ist hier eigentlich ganz schön, in dieser eleganten Suite des Georg V. Fayenceknöpfe hoch oben in der Wand, so dass man sich beim Duschen nicht zu bücken braucht. Schön, die leichten, weißen Decken – muss sie wirklich in einer halben Stunde schon gehen? Sie könnten sich ein frühes Diner aufs Zimmer servieren lassen. Er erklärt ihr etwas über seine Reise nach London: er würde sie ja einladen, mit ihm zu kommen, nur, dass ihn sein Schwager vom Flughafen abholen wird. Aber sie könnte ja ein, zwei Tage später nachkommen, und sie könnten gemeinsam durch Schottland fahren oder weiterfliegen nach.
Sie hat sich angezogen. Er will wissen, wie er sie wiedersehen kann. Sie lächelt, ihre Hand schon auf dem geschwungenen Messinggriff; vielleicht trifft man sich irgendwann wieder, an einem Nachmittag in den Tuilerien …
Sie schlendert durch die teppichbelegte Hotelhalle (vergewissert sich mit einem flüchtigen Blick auf die Zeitungsschlagzeilen, dass sich inzwischen nichts verändert hat, weder zum Guten noch zum Bösen) und hat ein gutes Gefühl, vor allem nach dem heißen Bad, bis sie am Eingang der Métro entdeckt, dass sie ihre Handschuhe entweder in seinem Auto oder im Hotel vergessen hat. (Im Hinblick auf eine solche Möglichkeit oder vielleicht aus anderen Beweggründen hat Sophie ihre Handtasche mit Hotel-Briefpapier und Seife vollgestopft, ein Fayencegriff vom Bidet – nichts, was dem Mailänder Geschäftsmann gehörte, von dessen Existenz sie nicht völlig überzeugt war.)
Gut für einen Nachmittag – aber zu anstrengend für einen umherstolpernden Millionär, den Leitstern oder auch nur einen exotischen Fisch darzustellen. Hat sie ihre Berufung verfehlt? Sie erinnert sich, wie sie vor zwei Jahren ein sehr reizvolles Angebot ausgeschlagen hat: eine Jacht, eine Villa in Nizza, ein Apartment in Paris. Er wollte, dass sie ihn nach San Francisco begleite. Es dauerte drei Tage, bis sie die Sinnlosigkeit erkannt hatte. Tut es ihr jetzt leid? Aber dann wären andere Dinge nicht geschehen. Und der steinreiche Tyrann, der meistens über die Fünfzig war, auch das war auf Dauer unmöglich – alles, was länger als einen Tag hielt, lief auf Dauer hinaus oder einfach auf vergeudete Zeit. Nein, es war einfach zu mühsam, sich in die Launen eines selbstbewussten, eitlen Mannes zu fügen oder sich dagegen aufzulehnen oder sie zu umgehen – sie wusste genau, dass sie diese Art von Geduld nicht besaß.
Selbstverständlich war ihr schon eingefallen, dass sie einen stolpernden Millionär für ihre eigenen Zwecke gebrauchen könnte, dies war eigentlich ihr Hauptanliegen. Es war gar nicht so sehr eine Frage der Mittel, und schon gar nicht ein moralisches Problem, es ging lediglich darum, dass man, um nach Rom zu kommen, nicht in den Shanghai-Express einsteigen sollte. In dem Fall ginge man besser zu Fuß. Der Shanghai-Express wäre vielleicht sehr vergnüglich, man könnte sich in einen Bahnhofsvorsteher verlieben oder vergessen, dass man je nach Rom hatte reisen wollen; eine Umwälzung des ganzen Lebens könnte stattfinden oder einfach nur ein Abenteuer. Alles war möglich, nur würde sie auf diese Weise nie nach Rom gelangen.
In ihrer Manteltasche ist der Brief nach New York, den sie gestern Nacht geschrieben hat; sie beschließt, ihn nicht abzuschicken.
*
Als sie spät in der Nacht heimkommt, liegt Ezra auf ihrem Bett.
»Was schaust du so schockiert«, sagt er lachend, »ich bin immer noch dein Ehemann.«
»Wo ist der Babysitter?«, fragt sie.
»Ich habe sie bezahlt und nach Hause geschickt. Es freut mich, dass meine Frau ausgeht. Aber du scheinst nicht sehr erfreut, mich zu sehen. Bitte schau doch etwas freundlicher.« Er erhebt sich, und sein Lächeln ist voll zärtlicher Nachsicht. »Hätte ich vielleicht besser draußen warten sollen, bis du zurückkommst? Ich wollte doch die Kinder sehen.«
»Du hättest mich im Voraus benachrichtigen können, dass du kommst.«
»Sophie, ich habe meine Vorlesungstermine extra so verlegt, dass ich dich sehen kann. Morgen Mittag muss ich wieder in London sein, und am nächsten Tag fliege ich nach New York weiter. Es war gar nicht so leicht, das einzurichten, und du bist sehr unfreundlich zu mir.«
»Also gut«, sagt sie, »dann lass uns zur Sache kommen. Ich habe dir vor einem Monat geschrieben.«
»Ja, ich habe deinen Brief bekommen.« Er steht auf und macht eine unglückliche Handbewegung. »Ich wusste nicht, was ich dir antworten sollte, Sophie, ich würde dich nie gegen deinen Willen halten. Aber Scheidung! Sophie, bist du dir eigentlich darüber im Klaren, welche Schwierigkeiten daraus entstehen, berufliche, medizinische, was das in Wirklichkeit für uns heißt? Wie stellst du dir das vor – eine Scheidung –, das ist finanziell undurchführbar, ich kann es mir nicht leisten. Scheidung ist ein Luxus für reiche Leute, arme Leute müssen miteinander auskommen. Ich habe dir gegenüber sehr viel Nachsicht und Milde walten lassen, ich habe dir in vielen Dingen nachgegeben, in zu vielen, aber ich habe dich entschieden zu weit gehen lassen. Es ist klar, dass du dir in den Kopf gesetzt hast, unsere Ehe zu zerstören, eine Zwanghaftigkeit, die schon von Anfang an da war. Nein, ich kann es nicht zulassen, einer muss ja die Verantwortung tragen.«
»Ezra, du hast es versprochen.«
»Unterschreiben? Ausgeschlossen! Was denn für Papiere? Du bist zum Anwalt gegangen? Unglaublich, meine eigene Frau, der ich mich und meine Kinder anvertraut habe? Du bist zu einem Anwalt gegangen. Meine eigene Frau fällt mir in den Rücken.« Er weint, reißt sich aber im nächsten Augenblick zusammen. »Es ist deiner unwürdig«, sagt er voller Abscheu.
»Wenn du dich weigerst, das Abkommen zu unterzeichnen, bring’ ich dich vor Gericht.«
»Aha, so ist das also. Du bist eine Schlampe. Na ja. Ich bin ja nicht der erste Mann, der …« Er brummt in sich hinein und geht ärgerlich auf und ab. Er will die Papiere sehen. »Bitte«, fordert er, es ist ein unwürdiger Gedanke, dass sie annimmt, er könne sie zerreißen. Er ist beleidigt, angewidert. Sie hat ein völlig falsches Bild von ihm, hält ihn für einen gemeinen Rohling, ungehobelt – das beweist nur, wie realitätsfremd –, er verlangt, die Papiere zu sehen, muss er denn so schreien? Die Blätter in der Hand, starrt er auf die erste Seite. »Juristisches Kauderwelsch, was soll denn das für eine Sprache sein? Ein Stück Papier. Zum Arschabwischen.«
»Manchmal kann das Leben von einem Stück Papier abhängen.«
Er kann das jetzt nicht lesen. Es ergibt keinen Sinn. Wenn sie Probleme hat, soll sie zu einem Psychiater gehen, nicht zum Rechtsanwalt. Ja, sie braucht einen Psychiater. Oder einen Liebhaber oder eine Tracht Prügel. Grün und blau schlagen müsste man sie. »Ich verprügel’ dich aber nicht, o nein, ich nicht.« Er stößt die Schuhe von den Füßen, wirft Hose und Jacke ab, deckt das Bett auf und legt sich hinein, deutsch und hebräisch vor sich hin murmelnd.
Sie steht da, starrt ihn sprachlos an.
»Gefall’ ich dir nicht in meinen Unterhosen? Ich weiß, ich bin lächerlich. Du hast mich dazu gemacht.« Er liegt auf dem Rücken, lächelt mit verschleiertem Blick. »Ich weiß, du hältst mich für unwürdig, für einen Lümmel«, er äfft den Widerwillen nach, den ihre ausdruckslose Maske von Würde verbirgt. »Ich weiß, ich weiß. Ich weiß, was du denkst und fühlst, alles. Du bist ein Kind, Sophie, ein reines, vornehmes Kind; ich verstehe dich«, er lädt sie ein, ins Bett zu kommen, mit ausgestrecktem Arm und verzücktem Lächeln. »Setz dich zu mir; morgen muss ich fort, und es ist vielleicht das letzte Mal, dass wir …«
Sie wünschte, sie wäre nicht mehr in diesem Zimmer. Ihr Mantel liegt über der Stuhllehne; sie möchte einfach rausgehen, einfach weglaufen und atmen können. Aber sie kann nicht einfach fortgehen, wegen der Kinder und weil sie seine Unterschrift braucht. Mit leiser Ironie fährt er fort: »Sieh es doch als Geschäftsvorschlag an. Ich bettle nicht, und ich werde dich nicht zwingen. Wir leben im zwanzigsten Jahrhundert; als Frau hast du deine Freiheit, und ich will, dass du eine rationale Entscheidung triffst. Ich hoffe, dass du mich vielleicht eines Tages gern haben wirst. Hoffen kann ich ja schließlich, aber ich akzeptiere auch deine feindseligen Gefühle. Ich möchte, dass du dies als ein Angebot betrachtest, das deinen Interessen, beruflichen Vorstellungen und deinem Geschmack entgegenkommt. Ich weiß, wie wichtig es für dich ist, in der richtigen Umgebung zu leben. Wir haben so schwierige Jahre hinter uns; jetzt kann ich dir zum ersten Mal das bieten, was du dir immer gewünscht hast.« Eine Kulturstadt, fügt er hinzu und erinnert sie, dass sie schon immer in Europa hatte leben wollen; den Sommer könnte sie immer in Griechenland verbringen. Was ihre Pariser Wohnung beträfe, dazu fielen ihm alle möglichen Lösungen ein. »Klingt das nicht vernünftig?« fragt er und sagt: »Sei doch vernünftig.«
Sie kann nicht vernünftig sein, wenn sein Vorschlag auch noch so vernünftig klingt – vernünftig und verlockend für jemand anders. Sie kann aber nicht dieser andere Jemand sein. Auch wenn ihre eigene Stellung unbegründbar ist, sie hat eigentlich gar keine Stellung, gar keine Pläne, hat gar nichts. Sie kann sich nur auf ihre Gefühle verlassen. Daher muss sie ablehnen. Vielleicht befindet sie sich in Wirklichkeit in einem anderen Zimmer, eine junge Frau, die Ezra Blinds Heiratsantrag vor fünfzehn Jahren anhört. Diesmal muss sie nein sagen.
»Sicher haben wir Fehler gemacht«, sagt er gerade, »aber wir sind keine Kinder mehr. Ich habe mich verändert, Sophie, ich verspreche es dir.«
Auch wenn es ihm wirklich ernst ist, sie kann es sich nicht verzeihen, dass sie beim ersten Mal den Fehler gemacht hat, noch kann sie riskieren, diesen Fehler zu wiederholen. Auch wenn es vernünftig sein sollte. Manchmal ist es absolut erforderlich, unvernünftig zu sein.
»Ich will dich nicht bedrängen, du musst dich jetzt nicht entscheiden. In zwei Wochen komme ich wieder nach Paris. Denk inzwischen darüber nach, Sophie«, sagt er abschließend, »und jetzt, nachdem wir uns in aller Freundschaft ausgesprochen haben …« Er bittet sie, ins Bett zu kommen. Es ist nach drei Uhr früh, bemerkt er, und schließlich gehört sich das so. »Aber warum denn nicht, Sophie?« Er lacht. »Komm, ich werde um dich werben. Sophie, du weißt doch, auch wenn ich mich mit anderen Frauen rumtreibe, du bist doch die Einzige, die ich je geliebt habe. Du bist die einzige Frau, die mich wirklich erregt hat.« Er wird es ihr beweisen, auf der Stelle. Sie legt sich nicht hin. Sie verlangt, dass er ihr Bett verlässt. Lachend steht er auf, legt den Arm um sie und zieht sie aufs Bett.
»Nein, Ezra, bitte nicht. Die Kinder wachen sonst auf.«
»Aber warum denn nicht? Merkwürdig. Du bist wirklich seltsam.« Er lächelt sie erstaunt an. Nicht mit ihrem eigenen Mann schlafen, wo sie doch mit anderen Männern schläft? Er weiß Bescheid – ihre Affäre mit Roland und die mit einem reichen, jungen Kunstliebhaber, den sie über seine Freundin kennengelernt hat. Er weiß alles, und es ist ihm ja recht, wenn sie ihren Spaß dran hat. Man kann ihm wirklich nicht vorwerfen, dass er nicht großzügig sei, ihr Ehemann. »Komm schon, sei doch nett zu mir. Leg deinen Kopf ruhig auf meinen Arm, hab keine Angst«, lacht er. »Na gut, dann leg ihn aufs Kopfkissen.«
»Ich kann nicht«, flüstert sie.
Seine Hand beginnt, ihre Brüste zu streicheln, er lacht noch immer. »Aber Sophie. Baby. Weinst du? Ich weiß, wie du dich fühlst. So schlimm kann es doch nicht sein. Tu einfach so, als wär’ ich ein Fremder. Nicht weinen, bitte nicht weinen …« Sie steht vom Bett auf. »Was ist denn los? Komm zurück, Sophie.«
»Ich kann nicht«, sagt sie, während sie ihren Mantel anzieht.
»Was kannst du nicht?«
»Ich kann nicht vergessen, dass ich dich einmal geliebt habe.«
»Wo gehst du denn hin?«
Sie muss sich etwas Bewegung verschaffen, sagt sie ihm ruhig. Nein, allein, sie muss jetzt allein sein. Es ist schon in Ordnung, versucht sie ihn zu beruhigen. Um sieben ist sie zurück, wenn die Kinder aufwachen.
»Geh wieder ins Bett. Ich gehe schon. Zieh deinen Mantel aus.« Sie wird den Mantel nicht ausziehen, bis er nicht fort ist. Sie will, dass er geht. »Jetzt. Sofort.«
»Ich darf mich doch hoffentlich anziehen. Du willst also wirklich, dass ich gehe?« Man könnte beim Zuschauen rasend werden – er bringt es nicht fertig, sein Hemd ordentlich reinzustecken. Er plärrt schamlos wie ein Kind, die dicken Tränen fallen auf seinen Schuh. Vielleicht wäre es besser gewesen, mit ihm ins Bett zu steigen – einfach so, irgendwas machen, einander an den Ohren ziehen oder was … »Ich geh’ schon, ich gehe …«, schluchzt er, während sie vor Wut zittert. Aber er geht sehr langsam. Er ist draußen. Sie verriegelt die Tür. Aber er ist gar nicht weg. Sie hört ihn noch auf dem nächsten Treppenabsatz heulen. »Die Einzige, die mich je wirklich geliebt hat … ich weiß … ich weiß … keine Frau wird mich je …«, hört sie ihn im Stiegenhaus jammern. Er will es ja so haben. Ezra gewinnt immer. Nach einer Weile geht er. Natürlich. Seine Verrücktheit geht immer nur bis zu einem gewissen Punkt.
Und in zwei Wochen ist er wieder zurück und spielt dieselbe komische Todesnummer von vorne.
*
Es läuft darauf hinaus, dass sie keine Wahl haben. Sie liest den langen Brief aus New York noch mal, eigentlich kein Liebesbrief, findet sie, aber es wird daraus deutlich, dass er ihre Beziehung ebenso wenig abbrechen kann wie sie. Er kann ihr Schweigen als Abbruch der Beziehung nicht akzeptieren. Ein richtiges Ende ist unter den Umständen unmöglich, aber kein Ende ist unerträglich. Wie ein unvollständiges Buch, zum Verrücktwerden; man weiß, dass irgendwer die fehlenden Seiten besitzt; die Adresse auf dem Umschlag, der vor ihr liegt – oder, wenn in Schicksalshand, umso mehr Grund für sie, diese Reise zu unternehmen. Ein Wahn … Eine Notwendigkeit … Sie muss die Reise unternehmen, allein schon um den Mythos zu zerstören, der sich von menschlicher Zeit nährt, der mit jedem Brief wächst, der geschaffen wird von einer Wasserschranke, Meilen bloß, die sich in Flugstunden umwandeln lassen, und diese wiederum in französische Francs …
Vielleicht will er ihr nur immer weiter Briefe schreiben; will, dass sie ihm immer wieder schreibt …
Was eigentlich in dem Brief stand, den Sophie am Ende doch stempelte und in den Schlitz des blauen CTP-Kastens steckte, entzieht sich des Zugriffs. Als eine Woche später Ivans Antwort kam, stieg sie gerade die schäbige Treppe hinauf, mit Flaschen von limonade, Vichy, vin ordinaire, baguettes beladen, den Brief oben auf der vollgepackten Einkaufstüte hielt sie mit ihrem Kinn eingeklemmt. Bis zum vierten Treppenabsatz widerstand sie der Versuchung, ihre Last abzustellen, um den Brief zu lesen, dann gab sie nach. Mit der nächsten Post ein weiterer Brief von ihm, in dem er schrieb: »… vergiss, was ich dir in einem Anfall von Wahnsinn in meinem ersten Brief geschrieben habe …«, der aber im Wesentlichen dieselbe Aussage enthielt – sie riss ihn auf ihrem Weg aus dem Haus auf und las ihn, während sie den Boulevard hinuntereilte. Über den ersten Brief musste sie weinen. Über den zweiten lachen.
Welchen Sinn hatte das Leben für Sophie auf dem Flug nach New York, wo sie zur Regelung ihrer Angelegenheiten hinflog, um sich in Paris richtig einrichten zu können? Keinen.
Welchen Sinn hatte das Leben für Sophie auf dem Flug von New York, nachdem sie ihre glückliche Liebesaffäre gehabt hatte? Keinen.
Welchen Sinn hatte das Leben für Sophie, als sie die Maschine in Orly bestieg, um zu ihrem Liebhaber zurückzufliegen? Welchen Sinn würde ihr Leben nach ihrer Ankunft dort für sie haben, nach einer Woche, einem Jahr, nach zehn Jahren –?
Über den Sinn seines Lebens nachzudenken und zu grübeln hatte Sophie immer für eine unnütze und müßige Beschäftigung gehalten. Schlimmer als unnütz, es war eindeutig gesundheitsschädlich. Kurzum, eine schlechte Angewohnheit. Und wie die meisten schlechten Angewohnheiten wurde auch diese einem von anderen Leuten aufgedrängt und von ihnen gefordert, von ihren Urteilen, die in ihren Fragen oder Behauptungen enthalten waren. Mit der Sinnlosigkeit der Urteile anderer Leute konfrontiert, zog Sophie natürlich ihre eigene Form von Sinnlosigkeit vor. Mit der Zeit begriff sie, dass sie umgänglicher werden musste, wenn sie Auseinandersetzungen vermeiden wollte. Schweigen allein bewirkte noch keine Besänftigung, auch Nicken und Lächeln reichten nicht aus.
Leute wollten immer eine Aussage haben. Meistens sprach Ezra für sie. Sie fand es ganz in Ordnung, wenn er in einer Gesellschaft ihre Meinung vertrat. Sie selbst würde sich nie so ausdrücken, auf keinen Fall so geschickt und überzeugend, wie Ezra es tat; sie könnte es gar nicht, sie konnte diese Art von Aussage überhaupt nicht machen. Die Aussagen, die Ezra für sie oder über sie machte, setzte er aus ihren Gesprächen, ihren Bemerkungen über Bücher, die er ihr zu lesen gegeben hatte, zusammen. Die daraus resultierende Aussage war weder richtig, noch war sie falsch; sie war einfach Ezras Erfindung für ein Zimmer voll Leute, die sonst das Schweigen seiner Frau als beleidigend empfunden hätten.
Es war seltsam, ein wenig peinlich, wenn Ezra in ihrem Beisein von ihr oder über sie sprach, als ob sie in einem Trancezustand oder abwesend sei. Gewiss, sie hörte meistens nicht zu – war sich nicht einmal bewusst, dass sie nicht zuhörte. Sie vergaß jedoch nie, dass sie als Ezras Frau an der Gesellschaft teilnahm; dass sie unter diesem Deckmantel überall und nirgends sein konnte, irgendwer und niemand. Vielleicht genoss sie dies zu sehr, wie Ezra ihr vorwarf, wenn sie allein waren. Er beschwerte sich, dass sie ihn die ganze Unterhaltung allein bestreiten ließ, sie, die das ganze Gequassel für so beschissen hielt, ließ ihn armen Deppen –! Wie einfach doch alles für sie sei, wie überaus günstig für sie, einen so getreuen Diener und Dolmetscher zu haben. Was wäre das delphische Orakel ohne einen Deuter? Ein stinkendes Loch. Während Ezra sich selbst und sie in diesen Rollen parodierte, mochte sich Sophie gefragt haben, wo sie denn nun wirklich stand.
Sogar dann, wenn Sophie Ezra nicht ausstehen konnte, liebte sie die Ehe. Sie war ein vielschichtiges Gewand, an dessen Schwere sie Gefallen fand. Es zu tragen, erleichterte, vereinfachte die Situation, wenn man ein volles Zimmer betrat, es rechtfertigte ihre Anwesenheit im Raum. Es war immer da, ein gebrauchsfertiges Kleid für öffentliche Anlässe. Ezras Frau; das war die Antwort für jeden, der sie kennenlernen wollte. Sie war die Frau, die Ezra Blind geheiratet hatte. Das hatte Gewicht und Kraft: wie ein undurchlässiger Mantel wehrte es dem unvermeidlichen Schwarm von Neugierigen, Geschwätzigen, Streitsüchtigen, Ausfragenden. Das Gewand diente dazu, die verbindlichen Auszeichnungen und Etikette entgegenzunehmen, es verschluckte die unvermeidlichen Flecken, sein Stoff ließ sich gefälligst falten und dehnen. Es rettete ihr die eigene Haut. Wie sollte man ein so vielseitig verwendbares Kleidungsstück nicht schätzen?
Was Ezra anging, so witzelte und jammerte er zwar über seine Frau, aber er wusste sehr wohl, dass er einen Schatz besaß. Sie war anders als andere Frauen. Er erzählte ihr von anderen Frauen, wenn sie im Bett lagen, Frauen, die er vor ihr gekannt hatte oder von denen er gerade kam – denn er hatte gelogen, er war gar nicht in der Bibliothek gewesen oder mit Rabbi X spazieren gegangen; im Bett mit ihr konnte er ihr ja die Wahrheit sagen, weil sie die einzige Frau war, die er liebte. »Ich weiß nicht, warum«, sagte er und gab eine lange Reihe von Gründen von sich, warum er wisse, dass er sie lieben müsste, obwohl es nicht das Natürliche für ihn sei. »Ich weiß wirklich nicht, warum ich dich liebe«, sagte er, weil sie nicht so sei wie andere Frauen, die er gekannt oder begehrt habe. Sie sei schwierig und unmöglich, aber auch nicht, wie andere Frauen das wären, die nörgelten, klammerten, forderten – außer wenn sie in Verzweiflung geriete, dann wisse er wenigstens, wie er sie behandeln müsse: sie verspotten, verprügeln, sie bumsen, sie umwerben, beschimpfen, trösten; dann sei sie genau wie andere Frauen auch. Aber nicht genug, beschwerte sich Ezra. Er erzählte ihr, was andere Frauen aus Verzweiflung täten, wie tief sie sinken, in welche Abgründe von Obszönität und Perversion; wie gern sie sich demütigen, herabwürdigen ließen, darum bettelten, dass man sie zertrample. Sie sei im Grunde leider nicht masochistisch veranlagt, seufzte er. Bei ihr wären Prügel nur rein zweckmäßig, kein erotisches Erlebnis wie bei einer anderen Frau, die er kenne, die auf allen vieren herumkröche und ihn anwinsele, dass er sie auspeitsche, die sogar seine Scheiße fressen würde – jawohl, sie bettelte ihn darum an. Sophie war nicht sonderlich beeindruckt. Sie brachte es nicht einmal fertig, richtig eifersüchtig oder beleidigt zu sein. Ihr Vater hatte ihr schon als Mädchen erklärt, warum Männer zu ihrer Lust die Obszönität brauchten, warum es nicht ganz einfach sein konnte. Und das war das jetzt. Und wenn sie es immer noch ganz einfach haben wollte, meinte Ezra, so käme das daher, dass sie ein Kind sei und von unverbesserlicher Romantik. Für sie war es eine persönliche Geschmacksfrage, dass ihr Ezras Praktiken missfielen; sie weigerte sich aus Prinzip, ihn nach den Regeln der Gesellschaft zu beurteilen. Sie hatte nie eine bürgerliche Ehe haben wollen, und wenn sie je der deprimierende Gedanke befiel, in die Falle einer bürgerlichen Ehe geraten zu sein, dann versicherte ihr Ezras Verhalten, dass dem doch nicht so sei. Was für eine Art von Ehe wünschte sich Sophie? In erster Linie hatte sie überhaupt nicht heiraten wollen. Ezra hatte heiraten wollen. Ezra war zutiefst schockiert gewesen, als sie auf seinen ersten Heiratsantrag geantwortet hatte, sie könnten doch in wilder Ehe miteinander leben; seine Reaktion hatte sie überrascht, amüsiert und schließlich gerührt, denn er hatte sich als Freigeist und Kosmopolit vorgestellt, außerdem lagen sie gerade miteinander im Bett; Ezra, noch immer durch ihre Frivolität gekränkt, behauptete, er habe sie nur defloriert, weil er ganz sicher angenommen habe, dass sie heiraten würden. Warum er so darauf bestand, konnte er selbst nicht erklären, das faszinierte sie daran. Ezra glaubte auch nicht an die bürgerliche Ehe, auch nicht an die jüdisch-orthodoxe. War es der Jude in ihm? Der Mann in ihm? Etwas, was sie als Frau nie würde verstehen können? Sie war sich noch unschlüssig, ob sie Ezra überhaupt mochte oder nicht; vorrangig beschäftigte sie sein feierliches Beharren auf einer Ehe, und als sie ihr Jawort gab, galt es eigentlich der Ehe selbst, ohne dass sie über ihre Gefühle für Ezra mit sich ins Reine gekommen wäre. Als sie dann verheiratet war, war sie froh, dass es so gekommen war; wer weiß, ob sie sich je für Ezra hätte entscheiden können. Und wie unwichtig das war! Erst nach der Eheschließung wurde ihr so richtig klar, dass es die einzig natürliche und respektable Lebensform war. Das Zusammenleben zweier Menschen, Mann und Frau, hatte eine naturgegebene Richtigkeit; diesen Sachverhalt ein für alle Mal festgesetzt und geregelt zu haben, um nicht seine ganze Zeit damit verbringen zu müssen, weiter Umschau zu halten oder endlos seine Gefühle zu zerpflücken – das war der große Vorteil der Ehe. So kam es, dass Sophie, die im Prinzip noch immer gegen die Ehe war, sie in der Praxis durchaus genoss; sie genoss die fraglose Zweisamkeit, die unabhängig von Launen, Zu- oder Abneigungen fortbestand, die keine Vernunftsgründe brauchte und auch nicht von Vernunftsgründen zerstört werden konnte; Ezras Fremdgehen verblüffte sie mehr, als dass es sie verletzte – sein Bedürfnis nach Abwechslung, an dem, wie sie wusste, nicht ihr Ungenügen schuld war, ebensowenig wie ihrer Treue etwa ein tiefes Gefühl für Ezra zugrunde lag – sie waren einfach verschieden.
Ihre Unschuld sei zum Wahnsinnigwerden, tobte Ezra. Er brachte sie in obszöne Stellungen, aber egal, was sie tat, sie war immer von unverbesserlicher Keuschheit. »Ein kouros – ein keuscher Knabe«, nannte sie Ezra. Es machte ihn wahnsinnig, völlig wahnsinnig, und trotzdem entzückte es ihn. »Nero wäre von dir völlig hingerissen gewesen«, sagte Ezra. Ein zweifelhaftes Kompliment, fand Sophie, und unter diesen eigenartigen Umständen erschien ihr die Erfüllung der ehelichen Pflichten überaus paradox.
»Wieso suchst du dir eigentlich keine Männer –?«, fragte sie ihn schließlich. »Sodomie ist doch mehr was zwischen Männern.«
»Ich hab’ schon dran gedacht«, gab Ezra zu.
»Und warum nicht?«
»Ich fürchte, ich wäre dann die ›sie‹«, gestand Ezra.
Wollte also nicht die »sie« sein. Der Jude in ihm.
»Warum liebe ich dich nur?«, faselte Ezra in der Nacht. »Warum komme ich immer zu dir zurück?«.
Und mit seiner Frage gab er die Antwort, die er lieber mit einem Fragezeichen versah als mit einem Schlusspunkt.
Es war seltsam mit Ezra. Ezra stand immer auf der Bühne: manchmal trat Sophie mit ihm auf und sagte ihren Text auf, manchmal war sie wie ein Gassenjunge, der durch die Bühnenbretter späht, um den Auftritt des großen Komödianten zu erhaschen. So ging es hin und her wie in einem schlecht geschnittenen Film, und immer war da eine Frau, die wartete, eine Frau, die schon im Bett lag, die das Licht vielleicht schon ausgeknipst hatte; eine Frau, die wartete, dass er wortlos im Dunkeln zu ihr käme; eine Frau, die etwas von diesem Manne wollte, das nur er ihr geben konnte und das er nur ihr allein geben konnte. Eine Frau wartete auf ihren Mann. Und die Komödie gefiel ihr letztlich auch, vor allem, weil sich Ezra dabei so maßlos amüsierte; vielleicht glaubte sie allmählich auch an die Rollen, die Ezra ihnen zugeteilt hatte, vielleicht lebte sie darin und hatte Gefallen daran, wie Ezra ihr vorwarf.
Eine andere Frau wartete und sehnte sich nach der Wirklichkeit. Mit der Zeit wurde es Sophie mit zunehmend hoffnungsloser Deutlichkeit bewusst, dass all dieses Verstellspiel die schreckliche Wirklichkeit zwischen ihr und Ezra war, dass es gar nicht anders sein konnte; vielleicht hatte sie schon die ganzen Ehejahre mit Ezra gewusst, dass es mit Ezra nie anders sein würde, und die ganze Zeit war sie eine andere Frau, die auf einen anderen Mann wartete, sosehr sie diese Tatsache vor sich selbst auch zu leugnen versuchte, weil sie ein sauberes, anständiges Leben führen wollte. Ezra merkte das, Ezra hatte von Anfang an begriffen, dass ein Mann wie er Sophie nicht glücklich machen konnte, und er zog sie immer damit auf. »Ich weiß, wie der Mann, der dich beglücken könnte, sein muss«, sagte er und beschrieb ihn ihr mal im Spaß, mal im Ernst: den Mann, der seiner Frau gefallen würde; teils improvisierte er, teils beschrieb er wirkliche Männer, die er als Gäste ins Haus lud; und Sophie gab sich immer vollkommen desinteressiert, weil sie ein anständiges, sauberes Leben führen wollte, mehr als das wollte sie gar nicht; aber sie wünschte es sich dafür umso mehr, weil Ezra für Anstand und Sittsamkeit nur Hohngelächter übrig hatte.
Dass zwei Menschen in Einsamkeit und Opposition einen gemeinsamen Weg beschreiten, das hatte sie als zur Ehe dazugehörig anerkannt. Dass aber ihr Glaube, Wille und Stolz dabei aufgebraucht werden sollten, das konnte Sophie nicht akzeptieren. Und als sie dann erschöpft waren, konnte sie es weder Ezra noch sich selbst verzeihen. Sosehr sie auch Ezra seine Dummheiten zur Last legte, sich selbst gab sie viel größere und unumschränktere Schuld dafür, dass sie Ezras Dummheiten erlegen war. Sie versuchte sich einzureden, dass sie Ezra nicht verließe, weil sie erledigt war, sondern weil sie die Niederlage in dieser Ehe ablehnte, sowohl Ezras wie auch ihre eigene, selbst wenn nichts von ihr übriggeblieben war als die Kraft zu dieser Verweigerung. Aber eigentlich ergab das keinen Sinn; und am Ende konnte sie es sich selbst nicht mehr erklären, warum sie Ezra verließ, wieso ausgerechnet jetzt und nicht vor drei Jahren oder nächstes Jahr. Jetzt musste sie das anderen Leuten erklären – Ezra, ihrem Anwalt, der Familie, den Kindern, den Freunden in Paris und New York. Sich selbst hatte sie nichts zu sagen.
Sie hatte keine Lust, mit Ivan, den sie gerade kennengelernt hatte, ihre Ehe zu erörtern. »Ein Missgeschick«, sagte sie zusammenfassend; es störte sie die Art, wie er sie zu diesen Erklärungen zwang, weniger durch direktes Befragen als dadurch, dass er ihr Ausweichen unterhöhlte und seine eigenen Schlüsse zog, gegen die sie sich verwahren musste, bevor er zu weit gegangen war. Anfänglich war es einfach nur lästig, sich gegen sein indirektes Bohren zur Wehr setzen zu müssen, wenn sie sich trafen, um über seinen Untergrundfilm oder ihr Buch zu reden, aber als die Diskussion sich im Verlauf der Woche vertiefte und sie einsehen musste, dass Ivan das Spiel besser beherrschte als sie – sowohl das Erfinden von Umgehungen als auch das Konstruieren von Theorien –, da begann sie sich zu fragen, warum Ivan so sehr daran interessiert war, ihr Verhältnis zu Ezra zu verstehen. War es, um sie verstehen zu können? Aber sie war es doch gar nicht mehr, jedenfalls nicht, wie sie von ihm gesehen werden wollte. War es, um zu verstehen, wie eine Ehe zusammenbricht, insbesondere, was eine Frau einem Mann niemals verzeiht; war es wegen seiner eigenen Zukunft oder wegen eines Films, den er einmal drehen würde? Und darauf hatte sie auch keine Antwort.
Ganz gleich, welche Klärung Ivan vielleicht für sich selbst daraus hatte ziehen wollen, er versuchte jedenfalls, ihr eine andere Sichtweise ihres Lebens zu vermitteln; dies hatte Sophie von Anfang an gespürt und war gerührt von Ivans Ton eifersüchtiger Besorgnis und seiner respektlosen Witzelei über Ezra. Ihre Situation erregte seinen Zorn. Er könne es nicht ertragen, Männer wie Ezra als Sieger hervorgehen zu sehen, erklärte er weiterhin, und er befürchtete, dass sie am Ende doch zu Ezra zurückkehren würde, da er hinter ihrem Ausweichen die Unentschlossenheit spürte. Aber warum sollte ihn das quälen?
Und warum wollte sie Ivan immer wiedersehen? Obwohl diese Gespräche sie beunruhigten und sie sich in seiner Gesellschaft unwohl fühlte – oft genug war er launisch, missmutig, wortkarg, oder wenn er sprach, dann so, als säße er irgendwo im außerirdischen Raum. Erst nachdem sie sich umarmten, wusste sie, dass sie sich seit Wochen eben danach gesehnt hatte.
Jetzt hätte sie gern aufrichtig mit Ivan gesprochen, und sie wusste nicht, wie; plötzlich musste sie infrage stellen, ob sie Ezra überhaupt jemals geliebt habe, angesichts der Liebe, die sie jetzt empfand. Ein Teil von ihr hatte sich hinter ihrem Willen, Ezra zu lieben, versteckt und nie daran teilgenommen. Irgend etwas in ihr hatte sich in der Ehe mit Ezra nicht verändert, und sie hatte es damals als ein gutes Zeichen angesehen; erst jetzt, da das Erlebnis der Liebe sie ganz verändert hatte, musste sie alles neu sichten.
Einerseits die Erkenntnis, dass sie sich Ezra nur geliehen, auf Lebensfrist verpachtet hatte, wobei sie aber einen Teil ihrer Selbst zurückbehielt – andererseits ihre völlig unabsichtliche, planlose Hingabe an Ivan, mit dem sie lediglich eine glückliche Liebesaffäre von drei Wochen genießen wollte; sie wusste nicht, worin da der Sinn lag. Vielleicht lag es an der vorgegebenen Situation: die Ehe erforderte ein Darlehen; wahre und rückhaltlose Hingabe konnte nur stattfinden, wenn kein Gedanke an Dauer auftauchte. Das konnte sie aber nicht ernsthaft glauben; sogar ihr stilles Glück mit Ivan hatte eine Beimischung von Falschheit – welche von beiden akzeptiert und als verkehrt empfunden wurde. Was einfach war, musste verschleiert werden; indem er mehr sein wollte als nur ihr Geliebter, spielte er die Rolle des Geliebten mit einem Anflug von zärtlicher Theatralik. Die Zärtlichkeit war echt, und sie musste sich davor schützen und sich in ein falsches Selbst flüchten, um ihnen beiden vorzumachen, dass sie die wirkliche Person schon zurückgelassen habe, bevor sie nach Paris abflog. Und die ganze Zeit sprachen ihre Augen zueinander: wir tun nur so, als ob wir so tun. Wahrheit mit Falschheit vermischt, sie wussten beide, dass es nicht anders sein konnte, auch ohne zu wissen, wo sie genau standen; wenn auch Ivan immer noch versuchte, ihre Situation zu definieren, er wusste, es war sinnlos und dass alle Aussagen nur dazu dienten, das Miteinanderschweigen zu schützen, das sie mittlerweile so genossen.
»Was wirst du in Paris machen? Wieso eigentlich Paris? «, fragte Ivan. »Und was machst du hier mit mir?«