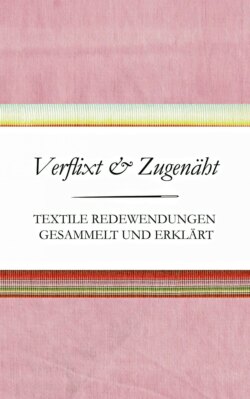Читать книгу Verflixt und Zugenäht - Textile Redewendungen gesammelt und erklärt - Susanne Schnatmeyer - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Spinnen
ОглавлениеGedanken spinnen
Wenn wir Gedanken oder Ideen spinnen, dann lassen wir eine freie Kette von Überlegungen aufeinander folgen. Solches Spinnen im Kopf geht auf die uralte textile Technik des Spinnens von Fäden zurück.
Um Garn zu erhalten, muss aus Wolle oder Pflanzenfasern erst einmal ein Faden gezogen werden. Bis zum Beginn der Industrialisierung wurde das Faserbündel, der sogenannte Rocken, mit der Hand zu Garn gedreht. Dabei halfen eine Handspindel oder ein Spinnrad. Das Spinnen war für die Menschen seit Urzeiten eine lebensnotwendige Handwerkskunst, denn nur mit genügend Garn konnte Kleidung hergestellt werden, konnten Zelte, Segel und Decken gewebt oder Netze geknüpft und Seile gedreht werden. Entsprechend haben noch heute viele Redewendungen ihren Ursprung in diesem Bereich der Textilgewinnung.
Das Bild des Spinnens wird in vielen Sprachen für Worte und für Gedanken gebraucht, die wie Fäden aus dem Kopf heraus gesponnen werden. Im Englischen steht to spin a yarn für etwas erzählen. Schon bei Luther heißt es: »Gott hat es ihnen nicht befohlen, sondern sie spinnen es aus ihrem eigen Kopfe.« Sprach jemand sehr offen und ungehobelt, so wurde das ein grobes Garn spinnen genannt.
Spinnen war meist Gemeinschaftsarbeit und wurde traditionell den Frauen zugeschrieben. Ein Spinnrocken in der Hand galt als weibliches Attribut. Lange gebräuchlich war auch die Redensart miteinander ein Garn spinnen im Sinne von: Gut miteinander können. Wer in der Gemeinschaft spann, arbeitete gut zusammen.
Spinner
»Du spinnst ja!« ruft man, wenn jemand nicht ganz bei Verstand zu sein scheint oder etwas Unwahres behauptet. Ein wunderlicher Mensch ist spinnert oder versponnen, und wenn er Hirngespinste hat, dann ist er ein Phantast und bildet sich etwas ein. Anders als beim neutralen Gedankenspinnen steht das Spinnen hier als Bild für ein unsinniges Verhalten oder unglaubwürdiges Erzählen. Wie kommt es dazu, dass Spinnen als Verrücktheit bis heute in unserer Alltagssprache fest verankert ist?
Ein Erklärungsversuch verweist auf die Geschichten, Märchen und Gerüchte, die in den Spinnstuben erzählt wurden, während die Spinnräder surrten. Im 16. und 17. Jahrhundert wurden Märchen auch Spinnmärchen, Rockenmärchen oder Kunkelmärchen genannt. Solcherlei Geschichten erzählte man sich beim gemeinsamen Spinnen aus den Rohfasern, die, zum Bündel zusammengefasst und aufgesteckt, Rocken oder Kunkel hießen.
Dieses Vliesbündel, die Kunkel, wurde mit dem Kopf gleichgesetzt. So heißt es in einer Sammlung von Sinnsprüchen aus dem 19. Jahrhundert: »Meidlin hinter der Kunkel, du hast wilde Dinge im Kopf; könnte man dir sie aus dem Kopf spinnen, als du es aus der Kunkel spinnest, es würde ein verworren Gespunst.«
Das Spinnen der Fäden war außerdem von jeher im Volksglauben mit Geheimnis und Zauberei verbunden. Das Faserbündel aus dem der Faden entsprang stand für das menschliche Leben. In den Faden konnte Gutes und Böses hineingesponnen werden.
Es gab auch das Bild der Spinne, die aus sich selbst heraus spinnt. Wenn sich jemand eine Lüge ausdachte, hieß das: »Wie eine Spinne aus sich selbst Lügen spinnen« oder »Es ist sein eigen Gespunst.« Ähnlich sagen wir heute noch: »Er hat es sich aus den Fingern gesogen.«
Im Frauenzimmer-Lexikon von 1719 wird der Aberglaube erwähnt, dass Frauen beim Sieden des Garns zum Bleichen gute Lügengeschichten erzählen müssen, um es weiß zu bekommen.
Einer anderen Erklärung zufolge rührt der Bedeutungswandel des Spinnens zum Verrücktsein aus der Zeit, als in Zuchthäusern und Besserungsanstalten gesponnen werden musste. Seit 1600 gab es sogenannte Spinnhäuser, in denen auffällig gewordene Frauen durch das Spinnen wieder resozialisiert werden sollten. Aber auch Männer in Zuchthäusern mussten für den König spinnen. Dieser Spinnzwang war vor allem in der Zeit wichtig, als das Garn aufgrund der neuen Maschinenwebstühle knapp wurde.
Hirngespinst
Im Bild des Hirngespinstes klingen nicht nur die Märchen aus den Spinnstuben an. Gemeint sind auch die luftigen und unbeständigen Gewebe der Spinnennetze. Schon im Alten Testament stehen Spinnweben für Illusionen: »Sommerfäden gleich ist sein Vertrauen, ein Spinnengewebe seine Zuversicht.« Dazu passt auch eine Strophe aus »Der Mond ist aufgegangen« von Matthias Claudius:
»Wir stolzen Menschenkinder
Sind eitel arme Sünder
Und wissen gar nicht viel;
Wir spinnen Luftgespinste
Und suchen viele Künste
Und kommen weiter von dem Ziel.«
Seemannsgarn
Erzählen Seeleute übertriebene und unglaubwürdige Geschichten von ihren Abenteuern auf See, so werden diese Berichte Seemannsgarn genannt. Wie schon beim Spinnen im Sinne von verrückt sein steht auch hier das Garn für die Geschichten, die aus dem Kopf der Matrosen gesponnen werden und in den Bereich der Märchen geraten. Der Ausdruck Seemannsgarn kommt wohl vom Schiemannsgarn, das zum Schutz vor Verschleiß um dickeres Tauwerk gewickelt wurde. Solches Schiemannsgarn mussten die Matrosen in ruhigen Zeiten an Deck aus alten Tauen drehen. Beim Auflösen der gebrauchten Seile und eintönigen Verzwirnen zu Garn erzählten die Seeleute sicher viele wilde Geschichten. Solche maritimen Flunkereien nennen wir heute Seemannsgarn.
Spinnefeind
Wenn zwei überhaupt nicht miteinander können, wenn sie vielleicht sogar Todfeinde sind, dann sind sie sich spinnefeind. Mit Ärger in der Spinnstube hat der Ausdruck aber wohl nichts zu tun, eher mit den Spinnentieren. Einerseits drückt das Wort aus, wie sehr Spinnen bei vielen Menschen Ekel und Abwehr erregen. Zahlreiche Aberglauben ranken sich um böse Spinnen. Andererseits heißt spinnefeind auch so feind wie die Spinnen. Manche Spinnenarten fressen sich gegenseitig, wenn es der Nachkommenschaft dient. Die größeren Weibchen saugen die Männchen nach der Begattung aus und fressen sie. Umgekehrt suchen sich manchmal aber auch Spinnenmännchen ein Weibchen als Beute.
Spinnen am Morgen
»Spinne am Morgen
bringt Kummer und Sorgen.
Spinne am Mittag bringt Glück am dritten Tag.
Spinne am Abend, erquickend und labend.«
Dieses Sprichwort verstehen die meisten so: Läuft am Morgen eine Spinne über das Fensterbrett, so bringt das Unglück. Man darf das Tier dann auch töten. Am Abend aber soll eine herumkriechende Spinne Glück bringen.
Hat das Sprichwort wirklich mit Spinntieren zu tun? Dazu gibt es zwei Meinungen. Die deutsche Sprachforschung geht eher davon aus, dass es in dem Sprichwort gar nicht um Tiere geht. Vielmehr soll mit Spinnen das Fadenziehen in der Spinnstube gemeint sein. Nur wer so arm war, dass keine Felder zu bestellen oder andere Arbeit zu erledigen war, spann am Morgen. Man musste vom Verkauf des Garns leben und hatte daher Kummer und Sorgen. Wer mittags spann, war fleißig und mehrte sein Vermögen – Glück am dritten Tag. Wer nur abends am Spinnrad saß, hatte tagsüber Besseres zu tun. Das Spinnen geschah nebenher im geselligen Beisammensein, als Erholung, erquickend und labend eben.
Eine andere Deutung geht in die Richtung, dass man nur abends spinnen sollte, weil zum Spinnen kein Tageslicht notwendig war. Den Faden konnte man auch im Halbdunkel ziehen und drehen. Wer das Tageslicht also nicht für wichtigere Arbeiten nutzte, sondern stattdessen gleich morgens lieber spann, dem drohte Kummer und Sorgen.
Es gibt aber auch gute Gründe dafür, das Sprichwort nicht auf das Fadenspinnen, sondern auf die Tiere zu beziehen. In anderen Sprachen wird in dem Spruch eindeutig das Spinnentier genannt, weil anders als im Deutschen dort die Bezeichnungen für die Spinne (das Tier) und das Spinnen (Fadenspinnen) nicht identisch, sondern unterschiedlich sind.
Auf Französisch heißt die Spinne araignée, das Spinnen des Fadens heißt filer. Vom Fadenspinnen ist in der französischen Version des Sprichworts keine Rede. Es geht nur um Spinnentiere:
»Araignée du matin – grand chagrin (Kummer),
araignée du midi – grand souci (Sorgen),
araignée du soir – bon espoir (Hoffnung).«
Die Spinne wird morgens als Unglücksbote und abends als Glücksbote gesehen. In einer anderen Variante des Spruchs verheißt die Spinne auch am Morgen etwas Gutes, nämlich Arbeit und Gewinn: »Araignée du matin – Travail et gain.« Auf Englisch ist ebenfalls nur von dem Tier, spider, die Rede:
»A spider in the morning is a sign of sorrow;
A spider at noon brings worry for tomorrow;
A spider in the afternoon is a sign of a gift;
But a spider in the evening will all hopes uplift.«
Erklärungen für das Sprichwort mit den Spinnentieren gibt es einige:
Spinnen bringen in vielen Kulturen Glück und Geld. Sie sind mit ihrem Spinnennetz ein Symbol für Beutefang und bedeuteten schon in der Antike Reichtum und gutes Gelingen. Im Mittelalter gab es zum Schutz vor Krankheiten Anhänger aus Walnussschalen, in die Spinnen eingeschlossen waren.
Aberglauben zufolge gab es gute und schlechte Tageszeiten, um etwas zu erledigen. Je nach Uhrzeit bedeutet daher das Auftauchen einer Spinne etwas Gutes oder Schlechtes.
Die verschiedenen Tageszeiten sollen auch etwas mit der Fähigkeiten der Spinnen zu tun haben, Wetter anzuzeigen. Steht ein Unwetter an, weben sie keine Netze und warten im Trockenen. »Kriecht die Spinne vom Netz zum Loch, gibt’s am Tage Gewitter noch« lautet eine Bauernregel. Kommt also morgens eine Spinne ins Haus, so ist das ein Zeichen für schlechtes Wetter, die Tagesarbeit wird behindert. Draußen dagegen lassen sie auf gutes Wetter hoffen: »Wenn die Spinnen emsig weben im Freien, lässt sich dauernd schönes Wetter prophezeien.«
Andererseits heißt es in einem Lexikon über Aberglaube von 1791, eine Spinne am Morgen solle Glück bringen: »Andere meinen, dass der glücklich sei, dem morgens eine Spinne auf den Rock krieche.« Das Unglück mit den Spinnen am Morgen lässt sich also nicht klar erklären.
Ganz gleich wie man das Sprichwort auslegt, ob man darin Spinnräder oder Spinnennetze sieht, am Ende treffen sich beide Varianten in dem Bild der Spinne als spinnendes Wesen. Auch die Spinne spinnt Fäden, und zwar aus ihrem Bauch heraus. Auf Deutsch heißt die Spinne Spinne, weil sie spinnt. Ihr lateinischer Name, Arachne, beruht auf der griechischen Sage über die Spinnerin und Weberin Arachnea. Diese Weberin war sehr virtuos und so von sich überzeugt, dass sie sich mit Athene anlegte, die als Göttin des Spinnens und Webens eigentlich über jeden Zweifel erhaben war. Nach einem Wettweben verwandelte die Göttin die sterbliche Webkünstlerin Arachne in eine Spinne. Schon in der Mythologie ist also das Spinnentier, das Netze spinnt, mit den textilen Techniken des Spinnens und Webens eng verbunden.
Kungeln
Wenn zwei heimlich Absprachen treffen und Pläne schmieden, dann kungeln sie zusammen. Kungeln oder auch kunkeln kommt von der Kunkel, dem altdeutschen Wort für den Spinnrocken, das zu spinnende Faserbündel. Wurde Wolle, Hanf oder Flachs um den Stab gedreht, der das abzuspinnende Material halten sollte, so hieß dieses Herumdrehen und -wickeln regional auch kunkeln. Kungeln bezieht sich also zum einen auf etwas Zusammengedrehtes. Zum anderen wurden auch die Gemeinschaften in den Spinnstuben danach benannt, sie hießen Kunkelgesellschaften. In einem Gedicht von 1821 klingt das vertrauliche Zusammensitzen beim Spinnen an: »Leis im Frauenkreise flüstert bei der Kunkel guter Rath.« Das Kungeln ist also auch das Ergebnis vom heimlichen Zusammentreffen in den Spinnstuben.
Klüngel
Ein Klüngel ist ursprünglich ein Fadenknäuel, auch eine Quaste oder eine Troddel. Das Knäuel als ein Gebilde aus vielen Fäden, deren Verlauf von außen nicht zu durchschauen ist, wurde auch als Bild für Betrügereien gebraucht. Schon vor 1800 kannte man den Klüngel im Sinne einer Clique, die Mauscheleien macht. Der Kölner Klüngel wird bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts als regionale Besonderheit erwähnt.
Spindeldürr
Die Spindel ist das zum Spinnen mit der Hand notwendige längliche Gerät, das in Drehungen versetzt wird und den Faden verzwirnt. Der Spindelstab ist oben und unten spitz und dünn, so dass seine Form mit der eines mageren Menschen verglichen wurde. Es gab spindeldürre Beine oder auch spindeldürre Gestalten.
Wirbel
Als Spinnwirtel bezeichnet man das Schwunggewicht am Ende der Spindel, auf die der Faden gedreht wird. Wirtel bedeutet eigentlich sich Drehendes. Aus Wirtel ist auch der Wirbel entstanden.
Verwickelt
Ursprünglich war der Wickel das Faserbündel, das zum Spinnen um den Spinnrocken gelegt wurde. Später hieß auch das aufgerollte Garnknäuel oder anderes Gewickeltes so. Wer in eine Sache wie in ein Knäuel mit eingedreht ist, der ist in die Sache verwickelt.
Abwickeln
Wird ein Wickel aufgelöst, so spricht man von abwickeln. Auch diesen Ausdruck benutzen wir heute im übertragenen Sinne. Die Liquidation eines Unternehmen oder eines Vereins wird Abwicklung genannt. Der Betrieb wird aufgelöst, so wie ein Knäuel abgewickelt wird.
Schief gewickelt
Wenn jemand sich in einem Irrtum befindet, dann ist er schief gewickelt. Historisch gesehen könnten wir auch sagen, er ist schief gewindelt. Aus dem Wickel, der mehrmals um sich selbst gedrehten Sache, entstand das Wort Windel für die Tücher, in die ein Wickelkind eingeschlagen ist. Früher wurden die Säuglinge mit dem ganzen Körper und besonders fest gewickelt, weil man Angst hatte, das Kind könne sonst schief wachsen. Das feste Einbinden sollte sicherstellen, dass die Glieder des Säuglings gerade ausgerichtet waren. Und wenn der kleine Körper nicht gut gewickelt war, dann brachte das dem Aberglauben nach entsprechend Unheil – das Kind war schief gewickelt.
Nachteilig ist aber auch eine schief aufgewickelte Garnspule, die rollt sie sich nämlich nicht gleichmäßig ab und kann sich verheddern. Und eine schief gewickelte Zigarre raucht sich nicht so gut.
Um den Finger wickeln
Wenn jemand leicht zu manipulieren und zu lenken ist, dann kann man ihn um den kleinen Finger wickeln. So, wie man eine flexible Schnur oder einen Faden ohne Widerstand um den Finger drehen kann. Der kleine Finger galt früher als ein besonders schlauer Finger. Ein leicht zu beeinflussender Mensch ist so schnell gefügig gemacht, wie ein Faden widerstandslos um den zartesten Finger gewunden ist.
Einwickeln
Wird jemand mit Worten eingewickelt, dann wird er schmeichelnd beeinflusst und zu etwas überredet, das vielleicht gar nicht in seinem Sinne ist. Er wird sozusagen schief um den Finger gewickelt.
Entwickeln
Ursprünglich wurde entwickeln im Sinne von sich losmachen benutzt, wie bei: »Sie entwickelte sich aus dem Netz, in dem sie gefangen war.« Später bedeutete das Wort aber auch entfalten und allmählich entstehen im übertragenen Sinne. So heißt es in einem Stück von Schiller: »Mich schaudert, wie sich das entwickeln soll.«
Am Wickel packen
In unserer Vorstellung haben wir jemanden am Wickel, wenn wir ihn so gepackt haben, dass er uns nicht mehr entkommen kann. Wie alles Gedrehte hieß auch das Band, das um einen Zopf gebunden wurde, Wickel. Bis 1800 war es bei Männern Mode, die langen Haare am Hinterkopf zum Zopf gebunden zu tragen. Um diesen Zopf wurde das sogenannte Wickelband geschlungen. Hielt man jemanden an diesem gewickelten Zopf fest, hatte ihn also beim Schopfe gepackt, dann hatte man ihn am Wickel. Und für den Fall, dass das Gegenüber zopflos war, konnte man ihm alternativ auch an den Kragen gehen.
Abspulen
Wenn jemand immer wieder dasselbe Programm abspult, dann tut er das automatisch und ohne Begeisterung. So, wie der Faden von einer Garnrolle mechanisch und gleichförmig abgespult wird.
Verhaspeln
Man kann sich in seiner Rede so sehr verhaspeln, dass man die richtigen Worte nicht mehr findet. Das Haspeln war ein wichtiger Schritt bei der Garnherstellung. Der gesponnene Faden wurde auf eine Winde, die sogenannte Haspel, gewickelt. Dabei wurde gezählt, wie viele Umdrehungen Garn schon auf der Haspel waren. Verhedderte sich das Garn oder hatte man das Zählen verpasst, so hatte man sich verhaspelt. Genauso kann man sich beim Sprechen verhaspeln, wenn einem der Gesprächsfaden durcheinander gerät oder die Wörter verrutschen.
Eine weniger wahrscheinliche Geschichte verbindet verhaspeln mit dem Wort verhaspen. Verhaspen bedeutete, Fenstern und Türen zu verhaken. Hat man sich verhaspelt, so hakt es eben.
Alter Knacker
Vermutlich ist ein alter Knacker einfach nur ein Mensch, dessen gealterte Gelenke hörbar knacken. So wird der Ausdruck jedenfalls im Grimmschen Wörterbuch aus dem 19. Jahrhundert erklärt.
Einer anderen Geschichte nach ist der alte Knacker der gebrechliche Großvater, dem in der Spinnstube die Aufgabe übertragen wurde, das gesponnene Garn aufzuwickeln. In einem Schauspiel von 1808 zum Beispiel träumt ein verwundeter alter Obrist vergeblich von Ehre auf dem Schlachtfeld: »Stattdessen muss ich Zeitungen lesen und Garn abwickeln, das gefällt mir übel.«
Zum Wickeln wird das Garn in der Regel auf eine Winde, die Haspel, gedreht. Weil jede Partie Garn die gleiche Länge haben sollte, löste nach einer bestimmten Anzahl Umdrehungen der Haspel ein Zahnrad ein Geräusch aus – es knackte. Diese Art von Haspeln nannte man auch Knackhaspeln. Ein alter Knacker wäre dann ein alter Mann an einer Knackhaspel.