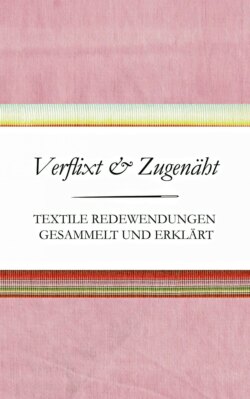Читать книгу Verflixt und Zugenäht - Textile Redewendungen gesammelt und erklärt - Susanne Schnatmeyer - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление» Lieber glorreich scheitern, als schäbig siegen.«
(Vita Sackville-West)
Flachs
Flachserei
Wer albern ist und Witze macht, der flachst herum. Ein Späßchen wird auch Flachserei genannt. Ohne Flachs soll bekräftigen: Das ist kein Witz! Die Ausdrücke erinnern an eine Zeit, als die Landbevölkerung in Mitteleuropa noch weit verbreitet Flachs zur Fasergewinnung für Leinen anbaute. Flachs ist eine der ältesten Nutzpflanzen der Welt und wurde schon vor Tausenden von Jahren zu Stoff verarbeitet. Bis zum Beginn des Industriezeitalters spielte der Flachsanbau in Deutschland eine sehr große Rolle. Leinen war ein wichtiges Handelsgut, bis es durch die Baumwolle verdrängt wurde. Die Flachspflanze musste sehr aufwändig bearbeitet werden, damit die brauchbaren Fasern von den holzigen Teilen getrennt werden konnten. Eine ganze Reihe der notwendigen Verarbeitungsschritte findet sich noch heute in der deutschen Sprache wieder.
Unter anderem mussten die Flachsbündel mit Schwingen aus Holz weich gemacht und mit Holzbrettern ausgeklopft werden. Vielleicht war den Männern und Frauen beim mühsamen Schwingen und Schlagen der Flachsbündel langweilig, jedenfalls wurde wohl viel gewitzelt und geflachst.
Einer anderen Erklärung zufolge ist flachsen im Sinne von necken erst seit dem 19. Jahrhundert bekannt und kommt aus dem sogenannten Rotwelsch, der Gaunersprache. Flachsen bedeutete danach betrügen, narren, aufziehen.
Raufen
Zur Erntezeit musste der Flachs in mühsamer Handarbeit mit der Wurzel aus dem Boden gezogen werden, denn die langen Stängel sollten möglichst unbeschädigt erhalten bleiben. Dieser erste Schritt der Ernte wurde das Raufen genannt. Bis heute erinnert der Ausruf: »Das ist zum Haare raufen!« an das Ziehen von Wurzeln. Wenn sich zwei ordentlich an den Haaren ziehen, dann raufen und prügeln sie sich. Hinterher müssen sie sich dann wieder zusammenraufen.
Durchhecheln
Wenn in Abwesenheit einer Person über diese geredet und geurteilt wird, dann wird sie durchgehechelt. Das Opfer hofft meist, dass die Hechelei bald aufhört. Der Ausdruck kommt von der Hechel, einem kammartigen Werkzeug aus der Flachsbearbeitung. Die nach dem Brechen der Flachsstängel noch groben Fasern wurden zur weiteren Säuberung und Ordnung mehrmals durch eine Art Nagelbrett gezogen, die Hechel. Die groben, bastartigen Teile des Flachses sollten so ausgekämmt werden. Je länger und feiner die durchgehechelten Fasern waren, desto besser wurde das Leinengarn, das später daraus gesponnen werden konnte.
Die spitzen Zinken der Hechel standen als Bild für scharfe Zungen, die sich über ein Thema austauschen. Schon im Simplicissimus aus dem 17. Jahrhundert hört der Erzähler bei einer Hochzeit betagten Mütterlein zu, wie sie »allerlei Leut, Ledige und Verheiratete … durch die Hechel zogen« und über die Kleidung der Gäste tratschten. Wenn jemand durch die Hechel gezogen wurde, dann urteilte man über ihn. Die Person und ihr Verhalten wurden genau betrachtet und besprochen. In einem Gedicht von 1748 heißt es über junge Frauen: »Wie scharf ist öfters eure Hechel, wenn ihr von Junggesellen sprecht?« Dazu passt auch ein Spruch aus derselben Zeit: »Greif erst die Fehler an, die du selbst an dir siehst, eh du der andern Thun durch deine Hechel ziehst.«
Eine von Beurteilungen unabhängige Bedeutung bekommt die Hechelei bei einem Thema, durch das man eilig hindurchprescht. Man kommt ganz außer Atem und hechelt wie ein Hund hinterher.
Schäbig
Die abgetrennten harten Pflanzenteile des Flachses wurden Schäbe genannt. Waren die Fasern nicht sauber gehechelt, das heißt gekämmt worden, so hing noch Schäbe in Form von kleinen Holzteilen an ihnen – sie waren schäbig und schlecht zu gebrauchen.
Verheddern
Auch das Verheddern kommt aus der Flachsverarbeitung. Hede hießen die kurzen, wirren Fasern, die in der Hechel nach dem Durchziehen der Büschel zurückblieben. Hede wurde vor allem als Dämm- und Dichtungsmaterial benutzt. 1778 wird sogar berichtet, der Flachs werde für künstliche Haarknoten verkauft: »Ist es Ihnen unbekannt geblieben, dass jährlich über hundert Centner Hede zu Chignons verbraucht werden?«
Von der Hede, die unordentlich und durcheinander in der Hechel zurückbleibt, kommt verheddern im Sinne von verwirrt sein. Wenn man sich im Text verheddert, so hat man den Faden verloren im Gewirr der Worte.
Rüffel
Wenn wir gerüffelt werden, dann werden wir zurechtgewiesen. Das Wort kommt von der Riffel, einem kammartigen Werkzeug ähnlich der Hechel. Gleich nach dem Ernten zog man die Flachsbündel durch diese Eisen- oder Hartholzkämme und trennte so die Kapseln mit den wertvollen Leinsamen von den Stängeln. Ähnlich wie bei der Hechel, die zum Durchhecheln, also dem tadelnden Reden führte, wurde aus Riffel der Rüffel, mit dem jemand gerügt wird. Bei Lessing heißt es entsprechend: »Willst du denn nie klug werden? Ich rüffle doch an dir, und rüffle.«
Flachsblond
Waren die langen Fasern des Flachses gut gesäubert und mehrmals fein gekämmt worden, dann konnten sie vor dem Spinnen noch hell gebleicht werden. Sie erinnerten an langes hellblondes Haar – eben an flachsblondes Haar.
Fahrt ins Blaue
Manche verbinden den Flachs auch noch mit dem Ausdruck Fahrt ins Blaue. In Deutschland waren die blau blühenden Flachsfelder ein gewohnter Anblick. Angeblich fuhr man ins Blaue, um zur Flachsblüte nach den Feldern zu sehen. Das ist aber eine eher unwahrscheinliche Erklärung. Mehr spricht dafür, dass sich der Ausdruck ins Blaue hinein auf die unbestimmte, unbekannte Ferne bezieht, vielleicht gepaart mit dem Ungewissen hinter dem blau-diesigen Horizont.