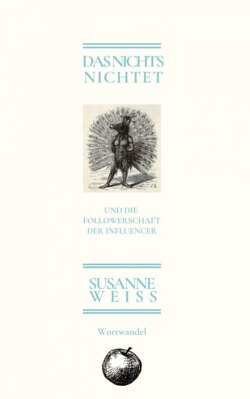Читать книгу Das Nichts nichtet und die Followerschaft der Influencer - Susanne Weiss - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVorwort
In dem wir einige Beteiligte vorstellen und Sachverhalte vorklären. Darüber hinaus geben wir in aller Kürze den Zweck dieses Buches bekannt.
Die „Followerschaft der Influencer“ ist eine kürzlich entdeckte Spezies, die niemand genau kennt und von der einige sogar behaupten, es gäbe sie gar nicht. Berichten gelehrter Kreise zufolge tragen die Angehörigen der Spezies Augen, Nase und Mund auf der Brust und können so – hier ähnlich den bekannteren Troglodyten – auf den Kopf verzichten. In gewissen Kreisen wird kolportiert, sie besäßen trotz dieser kleinen Einschränkung die geheimnisvolle Gabe, Kaufleuten und Industriellen lastwagenweise Geld vor die Tür zu kippen. [Was sich allerdings neueren Erkenntnissen zufolge als Trugschluss herausgestellt hat.]
Auch die Experten für Followerschaften aller Art sind eine in sich geschlossene Gruppe mit einer eigenen Sprache, eigenen Wettbewerben, eigenen Preisen und festem Blick nach Übersee. Diese Experten, der Chief Marketing Officer und der Chief Echo Officer talken über die richtige Platzierung der Kommunikations-Touchpoints entlang der Customer Journey oder vielleicht über das Tracking der Super Targets und anderer Troglodyten, die auch niemand wirklich kennt. Adepten der Zunft müssen beweisen, dass sie leichtfüßig und mit Todesverachtung in jedes Nichts springen und ihre Angst mit Bravour besiegen können. Doch große Vorbilder zeigen den Weg und spenden Zuversicht.
„In der Angst begegneten wir dem Nichts. Wir merkten, dass alles Seiende auch nicht sein könnte.“ Ein großer Satz. Ein grausamer Satz. Er stammt von einem der Chief Content Producers der Philosophie, dessen Einfluss auf Wissenschaft und Management bis heute sträflich unterschätzt wird. Denn zu wahren intellektuellen Höhen gelangen wir stets nur am Rande des geistigen Abgrunds.
„Das Spiegel-Spiel der weltenden Welt entringt als das Gering des Ringes die einigen Vier in das eigene Fügsame, das Ringe ihres Wesens. Aus dem Spiegel-Spiel des Gerings des Ringes ereignet sich das Dingen des Dinges.“
Hans Joachim Störig, viel gepriesener Autor der „Kleinen Weltgeschichte der Philosophie“, warnt uns mit fester Stimme davor, einen solchen Satz aus dem Zusammenhang zu reißen. „Ist das bloß Manier?“, fragt er uns, um gleich zu antworten und vieles zu erklären, was uns heute Kopfzerbrechen bereitet.
„Zu allen Zeiten haben Denker, die Neues zu sagen hatten, auch eine neue Sprache gesprochen. Heideggers [so heißt der Mann] eigenwillige Wortprägungen sind nicht sowohl Neubildungen als häufig Wiederentdeckungen: einem alten blass gewordenen Wort verleiht er einen nur aus seinem Denkzusammenhang fassbaren, dann aber plötzlich aufleuchtenden Sinn.“
Eben.
Ein ähnlich lautendes Gedicht „Das Gering des Ringes“ von Joachim Ringelnatz tut hier nichts zur Sache, denn: Vergessen wir niemals den Denkzusammenhang! Nur in ihm und mit ihm – dem Denkzusammenhang – verstehen wir den allerberühmtesten aller berühmten Sätze des immer in globalen Zusammenhängen weit über alle Touchpoints auf der Customer Journey hinweg denkenden Contentgenies:
Das Nichts nichtet.
Die Wirklichkeit ist kompliziert, das hohe Wesen der weltenden Welt schwer zu erringen. Daher sei einem gewissen Adorno verziehen, der das neue Denken, zu dem, wie Störig zweifelsfrei bewies, nur die Größten unter uns befähigt sind, forsch „Scharlatanerie“ nannte und einen „blöden, philosophischen, deutschen Schwindel“. Ganz und gar unpassend auch Tucholsky, ein Journalist ..., der öffentlich zum besten gab: „Heidegger! Ein Philosoph, der nur aus Pflaumenmus besteht – das ist mal schön!“ Nichtsdestotrotz. Die Followerschaft dieses großen Influencers ist zahlreich und ungebeugt. Der Ring ringt, das Ding dingt. „Der Regen regnet“, ergänzte scharfsinnig ein Physiker namens Carnap, der die Größe des neuen Gedankens besser zu erfassen imstande war als die schlichten Geister auf der Suche nach simpler Logik. „Nein“, lässt er uns wissen. „Der Satz ist nicht unlogisch.“ Ein Verleumder, wer so etwas behaupten wollte. „Der Satz ist sinnlos.“ Wir sagen: Das muss man erst einmal leisten! Im Übrigen nichtet das Nichts, wo es will: „Das Erreichen der Gänze des Daseins im Tode ist zugleich Verlust des Seins des Da.“ Von nichts kommt nichts, weiß schon der Volksmund. Unbeeindruckt von all der harschen Kritik an dem großer Steller der Seinsfrage bekennen sich seine wahren Adepten zu seinem Denken und zu seiner Sprache. Eine bekannte Ladenkette für Allerlei wirbt mit dem Hashtag „#Loveislove“, und ein „Storyarchitekt“ erklärt uns: „Storytelling ist die Kunst, Geschichten zu erzählen.“ Na bitte. Das hat Format, das müssen wir zugeben. Wir vermuten, dass der „Texter“, wie man Wortproduzenten in der Werbebranche nennt, und der „Storyarchitekt“ womöglich zum Kreis der zahllosen arbeitslosen Philosophen gehören, die heute so mühsam ihr trockenes Brot verdienen müssen.
Wie dem auch sei. Die Wahrheit ist ein bewegliches Ziel, da können wir uns problemlos zum einen oder zum anderen committen. Im überfließenden Überfluss des Alles und des Jeden wie auch des Nichts ist das nicht weiter wichtig. Hauptsache, das Rechnen rechnet sich, sei es in Wissenschaft oder Management. Damit dies zuverlässig gelingen möge, setzen wir alle Gegenstände unseres bescheidenen Büchleins auf die Watchlist. Jedesmal, wenn etwas Neues performativ emergiert, geben wir Ihnen ein Update und innovieren die assets. („Innovation“ sagt man nicht mehr. Das wurde geheideggert.)
Vox populi und die Entstehung von Verschwörungstheorien
Es gibt da ein kleines Problem. Kein gravierendes, aber übersehen sollten wir es auch nicht. Niemand (außer den üblichen Nörglern) hat heute noch Commitment-Probleme etwa mit „Digitalisierung digitalisiert“ (aus der Reihe „Pörksens Patentierte Plastikwörter“, besonders beliebt in Politik und Großkonzern, seit einiger Zeit auch in der Wissenschaft) oder etwa „Arbeitswelten der Zukunft“. Problematisch ist vielmehr das schwindende Commitment zu staatlichen Bemühungen in Sachen Wahrheit und Fortschritt. Wenn früher die Wissenschaft sagte, das ist so, dann war das auch so. Wenn die Leute es nicht verstanden, maulten sie nicht, sondern wussten eben, dass nicht jeder das Zeug zu Höherem hat. Man kannte seinen Platz. Gleiches galt für die tieferen Geheimnisse des ökonomischen Denkens und Handelns und der Geschäftsführung, die Laien ebenfalls nicht verstehen. Dafür hatte man die „Kommunikation“. Nett erzählte Geschichten beruhigten das Gemüt. Niemand kam auf die Idee, sich „schlau machen“ zu wollen und sich dabei womöglich schweren kognitiven Dissonanzen auszusetzen, die – wie wir wissen – zu irreversiblen Schäden führen können. So konnte man in Ruhe Wahrheit, Fortschritt und Wohlstand entgegenschreiten und schützte gleichzeitig unbescholtene Menschen davor, sich unnötig in die Gefahr geistiger Verwirrung zu begeben. Das Problem war nun, dass unterkomplexe Popularisierungen und Verständlichkeitsattacken dieses wohl ausgewogene Gefüge empfindlich störten. Eine Kakophonie von Meinungen (oft unsinnig und irrational) erschütterte den Frieden. Wissenschaft und Management gerieten unter Druck, sich an Popularisierungskampagnen zu beteiligen. Alte gute Tugenden drohten in Vergessenheit zu geraten.
Sie wieder in Erinnerung zu bringen, insonderheit auf der Ebene der Sprache (aber nicht nur), ist uns Aufgabe und Verpflichtung. Unsere bescheidenen Bemühungen haben zum Ziel, die Freiheit von Wissenschaft und Management zu gewährleisten sowie den Seelenfrieden der Bevölkerung sicherzustellen. Wir müssen – so gut wir können – die Dinge wieder zurechtrücken und alles wieder an seinen Platz stellen.
Es kann nicht sein, dass noch mehr Worte und sogar Wörter aus dem heiligen Denkzusammenhang herausgerissen werden, um sie der Masse zum Fraße vorzuwerfen. Die Vermengung der Sphären hat Leid, Verzweiflung und große Unzufriedenheit unter die Menschen gebracht, die sich im Grunde nach Brot und Spielen sehnen.
Gelehrte und Praktiker verschiedener Sparten und Branchen kommen in unserer kleinen Zusammenstellung zu Wort, um Richtung zu weisen und Hinweise zu geben, wie man das sprachliche Niveau des Denkzusammenhangs schützen und bewahren kann vor unsinnigen Versuchen, sie durch „Allgemeinverständlichkeit“ zu verwässern und auf diese Weise ihrer ewigen Seele zu berauben (und ihre Schöpfer ihres Einkommens).
Gleich zu Beginn soll Professor Grundmann aus Köln am Rhein für die Wissenschaft zu Wort kommen, weil wir unser Anliegen selbst kaum besser zum Ausdruck bringen könnten. „Laien vertrauen Experten, weil sie innerhalb des Expertensystems durch Ausbildung, Ämter oder Auszeichnungen anerkannt werden, weshalb auch das Vertrauen in die Experten der zuverlässigste Weg der Wahrheitsfindung“ ist. Wissensgewinnung und Erkenntnis dagegen an demokratischen Idealen messen zu wollen, hält er – wie wir – für grundfalsch. „Die Spielregeln der Wissensgesellschaft unterscheiden sich [...] radikal von den Spielregeln der modernen Demokratie, in der [...] allein die Mehrheit entscheidet.“
Demokratische Kritik an den Asymmetrien der Wissensgesellschaft untergrabe systematisch das Vertrauen in Experten und Wissensautoritäten, findet der kölnische Professor. Wir stimmen zu, indem wir sagen, dass es besonders schlimme Folgen haben kann, wenn jemand in Professor Grundmanns ureigenem Fach, der Philosophie, herumdilettiert. „Was sind die Folgen einer solchen Demokratisierung?“, fragt er. „Sie kann zum Beispiel zu Verschwörungstheorien führen, dass 9/11 ein von der CIA verantworteter Anschlag war.“ Na bitte. Ist das nicht schrecklich? Also besser nicht selber denken und auch nicht fragen ... nein, lassen wir das. Deshalb, da stimmen wir unbedingt zu, muss „das Vertrauen in Experten und Autoritäten [...] geschützt und gestärkt werden.“ [Wir sind auch sehr froh, dass der Professor in diesem Zusammenhang die Autoritäten nicht vergessen hat.] 1
Wissenschaft und Management dienen stets der Wahrheitsfindung zum Nutzen und Frommen des jeweils größeren Ganzen. Wenn sie die Wahrheit gefunden haben – eines jedes in seinem Denkzusammenhang – können sie uns allen diese Wahrheit mitteilen [wenngleich wir sie manchmal nicht verstehen mögen] und die Richtung weisen, im Kleinen wie im Großen.
(Ein bisschen) Geist im Zirkus
Wir wollen allerdings nicht denselben Weg beschreiten wie der Professor und viele seiner Kollegen (einiger Kolleginnen auch) und das „Kommunizieren“ ganz und gar verdammen. Vielmehr möchten wir einen innovativen Weg beschreiten und Methoden vorschlagen, denen sich die Vorgenannten womöglich anschließen können:
Die Wahrheit bleibt im Denkzusammenhang, aber winzige Teile davon oder gewisse Derivate werden umgewandelt in „populäre“ Formate und zur Unterhaltung der Massen aufbereitet. In Stadien und Hallen, in Show und Spiel, ja, auch in Wort und Bild können farbenfrohe Spektakel genau den Eindruck von Wissenschaft und Management vermitteln, der allen Beteiligten am besten zuträglich ist. Das sogenannte „Storytelling“ ist hier ein Mittel der Wahl, um den emotional gesteuerten Teil der Bevölkerung vom rational denkenden und handelnden Teil zu trennen. [Wir kommen dazu.]
So hat die liebe Seele Ruh, die Nörgler verstummen, die Wahrheitsucher und -finder bleiben unter sich und müssen sich nicht mit den Niederungen der Populärkultur beschäftigen. Die Höherwertigkeit des auf das Allgemeine gehenden Denkens gegenüber dem Zufälligen der Wirklichkeit bleibt erhalten. Die Voraussetzungen für mögliche Erkenntnisse bleiben ebenfalls unberührt von der Wirklichkeit, das Zustandekommen von Wissen und Gewissheit bleibt geschützt und jeder weiß (nach Wittgenstein), dass ein Baum ein Baum ist.
Wir arbeiten selbstverständlich mit anschaulichen Beispielen, auch einige kleine Handreichungen nebst zahlreicher Best-Practice-Beispiele sollen nach den Zumutungen sogenannter „Augenhöhe“ und „Verständlichkeit“ dazu dienen, durch sprachliches Improvement die eigentlichen Heimatsphären zum Geringen zu bringen und zwischenzeitliche Versehen und Irrtümer zu überwinden.