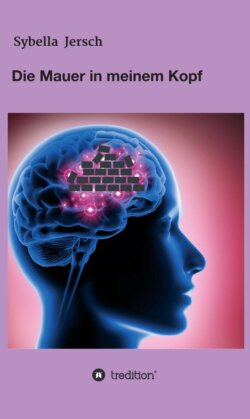Читать книгу Die Mauer in meinem Kopf - Sybella Jersch - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 2
Mein Leben in der Klinik
Der Alltag in der Klinik war schwer und eintönig. Alles hatte seine geregelte Routine. Um 6.30 Uhr aufstehen, in einer Reihe vor dem Ärztezimmer anstehen, um meine Medikamente zu bekommen. Das Essen wurde in einem großen, lieblos eingerichteten Raum eingenommen. Als „Neue“ wurdest du angestarrt und beobachtet. Um punkt acht Uhr mussten wir unsere Zimmer verlassen. Um 8.30 Uhr begannen die verschiedenen Therapien. Walking, Sport, Schwimmen, Kochen und Backen. Da ich ein begeisterte Hobbybäckerin und Hobbyköchin bin, entschied ich mich für das Backen. Aber selbst da stieß ich schnell an meine Grenzen. Einen stinknormalen Kopfsalat anrichten – und meine Kräfte waren am Ende.
Ich, die ein Leben lang gearbeitet habe, zwei Arbeitsstellen habe, die gut durchorganisiert ist. Ist körperlich am Ende wegen eines Salates.
Ich wollte endlich wissen, was mit mir los war. Ich wollte Antworten.
Leider ist das, was man möchte und das, was man bekommt, nicht immer dasselbe.
Ich bekam einen sehr netten Therapeuten zugewiesen. Er erklärte mir als Erstes, dass sie in diesem Krankenhaus gar nicht meine Posttraumatische Belastungsstörung behandeln, da ich psychisch und physisch nicht in der Lage sei, alles zu verarbeiten. Hier würde ich nur stabilisiert, um dann später, so in einem halben Jahr, sich um die Belastungsstörung zu kümmern. Und er erklärte mir, dass mein Aufenthalt in dieser Klinik mehrere Wochen dauern würde. War also nichts mit „in zehn Tagen wieder gesund“.
Es ist eigenartig wie der Mensch sich an Dinge gewöhnt, die unabänderlich sind. Meine Mitpatienten erschienen mir plötzlich nicht mehr als sonderbar. Nein, sie waren sehr liebenswert, aufgeschlossen und hilfsbereit. Wir lachten miteinander, wir halfen einander und trösteten einander. Jeder hatte sein eigenes Schicksal zu bewältigen. Es gab einen Mann, der im Kroatienkrieg gewesen war und sich schon mehrere Monate in der Klinik aufhielt. Eigentlich bemerkte man seine Krankheit gar nicht. Aber jede Nacht hörte man ihn schreien. Ein anderer Mann wollte gar nicht mehr nach Hause, da er sich in der Klinik sicherer fühlte.
Und es gab eine Frau in meinem Alter. Sie fühlte sich ständig von allen beobachtet. Sie war sehr abgemagert und schüchtern. Sie konnte nicht mit uns anderen essen, sprach mit niemandem, meinte, dass jeder über sie lache und sie beobachte. Sie verließ nur mit großem Zwang die Station. Sie war so dünn und zierlich. Irgendwie schloss ich sie in mein Herz. Da wir im gleichen Back Kurs waren, ergab sich doch ein Gespräch.
Sie erzählte mir, dass sie schon seit Wochen in der Klinik sei und auch immer wieder zwangsernährt werden müsse. Sie litt so sehr. Aber ganz langsam gewann sie Vertrauen zu mir. Sechs Wochen später, an meinem letzten Tag in der Klinik, wollte ich mir einen Eisbecher gönnen. So richtig mit Sahne und Obst. Ich war schon in der Cafeteria, als mir der Gedanke kam, sie zu einem großen Eis einzuladen. Ich machte also wieder kehrt und fand sie auf unserer Station. Ich fragte sie, ob sie nicht Lust auf einen Eisbecher habe, ich würde sie einladen. Aber sie meinte, dass sie unmöglich in den Fahrstuhl steigen könne, weil sie alle Menschen anstarrten. Und schon gar nicht setze sie sich in die Cafeteria.
„Aber du liebst doch Schokoladeneis und ich habe gesehen, dass sie das heute haben. Und wenn ich dich an die Hand nehme, und wir schauen mal, wie weit wir kommen? Es ist doch mein letzter Tag hier. Das müssen wir doch feiern.“ Ich redete mit Engelszungen auf sie ein und zum Schluss nahm sie meine Hand. In den Fahrstuhl steigen war schon eine große Überwindung. Auch den Hof zu überqueren, schafften wir. Aber uns in die Cafeteria zu setzen, das schafften wir nicht. Da hatte ich eine Idee.
„Wie wäre es, wenn wir uns ein Eis zum Mitnehmen holen, und wieder auf die Station gehen?“, fragte ich sie.
So machten wir es. Wir kauften drei große Kugeln Schokoladeneis mit Schlagsahne, gingen wieder auf unsere Station, suchten uns ein schönes, einsames Plätzchen und genossen unser Eis. Das war das beste Eis aller Zeiten und sie hatte alles aufgegessen.
Oder eine Frau in den Vierzigern. Sie war verheiratet und hatte zwei Kinder. Sie litt dermaßen unter Angstzuständen. Sie war den ganzen Tag am Weinen. Sie bekam so viel angsthemmende Mittel, wie es noch ärztlich zu verantworten war. Ihr Mann war ständig zu Besuch und sprach ihr Mut zu. Sie war selbstmordgefährdet. Eines Tages setzte sie sich zu mir an den Tisch und begann ein Gespräch mit mir. Sie meinte, dass sie am Ende sei. Sie kämpfe so sehr gegen die Ängste an, aber es helfe einfach nicht.
„Die Ängste zerstören mich und mir fehlt die Kraft.“
„Vielleicht solltest du dir mal einen Tag frei nehmen vom Kämpfen“ erwiderte ich. „Denk doch mal: Heute geht’s mir nicht gut, da habe ich keine Kraft, auch noch zu kämpfen. Aber morgen nehme ich es wieder in Angriff und kämpfe weiter. Du musst nicht jeden Tag kämpfen.“
Sie sah mich erstaunt an und meinte:“ Das hat mir noch niemand gesagt, das probiere ich aus.“
An diesem Tag hatte sie sich frei genommen. Frei von der Angst.