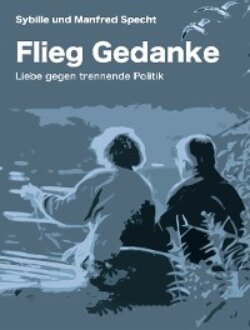Читать книгу Flieg Gedanke - Sybille und Manfred Specht - Страница 8
Manfred: Mein Geburtsort
ОглавлениеDort, wo die Mulde in die Elbe fließt, liegt die Stadt Dessau-Roßlau. Ein urbanes Zentrum im heutigen Bundesland Sachsen-Anhalt. Erst im Jahr 2007 vereinigten sich die beiden Städte Dessau und Roßlau, Dessau am Ostufer und Roßlau am Westufer der Elbe gelegen.
In Dessau, in dieser einst als Ackerbürgerstadt wahrgenommenen Ansiedlung, erblickte ich am 13. November 1937 das Licht der Welt. Bis dahin hatte sich Dessau sehr respektabel entwickelt, von ersten Anfängen als Handelsplatz, man kannte ihn unter dem Namen „Ein-Straßen-Stadt“, bis zum weltbekannten Industriestandort, allen voran die Junkers-Flugzeugwerke mit bis zu 40.000 Mitarbeitern.
Viele haben sicher schon einmal vom „Alten Dessauer“ gehört. Gemeint ist Leopold I., seit 1693 Fürst von Anhalt-Dessau. Er ist beachtliche 71 Jahre alt geworden. Für damalige Verhältnisse und bei seinem militärischen Lebenswandel als Feldmarschall in preußischen Diensten sicher nicht alltäglich. Er kämpfte erfolgreich in drei geschichtlich bedeutsamen Kriegen, wofür ihm der Preußenkönig in der Berliner Mohrenstraße ein Denkmal errichten ließ. Dort kann jeder von Euch ihn noch heute jederzeit besuchen.
Im Januar 1871 trat das anhaltinische Gebiet als Herzogtum Anhalt mit der Hauptstadt Dessau dem seinerzeit proklamierten Deutschen Reich als Bundesstaat bei.
Die kulturelle und politische Offenheit und Fortschrittlichkeit der Stadt zog immer wieder Persönlichkeiten mit neuen Ideen und Weitblick an. Einer der sicher bekannten Zuwanderer in jüngerer Zeit war Walter Gropius, der 1925 das Bauhaus nach Dessau verlegte.
Das Besondere meines Geburtsdatums
Anfang der neunziger Jahre überraschte Peter Plichta die Wissenschaftsgemeinde mit der Aussage, dass dieser Welt ein bisher verborgener, göttlicher Zahlenbauplan zugrunde läge, der durch einen ewigen Primzahlencode verschlüsselt ist. In mehreren Buchveröffentlichungen führt er seine Beweise an, unter anderem seien genannt: „Gottes geheime Formel“ (1) und „Das Primzahlkreuz“ Bd. I – III (2). Dort steht zu lesen: „Hinter den verdrängten Rätseln unserer materiellen Welt steckt ein geheimer Bauplan: ein Zahlencode, bei dem die Primzahlen eine herausragende Rolle spielen.“
So muss es erstaunen und regt zu vielerlei Gedankenspielen an, dass mein Geburtsdatum
13-11-19-37
ausschließlich aus Primzahlen besteht. Was kann das bedeuten? Ist mein Leben göttlich vorbestimmt oder dem Zahlencode eine real existierende Bedeutung zuzuweisen? Eine Antwort kann nur eine wertende Inventur meines Lebens geben, das ich hier nach bester Erinnerung niederschreiben will. Jeder Leser möge sich dann sein eigenes Urteil bilden.
Ich habe einen jüngeren Bruder. Etwa dreieinhalb Jahre nach mir kam Siegfried zur Welt, auch in Dessau, und man lese und staune, auch sein Geburtsdatum besteht ausschließlich aus Primzahlen:
13-3-19-41.
Um diese exzeptionelle Wiederholung gebührend einordnen zu können, muss bedacht werden, dass diese beiden Jahrgänge 1937 und 1941 die einzigen von 1931 bis 1943 sind, demnach über eine Zeitspanne von zwölf Jahren, die überhaupt durchgängige Primzahlen als Geburtsdaten, wie hier vorgestellt, enthalten können. Das klingt vielleicht höchst esoterisch, mysteriös, vielleicht aber auch substanziiert. Jedenfalls verheißungsvoll.
Ein wacher Blick in die Natur lehrt uns Demut und Zurückhaltung, was unser beschränktes menschliches Wissen anbelangt. Dinge, die wir nicht verstehen oder wahrnehmen, müssen noch lange nicht falsch sein oder nicht existieren. Belassen wir es daher einfach bei der dargelegten Feststellung und überlassen es des Schicksals Mächten.
Meine Eltern und Großeltern
Kurz vor Jahresende 1936, zwischen Weihnachten und Sylvester, gaben sich meine Eltern das Ja-Wort. Schaue ich meinen Bruder an und mich, kann ich sagen: Das habt ihr gut gemacht. Die schicksalhaften Stürme der Zeit aber haben diese Ehe zerzaust. Sie wurde 1955 geschieden. Fortan schuf meine geliebte Mutter in heldenmütiger Anstrengung das familiäre Fundament, auf dem mein Bruder und ich unsere Zukunft bauten. Von vielem davon wird noch die Rede sein. Alle in unserer Familie nannten sie nur Mutsch, und so will ich auch hin und wieder diesen Ehrennamen benutzen.
Die Mutsch, Hedwig Prager, wuchs als viertes von fünf Kindern auf einem kleinen Bauernhof in Bad Köstritz im Thüringer Land heran. Sie war gerade fünf Jahre alt geworden und ihr ältester Bruder Walter zehn Jahre alt, als der von langer Hand vorbereitete Erste Weltkrieg ausbrach und ihr Vater, mein Großvater Franz Prager, zur kaiserlichen Marine eingezogen wurde. Hof, Haus, Acker und Stall lasteten nun auf den Schultern der Mutter, meiner Oma, geborene Henriette Nagler. Zum Hof gehörten Hühner und stets war ein stolzer Hahn dabei, ein oder auch mal zwei Schweine, zwei Kühe und ein Ochse als Zugtier. Musste der beim Pflügen des Ackers helfen und die Kirchturmuhr schlug zwölf, blieb er spontan stehen und bestand auf einer einstündigen Stehpause. Anfängliches Antreiben blieb völlig wirkungslos. Auf diese Weise hatten dann auch die Oma und die zu Hilfsdiensten verpflichteten Knaben ihre erholsame Pause. Die Natur ist doch voller Wunder.
Zum Glück kehrte Opa unversehrt aus dem Krieg zurück. Seinerzeit schloss er sich aktiv dem Matrosenaufstand von Kiel an und lehrte auch mich, stets kritisch und abwägend zu sein. Sein Leibspruch war: „Und ist der Schwindel noch so dumm, er findet stets sein Publikum.“
Zu gern wollte meine liebe Mutter Sport treiben. In der Schule fiel sie auch auf diesem Gebiet besonders auf. Aber dafür fehlte einfach in der bäuerlichen Vorstellung und in der damals entbehrungsreichen Zeit jedes Verständnis. Ihre Eltern waren großzügig und ließen sie eine Lehrstelle als Schuhverkäuferin im benachbarten Gera antreten. Kostete es die Familie doch eine wochentägliche Eisenbahnfahrkarte. Und als tüchtige Schuhverkäuferin lernte sie später einen gewissen Hermann Franz Specht aus Roßlau bei Dessau kennen, lieben und heiraten.
Das Elternhaus meines Vaters war eine Fleischerei in Roßlau an der Elbe. Es wurde im eigenen Haus geschlachtet und jedes Verkaufsprodukt auch eigenhändig hergestellt. Mein Opa Hermann Franz Specht war schließlich ein sehr befähigter Schlachtermeister und in der Fleischerinnung hoch angesehen. Einmal im Jahr gab es einen besonderen Tag, an dem alle Handwerker mit ihren Gesellen in Berufstracht durch die Stadt zogen. Die Fleischer mit weißer Schürze, zur Dreiecksform gerafft. Opa Specht stets in der ersten Reihe der besonders Wertgeschätzten. Da erschien es völlig normal, dass auch der Sohn das Fleischerhandwerk erlernen sollte, um später das Geschäft zu übernehmen. Der aber wollte lieber Ingenieur werden. Am Ende gab er nach, absolvierte eine Fleischerlehre, um sich dann aber nach deren Abschluss doch zu verweigern. Auch politische Differenzen in den Dreißigerjahren zwischen Vater und Sohn hatten ihren Anteil.
Auch Opa Specht musste als Soldat in den Ersten Weltkrieg ziehen. Immer wieder hörten wir ihm gern und aufmerksam zu, wenn er von jenen entsetzlichen Geschehnissen und seinen persönlichen Wertungen sprach. Besonders verbitterten auch ihn die Lügen und Märchen der Siegerpropaganda und die ungeheure Geschichtsverdrehung durch den erpressten Versailler Vertrag und die Ächtung Deutschlands. In (4) S. 403 ist zu lesen:
Ein Jahrhundert der Propaganda, der Lügen und der Gehirnwäsche zum Ersten Weltkrieg liegt hinter uns. Aufgrund kognitiver Dissonanz fühlen wir uns unbehaglich angesichts der Wahrheit: dass es ein Grüppchen wohlsituierter englischer Rassenpatrioten war, die mit Unterstützung mächtiger Industrieller und Finanziers in Großbritannien und den Vereinigten Staaten den Ersten Weltkrieg auslösten. Die in London ansässige geheime Elite war fest entschlossen, Deutschland zu vernichten und die Welt zu kontrollieren. Ihre Handlungen sind für den Tod von Millionen ehrbarer junger Männer verantwortlich, die in einem stumpfen und blutigen Gemetzel verraten und geopfert wurden, um eine unehrenhafte Sache voranzutreiben.
Zu Beginn seiner Erwerbstätigkeit war Opa gewerkschaftlich engagiert, trat später der SPD bei. Sein Sohn dagegen neigte der aufgekommenen Neuen Bewegung zu und wollte auf diese Weise der historischen Demütigung seines Vaterlandes entgegentreten. Als ich meinen Vater später einmal daraufhin ansprach, zuckte er mit den Schultern und bemerkte: „Wir glaubten fest daran, für unser Land etwas Gutes zu tun.“
Beruflich fand er bei den expandierenden Junkers Flugzeugwerken als Werksschutzmann eine Anstellung, war stets bemüht, in technische Bereiche hinzuwachsen. Unser erstes Familiendomizil bezogen wir daher in Dessau in der Lutherstraße. Eine ausgefallene Örtlichkeit hat sich mir schon als Knirps tief eingeprägt, ein Obstgeschäft, in dem es Bananen gab. Bei jeder Vorbeifahrt im Kinderwagen forderte ich mit ausgestreckter Hand: „eine Nane.“ Da half auch keine Ablenkung. Noch gab es sie.
Endlich: 1942/1943 hatte mein Vater Erfolg. Die Krupp-Gruson-Werke in Magdeburg boten ihm die Leitung einer Abteilung des Werkverkehrs an. So wechselten wir noch im gleichen Jahr nach Magdeburg in eine Wohnung im Hohenstaufenring, unmittelbar am Nordpark gelegen (heute: Otto-von-Guericke-Universität).
Meine Einschulung
Seit vier Jahren tobte nun schon wieder in Europa ein verheerender Krieg. In unserem Lebensbereich war zum Glück noch nichts von Kriegshandlungen zu spüren. Meine Eltern bemühten sich, mich von diesen noch entlegenen Geschehnissen fernzuhalten. Nur hin und wieder sah ich Gruppen von jungen Männern am Rand vom Nordpark sitzen und unter Aufsicht einer stupiden Beschäftigung nachgehen wie krumme Nägel wieder gerade klopfen. Es seien Kriegsgefangene, hieß es, was mir aber absolut nichts sagte.
Kurz vor Ostern 1943 fassten meine Eltern den Entschluss, mich zu Opa nach Bad Köstritz auf den Bauernhof zu schicken, natürlich in Begleitung der Mutsch. Landluft konnte ja nicht schaden und ordentlich zu essen gab es dort auch. Einige Wochen nach Ostern sollte mich die Mutsch wieder abholen.
Damals wurde zur Osterzeit eingeschult. Zusammen mit meinem Opa stand ich am Hoftor und sah auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine große Kinderschar vorbeiziehen, etwa in meinem Alter, und jedes Kind hielt eine sonderbare spitze Tüte im Arm.
„Opa, was haben die denn da drin?“ „Äpfel, Kekse, Bonbons, vielleicht sogar Schokolade“.
„Das ist ja toll. Eine solche Tüte möchte ich auch haben“.
Pragmatisch, wie ein bodenständiger Bauer nur sein kann, sagte er ruhig und logisch: „Dann musst du eben zur Schule gehen“.
„Na klar, dann gehe ich zur Schule“.
Nach kurzer Überlegung rief Opa über die Straße hinweg dem Lehrer zu: „Anton, hier hast du noch einen vergessen“.
Bild 1 – Manfreds Einschulung, Ostern 1943
Und auf diesem Weg wurde ich mit fünf Jahren in Bad Köstritz eingeschult. Einfach auf Zuruf, ohne Wissen meiner Eltern. Auf dem Dorf war das anscheinend kein Problem. Erst als meine Mutter mich wieder abholen wollte, fiel sie aus allen Wolken. Einmal eingeschult, gab es kein Zurück mehr. In Magdeburg musste ich weiter zur Schule gehen. Diese frühe Einschulung war schicksalhaft für mich. Hat sie doch mein ganzes weiteres Leben bestimmt, in ausnahmslos positivem Sinn.
An eine Episode in der Bad Köstritzer Schule kann ich mich noch gut erinnern. Wir lernten das ABC. Der Lehrer zeigte mit einem Stab auf einen Buchstaben und der aufgerufene Schüler musste ihn laut und deutlich aussprechen. Wer versagte, kam ins „faule Ei“, ein auf den Boden gemalter Kreis in der Zimmerecke. Nach nochmaliger Abfrage und richtiger Antwort war er wieder entlassen. Anderenfalls mussten zwei Zeilen der Schiefertafel als zusätzliche Hausarbeit mit dem ungenannten Buchstaben beschriftet werden. Dieses Malheur drohte mir stets bei dem Buchstaben Q (Ku). Unvorstellbar, dass ein so großes Tier auf derartige Weise dargestellt werden soll. Irgendwann später riss dann doch der Knoten.
Evakuierung
Kaum eingelebt in der neuen Schule, kam zum Jahresende 1944 die Order, Familien mit Kindern müssten aus Sicherheitsgründen in benachbarte Dörfer umziehen. Meine Mutter und wir beiden Kinder erhielten in Dahlenwarsleben im Obergeschoss eines bäuerlichen Anwesens zwei Zimmer, einen Wohnraum und einen Schlafraum. Die Entfernung betrug etwa elf Kilometer und konnte per Pferdewagen bewältigt werden. Bis heute blieb mir verborgen, warum neben den Betten ausgerechnet das Klavier mit umziehen musste. Mein Vater blieb in der Stadt zurück und besuchte uns gelegentlich am Wochenende.
Schon bald erreichte das Kriegsgeschehen auch unsere heimatliche Flur. Das bereits fünf Jahre währende Bombardement deutscher Städte und Dörfer im Zweiten Weltkrieg, meistens fernab von militärischen Anlagen und kriegswichtiger Industrie, ist ohne Entsprechung in der Geschichte. Wenn feindliche Bomberverbände anflogen, gab es Sirenenalarm. Dann galt es, sofort mit dem bereitstehenden Handgepäck in den zugeteilten Luftschutzraum zu eilen und die Entwarnung abzuwarten. Bis kurz vor unserer Evakuierung holten uns die Sirenen des Öfteren zweimal pro Nacht aus dem Schlaf.
Auch die sich noch immer abmühenden Schulen hatten gewöhnlich eigene Schutzbunker. Nur unsere Dorfschule in Dahlenwarsleben nicht. Sobald die Sirene losbrach, musste alles in Windeseile eingepackt und im Laufschritt der abseits liegende Schutzraum in unserem Wohnhaus erreicht werden. In meiner Erinnerung schaffte ich es zwischen fünf und zehn Minuten, je nach Wetter und immer noch vor dem Überflug der Bomberverbände. Von Bombenabwürfen blieben wir Gott sei Dank verschont. Nur einmal erreichten uns auf dem Heimweg einige Tiefflieger. Sofort warfen wir uns bäuchlings in den Straßengraben, den Schulranzen über den Kopf und hörten über uns Maschinengewehrfeuer. Es wurde niemand getroffen, obwohl es sicher ein Leichtes gewesen wäre. Vermutlich wollten die Piloten ihr Gewissen nicht mit Kindermorden belasten.
Der Feuersturm am 16. Januar 1945
Am Vormittag dieses denkwürdigen Tages attackierte die 8. US-Flotte die Krupp-Gruson-Werke und die Hydrieranlage Brabag. Am Abend jedoch, nach 21 Uhr, fielen sechs Teilverbände über die Wohngebiete der Stadt her und legten alles in Schutt und Asche. In dieser Nacht fanden viertausend unschuldige Menschen den Tod durch Splitter, Trümmer oder Phosphorbrand. Von Dahlenwarsleben aus konnten wir das brennende Magdeburg sehen. Eine rot leuchtende Feuerglocke überwölbte die Stadt.
Meine Mutter brach noch zu Fuß in dieser Nacht nach Magdeburg auf, um zu sehen, ob auch unsere Wohnung getroffen worden war und wie es um unseren Vater stand. Er hatte glücklicherweise außerhalb unseres Hauses überlebt. Das Haus selbst aber hatte einen Volltreffer erhalten und war total zerstört. Es gab nichts mehr zu retten. Heimgekehrt schilderte uns unsere Mutter dann das schier unvorstellbare Inferno. Auf den Straßen liefen Menschen schreiend vor Schmerzen umher. Phosphor hatte ihre Kleidung durchsetzt und verbrannte sie bei lebendigem Leib. Auch wenn sie sich in den noch teils zugefrorenen Teich im Nordpark stürzten, brachte ihnen das keine Erlösung. Der Phosphor brannte auch im Wasser weiter.
Bombardiert wurden mehr als tausend deutsche Städte und Ortschaften. Auf dreißig Millionen Zivilpersonen, überwiegend Alte, Frauen und Kinder, fielen nahezu eine Million Tonnen Sprengund Brandbomben. Mehr als eine halbe Million Todesopfer und der unwiederbringliche Verlust der seit dem Mittelalter gewachsenen deutschen Städtelandschaft waren zu beklagen (5).
Erst vier Jahr später schuf die UNO mit der Genfer Konvention einen völkerrechtlichen Schutz für Zivilpersonen in Kriegszeiten. Geschähe das heute, wäre diese Missetat ein Kriegsverbrechen, ein moralisches wird es wohl bleiben.
„Bringst du einen Menschen um, nennt man dich einen Killer und du kommst auf den elektrischen Stuhl, tötest du Millionen, wird dir ein Orden verliehen“ (unbekannter amerikanischer Verfasser).
Kriegsende und Besatzung
Eine normale Landstraße, von Nordost kommend, durchquert Dahlenwarsleben, öffnet sich in der Dorfmitte vor dem Rathaus und der Kirche zu einem Platz und führt dann weiter in Richtung Autobahn nach Magdeburg. Auf ihr war plötzlich ungewohnter Betrieb. Zurückflutende Wehrmachtsverbände strebten Richtung Magdeburg. Ein Befehlshaber verpflichtete den Bürgermeister dazu, eine Straßensperre bauen zu lassen, wohl um nachrückende alliierte Verbände aufzuhalten. Zwischen zwei eingeschossigen Einfachhäusern, die unmittelbar am Straßenrand standen, errichteten verfügbare Einsatzkräfte an jeder Seite einen massiven, mannshohen Steinsockel. Es verblieb ein etwa drei Meter breiter Zwischenraum, der mit einer herbeigeschafften Straßenwalze geschlossen wurde. Als nach Abzug der militärischen Verbände der Bürgermeister mit einigen Vertrauten wieder allein war, gelangte er zu der Einsicht, dass diese Sperre anrückende Panzer nur dazu einlud, sie zu umfahren, indem sie die am Rande stehenden, wackligen Hofgebäude einfach niederbrächen. Die Straßenwalze wurde zur Seite gefahren und die Passage wieder frei gegeben. Kurz darauf sah ich den Bürgermeister mit zwei Begleitern, in der Hand eine weiße Fahne, auf der Landstraße den sich nähernden Amerikanern entgegengehen. Nach einem kurzen Stopp und Entgegennahme der Berichterstattung des Bürgermeisters rückten die Amis in Dahlenwarsleben ein.
Unter der Bevölkerung, besonders unter den Frauen, herrschte ein großes Angstgefühl. Wie wird das Ganze wohl enden? Vorsichtshalber verbargen sich alle in den Luftschutzräumen, wir uns im Keller unseres Hauses. Es geschah absolut nichts. Noch nicht einmal ein GI kam in den Keller, um nachzuschauen. Stattdessen hörten wir Klaviermusik. Die Amis machten es sich in unserem Wohnzimmer bequem und spielten Boogie-Woogie auf unserem Klavier. Für diesen Zweck hatten es meine Eltern ganz bestimmt nicht mit auf den Umzugswagen geladen.
Eine der älteren Frauen im Keller, vermutlich die unattraktivste, fasste sich ein Herz und ging nach oben. Nach zwanzig Minuten kam sie zurück und war fassungslos. Das Haus war voller Uniformen, aber keiner der Soldaten nahm sie näher zur Kenntnis. Da sie kein Englisch sprach, wagte sie nicht, jemanden anzusprechen und Fragen zu stellen. Nach einem ungestörten Rundgang durchs Haus ging sie wieder zurück in den Keller und hatte die vage Empfehlung, man möge einfach nach oben gehen und den nicht mehr zu ändernden Dingen ins Auge sehen. Unsere Mutter zögerte, war jedoch damit einverstanden, dass ich mich oben umsah. Schon in der Diele sprach mich ein GI an und schenkte mir einen Kaugummi. Ich hatte so etwas noch nicht gesehen, ich zeigte ihn meiner Mutter. Um Himmelswillen, der könnte vergiftet sein. Die Kriegspropaganda wirkte noch immer. Der Kaugummi wurde sicherheitshalber entsorgt. Allmählich entspannte sich die Situation und alle Hausbewohner kehrten in ihre Zimmer zurück. Ein Offizier teilte die Räume neu auf. Die Hälfte des Hauses galt als beschlagnahmt für die US-Armee. Uns verblieb allein das Schlafzimmer. Das Wohnzimmer mit dem Klavier war ab sofort ein konfiszierter Sperrbezirk. Des Weiteren mussten alle Waffen auf schnellstem Wege abgeliefert werden. Der Bauer hatte herrliche Jagdgewehre mit ziselierten Läufen aus Suhler Produktion. Achtlos wurden sie über die Knie gebrochen und auf den Mist geworfen. Nachträglich wird sich sicherlich der eine oder andere der Offiziere geärgert haben, sie nicht als Souvenir mit nach Hause genommen zu haben.
Wenn die Militärjeeps vorfuhren, umrundeten sie erst den zentralen Misthaufen und hielten dann vor der Haustür. Die Fahrer waren meist Schwarze. Einer von ihnen saß sehr lässig hinterm Steuer und zündete sich mit einem Feuerzeug eine Zigarette an. Das Feuerzeug hielt er etwa dreißig Zentimeter unter die Zigarette und plötzlich stieg eine gewaltige Flamme auf. Ich war fasziniert und hochgradig beeindruckt.
Nach zwei Tagen wurde das zentrale Lebensmittel-Notlager für die Bevölkerung freigegeben. Alle liefen hin, auch unsere Mutsch. Sie kam aber mit leeren Händen zurück. Einen großen Sack Zucker hatte sie ergattert, als sie aber um die Ecke bog, stand ein Schwarzer mit herausforderndem Grinsen vor ihr. Den Sack fallen lassen und nichts wie weg, das wars dann.
Hinter unserem Hofgrundstück erhob sich ein kleiner Hügel, der Rübenberg, dort stand ein Geschütz und feuerte in Richtung Magdeburg. Mein Bruder und ich hielten uns gerade in der Scheune auf, als ein heftiger Donnerschlag die Luft erschütterte und ein Regen aus handgroßen Splittern von Dachziegeln unversehens auf uns niederprasselte. Wie durch ein Wunder blieb ich unverletzt. Mein Brüderchen aber wurde getroffen, blutete aus einer großen Kopfwunde, war aber bei Bewusstsein. Mit angepresstem Taschentuch lief er über den Hof zum Wohnhaus und einem amerikanischen Militärarzt direkt in die Arme. Der nahm ihn sofort zur Seite, schnitt die Wunde frei und stillte sie mit einem darüber gestreuten Pulver. Unsere Mutter verband den Kopf und das Malheur war bald vergessen. Dem lieben Siegfried sind merkwürdigerweise derartige Missgeschicke noch mehrmals passiert. Diese gottgegebenen Kopfnüsse haben ganz gewiss zu seinen späteren außerordentlichen Schulleistungen beigetragen.
Nach etwa zwei Monaten kam die Order: alle Umgesiedelten wieder zurück zum ursprünglichen Wohnort. Wer seine Wohnung durch die Bombardierung verloren hatte, erhielt eine neue Zuweisung. Die unsere hieß Barbarastraße im ehemaligen Kruppviertel. Ein geräumiges Einfamilienhaus, das nun für drei Parteien Raum bieten musste. Mein Vater war wieder bei Krupp beschäftigt, anfänglich mit Instandsetzungsarbeiten, und stand der Familie nun wieder leiblich zur Verfügung. Viel gab es nicht mehr zu transportieren. Immerhin blieben uns neben einer ausreichenden Kleidung die Betten, Tisch und Stühle und das Klavier. Vom Porzellan und den Bestecken war uns, während wir im Schutzraum ausharrten, die Hälfte gestohlen worden.
Wieder zurück in Magdeburg
Die Schule hatte noch immer nicht wieder begonnen. Die ganztägige Freizeit währte allerdings nicht lange. In die Barbarastraße zog auch ein Lehrer ein, der alle schulpflichtigen Kinder der unmittelbaren Umgebung zum Privatunterricht einlud. Meine Eltern stimmten sofort zu. Bezahlt wurde mit Naturalien. Im Winter musste jeder Schüler zusätzlich ein Stück Kohle mitbringen. Wir waren zu sechst und saßen zusammen mit dem Lehrer um einen runden Esstisch herum. Der Name des Lehrers und die Anzahl der täglichen Unterrichtsstunden sind mir entfallen. Als dann die offizielle Schule wieder begann, wurden die meisten meiner ehemaligen Mitschüler ein Jahr zurückgestuft, während wir Privatklässler nahtlos an unsere letzte Unterrichtsstunde anschlossen. Ohne dass es mir bewusst wurde, war mein frühzeitiger Start von Bad Köstritz gerettet. Möglicherweise doch ein Primzahlprivileg.
Es blieb noch immer genügend Zeit, um sich einer Jugendbande anzuschließen und mitzuwirken. An der Straße stand ein zweigeschossiger Rohbau, ein während des Krieges angefangenes Wohnhaus. Das war unser Hauptquartier. Die Decke im Obergeschoss bestand nur aus Holzbalken im Abstand von etwa einem halben Meter. Absolut trittsicher liefen wir im Laufschritt darüber hinweg. Durch die Brandwand zum Nachbarteil brachen wir eine kleine Öffnung, durch die gerade ein Kinderkörper hindurch passte. Eine erwachsensperrige Fluchtburg. Der vorbeiführende Fußweg wurde mit Stolperdrähten abgeschirmt. Als eines Tages eine ältere Dame über einen der Drähte fiel und sich sehr schmerzhaft die Knie aufschlug, plagte uns das schlechte Gewissen. Mit einem Akkordeon sind wir zu ihrem Haus gezogen, haben uns entschuldigt und ein Lied gesungen. Das hat uns viele Sympathien eingebracht, was sich später auszahlen sollte.
Ganz in der Nähe, an der Grenzmauer des Sudenburger Krankenhauses (heute Medizinische Akademie, Gustav-Ricker-Krankenhaus) fuhr auf offener Straße eine Eisenbahn. Sie verband die Zuckerraffinerie mit dem Krupp-Gruson-Werk. Auf der Rückfahrt blieben die Tore der Güterwagen zur Entlüftung geöffnet. Wir stellten uns rücklings an die Mauer und enterten bei meistens langsamer Fahrt mit einem Hechtsprung einen Waggon. In den Ecken lagen immer große Haufen Zucker, vermutlich von geplatzten Papiersäcken.
Mütze runter und mit Zucker gefüllt. Unsere Mutter hatte so immer etwas zum Handeln auf dem Schwarzmarkt.
Eines Tages geschah das Unfassbare. Ein Bautrupp rückte an,um das Haus zu vollenden, und richtete eine Baustelle ein. Als der Polier auf dem Plumpshäuschen saß, schlichen wir uns von hinten an und kippten das Häuschen nach vorn um auf die Tür. „Laut ertönt sein Wehgeschrei, denn er fühlt sich schuldenfrei“ (Wilhelm Busch).
Ein Anwohner gegenüber der Baustelle stand im Verdacht, uns zu beobachten und auch zu verpfeifen. Nach Feierabend kaperten wir den einachsigen Plattenwagen mit langer Deichsel, richteten ihn zum Gegner aus und beluden die Deichselspitze mit einem Ziegelstein. Drei Freunde, die auf dem Wagen standen, schritten dann zugleich nach vorn zur Kante und ließen sie unten aufschlagen. Der Schwung katapultierte den Stein etwa dreißig Meter durch die Luft zielgenau in Nachbars Garten. Ich weiß nicht mehr, wie viele Steine wir ihm beschert haben. Gottlob, unsere Strafaktion verlief glimpflich ohne Personenschaden. So ging es noch einige Zeit weiter, bis eines Tages die Polizei auch bei uns vor der Tür stand. Entweder die gemeinen Umtriebe würden sofort aufhören oder man überlege die Einweisung in eine Erziehungsanstalt. Die Konsequenz war erklärtermaßen ein gehöriges elterliches Donnerwetter mit der tatsächlichen Folge einer anhaltenden Besserung.
Unsere Räuberburg war also verloren und neue politische Meldungen ließen bei den Erwachsenen wieder sorgenvolle Existenzängste aufkommen, die ohne Frage auch uns Kinder erreichten. Die Schreckensmeldung lautete, dass der Ami unsere Stadt (und weite Teile Mitteldeutschlands) gegen einen Teil Berlins eingetauscht hätte und wir in Kürze von sowjetischen Truppen besetzt würden. Eine ganze Nacht saßen Freunde und Bekannte unserer Eltern zusammen und sinnierten über die kurzfristigen Folgen, unser aller Zukunft und darüber, ob es einen möglichen Ausweg gäbe. Ein Teilnehmer verkündete, dass die vereinbarte Neuordnung den Amerikanern zwar jede Art von Bevölkerungsaustausch untersagt hätte, sie aber heute Nacht in jede Straße einen leeren Lkw abstellen würden. In den Morgenstunden käme dann ein Fahrer, der sich, ohne den Laderaum zu überprüfen, ans Steuer setzen und losfahren würde. Ja, aber wohin? Dem Ami war doch auch nicht zu trauen. Meine Eltern entschieden sich zu bleiben. Andere dagegen setzten sich mit allem, was sie tragen konnten, auf den Lkw und ließen sich in eine ungewisse Zukunft fahren.
Magdeburg wird sowjetische Besatzungszone
Den Wechsel der Besatzungsmacht nahmen wir anfangs nur am Rande wahr, wenn auf breiteren Durchgangsstraßen hin und wieder Militärfahrzeuge zu sehen waren. Meinen Vater bekamen wir Kinder immer seltener zu sehen. Offenbar zog er sich sukzessive zurück. Die Hauptlast, die Familie zu versorgen, lag schon in dieser schweren Zeit bei unserer tapferen Mutter. Sie muss es vortrefflich gemeistert haben, denn wir Kinder spürten wenig von der seinerzeitigen Not.
Nach einigen Wochen begann dann auch wieder der Schulbetrieb. Das Schulgebäude war beinahe unversehrt geblieben, ein prächtiger Bau aus der Gründerzeit, etwa zwanzig Minuten Fußweg entfernt. Der Haupteingang zur Straße blieb geschlossen, so mussten alle Schüler, die aus meiner Richtung kamen, um das gesamte Gebäude herumgehen und den Eingang vom Pausenhof benutzen. Eine Herausforderung für kreative Geister. Ein etwa zwei Meter hoher Metallzaun mit aufrechten Spitzen auf einem halbhohen Mauersockel begrenzte den Schulhof. Mit Umsicht und etwas Übung war er kein wirkliches Hindernis und die Abkürzung wurde zum Normalfall. Allerdings nur kurzzeitig, denn der Herr Rektor verkündete ein strenges Verbot.
Ein renitenter Rest nahm, schon aus sportlichen Gründen, dennoch den kürzeren Nachhauseweg, zumindest gelegentlich. Jedoch einmal zu viel. Am Ende einer Unterrichtsstunde verlas unsere Lehrerin, übrigens sehr jung und schön, sieben Namen mit der Aufforderung, sie doch bitte zum Herrn Schulleiter zu begleiten. Aufgereiht standen wir nun zwei Meter vor dem Schreibtisch des Herrn Rektors und erwarteten die übliche Standpauke. Nichts geschah. Der Herr Rektor schaute kaum auf und erledigte, provozierend konzentriert, seine schriftlichen Arbeiten. Nach gefühlten fünf Minuten stand er plötzlich auf, schaute uns strafend an, wiederholte sein Verbot und beklagte unsere Missachtung. Angefangen von links bekam jeder der Reihe nach eine kräftige Backpfeife. Der Letzte fand das komisch, konnte sich das Grinsen nicht verkneifen und bekam auf die andere Seite gleich noch eine. Das wars, ab zurück in unsere Klasse.
Der Sportunterricht war sehr eingeschränkt. Keine Leichtathletik, kein Fuß- oder Handball, kein Geräteturnen, kein Schwimmunterricht. Alles war angeblich verboten. Nur Völkerball als einzige Ausnahme war gestattet. Der Lehrer durfte nicht „Antreten“ sagen oder ähnliche militärische Kommandos gebrauchen. Wir nahmen diesen Übereifer einfach hin und amüsierten uns anderweitig auf unsere Art.
Während einer großen Pause erwartete uns eines Tages eine große Gaudi. Zwei sowjetische Soldaten, von denen jeder irgendwo ein Fahrrad konfisziert und als volkseigen bewertet hatte, versuchten nun, vor unser aller Augen das Gleichgewicht zu halten. Wir haben uns köstlich amüsiert. Diese Szene kam mir immer wieder in einem späteren Gegenwartskunde-Unterricht in den Sinn, wenn wieder von der überragenden technischen Leistung des sowjetischen Systems die Rede war und behauptet wurde, dass die bedeutendsten Erfindungen russischen Ursprungs wären, sicherlich auch die des Fahrrads.
Eines Tages brach eine unerwartete Heimsuchung über uns herein. Deutsche Kommunisten und solche, die sich dafür ausgaben, sahen in der Roten Armee eine Schutzmacht, die sie zu den neuen Herren des Landes machten bis hin zu gesetzloser Machtvollkommenheit und der angemaßten Befugnis zur eigenen Bereicherung. Dazu beanspruchten sie das moralische Recht, ehemalige Erfüllungsgehilfen nach Gutdünken als solche zu bewerten und zum eigenen Vorteil zu enteignen. Unser Vater galt offensichtlich als belastet. Eines Tages hielt ein kleiner Lastwagen vor unserem Haus und zwei Männer inspizierten unsere Wohnung. Verschiedene tragbare Gegenstände nahmen sie einfach mit und drohten meiner verzweifelten Mutter mit ihrem nochmaligen Erscheinen und der Mitnahme einiger Möbel. In ihrer hilflosen Situation fand sie jedoch Beistand bei einsichtigen Menschen mit verbliebenem oder neuem Einfluss. Sie rieten, den Übeltätern nicht die Tür zu öffnen, denn diese hätten keinerlei rechtliche Befugnis für ihre Diebestouren. Polizeiliche Hilfe gäbe es allerdings auch nicht.
Auf dem Heimweg nach der Schule lief ich einige Zeit neben einem von zwei Pferden gezogenen Möbelwagen her. Plötzlich hatte ich die Eingebung, die könnten womöglich zu uns kommen, um Möbel zu holen. An der nächsten Straßenecke bogen sie tatsächlich in Richtung unseres Hauses ab. Wenige Minuten später hielten sie vor unserer Tür. Mir war sofort klar, dass ich nicht zu uns ins Haus gehen durfte. Ich ging einfach weiter bis zum Nachbarhaus und klingelte dort, wurde eingelassen und beschrieb meine Befürchtungen. Sofort erhielt ich Unterstützung und Gastrecht. Die Hausbesitzerin war übrigens die Dame, die über unsere Spanndrähte gestolpert war. Später erzählte mir meine Mutter, dass sie hinter der Gardine gestanden und bangen Herzens mich zusammen mit dem Möbelwagen hatte kommen sehen. Sie hätte Blut und Wasser geschwitzt. Natürlich war ich stolz auf meine Weitsicht.
Eines Tages wurde der Vater eines meiner Freunde von den Russen abgeholt. Er war Maschinenbau-Ingenieur, schon des Längeren bei Krupp beschäftigt und spezialisiert auf Mühlenbau. Der Grund blieb unbekannt. Als glaubensstarke Katholiken betete die Familie täglich mehrmals für ihren Mann und Vater. Nach zwei Tagen kam er tatsächlich wieder heim, und einen Tag später war das Haus verlassen. Die Familie war nach Westberlin geflohen.
Mit der Zeit normalisierten sich die Verhältnisse auf ein bescheidenes Nachkriegsniveau. Mein Vater avancierte zu einer Leitfigur für den Wiederaufbau der Industrie und wechselte zum Stahl- und Walzwerk Riesa, ehemals Thyssen.
Unser Wechsel nach Riesa
Wieder ein Umzug, wieder ein Schulwechsel. In Riesa-Gröba bezogen wir im Jahr 1949 anfangs eine Werkswohnung, etwas später eine kleinere Etagenwohnung in einem Zweifamilienhaus ganz in der Nähe. Nach sechs Jahren wurden dann meine Eltern nach jahrelangem Getrenntsein geschieden. Mein Vater wechselte in der Zwischenzeit nochmals zum Stahlwerk Freital bei Dresden, um dann nach der Scheidung die DDR zu verlassen und in Hürth bei Köln unterzutauchen.
Der Schulbetrieb in Gröba unterschied sich essenziell von dem in Magdeburg. Hier gab es normalen Sportunterricht, sogar Sportfeste mit Siegerehrungen. Jede Klasse verfügte über eine Fußballmannschaft, die gegeneinander antraten. Es gab eine Turnhalle. Der Unterricht war interessant. Ich war hoch motiviert. Am Ende war ich Schulrekordhalter im Weitsprung und beendete 1951 die Grundschule Gröba „mit Auszeichnung“. Ein Jahr zuvor war ich in den Sportverein „Fortschritt Riesa“, Abteilung Fußball eingetreten und wechselte später in die A-Jugend zu „Chemie Riesa“.
Vorausgegangen war bei annehmbarem Wetter ein beinahe tägliches Treffen einer Jugendclique auf dem Sportplatz der Radrennbahn – kurz „Ratsche“ genannt. Harald war der Älteste, arbeitete bereits im Stahlwerk, verdiente Geld und konnte uns einen Fußball spendieren. Dafür war er Ehrenmitglied. Ernstl wohnte in der Nähe und konnte aus dem Dachfenster die Ratsche überblicken.
Sobald sich dort etwas regte, war Ernstl zur Stelle. Er zählt noch heute zu meinem Freundeskreis und wohnt noch immer ganz in der Nähe, sodass wir uns regelmäßig besuchen können. Auch er zählte neben zwei weiteren Freunden zum Kern unserer Jugendmannschaft in Riesa.
Meine Mutter hatte in der nahen Umgebung in einem Kolonialwarengeschäft als Verkäuferin eine Arbeitsstelle gefunden. Sie legte großen Wert darauf, nahe bei unserer Wohnung arbeiten zu können, um die Mittagszeit zu nutzen, uns beiden Kindern immer nach der Schule ein Essen bereiten zu können und stets für uns bei Bedarf erreichbar zu sein. Sie selbst war gleichermaßen eingebunden in einen Freundeskreis, der ihr sicher in vielen belastenden Situationen Halt gab.
Nach der Grundschule besuchte ich von 1951 bis 1955 die Max-Planck-Oberschule Riesa. Der einfache Schulweg nahm etwa eine dreiviertel Stunde in Anspruch. Bei ganz und gar miserablem Wetter erhielt ich von meiner Mutter für die Hin- und Rückfahrt mit dem Bus dreißig Pfennige. Viele Male habe ich mir dann doch ein Herz genommen, bin gelaufen und habe dreißig Pfennig in meine Sparbüchse getan. Da ich wegen der beruflichen Stellung meines Vaters nicht zu den Arbeiter- und Bauernkindern zählte, musste meine Mutter ein monatliches Schulgeld bezahlen. Als vier Jahre später mein Bruder zur Max-Planck-Oberschule nachrückte, galt er zu unserem Erstaunen als Arbeiter- und Bauernkind. Ein Entscheider hatte offensichtlich ein Einsehen und Mitgefühl.
Täglich sah ich, wie meine tapfere Mutter sich abmühte, um die Familie über die Runden zu bekommen und dazu das Schulgeld aufzubringen. Als ich ihr eines Abends vorschlug, von der Schule zu gehen und im Stahlwerk eine Arbeit annehmen zu wollen, war sie strikt dagegen. „Und wenn ich Tag und Nacht arbeiten müsste, meine Jungs bekommen die beste Ausbildung, die erreicht werden kann.“ Ihr Heldenmut war ungebrochen. Ohne diese starke Mutter hätten mein Bruder und ich unsere Lebensziele wohl nicht verwirklichen können. In den Sommerferien habe ich für einige Wochen im Reifenwerk eine Arbeit angenommen und konnte auf diese Weise etwas zum Familienbudget beitragen. Die Arbeitseinsätze waren sehr abwechslungsreich vom Besenschwinger der Hofkolonne über Beifahrer im Lastwagen (ohne Führerschein), Formenreiniger in der Reifenfertigung bis hin zum Hilfsarbeiter bei der Fahrstuhlmontage. Bei letzterem Einsatz habe ich zwei sehr bedrohliche Arbeitsunfälle mit glücklichem Ausgang überstanden. Hier hatte ich in der Tat einen behütenden Schutzengel.
Der erste Winter meiner Oberschulzeit war sehr kalt. Von einem Bekannten konnte ich ein Paar passende Wehrmachtsstiefel, sogenannte Knobelbecher, ergattern und erschien damit täglich in der Schule. Kein Lehrer, noch nicht einmal der Rektor, nahm daran Anstoß. Jeder musste damals eben sehen, wie er zurechtkam.
Einige der Lehrer waren Kriegsteilnehmer und durch intensive Kurzlehrgänge umgeschult worden. Der Mathelehrer war Artillerieoffizier, der Chemielehrer hatte im Lazarett gesunden können, und der Deutschlehrer war ein beinversehrter Jagdflieger, der mit Krücken umherlief. Die Biologielehrerin war zuvor bis zur Vergesellschaftung Chefsekretärin bei Thyssen im Stahlwerk. Aber ausnahmslos alle beherrschten ihr Fach und konnten es uns auch erfolgreich vermitteln. Hin und wieder durchwehte ein spürbarer Hauch entlehnter einstiger Ordnung unsere Klassenräume. Durchaus zu unserem Vorteil.
Unseren Deutschlehrer hatten wir besonders ins Herz geschlossen, obwohl es im Unterricht streng und zackig zuging. Ab dem elften Schuljahr waren wir eine reine Jungsklasse von neunzehn Schülern. Ein Schwätzer erhielt die Ermahnung: „Kerl, wenn du weiter schwatzt, schlag ich dir die Krücke auf den Schädel, dass du Plattfüße bekommst“. Oder ein Schüler, der vergessen hatte, ein Gedicht auswendig zu lernen, und eine Ausrede zusammen stotterte: „Setz dich, Dussel. Aber den Nächsten lass ich stehen, und wenn ihm der Schweiß den Arsch runterrinnt“. Wenn er das Klassenzimmer betrat, war manchmal zu hören: „Kerle, reißt die Fenster auf, ein Weibermief ist das hier.“ Wir haben uns köstlich amüsiert. Verehrt haben wir ihn vor allem, weil er in kritischen Situationen, die es auch gab, stets auf unserer Seite stand und uns beigestanden hat. Unsere Biologielehrerin rief einmal verzweifelt: „Ihr seid sehr intelligent, aber schrecklich doof.“ Gemeint hatte sie wohl unsere noch unterentwickelte Allgemeinbildung.
Auch in Riesa gab es eine Jugendclique, sogar mit einem Hauptquartier, ein kleines Wäldchen am Ufer der Elbe. Bis Anfang der Fünfzigerjahre war das Wasser sauber genug, um hinüber ans andere Ufer zu schwimmen. Danach verschmutzte die Elbe zusehends. Vorbeitreibende Lastkähne wurden von uns mit einer Steinschleuder traktiert. Wir zielten auf die Bullaugen, getroffen haben wir allerdings nie eine. Die Schiffer tobten und brüllten herüber. Eines Tages kam wieder ein Kahn vorbeigetrieben, aber der Schiffer blieb ruhig vor seinem Steuerhaus stehen. Das hätte uns misstrauisch machen müssen.
In dem Moment griff von hinten eine uniformierte Hand zu meiner Schleuder und die Polizei hatte uns am Haken. Auf der Wache erhielten wir eine einschüchternde Standpauke mit der Drohung, im Wiederholungsfall erfolge eine Meldung an die Oberschule. Das war in der Tat für mich bedrohlich. Alles durfte passieren, aber die Oberschule musste ungefährdet bleiben. So wie mir immer motivierend klar war, dass ich meine Mutter nicht enttäuschen durfte. Ich musste nicht unbedingt zur Leistungsspitze gehören, zur oberen Hälfte aber immer.
Einige Jahre später, als ich schon studierte, aber noch regelmäßig meine Mutter besuchte, hörte ich von einer längeren politischen Gefängnisstrafe für unseren ehemaligen Deutschlehrer. Man hätte angeblich belastende Literatur bei ihm gefunden. Inzwischen war er wieder frei, aber ohne Anstellung. Dennoch blieb er in Riesa, und wenn ich ihm zufällig auf der Straße begegnete, ließ ich es mir nicht nehmen, ihn freundlich zu grüßen. Augenscheinlich hat ihn das sehr berührt.
Es gab sportliche Wettkämpfe mit anderen Oberschulen. Je nach Qualifikation mussten wir auch schon mal etwas weiter reisen und in Jugendherbergen übernachten. Durch den Vereinssport war ich durchtrainiert und gehörte in mehreren Sportarten der Schulauswahl an. Für bemerkenswert halte ich die kluge Einrichtung im Sportverein, die uns beim Wechsel von der B- in die A-Jugend in Absprache mit der Ruderabteilung am dortigen Trainingsprogramm über sechs Monate teilnehmen ließ, auf der Elbe jeweils im Vierer mit Steuermann. Fußball war eben doch etwas einseitig, und die jungen Burschen sollten auch ihren Oberkörper ertüchtigen.
Als ich am Mittwoch, dem 17. Juni 1953, nach Unterrichtsschluss auf dem Heimweg war und am Werkstor des Stahl- und Walzwerks vorbeikam, sah ich schon von Weitem russische Panzer auf der Straße stehen. Je näher ich dem Werkstor kam, desto gedrängter standen die Panzer. Zivile Menschen waren nicht zu sehen. Wie man mir später berichtete, hatten die Arbeiter die Arbeit niedergelegt und waren im Werksgelände von den Panzern eingeschlossen. Zum Glück kannte ich einen unauffälligen Seitenweg, der an der Elbe entlang durch unser kleines Wäldchen führte. So konnte ich die brenzlige Situation umgehen. Bis zu unserem Zuhause bin ich dann keinem einzigen Menschen mehr begegnet. Zwei Männer aus unserem Bekanntenkreis wurden verhaftet und verurteilt. Offizieller Vorwurf: Spionage für den Klassenfeind. Im nachfolgenden Unterricht ist dieses Thema niemals erschöpfend behandelt worden. Man war sichtlich bemüht, Normalität zu simulieren.
In den Ferien besuchte ich meinen Opa in Roßlau, den Fleischermeister. Selbstverständlich musste ich mich nützlich machen.
Das Schlachtvieh kam lebend mit Güterwaggons am Bahnhof an. Ohne Transportmöglichkeiten blieb nichts anderes übrig, als jedes Tier einzeln durch die Straßen vom Bahnhof bis zum Schlachthaus zu führen. Autos kamen selten vorbei. Opa führte meistens die Bullen, deren Augen stets verbunden waren, am Nasenring. Die Gesellen übernahmen die äußerst lebhaften Färsen, die Frauen die gemächlich trabenden Milchkühe und ich eines der Schweine. Allerdings kam ich nie weit mit einem Schwein. Es war das Laufen nicht gewöhnt, legte sich nach kurzer Wegstrecke auf die Erde, meistens in den Rinnstein, und streikte. Wache halten war nun meine Aufgabe, bis endlich, nach gefühlt langer Zeit, die Gesellen mit einem zweirädrigen Plattenwagen kamen und das Borstentier aufluden. Ärgerlich waren die zum Teil geistlosen Kommentare einiger Neunmalschlauer, die laut vortrugen, mit welchen einfachen Methoden ein Schwein wieder zum Laufen zu bringen sei.
Gemessen an der normalen Anzahl der Zuteilung von Schlachtvieh, bekam mein Opa einige Sonderlieferungen. Ihm oblag die Verpflichtung, die dortige Kaserne der Roten Armee mit entsprechend kontingentierten Fleischwaren zu versorgen. Abgeholt wurde die Ware von zwei gut Deutsch sprechenden Offizieren. Schon nach kurzer Zeit hatte mein Opa es geschafft, ein anhaltendes Vertrauensverhältnis aufzubauen. Die Offiziere parkten bei ihm in der Garage ein sicherlich irgendwo beschlagnahmtes Motorrad mit ausreichenden Benzinreserven, um an Wochenenden heimliche Spritztouren zu unternehmen. Wenn Fleischwaren abzuholen waren, zog man sich ins Kontor zurück und besprach die Lieferliste mit einigen Gläschen Wodka. Sobald sich die Möglichkeit bot, hatte ich mich mit ins Kontor geschlichen und setzte mich in eine hintere Ecke. Niemand nahm von mir Notiz. So hörte ich eines Tages, wie die Zwei von stalinistischen Zwangslagern erzählten. Am Ende seines Berichtes hielt einer der beiden die gespreizten Finger beider Hände über Kreuz vor sein Gesicht, um anzudeuten, was zu erwarten wäre, wenn seine Schilderung bekannt würde. Soweit meine frühen Einblicke in die politische Realität.
Etwa zwanzig Minuten Fußweg trennten mich vom Ufer der Elbe. Während des Krieges war dort in Ufernähe ein Frachtschiff, voll beladen mit Briketts, untergegangen. Es lag etwa zwei Meter unter Wasser. Eine Einladung für meine Freunde und mich, nach der Kohle zu tauchen und so manchen Handwagen voll davon zu Hause abzuliefern.
Direkt vor der Fleischerei endete die Straßenbahn, die Dessau und Roßlau verband – ein Triebwagen und ein, hin und wieder auch zwei Anhänger. Die Schienen waren niveaugleich in das Straßenpflaster eingelassen und endeten abrupt ohne jede Sperre. Die Straße sollte ja schließlich auch für Pferdewagen und Autos in voller Breite genutzt werden können. An dieser Endhaltestelle musste nun der Triebwagen die Richtungsposition ändern, an den Anhängern vorbei wieder an die Spitze Richtung Dessau fahren. Dafür waren zwei Weichen und ein kurzes paralleles Gleisstück eingerichtet. Gar nicht so selten kam es vor, dass der Triebwagenführer zu weit ausholte und mit den vorderen Rädern auf das Straßenpflaster geriet und festsaß. Der Schaffner ging dann zur nahe gelegenen Gaststätte, kam auch in unseren Fleischerladen und bat alle dienstbereiten Männer um Hilfe. Mit lauten Rufen und Kommandos gelang es stets, die Straßenbahn wieder einsatzbereit zurückzuschieben. Ein immer wieder unterhaltsames Schauspiel für zahlreiche Zuschauer.
Die Schlachtabfälle lagerten einige Tage im Hof bis zur Entsorgung. Das zog natürlich Ratten an. Scherry, unser Hofhund, ein Terrier, besorgte die Abwehr. Leider hatte er auch einen großen Freiheitsdrang und benutzte jede Gelegenheit, bei offenem Hoftor auszubüxen. Klar, dass Opa mich auf die Suche schickte. So lernte ich viele Straßen, Gassen und Plätze kennen. Wenn ich ihn fand, kam er ganz vertraulich angewedelt und ließ sich widerstandslos an die Leine nehmen. Meistens fand ich ihn im Schlossgarten und so hatte ich wenig Mühe, seinem Fluchtweg zu folgen.
Die Ferien gingen zu Ende. Die Abiturprüfungen nahten heran. Die zu erwartenden schriftlichen Prüfungsaufgaben, wurden von einer Zentralstelle formuliert. Die mündlichen Fragen ergaben sich aus dem Lehrplan. In jedem Fach umriss in den letzten Wochen der Lehrer jeweils das gesamte Spektrum der erforderlichen Kenntnisse, die jeder Schüler für ein Bestehen „drauf haben“ musste. Unser Primus ersann eine ungewöhnliche Vorbereitungsmethode. Für jedes Prüfungsfach wurde eine „Expertengruppe“ gebildet mit der Aufgabe, sachbezogene Gliederungstitel zu formulieren und eine erschöpfende Abhandlung zu Papier zu bringen. Jeder hatte am Ende einen umfassenden Ordner mit ausreichendem Prüfungswissen, beste Vorbereitungschancen und keiner fiel durch. Anlässlich späterer Klassentreffen war diese Strategie immer wieder ein mit vielen Episoden drapierter Gesprächsstoff.
Wenige Wochen vor dem Abitur wurde ohne Ankündigung jeder Schüler, somit auch ich, ins Zimmer des Rektors bestellt. Vier Herren saßen um einen Tisch herum und boten mir dort einen Sitzplatz an. Ich sei doch wohl auch, wie sie, für den Frieden, den es aber zu sichern gelte. So wäre der Eintritt in die Nationale Volksarmee doch eine große Chance für jeden jungen Mann, dem der Frieden am Herzen läge.
„Was hast du denn für Berufsvorstellungen?“
„Ich möchte gern Bauingenieurwesen studieren.“
„Sehr gut, aber völlig überlaufen, wohl aussichtslos“.
Leider war ich so unvorsichtig, Interesse an Flugzeugen zu zeigen, und in der Folge hatte ich schweißtreibende Mühe, mich aus dieser Klammer wieder herauszuwinden.
Entgegen dieser Angstmache wurde ich ohne Probleme als Student des Bauingenieurwesens zum Herbstsemester 1955 an der Technischen Hochschule Dresden immatrikuliert. Noch war ich erst siebzehn Jahre alt. Hans, ein Klassenkamerad, wählte das gleiche Studium, ebenfalls in Dresden. Auch er wurde angenommen. Noch immer bin ich mit ihm freundschaftlich verbunden. Mit seiner Familie wohnt er heute gleichfalls in unserer Nähe und wir sehen uns regelmäßig.
Vor Studienbeginn konnte ich noch einige Wochen im Riesaer Reifenwerk arbeiten und etwas zum Familienetat beisteuern. Ab Studienbeginn erhielt ich ein Stipendium, etwas gekürzt, da ich nach wie vor kein Arbeiter-und Bauernkind war. Meine erste Unterkunft in Dresden war ein Zimmer im Studentenwohnheim, zusammen mit weiteren fünf Kommilitonen untergebracht in drei Doppelstockbetten. Einer von ihnen war Hans, mein heutiger Freund und ehemaliger Klassenkamerad.
Der lange Schatten und der 50. Breitengrad
Prägend waren für mich zwei besondere Erlebnisse während der Oberschulzeit.
Anfang März 1953 verstarb der gefürchtete wie untertänig verehrte Übervater Josef Stalin. Wir waren inzwischen in die elfte Klasse aufgestiegen. Der Jahrgang vor uns bereitete sich auf das Abitur vor.
Etwa Mitte März wurden alle Schülerinnen und Schüler wieder einmal in die Aula zu einer klassenübergreifenden Zusammenkunft gebeten. Das Lehrerkollegium versammelte sich wie gewöhnlich vorn links. Mit meinen Klassenkameraden hatte ich einen Platz in der Mitte des Saales. Die Abiturklassen saßen weiter vorn. Das Hauptthema und das Nachspiel haben sich mir unvergessen eingebrannt. Der Rektor betrauerte noch einmal pflichtgemäß den unermesslichen Verlust für die gesamte Menschheit und setzte uns unversehens in Kenntnis über das schändliche Treiben der Riesaer Jungen Gemeinde.
Sie sei eine Brutstätte antisozialistischer, konterrevolutionärer Umtriebe, ihre Aktivisten seien Volksschädlinge, scheinheilig getarnt hinter christlichen Wertvorstellungen, einfach Abschaum. Das Allerschlimmste aber sei, dass einige Schüler unserer Oberschule dort mitwirkten.
Als schlagenden Beweis könne er den von ihm selbst besichtigten Schaukasten der Jungen Gemeinde anführen. Zum Tod des allseits schmerzlich betrauerten Generalissimus hätte die Junge Gemeinde ein Bild von ihm auf rotem Hintergrund ausgehängt. Mit dem Rot der Arbeiterklasse wolle sie nur täuschen und ihre versteckte Freude über Stalins Tod signalisieren, denn die Farbe wirklicher Trauer sei Schwarz. Eine unerhörte Provokation. Des Rektors Gesicht war inzwischen rot angelaufen, nicht schwarz. Beklemmende Stille trat ein. Die Luft im Saal lastete schwer auf der Schülerschaft.
Ein Arm ging in die Höhe und ein Schüler aus einer der Abiturklassen erhob sich. Mit ruhiger Stimme bekannte er sich als Mitglied der Riesaer Jungen Gemeinde. Ich sah ihn nur von hinten, meine aber, mich an einen eher schmächtigen rotblonden Burschen zu erinnern. Er verwahrte sich gegen die ungeheuerlichen Anschuldigungen. Nichts würde stimmen. Die Riesaer Junge Gemeinde sei eine Jugendgruppe der evangelischen Kirche mit dem alleinigen Ziel einer gemeinschaftlichen christlichen Betätigung. Sie seien Teil der Kirchengemeinde. Politische Arbeit oder gar oppositionelle Öffentlichkeitssuche fände nicht statt.
Er konnte tatsächlich ausreden. Allem Anschein nach hatte niemand mit einer derartigen Widerrede gerechnet. Dieses mutige Bekenntnis empfand ich als tollkühn und es fuhr mir in alle Glieder. Ich war starr vor Ehrfurcht und Bewunderung, aber gleichzeitig auch mit bestürzender Ahnung. Musste nicht mit einem sofortigen Schulverweis gerechnet werden? Abitur ade, Lebensplanung dahin, Zukunft verdorben. Später erfuhr ich, dass er tatsächlich unsere Schule verlassen hatte oder musste, jedoch in Westberlin Aufnahme fand und gewiss sein Abitur nachholen konnte. Ich war erleichtert. Dieser unerschrockene Bekennermut, diese charakterstarke Zivilcourage haben mich zutiefst beeindruckt und durchdringen mich bis zum heutigen Tage.
Wie ich noch berichten werde, gab es auch in meinem weiteren Leben Zeiten, an denen ich das Herz in beide Hände nehmen, Angst überwinden, mich erkühnen und neuen Mut schöpfen musste. Die Erinnerung an diese Lehrstunde hat mir in kritischen Momenten sehr geholfen. Es war eine wegweisende Lebenserfahrung. Ein prägendes Ereignis mit langem Schatten.
Wieder eine weitere Zusammenkunft in der Aula. Ein westdeutscher Friedenskämpfer aus Mainz hatte sich angesagt und wollte von seiner löblichen Tätigkeit berichten. Der Vortag war eine läppische Aneinanderreihung von alltäglichen Delikten, natürlich im Sinne der Friedenssicherung, und davon, wie man in überlegener Weise die Polizei zum Narren halten konnte. Am Ende durften Fragen gestellt werden. Unser schon etwas älterer Lateinlehrer bat um Auskunft, da er seit dem Krieg nicht mehr in seiner Studentenstadt Mainz war, ob denn der 50. Breitengrad noch immer unversehrt geblieben und für jeden Besucher sichtbar sei. Die Reaktion war ein verlegenes Gestammel, ein hilfesuchendes Herumgerede. Jedem intelligenten Menschen im Saal war klar, dass es sich um einen auf Tour geschickten Schwindler handelt. Jedes Mainzer Schulkind kennt das in der Innenstadt in das Straßenpflaster sichtbar eingelassene Metallband als Markierung des 50. Breitengrades nördlicher Breite. Noch heute haben es die politischen Propagandisten und die Missionare der Indoktrination schwer mit mir.
Studium an der TH Dresden
Angefangen habe ich mit einer Vier in darstellender Geometrie, aber das Studium beendet mit einem „Sehr gut“ in der Diplomarbeit. Die größte Hürde war für mich Russisch. Bei der ersten Prüfung durchgefallen und die zweite mit Ach und Krach bestanden. Ich bin einfach nicht sprachbegabt. Die Ingenieurfächer mit mathematischen, physikalischen, mechanischen und konstruktiven Anforderungen fielen mir dagegen umso leichter.
Da ich bei Studienbeginn erst 17 Jahre alt war, durfte ich noch in der A-Jugend spielen und wechselte zu „Empor Tabak Dresden“.
Die erste Note an der TH, die schon erwähnte Vier, war ein Segen für mich, denn nun gab es keinen Zweifel mehr, ich musste mich auf das Studium konzentrieren und dem Vereinsfußball für immer ade sagen. So verabschiedete ich mich am Ende der Jugendsaison von meinen Sportkameraden.
Das siebte Semester war für ein Praktikum bestimmt. Hans und ich erhielten eine Anstellung bei der damals noch privaten Baufirma Louis Schneider in Riesa. Zu Beginn arbeitete ich auf einer Brückenbaustelle, wechselte danach zum Gerüstbau und die restliche, etwa halbe Zeit, durfte ich im Konstruktionsbüro mitwirken. Dessen Leiter war ein ehemaliger Professor aus Rostow am Don. Er hatte in Karlsruhe studiert und sprach sehr gut deutsch. Auch seine Familie lebte in Riesa. Der erwachsene Sohn arbeitete ebenfalls bei Louis Schneider. Anfangs war er sehr zurückhaltend und beschränkte sich auf die notwendigen technischen Anweisungen. Mit der Zeit aber öffnete er sich mehr und mehr, es entstand in der Tat ein Vertrauensverhältnis.
Eines Tages überraschte er mich sogar mit der Prognose, dass ich eine große Zukunft vor mir hätte. Von ihm hörte ich dann auch seinen Lebensweg: festgenommen und eingekerkert während der Oktoberrevolution. Ein nachträglich empfundener Glücksumstand, denn der Kerker war ein unerwartet sicherer Ort. Nur weniger seiner Gefährten hatten die verderblichen Unruhen überlebt. Danach arbeitete er als Bauleiter an verschiedenen Orten. Amüsant, wie fehlendes oder unpassendes Material auf russische Art beschafft oder passend gemacht wurde. Nach einigen Jahren erreichte ihn ein Ruf an die Rostower Technische Hochschule als Professor für Baukonstruktionen. Als die deutschen Truppen Rostow am Don erreichten und sich später wieder zurückzogen, schloss er sich mit seiner Familie dem Rückstrom an und galt später in der DDR als Heimatvertriebener aus den deutschen Ostgebieten. Stets plagte ihn die Sorge, unter den sowjetischen Offizieren könnte ihn ein ehemaliger Student durch einen unglücklichen Zufall wiedererkennen. Es erfüllt mich noch heute mit ehrendem Erstaunen, von ihm auf diese Weise ins Vertrauen gezogen worden zu sein.
Meine Studienjahre waren zwar angefüllt mit ernsthaftem Bestreben und aufsteigendem Erfolg, ließen aber auch Raum für studentisches Lebensgefühl. Das Vordiplom feierten wir auf der Bastei in der Sächsischen Schweiz. Zur Eröffnung sangen wir gemeinsam „Gaudeamus igitur“, zogen später mit brennenden Fackeln auf Bergeshöhe, wo ein Kommilitone die „Bergpredigt“ verkündete.
Meine Unterkunft im Studentenheim konnte ich schon nach zwei Semestern mit einem Vierbettzimmer in einer alten Villa tauschen. Wiederum zwei Semester später bezog ich ein Privatzimmer bei einem Ehepaar. Der Mann war mir bestens bekannt, denn es war mein ehemaliger Trainer beim Fußballklub, sowohl in Riesa als auch später bei Tabak Dresden. Zufälle gibts. Als vier Jahre nach mir mein Bruder ebenfalls an der TH Dresden ein Studium für Radiochemie aufnahm, konnte ich ihm in Absprache mit meinen Vermietern das Zimmer überlassen, da es mir gelang, ein anderes Privatzimmer zu finden. Bei der Zimmersuche hatten es Erstsemester sehr viel schwerer als Altsemester, eine Privatunterkunft zu finden. Mein neues Zuhause war ein gut möbliertes Zimmer, allerdings mit einer Waschkommode am Bett. Dafür wurde ich aber von meinen beiden Wirtinnen, zwei alleinstehenden, schon etwas älteren Schwestern im Ruhestand, wie ein Herr Studiosus alter Prägung umsorgt. Nach dem Aufstehen ging ich gewöhnlich zur Toilette auf halber Höhe im Treppenhaus. Zurückgekehrt stand ein Kännchen mit heißem Wasser zum Nassrasieren neben der Waschschüssel. Etwas später, nie zu früh, wurde das Frühstück serviert und der Herr Studiosus begab sich gestärkt auf den Weg zur Universität. Die überaus fürsorgliche Betreuung erstreckte sich allerdings auch auf die übrige Zeit. Die Beaufsichtigung kannte keine Unterbrechung. Damenbesuche waren ohnehin strikt untersagt. Das letzte Semester war hauptsächlich für das Anfertigen der letzten Belegarbeiten und für die Vorbereitung der Diplomarbeit vorgesehen. Planmäßige Lehrveranstaltungen blieben nur noch für Nachzügler im Programm.
Die Einteilung des Tages oblag nunmehr der persönlichen Neigung und dem Vorwärtsstreben, sofern keine Wiederholungen anstanden. Einige Studienkameraden wohnten ganz in der Nähe, und so verabredeten wir uns mal beim einen, mal beim anderen zum geselligen Abend bei Schach, Skat, Plausch und selbstredend auch zum Junggesellentratsch und so manchen studentischen Träumen. Bier zu trinken war üblich, höherprozentigen Alkohol gab es nur zu ausgesprochenen Ausnahmesituationen. Ich habe nie einen betrunkenen Studienkameraden erlebt. Rauschgift war völlig unbekannt. Es war noch nicht einmal ein Thema. Über Politik sprachen wir selten, obwohl jeder von uns eine Vorstellung von der übereinstimmenden Grundüberzeugung des anderen hatte. Keiner wollte sein Studium leichtfertig gefährden, hielt gesellschaftspolitische Kritik in unserer Situation ohnehin für fruchtlos. Noch war es für einen normalen, intelligenten Kopf einigermaßen machbar und erträglich, im Strom der vorgegebenen Sichtweisen mitzuschwimmen. Der heutige Leser muss bedenken, wir gehörten zu den Überlebenden eines furchtbaren Krieges, unser Land war größtenteils zerstört, der Wiederaufbau hatte gerade begonnen und wir wollten als zukünftige Bauingenieure daran nach besten Kräften mitwirken.
Hin und wieder flog mitten in der Nacht ein Steinchen an meine Fensterscheibe. Unten stand meistens mein Kommilitone Paulchen und forderte mich auf, unverzüglich zu ihm zu kommen. Es fehlte der dritte Mann zum Skat. Der Trainingsanzug war schnell über den Schlafanzug gezogen und ich stand zur Verfügung. Hatte ich doch selbst Freude und Vergnügen am Skatspiel und der Geselligkeit. Gegen elf Uhr am Morgen machten wir uns dann auf zur Mensa, noch immer im Trainingsanzug, um uns zu stärken. Wieder im heimatlichen Quartier erschien eine meiner Wirtinnen mit erhobenem Zeigefinger und der Ermahnung: „Manfred, Sie leben wieder sehr unsolide.“ Es blieb bei dem Tadel, Konsequenzen hatte er jedoch keine.
Die Osterfeiertage 1960 verbrachte ich zusammen mit meinem Bruder bei unserer Mutter in Riesa. Nach dem üblichen Osterspaziergang auf dem Gröbaer Elbdeich war ein Besuch im örtlichen Kino geplant. Viele Mitbewohner schlossen ein Wochenende oder einen Feiertag mit einem besinnlichen Kinobesuch ab. Vorausgesetzt, ein akzeptabler Film stand auf dem Programm. Dieses Mal wurde „Fanny“ angeboten. Nach Schluss der Vorstellung standen noch einige Grüppchen zusammen und unterhielten sich angeregt über private Begebenheiten. Mit uns unterhielten sich ein mit unserer Mutter sehr gut befreundetes älteres Ehepaar und stellten uns seine Enkelin Sybille aus Berlin-Rahnsdorf vor. Ein sehr charmanter, aparter und dazu noch sehr hübscher Teenager mit strahlenden Augen kurz vor seinem sechzehnten Geburtstag. Sie gefiel mir auf Anhieb. Ich war aber völlig unvorbereitet, da mich das Studium total ausfüllte, und empfand leichte Hemmungen, einmal wegen ihrer Jugend und zum anderen wegen des zusprechenden Interesses meiner Mutter. Ja, so war ich nun einmal gewickelt. Meine Mutter kannte Sybille bereits von gelegentlichen Einkäufen bei ihr. Gefragt nach meinem Eindruck erfand ich die Ausrede, Sybille sei wohl eine sympathische Person, sie habe aber eine deutliche Knollennase. Meiner Mutter war meine Ausflucht sofort klar. Sie schwieg zwar, vereinbarte aber einen Familienbesuch bei Sybilles Großeltern anlässlich einer Fernsehübertragung von Goethes Faust schon am nächsten Abend. Brav saßen wir beieinander, die Gedanken ganz sicher nicht bei der Darbietung im TV. Diese Begegnung sollte sich als glückliche Fügung des Himmels erweisen. Sybille hat bis zum heutigen Tag mein weiteres Leben bestimmt, in Liebe, Zufriedenheit und Dankbarkeit. Näheres darüber etwas später auch von ihr.
Zurück in Dresden schlich sich eine „schöpferische Pause“ ein. Unversehens bemerkte ich im Fach Statik einige Lücken, die mein weiteres Vorankommen in diesem Fach hemmten. Meine Idee war: Ich musste etwas organisieren, was mich zwang, vermehrt zu arbeiten. Die Lösung: Ich bewarb mich am Lehrstuhl für Statik als Hilfsassistent zur Betreuung jüngerer Semester in Übungsstunden und wurde angenommen. Die Lösungen der gestellten Übungsaufgaben mussten anschließend von einem der Hilfsassistenten im Schaukasten des Lehrstuhls ausgehängt werden. Das war für mich der schweißtreibende, aber heilsame Zwang. Außerdem gab es ein willkommenes Salär. Nun, Ende gut, alles gut.
Zur Diplom-Abschlussfeier nach Ende des erfolgreichen Studiums versammelten wir uns zusammen mit unseren Professoren in einer Gaststätte an der Tharandter Talsperre. Ein eigens verfasstes Schattenspiel in mehreren Bildern schilderte das erlebnisreiche Studentenleben von der Immatrikulation bis zum Finale in Versform, erschaffen von einem eigenen, begabten Team. Das Stück trug den Titel „ Stud. ing. Flasche“. Mir kam die ehrende Auszeichnung zuteil, den Titelhelden zu spielen. Der Auszug im folgenden Kapitel soll es dem Leser nahebringen und ihn sicher auch erfreuen.
Den Höhepunkt der Feier bildete der symbolische Abschied von den Lehrfächern unserer Disziplin. Alle Teilnehmer einschließlich unserer Professoren, unserer Gäste und die Kapelle bestiegen um Mitternacht bereitstehende Ruderkähne und fuhren weit auf den See hinaus. Mitgeführt hatten wir für jedes Fach eine mit Steinen bewehrte Holzkiste, mit deutlicher Aufschrift. Unter Dankesworten und Musikbegleitung wurde nacheinander jede einzelne Kiste symbolisch und feierlich auf den Grund des Sees versenkt. Sollte das Holz widerstandsfähig genug sein, dann liegen unsere Reliquien noch heute dort unten.
„Stud. ing. Heinrich Flasche“– ein Schattenspiel
Amor hominis
Flasche hat sich vorgenommen,
heut zu einem Weib zu kommen. …
Jetzt fragt er, ob sie’s interessiere,
dass er an der TH studiere …
Doch als er nun auf Tröstung wartet,
da ist die Schöne schon gestartet.
Ganz anders ist hier cand. ing. Bock,
der hat die Hand schon unterm Arm,
das zeugt von ganz besonderem Charme.
Prüfung
Nach dieser kleinen Ouvertüre
büffelt er die Fachlektüre,
denn am Mittwoch, welche Qual,
muss er zur Prüfung noch einmal.
Ach, lieber Gott, hab doch Pardon
mit mir und mit dem Stahlbeton. …
Nach dergestalter Vorbereitung
naht sich für Flasche die Entscheidung.
Der gute Anzug wird geplättet,
mit Freunden wird um Bier gewettet,
dass man `ne Fünf baut, garantiert,
und dann wird prüfungswärts marschiert.
Am Ort der Handlung angekommen,
ist Flasche etwas arg beklommen.
Er wünscht da drinnen den zur Hölle
und sich selbst an dessen Stelle.
Doch nichts ist jetzt mehr aufzuhalten,
die Tür geht auf, er steht vorm Alten.
„Sie sind Herr Flasche? Sehr erfreut!“
So heuchelt man voll Freundlichkeit.
Drauf setzt man allerseits sich hin,
auf dass die Folterung beginn.
Und auf Herrn Flasche treu und bieder,
senkt drohend sich ein Schatten nieder.
Und salbungsvoll und voller Tücke
ertönt‘s: „Was ist denn eine Brücke?“
Die Frage trifft ihn wie ein Hieb,
er duckt sich und glotzt merklich trüb.
„`Ne Brücke? Das ist sozusagen“,
warum so Schweres immer fragen?
„Nun ja, man spricht von einer Brücke,
wenn im Gelände eine Lücke
– man nennt dies Tal – vorhanden ist,
welch Selbes man dann kunstvoll schließt.
Wobei man darauf achten muss,
dass, wenn im Talesgrund ein Fluss
sich tummelt, vielerorts derselbe,
als Beispiel denk ich an die Elbe,
naturgemäß sehr dankbar ist,
wenn man beim Bauen nicht vergisst,
die Brücke also anzulegen,
dass er sich drunter kann bewegen.
Zu welchem Zweck man oft bei Brücken
gar große Löcher kann erblicken.
Wobei man noch auf diese Art
sehr viel des Materials erspart.“
„Das reicht, Herr Flasche! Denn fürwahr,
die Antwort scheint mir ziemlich klar.“
Bejahend nickt der Assistent,
der nebenan am Tische pennt.
Und bloß damit er auch was spricht,
sagt er: „Mehr weiß ich selber nicht!“
So naht der große Augenblick,
der Delinquent wird rausgeschickt,
denn Ordnung muss ja schließlich sein.
Gleich drauf, da muss er wieder rein.
Was falsch war, wird ihm offeriert,
– man hat im Buch sich informiert –,
dann reicht man ihm mit Gönnermiene
`ne Vier, weil mehr er nicht verdiene.
Worauf er froh verlässt den Saal
Und denkt – ihr alle könnt mich mal.
Ein Wunsch, wie später er versteht,
der doch nicht in Erfüllung geht.
Finale
Dies jedoch war nicht der Schluss,
denn jetzt kommt nun, was kommen muss.
Flasche spricht zu Schulz und Staufen:
„Los, jetzt geh´n wir einen saufen.
nach der alten Väter Weise,
wandert man, nicht grade leise,
eben zu besagtem Zwecke
zur Kaschemme an der Ecke,
auf dass man nach bestand´nem Werke,
mit Korn und Bier sich gütlich stärke …
Flasche brüllt: „Ich geb `ne Runde!“
Freude herrscht ob dieser Kunde,
und mit einem Liter Bier,
feiert man die neue Vier …
Leicht verworren, die Gedanken,
sieht man sie nun heimwärts schwanken.
In der Tür vor lauter Lust
Singt Flasche noch aus voller Brust:
(– alle singen ein Studentenlied –)