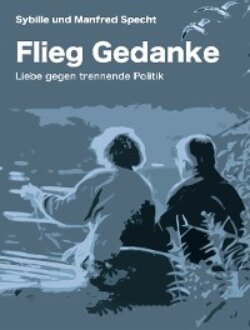Читать книгу Flieg Gedanke - Sybille und Manfred Specht - Страница 9
Sybille: Geboren in Sachsen, aufgewachsen in Berlin
ОглавлениеIch, Angela Sybille Tischer, wurde am 14. Mai 1944 in Riesa an der Elbe geboren. Meine Eltern Helmut und Ursula Tischer hatten im Februar 1943, noch während des Krieges, geheiratet und lebten in Leipzig.
Da mein Vater zu dieser Zeit als Soldat in Großenhain stationiert war, hielt sich meine Mutter zur Zeit meiner Geburt bei ihren Eltern Margarethe und Paul Marx in Riesa auf. Auch die Eltern meines Vaters, Camilla und Paul Tischer, lebten in Riesa an der Elbe. Ihr Wohnhaus befand sich tatsächlich in unmittelbarer Nähe zum Elbufer, das nur durch das Eisenbahngleis einer Werksbahn zur Mühle nebenan getrennt war.
Während meine Mutter als Einzelkind aufwuchs, war mein Vater jüngstes Kind von acht Geschwistern. Von allen neun Kindern erreichten aber nur sechs das Erwachsenenalter.
Mein Vater selbst konnte zum Zeitpunkt meiner Geburt leider nicht in Riesa sein, deshalb war die Unterstützung meiner Großeltern von großem Wert. Nach Überlieferung waren sie sehr stolz über die Geburt ihrer ersten Enkelin, und das blieben sie auch bis an ihr Lebensende. Die Liebe zu mir begann allerdings mit einem Schock. Am Tag nach meiner Geburt besuchten sie meine Mutter im Krankenhaus und wollten auch das kleine Würmchen Sybille begrüßen. Man fand mich aber nicht! Es war Krieg und alles ging einfach drunter und drüber. Letztlich wurde ich dann doch gefunden – in einem Pappkarton!
Da mein Kopf nach den Geburtsanstrengungen noch etwas deformiert war, behauptete mein Opa, das könne unmöglich seine Enkeltochter sein. Hat sich dann aber alles verwachsen. Glaube ich zumindest.
Auch Leipzig wurde von den Alliierten schwer bombardiert, daher blieb meine Mutter mit mir bis zum Ende des Krieges bei meinen Großeltern in Riesa. Im Zuge der Vertreibung aus den deutschen Ostgebieten (ein Kriegsverbrechen, das bis heute als solches nicht anerkannt ist) nahmen Oma und Opa Marx die vierköpfige Familie seiner Schwester aus Schlesien auf. Die Wohnverhältnisse in einer Dreizimmerwohnung waren dadurch sehr beengt, und da unser Haus in Leipzig in einer Trümmerstraße zum Glück nicht betroffen war, zogen meine Mutter und ich zurück nach Leipzig.
Mein Vater geriet zu dieser Zeit vorerst in amerikanische Gefangenschaft, wurde anschließend von den Sowjets „übernommen“ und nach sechs Wochen im KZ Sachsenhausen nach Tiflis in Georgien verschleppt. Vier lange Jahre musste er unter schwierigsten Umständen und Bedingungen dort verbringen, ohne ein Lebenszeichen geben zu können. Auch für die Daheimgebliebenen eine unerträgliche und unmenschliche Zeit. Nur einer geringen Anzahl der Kriegsgefangenen war eine Heimkehr, oftmals schwer gezeichnet und krank, überhaupt möglich. Mein Vater gehörte zu den wenigen Glücklichen, die 1949 nach Hause zurückkehren durften. Er war körperlich unversehrt, das Aufarbeiten der seelischen Wunden der Gefangenschaft sowie der Bilder der neben ihm im Feld gefallenen Kameraden hat aber noch viele Jahre gebraucht.
Immer wieder hat er uns über diese Zeit seine Erlebnisse geschildert. Das war sicher seine Art, diese schlimme Zeit zu verarbeiten.
1949 kehrte er also heim. Fünf Jahre hatte ich mit meiner Mutter allein verbracht und mit ihr zusammen im Schlafzimmer in einem Bett geschlafen. Ich kann mich noch heute daran erinnern, wie verletzt ich war, nun allein in einem anderen Raum schlafen zu müssen, und ein „fremder“ Mann durfte neben Mutti meinen Platz einnehmen. Aber auch für meinen Vater war es nicht einfach, denn an meinen ersten frühkindlichen Entwicklungsjahren hatte er nicht teilnehmen dürfen. Nach einer kurzen Übergangszeit spielte sich alles ein, Vati wurde akzeptiert und es begann ein normales Familienleben.
Auch außerhalb der Familie normalisierte sich das Leben auf niedrigem Niveau. Vati bekam Arbeit als ausgebildeter Kaufmann in der Farbenfabrik Wolfen, was eine tägliche Bahnfahrt von Leipzig nach Wolfen bedeutete. Aber es gab ein regelmäßiges bescheidenes Einkommen.
Wovon Mutti mit mir die Jahre während Vatis Abwesenheit gelebt hat, ist mir leider nicht bekannt; ich hatte sie nie danach gefragt. Ich kann mir vorstellen, dass sie so eine Art Soldatengehalt bekommen hat. Wahrscheinlich wurde sie auch von ihren Eltern unterstützt, wobei diese auch ihr gesamtes Sparvermögen verloren hatten. Nach dem Krieg gab es eine Währungsreform – sprich: Man wurde enteignet.
Bild 2 – Sybilles Einschulung im September 1950
1950 begann für mich mit meiner Einschulung ein neuer Lebensabschnitt. Die Schule hatte die Bombardierung nur zur Hälfte überstanden, aber im unversehrten Teil konnte wieder Unterricht stattfinden. Es musste halt etwas zusammengerückt werden. Unsere Lehrer waren jedoch hoch motiviert und konnten uns Schüler schnell fürs Lernen begeistern. Das ABC erlernten wir nach alter Väter Sitte, Ganzheitsmethode und Legasthenie waren noch unbekannt. Auch stand das Einmaleins auf dem Lehrplan, mit Mengenlehre mussten sich erst unsere Kinder plagen. Bei ihnen war zwar auch wieder Kopfrechnen angesagt, während heute schnell mal zum Handy gegriffen wird.
1952 wurde mein Bruder Matthias geboren. Oma Camilla kam hochbetagt mit der Bahn von Riesa nach Leipzig angereist, um den damals letzten Stammhalter der Familie Tischer in Augenschein zu nehmen. In dieser Generation ist er auch der einzige Nachkomme der Familie Tischer geblieben. Zu dieser Zeit war gewöhnlich die „Thronfolge“ männlich, und somit rückte ich als Erstgeborene automatisch ins zweite Glied.
Zur gleichen Zeit wurde Vati von seiner Firma nach Berlin (natürlich Ost, denn Leipzig gehörte zur sowjetischen Besatzungszone) versetzt und übernahm als kaufmännischer Leiter das Außenbüro der Farbenfabrik Wolfen. Nach mehrmonatigem Pendeln zwischen Leipzig und Berlin (immer mit der Bahn, denn ein eigenes Auto oder ein Firmenwagen waren bis dahin außerhalb des Vorstellbaren) ging Vati auf Wohnungssuche, was im immer noch bombenzerstörten Berlin eine fast unlösbare Aufgabe war.
Vor dem Krieg war Vati allerdings stolzer Besitzer eines eigenen Autos einschließlich eines auch damals schon notwendigen Führerscheins. Am Ende des Krieges beschlagnahmten die Russen den Wagen und haben das Auto während der Zeit, als Vati in Gefangenschaft war, einfach verkauft. Bei einem Besuch in Riesa sah Vati sein Auto am Straßenrand und machte den Fahrer ausfindig. Es war der neue Besitzer, der den Wagen von den Russen gekauft hatte. Somit hatte Vati keinen Anspruch mehr!!!
Zurück zur Wohnungssuche:
Er hatte Glück und ergatterte eine schöne Zweieinhalbzimmerwohnung in einem Zweifamilienhaus – allerdings für damalige Verhältnisse jwd. Der unmittelbare Zugang zu Wald und Wasser (Müggel- und Dämeritzsee) war für uns Kinder einfach paradiesisch und ließ uns in nahezu unberührter Natur aufwachsen. Im Sommer ging es mit den Eltern und Großeltern in die Beeren und Pilze, die damals noch reichlich vorhanden waren. Oma und Opa Marx verbrachten regelmäßig ihren dreiwöchigen Urlaub bei uns, und wir Kinder freuten uns immer riesig auf ihren Besuch. Wie das Schlafproblem mit sechs Personen in unserer Wohnung gestaltet wurde, ist mir heute nicht mehr in Erinnerung, es wurde aber wohl gelöst und wir hatten immer eine wunderbare Sommerzeit.
Bei bedecktem Himmel ging es also in die Pilze und die Ausbeute war immer reichlich, sodass auch für den Winter eingeweckt werden konnte. Manchmal besuchte uns auch eine entfernte Cousine aus Niesky und zeigte uns als offizielle Pilzberaterin viele uns unbekannte Pilze. Dazu gehörten auch die giftigen, damit wir vor Verwechslungen sicher waren. Dieses Wissen war uns noch viele Jahre später sehr hilfreich, als wir die schwedischen Wälder erkundeten.
Bevor wir nun diese wunderbare Umgebung in Rahnsdorf erleben konnten, stand erst einmal der Umzug von Leipzig nach Berlin an. Vati war schon ein Jahr vor der Familie in seiner neuen Arbeitsstelle tätig und wohnte die Woche über bei einem Arbeitskollegen und seiner Frau. Am Wochenende fuhr er zu uns nach Leipzig. Mit der Übersiedlung nach Berlin im Februar 1953 begann nun auch ein wirkliches Familienleben für uns, die Wochenenden konnten genossen werden, wobei samstags noch bis mittags gearbeitet werden musste. Auch wir Schüler drückten bis zum Schulabschluss jeden Samstag die Schulbank.
Meine Umschulung nach Berlin bereitete mir keine Schwierigkeiten, zumindest was den Lernstoff betraf. Allerdings war ich mit meinem wohl breiten Sächsisch ein Exot. Die „herzliche“ Art der Berliner Gören machte es mir aber leicht, mich innerhalb kurzer Zeit auf „icke, icke“ umzustellen. Eigentlich ist Sächsisch ja ein liebenswerter Dialekt (was nicht viele so sehen), und bei Bedarf kann ich es heute noch sprechen und viele Begriffe auch verstehen.
Mein Bruder Matthias war beim Umzug erst drei Monate alt und hatte noch keine Sprachprobleme. Allerdings weigerte er sich lange, überhaupt zu sprechen, er wurde sogar mal beim Arzt vorgestellt, weil meine Eltern sich Sorgen machten. Mit gut zweieinhalb Jahren kam dann die Erlösung und er sprach sofort ganze Sätze!
Mein Einleben in die neue Schule gelang also ohne Probleme, und die ersten Sommerferien wurden intensiv am Müggelsee verbracht. Da ich als Leipziger Stadtkind bis zu unserem Umzug keine Möglichkeit hatte, schwimmen zu lernen, bot sich nun dazu die erste Möglichkeit, zumal ich mit meinen Schulkameraden auch allein ohne meine Eltern zum See fahren wollte. Also wurde ich zum Schwimmunterricht angemeldet und kam „an die Angel“. Auf einer schwimmenden Insel (unter dem Begriff Prahm im Strandbad bekannt) war ein Ausleger wie eine steife Angelrute befestigt. Statt Angelschnur hing am vorderen Ende eine Schlinge an der langen Leine, die um die Brust gelegt wurde. So wurden nach den ersten Trockenübungen die ersten Schwimmversuche im tiefen(!) Wasser gemacht. Beim drohenden Abgluckern wurde man sofort nach oben gezogen. Ich fand es eine tolle Erfindung, sie wurde aber schon nach einiger Zeit aus mir unbekannten Gründen nicht mehr praktiziert. Jedenfalls präsentierte ich bereits nach zwei Wochen stolz meinen Fahrtenschwimmer. So ausgestattet konnten wir Kinder jeden Sommer im und am Wasser ausgiebig genießen. Ich entwickelte mich zu einer ausgesprochenen Wasserratte! Nach Schulschluss, wenn die Hausaufgaben erledigt waren, fand sich immer eine Clique fürs Strandbad. Damals war das Wasser auch noch glasklar und sauber. Waren wir in den Ferien den ganzen Tag im Bad, so packte mir Mutti immer acht bis zehn Schrippen ein. Abends war ich dann so kaputt, dass ich die zwei Kilometer kleine Steigung nach Hause mit dem Rad zu unserer Wohnung am Püttbergeweg kaum geschafft habe. Das Fahrrad war ein alter „Brennabor“ aus Vorkriegszeiten, natürlich ohne Gangschaltung. Diese gabs damals noch nicht. Das Rad bestand aus Rahmen, bereiften Rädern, Lenkstange, hartem Sattel, Lampe mit Dynamo und Klingel! Aber toll war es dennoch, denn die Alternative war Laufen. Busfahren war zwar billig, aber es fuhr kaum einer und wenn, dann war er überfüllt und oft wurde man dann gar nicht mehr mitgenommen.
Da dieses von einem Freund meines Vaters geschenkte Fahrrad (wie schon erwähnt ein Vorkriegsmodell) schon deutliche Rostspuren aufwies, musste langsam an eine Neuerwerbung gedacht werden. In Osten gab es zwei Fabrikate von Fahrrädern. Ein „Diamant“ für 450 Ostmark oder ein „MIFA“ für 250 Ostmark. Beides waren Festpreise, genannt EVP (Endverbraucherpreis). Mit zwölf Jahren fing ich an zu sparen, meine Eltern konnten es mir nicht finanzieren. Meine Großeltern sponserten mich für gute Zeugnisnoten, und für jeden Brief, den ich ihnen schrieb, gab es drei Mark. Da ein Telefon zu bekommen die absolute Ausnahme war, wurden Oma und Opa auf diese Weise recht ausführlich unterrichtet. Ja, damals schrieb man noch lange Briefe.
Da Vati schon gleich mit unserem Umzug nach Berlin geschäftlich ein Telefon bekam, waren wir natürlich sehr glücklich. Von meinen Klassenkameraden hatte meines Wissens nur noch Christine ein Telefon, ihre Eltern hatten einen Kohlenhandel. Um am Nachmittag mit meinen anderen Freundinnen zu kommunizieren, waren wir also gezwungen, uns zu verabreden und zu treffen. Gespielt haben wir draußen, bis es dunkel wurde und der Hunger uns nach Hause trieb.
Nun zurück zum Fahrrad. Eine weitere Möglichkeit der Finanzierung war das Stopfen von Socken. Herren- und Kindersocken hatten damals viele Löcher und stets neue Socken zu kaufen war einfach nicht drin. Da Mutti viele andere Sachen zu flicken hatte (mein Bruder Matthias war inzwischen im Hosenverschleißalter), bot ich meine Unterstützung an. Natürlich nicht kostenlos! Kleine Löcher wurden mit 1 (einem) und große Löcher mit 2 (zwei) Pfennig vergütet. So kam ein Groschen zum anderen und eine Mark zur anderen. Am Ende konnte ich so gut stopfen, dass ich mich sogar zur gewerblichen Kunststopferin hätte melden können.
Zu meinem 15. Geburtstag stand dann das neue „MIFA“-Fahrrad vor der Tür. Eltern und Großeltern hatten den noch relativ kleinen Fehlbetrag ergänzt. Diesmal war das Rad nun auch mit einer Drei-Gang-Schaltung ausgestattet! Bei so langer Ansparzeit und so viel Eigenanteil habe ich es gehegt und gepflegt und bis zu meinem Auszug wie meinen Augapfel gehütet. Ein Fahrrad zu besitzen war schon ein kleiner Schatz, Fahrraddiebstähle waren zwar recht selten, kamen aber doch vor.
Das Schulsystem in der DDR bestand aus einer achtklassigen Grundschule. Mit überdurchschnittlich guten Noten gab es nach erfolgreichem Abschluss die Möglichkeit zum Besuch der vierjährigen Oberschule. Noten allein genügten jedoch nicht, sowohl die Schüler als auch die Eltern mussten sich schon als linientreue Staatsbürger zu erkennen geben.
Die Regel war, mit 14 Jahren nach Abschluss der Schule einen Beruf zu erlernen. Die Plätze auf der weiterführenden Oberschule bis zum Abitur waren sehr beschränkt und in einem Arbeiter- und Bauernstaat vorzugsweise für Kinder dieser Klasse vorgesehen. Vati war als kaufmännischer Angestellter, wenn auch in einem volkseigenen Betrieb, weder das eine noch das andere. So fiel ich nicht in diese Kategorie, obwohl ich Zweitbeste der Klasse war.
Kurz vor dem Ende meiner regulären achtjährigen Schulzeit wurde die sogenannte Polytechnische Oberschule (10 Klassen) – im Gegensatz zur Erweiterten Polytechnischen Oberschule (12 Klassen) – eingeführt. Im Westen waren das traditionell Realschule und Gymnasium.
Da ich weder Junger Pionier noch FDJ-Mitglied war, blieb vorerst mein Traum, weiter in die Schule gehen zu können, unerfüllt. Engste Verwandte meines Vaters, sein Bruder und zwei Schwestern, lebten im Westen. Ein Umstand, der uns im täglichen Leben oft hinderlich war. Außerdem war unsere Fernsehantenne nach Westen gerichtet, was erwarten ließ, dass wir dem Aufbau des Sozialismus nicht mit Nachdruck dienten. Aber Vati ließ nicht locker, für meine weitere Schulbildung zu kämpfen. Nach einem mehrstündigen Gespräch mit meinem damaligen Schuldirektor (straffer Parteigenosse der SED) konnte Vati erreichen, dass ich die „Realschule“ besuchen durfte. Besser als nichts, aber meinen Wunsch, Sprachen zu studieren, musste ich begraben, da mir das Gymnasium verwehrt blieb.
Mittlerweile wurden die Einschränkungen im täglichen Leben und in der Zukunftsplanung immer umfangreicher, sodass in der Familie über eine Umsiedlung in den Westen immer öfter nachgedacht wurde. Aber innerhalb Berlins gab es noch Freizügigkeit, und die Hoffnung, dass die Teilung Deutschlands bald ein Ende haben könnte, ließ meine Eltern immer noch zögern. Auch fiel Mutti der Gedanke nicht leicht, ihre Eltern allein in Riesa zurückzulassen, war sie doch die einzige Tochter.
Der Familienrat beschloss dann, ich solle eine Ausbildung beginnen und abschließen, dann würde ein Neuanfang im Westen leichter fallen. Nun stand auch bei mir wie bei allen jungen Menschen die Frage der Berufswahl an. Da ich schon damals gerne gezeichnet habe und mich auch für Kunst interessierte, erschien mir das Berufsbild der Schaufensterdekorateurin als recht geeignet, zumal es meinen praktischen und handwerklichen Veranlagungen sehr entgegenkam. Da man sich in der DDR auch sprachlich gerne von der BRD absetzte (ein Brathähnchen etwa nannte sich dort Broiler), hieß die genaue Berufsbezeichnung Gebrauchswerber. Mein Schulabschlusszeugnis war sehr gut, aber für die Lehrstelle musste doch eine Eignungsprüfung abgelegt werden.
Als Kind verbrachte ich sehr oft einige Zeit der Ferien bei meinen Großeltern in Riesa. Wie oben erwähnt kamen Oma und Opa in ihren Sommerferien auch regelmäßig drei Wochen zu uns nach Rahnsdorf. Das war ihr Jahresurlaub. Urlaub im heutigen Sinn mit Verreisen – gar in andere Länder – gehörte zur absoluten Ausnahme. Auslandsziele waren sowieso auf das sozialistische Ausland beschränkt, nebenbei war es auch eine Frage der finanziellen Mittel. Meines Wissens war Oma ein einziges Mal in ihrem Leben in Urlaub in Berchtesgaden. Opa konnte leider nicht mit, da einer sich um das Restaurant kümmern musste. Bis ins hohe Alter hat sie mir immer mal wieder von diesem Ferienerlebnis erzählt. Für so ein Ereignis, das mit einer vielstündigen Bahnreise begann, wurde auch extra Reisekleidung besorgt, das gehörte einfach zum guten Ton.
Meine Großeltern Marx hatten vor dem Krieg eine große Gastwirtschaft mit Speisesaal, Tanzdiele, gemütlicher Bauernstube und im Sommer mit Biergarten bewirtschaftet. Es war ein hartes Brot, denn es gab bis zum Krieg keine „Polizeistunde“, was „open end“ hieß. Man musste ausharren, bis der letzte Gast ging. Nachdem mit Gründung der DDR alles Ersparte auf zehn Prozent abgewertet worden war, hat man dann 1955 Firmen und mittlere Gewerbe verstaatlicht. Kleine Gewerbe wurden nach Mauerbau dann teilverstaatlicht! Oma, die bis zur Enteignung ihres Restaurants jeden Tag mitgearbeitet hatte, sagte einmal: „Ich war an keinem Tag in diesen Jahren ausgeschlafen.“ Beide waren enorm fleißig und sparsam und wollten mit dem Ersparten einen angenehmen Lebensabend verbringen.
Nach der Enteignung hat Opa noch einige Zeit als Geschäftsführer in seinem eigenen ehemaligen Restaurant gearbeitet, denn er war noch nicht im Rentenalter. Die Zustände wurden aber mit der Zeit unerträglich, sodass er sich entschied, mit Mitte 50 in einer anderen Gaststätte als Kellner zu arbeiten. Wenn nach seiner Spätschicht gegen Mitternacht kein Bus mehr fuhr, musste er die fünf Kilometer zu Fuß nach Hause laufen, und das nach acht Stunden, die er als Kellner schon gelaufen war. Zu dieser Zeit hatte er das 60. Lebensjahr schon überschritten, aber an Ruhestand war leider noch nicht zu denken. Wie schon beschrieben, war also bei dem geringen Verdienst ein Urlaub nach heutigen Maßstäben unmöglich. Trotzdem hatten wir immer eine schöne Zeit am Müggelsee. Gedanklich haben wir uns gefühlt wie an der Adria, obgleich wir von dieser nur eine vage Vorstellung hatten. In westlichen Illustrierten, die wir manchmal ergatterten, konnte man manchmal das Feeling der Westdeutschen an den südlichen Badestränden erahnen. Die Sommer bei uns waren aber auch heiß – verglichen mit heute und in Erwartung der proklamierten Erderwärmung. Und das war vor über 60 Jahren!
Die Osterferien 1960 verbrachte ich wieder einmal bei meinen Großeltern Marx. Die Eltern von Vati waren bereits ins Altersheim übergesiedelt, sie waren beide über achtzig und Oma Camilla hatte Probleme mit dem Gedächtnis, so war sie sich beim Kochen nicht mehr sicher, ob nun alle Zutaten schon drin waren oder nicht und ob noch was fehlte. Wohl nicht das größte Problem, aber es wurde immer beschwerlicher, und so waren sie eigentlich ganz froh, von den täglichen Pflichten entbunden zu sein. Sie hatten ihren eigenen Wohnbereich und wurden, soweit ich es beurteilen konnte, auch gut betreut, sie waren kein Pflegefall.
Bei meiner Anwesenheit in Riesa besuchten wir sie des Öfteren gemeinsam mit Oma Margarethe und Opa Paul. Außer meinem Vater wohnten die anderen drei noch lebenden Kinder alle im Westen und für diese war es immer sehr kompliziert und schwierig, nach Riesa zu reisen. Nach dem Mauerbau 1961 war es über Jahre erst mal gänzlich unmöglich.
Diese Osterferien begannen nun wie alle Ferienaufenthalte vorher. Mit heutigen Ferien der Kinder und Jugendlichen nicht zu vergleichen, denn es gab nichts Spektakuläres zu erleben. Aber halt: Es gab ein Kino in der unmittelbaren Nachbarschaft, und hin und wieder wurde auch ein Film aus dem Westen gespielt, der die ewigen sozialistischen Erziehungsmachwerke unterbrach. Opa war im „Sachsenhof “ zur Abendschicht und ich ging mit Oma ins Kino. Es wurde „Fanny“ gespielt. An den Inhalt kann ich mich nicht mehr erinnern, denn nach dem Kinobesuch kam es zu einer folgenschweren, ja zukunftsentscheidenden Begegnung. Beim Verlassen der Lichtspiele, (so nannte man damals in der DDR die Kinos) begegneten wir Hedi Specht mit ihren beiden Söhnen. Hedi Specht war eine gute Bekannte meiner Oma und die gute Seele im benachbarten Lebensmittelgeschäft. Wenn ich in Riesa zum Einkaufen geschickt wurde, wurde ich von Frau Specht immer sehr freundlich und nett bedient. Selbstbedienung war derzeit noch unbekannt. Sie wusste, dass ich die Enkelin von Margarethe war, und ich bemerkte, dass sie mich wohl mochte.
Nach „Fanny“ gab es also eine freudige Begrüßung und es wurde ein Treffen vereinbart. Meine Großeltern besaßen als eine der wenigen in Riesa einen Schwarz–weiß-Fernseher (es gab nichts anderes), und wir verabredeten uns zu „Faust I“ im Abendprogramm.
Einige Tage später fand also der große Dramenabend in Omas Wohnung statt. Hedi erschien mit beiden Söhnen und wir nahmen alle in der Wohnzimmer-Loge Platz. Viel geredet wurde nicht, denn Faust war ja nicht gerade leichte Kost und es gab viel nachzudenken. Ich war gerade 16 Jahre alt geworden und entsprechend schüchtern. Da wir wegen des Fernsehens kaum ein persönliches Wort wechselten, vereinbarten wir für den übernächsten Tag ein Treffen im Hause Specht zum lockeren Beisammensein. Unser erstes Beschnuppern sollte dann vertieft werden. Aber bereits am nächsten Tag erhielt ich ein Telegramm von meinen Eltern, dass ich sofort nach Berlin zurückkommen müsse, um zur Aufnahmeprüfung zu erscheinen. Somit konnte das vereinbarte Treffen bei Spechts nicht wie geplant stattfinden, und das hatte weitreichende Folgen.