Mehrsprachigkeit im Fremdsprachenunterricht
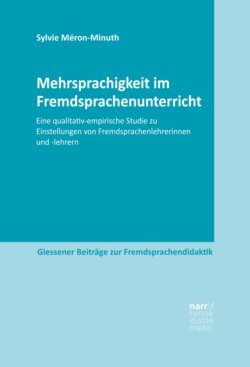
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Sylvie Méron-Minuth. Mehrsprachigkeit im Fremdsprachenunterricht
Inhalt
Vorwort
1. Einleitung. 1.1 Meine Beweggründe, dieses Projekt durchzuführen
1.2 Fremdsprachenlehrkräfte und die multilinguale Herausforderung
1.3 Lehrerrolle und Pädagogisches Handeln
1.4 Aufbau der Arbeit
2. Historischer Exkurs und theoretische Grundlagen zum Konzept der Mehrsprachigkeit
2.1 Europäische Sprachen- und Bildungspolitik und Mehrsprachigkeit
2.2 Zweisprachigkeit – Mehrsprachigkeit: Annäherung an eine Begrifflichkeit
2.2.1 Zweisprachigkeit
2.2.2 Mehrsprachigkeit
2.3 Gesellschaftliche Mehrsprachigkeit
2.4 Individuelle Mehrsprachigkeit
2.4.1 Lebensweltliche Mehrsprachigkeit
2.4.2 Schulische Mehrsprachigkeit
2.5 Aspekte meines eigenen Verständnisses von Mehrsprachigkeit
2.6 Mehrsprachigkeitsdidaktik. 2.6.1 Begriffsklärung
2.6.2 Integrierte Sprachdidaktik
2.6.3 Interkomprehensionsforschung
2.6.4 Der EuroComRom-Ansatz und seine Umsetzung
2.6.5 Schulfremdsprachen als Brückensprachen und ihr Potenzial
2.6.5.1 Englisch
2.6.5.2 Französisch
2.6.5.3 Latein
2.6.5.4 Spanisch
2.6.5.5 Italienisch
2.6.6 Lebensweltliche Sprachen als Brückensprachen und ihr Potenzial für das Erlernen einer Schulfremdsprache. 2.6.6.1 Türkisch
2.6.6.2 Russisch
3. Zur Erforschung der Binnensicht von Fremdsprachenlehrkräften. 3.1 Terminologische Vielfalt: Subjektive Theorien – Einstellungen
3.2 Zum Forschungsprozess über Einstellungen von Lehrpersonen
3.3 Einstellungen und Unterrichtshandeln
4. Forschungsmethodischer Ansatz und Erhebungsdesign. 4.1 Wissenschaftstheoretische Grundlagen – Rahmenbedingungen, Forschungsverfahren und Fragestellungen
4.2 Exkurs: Veränderungen der gesellschaftlichen Situation in Deutschland seit der Datenerhebung im Jahr 2012
4.3 Datenerhebung – qualitative Interviews als Forschungsmethode
4.3.1 Leitfaden-(halbstrukturiertes) Interview
4.3.2 Das problemzentrierte Interview
4.3.3 Explorativ-problemzentriertes Experteninterview
4.4 Diskussion zur Auswertung von verbalen Daten aus mündlichen Befragungen
4.5 Durchführung der Erhebung
4.6 Transkription
4.7 Auswertungsverfahren – qualitative Inhaltsanalyse
4.8 Transparenz und Nachvollziehbarkeit
5. Die Vorstudie. 5.1 Vorüberlegungen
5.2 Genese der Vorstudie
5.3 Die Untersuchungsgruppe
5.4 Analyse und Ergebnisse der Untersuchungsergebnisse. 5.4.1 Kategorisierungen der Antworten – Hauptkategorien
5.4.1.1 Sprachlernbiografische Aspekte
5.4.1.2 Eigendefinition „Mehrsprachig sein“
5.4.1.3 Mehrsprachigkeit und Unterricht
5.4.1.4 Lebensweltliche Mehrsprachigkeit und Einbeziehung der Herkunftssprachen der Schüler
5.4.2 Nebenkategorien
5.4.2.1 Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen und das Europäische Sprachenportfolio
5.4.2.2 Unterrichtspraxis und -methodik, Fortbildungsangebote
5.4.2.3 Projektunterricht und fächerübergreifender Unterricht
5.4.2.4 Zukünftige Entwicklung des Fremdsprachenunterrichts
5.5 Fazit und Bedeutung für die Hauptuntersuchung
6. Die Hauptstudie – Einzelfalldarstellungen
6.1 Exemplarische Darstellung einer Interviewpartnerin – Charlotte Heilmann
6.1.1 Biografisches und berufliche Rahmenbedingungen
6.1.2 Einstellungen zur schulischen und lebensweltlichen Mehrsprachigkeit ihrer Schüler / Unterrichtspraxis
6.1.3 Anregungen und Änderungsvorschläge
6.1.4 Zusammenfassung ihrer Einstellungen
6.2 Clara Mühlbauer
6.2.1 Biografisches und berufliche Rahmenbedingungen
6.2.2 Einstellungen zur schulischen und lebensweltlichen Mehrsprachigkeit ihrer Schüler / Unterrichtspraxis
6.2.3 Anregungen und Änderungsvorschläge
6.2.4 Zusammenfassung ihrer Einstellungen
6.3 Anne Rieder
6.3.1 Biografisches und berufliche Rahmenbedingungen
6.3.2 Einstellungen zur schulischen und lebensweltlichen Mehrsprachigkeit ihrer Schüler / Unterrichtspraxis
6.3.3 Anregungen und Änderungsvorschläge
6.3.4 Zusammenfassung ihrer Einstellungen
6.4 Natalia Peréz Sanchez
6.4.1 Biografisches und berufliche Rahmenbedingungen
6.4.2 Einstellungen zur schulischen und lebensweltlichen Mehrsprachigkeit ihrer Schüler / Unterrichtspraxis
6.4.3 Anregungen und Änderungsvorschläge
6.4.4 Zusammenfassung ihrer Einstellungen
6.5 Sophie Kallmayer
6.5.1 Biografisches und berufliche Rahmenbedingungen
6.5.2 Einstellungen zur schulischen und lebensweltlichen Mehrsprachigkeit ihrer Schüler / Unterrichtspraxis
6.5.3 Anregungen und Änderungsvorschläge
6.5.4 Zusammenfassung ihrer Einstellungen
6.6 Werner Scholl
6.6.1 Biografisches und berufliche Rahmenbedingungen
6.6.2 Einstellungen zur schulischen und lebensweltlichen Mehrsprachigkeit seiner Schüler / Unterrichtspraxis
6.6.3 Anregungen und Änderungsvorschläge
6.6.4 Zusammenfassung seiner Einstellungen
6.7 Isabel Mayr
6.7.1 Biografisches und berufliche Rahmenbedingungen
6.7.2 Einstellungen zur schulischen und lebensweltlichen Mehrsprachigkeit ihrer Schüler / Unterrichtspraxis
6.7.3 Anregungen und Änderungsvorschläge
6.7.4 Zusammenfassung ihrer Einstellungen
6.8 Grit Kaufmann
6.8.1 Biografisches und berufliche Rahmenbedingungen
6.8.2 Einstellungen zur schulischen und lebensweltlichen Mehrsprachigkeit ihrer Schüler / Unterrichtspraxis
6.8.3 Anregungen und Änderungsvorschläge
6.8.4 Zusammenfassung ihrer Einstellungen
6.9 Adriana Pini
6.9.1 Biografisches und berufliche Rahmenbedingungen
6.9.2 Einstellungen zur schulischen und lebensweltlichen Mehrsprachigkeit ihrer Schüler / Unterrichtspraxis
6.9.3 Anregungen und Änderungsvorschläge
6.9.4 Zusammenfassung ihrer Einstellungen
6.10 Noemie Hartmann
6.10.1 Biografisches und berufliche Rahmenbedingungen
6.10.2 Einstellungen zur schulischen und lebensweltlichen Mehrsprachigkeit ihrer Schüler / Unterrichtspraxis
6.10.3 Anregungen und Änderungsvorschläge
6.10.4 Zusammenfassung ihrer Einstellungen
6.11 Constanze Schrader
6.11.1 Biografisches und berufliche Rahmenbedingungen
6.11.2 Einstellungen zur schulischen und lebensweltlichen Mehrsprachigkeit ihrer Schüler / Unterrichtspraxis
6.11.3 Anregungen und Änderungsvorschläge
6.11.4 Zusammenfassung ihrer Einstellungen
6.12 Katrin Drewes
6.12.1 Biografisches und berufliche Rahmenbedingungen
6.12.2 Einstellungen zur schulischen und lebensweltlichen Mehrsprachigkeit ihrer Schüler/ Unterrichtspraxis
6.12.3 Anregungen und Änderungsvorschläge
6.12.4 Zusammenfassung ihrer Einstellungen
7. Gesamtauswertung der Ergebnisse der Lehrerinterviews
7.1 Beruflicher Werdegang und berufliches Selbstbild der gymnasialen Fremdsprachenlehrkräfte. 7.1.1 Beruflicher Werdegang
7.1.2 Berufliches Selbstbild und Einstellungen zum Lehrerberuf
7.2 Kenntnisse der Sprachbiografien und der lebensweltlich-kulturellen Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler
7.3 Einstellungen zu den schulischen Fremdsprachenkompetenzen der Schülerinnen und Schüler
7.4 Einstellungen zu Herkunftssprachen und -kulturen der mehrsprachigen Schülerinnen und Schüler
7.5 Änderungsvorschläge für die Unterrichtspraxis mit Fokus auf Mehrsprachigkeit. 7.5.1 Lehrerpersönlichkeit
7.5.2 Institutionelle Bedingungen: G8 als Hindernis
7.5.3 Fortbildungsmaßnahmen
7.6 Änderungsvorschläge zur Lehrerausbildung. 7.6.1 Defizite im Studium und in der Lehrerausbildung
7.6.2 Anregungen
7.7 Das interindividuelle Gemeinsame – abschließende Thesen und Ergebnisse
8. Ausblick und Forschungsperspektiven
8.1 Kritik der europäischen Mehrsprachigkeitsdoktrin. 8.1.1 Aus der Forschung
8.1.2 Aus Lehrerperspektive
8.2 Forschung zum Unterrichtshandeln der Lehrkräfte: ein (wohlwollend-)kritischer Blick
8.3 Forschungsdesiderata. 8.3.1 Bezogen auf Lehrerfort- und -weiterbildung
8.3.2 Bezogen auf Unterrichtsbeobachtung / Fremdsprachenlehrpraxis
8.3.3 Bezogen auf die aktuelle Migrationsentwicklung
9. Literaturverzeichnis
Fußnoten. 2.1 Europäische Sprachen- und Bildungspolitik und Mehrsprachigkeit
2.2 Zweisprachigkeit – Mehrsprachigkeit: Annäherung an eine Begrifflichkeit
2.2.1 Zweisprachigkeit
2.2.2 Mehrsprachigkeit
2.4.1 Lebensweltliche Mehrsprachigkeit
2.4.2 Schulische Mehrsprachigkeit
2.6.1 Begriffsklärung
2.6.4 Der EuroComRom-Ansatz und seine Umsetzung
2.6.5 Schulfremdsprachen als Brückensprachen und ihr Potenzial
2.6.5.2 Französisch
2.6.5.4 Spanisch
2.6.6.1 Türkisch
3.1 Terminologische Vielfalt: Subjektive Theorien – Einstellungen
3.2 Zum Forschungsprozess über Einstellungen von Lehrpersonen
3.3 Einstellungen und Unterrichtshandeln
4.1 Wissenschaftstheoretische Grundlagen – Rahmenbedingungen, Forschungsverfahren und Fragestellungen
4.2 Exkurs: Veränderungen der gesellschaftlichen Situation in Deutschland seit der Datenerhebung im Jahr 2012
4.6 Transkription
5.1 Vorüberlegungen
5.3 Die Untersuchungsgruppe
5.4.1.1 Sprachlernbiografische Aspekte
5.4.1.2 Eigendefinition „Mehrsprachig sein“
5.5 Fazit und Bedeutung für die Hauptuntersuchung
6.3.4 Zusammenfassung ihrer Einstellungen
6.9.4 Zusammenfassung ihrer Einstellungen
8.1.1 Aus der Forschung
Отрывок из книги
Sylvie Méron-Minuth
Mehrsprachigkeit im Fremdsprachenunterricht
.....
Jedoch entsprechen die Migrantensprachen meistens nicht dem offiziellen, schulischen Sprachenkanon, werden gesellschaftlich nicht besonders wertgeschätzt und folglich in der Schule auch nicht eingebunden (vgl. Fürstenau et al. 2017: 49). Und Adelheid Hu (2010) konstatiert:
„Während für die Schüler/innen Mehrsprachigkeit und sprachlich-kulturelle Identität zentrale Kategorien darstellten, spielten diese für die Fremdsprachenlehrer/innen kaum eine Rolle.“ (Hu 2010: 67)
.....