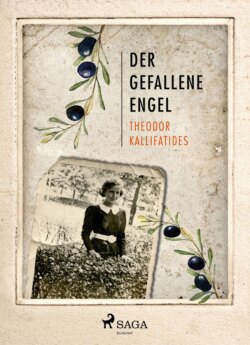Читать книгу Der gefallene Engel - Theodor Kallifatides - Страница 9
4
ОглавлениеWie lange war Andreas schon auf dem Weg zu mir? Wie lange war es mir schon gelungen, ihn zu vergessen? Und Maria?
Ich hatte nicht vergessen. Ich hatte nur gelernt, so zu tun, als würde ich leben und habe mir in dieser Kunst eine solche Fertigkeit angeeignet, daß niemand den Unterschied bemerkt. Aber besteht überhaupt irgendein Unterschied zwischen leben und so tun, als würde man leben? Welcher von diesen zwei Träumen ist nun wahrer oder richtiger?
Ich kann es nicht sagen. Wer kann das schon?
Wenn die Ethik der Aufopferung stimmt, habe ich alles gewonnen, denn ich habe alles verloren. Zuerst verlor ich Maria, danach Andreas und endlich diese grausame Erfindung der grausamen Götter, mein Land, dieses Gebilde aus Berg und Meer, das meine Sinne erzogen hat.
Alles hatte ich verloren, aber hatte ich auch meine Seele gewonnen? Aber was ist meine Seele, wenn nicht Maria, Andreas und mein Land? Und dann diese Einsicht von der Unausweichlichkeit des Scheiterns, die sich vererbt hat vom Vater auf den Sohn, von der Mutter auf die Tochter.
Diese Einsicht zwang mich, in der Zeit aufzugehen. Das hat Andreas nie gelernt, in seinen Genen hatte ein Sprung stattgefunden, er war für niemanden eine Fortsetzung, er wurde geboren, um von vorne anzufangen.
Er war in der Klasse zweifellos der intelligenteste von uns allen, aber er kam nie in die Nähe der richtig guten Zensuren. Ich hatte immer viel bessere Zensuren als er. Die Lehrer hatten Angst vor Andreas, jedesmal, wenn er die Hand hob, weil er etwas sagen wollte, wurde es ganz still in der Klasse und jedes zweite Mal taten die Lehrer so, als hätten sie seinen fordernden Zeigefinger nicht bemerkt.
Einmal protestierte Andreas und der Lehrer, dieser Hundsfott, der Mathematik unterrichtete, verteidigte sich lachend: «Du bist so klein, daß ich dich nicht gesehen habe!»
Andreas war leichenblaß geworden und ich sah, wie er mit einem Asthmaanfall kämpfte, er atmete pfeifend und hastig und wir andern, sogar ich, lachten und stellten uns auf die Seite des Mathematiklehrers. Andreas hatte mit wütenden Augen in meine Richtung geblickt, aber weder damals noch später etwas gesagt. Er war vermutlich daran gewöhnt. Er war daran gewöhnt, verraten zu werden, aber er lernte nie etwas daraus, er blieb unverändert lauter in seinem Wesen und unverändert unglücklich.
Andreas hatte oft homerische Auseinandersetzungen mit dem Religionslehrer, einem sehr ehrgeizigen Seelenjäger, der neben den üblichen Sünden mit großer Leidenschaft die für ihn schlimmste aller Sünden bekämpfte – das Widersprechen. Andreas brachte kaum seinen Mund auf, und der Lehrer unterbrach ihn und belegte ihn mit dem schrecklichsten Ausdruck, den er kannte, nämlich «Jesuit!».
Andreas, der es überhaupt nicht vertragen konnte, wenn man seine intellektuelle Redlichkeit in Frage stellte, wurde total wütend, erhob sich in seiner Bank und schrie, daß keiner ein Monopol auf Gott besitze.
«Doch, ich schon!» brüllte der Lehrer.
«Und warum?» erkundigte sich Andreas, jetzt in höflicherem Ton.
«Weil ich es sage!» tobte der Kreuzritter und ging dazu über, mit den Zähnen zu knirschen.
«Ich dachte, es sei Gott vorbehalten, das zu sagen!» reizte ihn Andreas aufs neue.
«Raus!» heulte der Lehrer. «Raus!» Und er hob die Hand wie Moses es an seiner Stelle getan hätte. Und Andreas verließ lachend das Klassenzimmer, aber nach zehn Minuten rief ihn der Lehrer wieder herein, weil die Stunde ohne Andreas so eintönig war.
Die große Streitfrage zwischen ihnen war nicht, wie man vielleicht meinen könnte, die Existenz Gottes. Dieses Problem hatte Andreas bereits abgeschlossen. Nicht er mußte Gottes Existenz beweisen, es war die Sache Gottes zu beweisen, daß er existierte. Ebensowenig quälte sich Andreas damit, einen Gegenbeweis zur Existenz Gottes zu führen, «weil es theoretisch unmöglich ist, etwas zu zeigen, was es nicht gibt. Das einzige, was man tun kann, ist der Nachweis, daß es etwas nicht hier und jetzt gibt, aber das setzt voraus, daß dieses Etwas woanders zu finden ist. Mit anderen Worten: der Versuch, zu beweisen, daß es Gott nicht gibt, ist ein sinnloseres Unterfangen als der Versuch, zu beweisen, daß es Gott gibt. Deshalb besitzen die Christen meine ganze Sympathie!» schloß er seine Überlegung. Die zentrale Streitfrage war: «Wie kann jemand glauben, ohne zu wissen oder schlimmer, ohne den Versuch gemacht zu haben, zu wissen!»
«Ich kann das!» lachte der Lehrer triumphierend.
«Das können Sie nicht!» lachte Andreas zurück.
«Kann ich nicht?» höhnte der Lehrer. «Und wer, wenn ich fragen darf, sollte mich daran hindern?»
«Die Logik!» antwortete Andreas pathetisch. «Die höchste Richterin!»
«Was hat die Logik damit zu tun?»
«Lassen Sie mich erklären!»
«Dann aber schnell!»
«Gut. Gesetzt der Fall, ich begegne Ihnen auf der Straße...»
«Dann bewirfst du mich mit Tomaten, du Flegel!»
«Ja, aber abgesehen davon... wenn ich Ihnen auf der Straße begegne und Sie frage: regnet es? Da antworten Sie, ja es regnet, wenn es regnet und nein, es regnet nicht, wenn es nicht regnet. Wenn ich aber frage: Glauben Sie, daß es heute vor zweitausend Jahren geregnet hat? Da können Sie antworten: Ich weiß es nicht, aber ich glaube es oder ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Mit andern Worten: glauben bedeutet, daß man zugleich bezweifelt, was man glaubt, was wiederum bedeutet, daß der Glaube manchmal stärker sein kann als der Zweifel und manchmal umgekehrt. Aber zu glauben, ohne gleichzeitig zu zweifeln, ist eine psychologische Möglichkeit für Fanatiker, aber eine logische Unmöglichkeit für vernünftige Leute!»
«Dann gehöre ich also nicht zu den vernünftigen Leuten?»
«Leider ist diese Folgerung...»
«Raus!»
Aber nach zehn Minuten hatte der Lehrer, der im Grunde ein gutmütiger Mensch war, ein neues Argument gefunden und er schickte einen von uns, um Andreas hereinzuholen. Diese Aufgabe oblag fast immer mir, denn zu der Zeit wußten alle, daß Andreas und ich dicke Freunde waren.
Andreas war, sogar mit griechischem Maß gemessen, ziemlich klein und er litt sehr darunter, obwohl er nie darüber sprach. Aber er konnte ab und zu ohne sichtbaren Anlaß bleich werden, ein dunkler Schatten fuhr rasch über sein Gesicht, und das konnte jederzeit passieren, aber besonders oft passierte es in den Musikstunden.
Der Musiklehrer war ein brutaler Riese, sehr begabt, aber sehr unglücklich über seine Größe und seine weißgefleckte Haut. Er war wie eine Pythonschlange, die ständig ihre Haut wechselte, und er hatte einen sehr verschrobenen Humor. Mich verabscheute er und nannte mich einen großen «Scheißhaufen», ich solle doch die Äcker düngen, dann würde der Klatschmohn «hoch wie Zypressen», und er verspottete mich auf jede Art, weil ich nicht singen konnte und auch die Noten nicht lernte.
Andreas dagegen liebte er, Andreas war sein großer Stolz, dabei quälte er ihn noch mehr als uns andere. Andreas konnte nicht nur singen, er fing auch bald an, eigene Melodien zu komponieren, die er auf einer armseligen Gitarre des Lehrers spielte und man sah, wie der Lehrer vor Freude nasse Augen bekam, aber er konnte es nicht lassen, er mußte Andreas reizen und natürlich reizte er ihn an dem Punkt, der Andreas’ wundester war. Sobald Andreas der kleinste Fehler unterlief, forderte ihn der Lehrer auf, rauszugehen und «sich zu entspannen, denn wenn einer so klein ist, wirbelt er doch nur den Staub vom Boden auf», und da sah man jedesmal den dunklen Schatten über Andreas’ Augen.
Ansonsten hatte Andreas einen schönen, kräftigen Oberkörper und sein stolzes Haupt, die feurigen schwarzen Augen, das kohlschwarze Haar und der blasse Teint verliehen ihm ein Aussehen wie die byzantinische Ikone eines christlichen Märtyrers. Ich liebte dieses Gesicht und als ich Maria getroffen hatte, wußte ich, daß auch sie dieses Gesicht lieben würde.
Und doch, ich konnte es nicht lassen, die beiden zusammenzubringen. Ich hatte das unbestimmte Gefühl, daß ich ihm ihre Bekanntschaft schuldig war und ihr seine Bekanntschaft, und ich akzeptierte es ohne nennenswerte Schwierigkeiten, daß sie im Grunde schon bei ihrem ersten Zusammentreffen ein Verhältnis anfingen. Was ich nicht einsehen konnte war, daß Maria mich auch liebte oder, was viel schwerer verständlich war, daß sie eigentlich nur mich liebte. Mir erschien so etwas naturwidrig, man konnte doch nicht das schlechtere Exemplar einer Rasse lieben, wenn man ein besseres kriegen konnte?
Ich war noch zu jung, ich wußte nicht, daß es in der Liebe keine Normen gibt, jedenfalls nicht solche, die man bei Licht betrachten kann, ich begriff nicht, daß alles, was man über die Liebe gesagt hat und was man noch über die Liebe sagen wird, schmerzhafte Rationalisierungen sind oder pseudometaphysische Tiefsinnigkeiten; ich verstand nicht, daß Liebe ist wie das Schweigen: sie existiert in Abwesenheit von allem andern.
Ich war immer noch von der völlig falschen Vorstellung besessen, daß einer der Liebe eines andern wert sein könne oder müsse. Ich war gründlich getäuscht worden von dem Ritter und seiner Dulcinea, ich betrachtete die Welt als große Arena und Dulcineas Liebe winkte dem Gewinner. Ich sehnte mich danach, alle anderen zu besiegen, damit meine Niederlage in der Liebe um so größer sein würde. Ich wollte Maria den Siegerkranz zu Füßen legen und ich kapierte nicht, daß Maria keinen Kranz, sondern nur mich haben wollte. Aber vielleicht war ich nicht bereit, diesen Preis zu bezahlen!
Der Verkehr begann wieder zu fließen. Der luftgekühlte Motor hatte offenbar den langen Leerlauf nicht so gut vertragen, er spuckte und stotterte, aber als ich den dritten Gang eingelegt hatte, schnurrte er sanft wie ein verschmustes Kätzchen.
Auf Essingeleden hatte es einen Unfall gegeben, als die Polizei uns vorbeidirigierte, sah ich zwei verbeulte Autos, einen Volvo und einen VW-Bus, und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wie das passiert sein sollte. Ich erblickte ein kleines blondes Mädchen, das in den Armen eines Polizisten weinte. Eine Frau um die Dreißig stand ein bißchen abseits und verbarg ihr Gesicht in den Händen. Ich dachte an ein anderes Kind, das Maria und ich eines Nachts vor langer Zeit überfahren hatten und ich dachte an das Kind, das ich beim Abendbrot verlassen hatte, das Kind, das meine Tochter ist. Sie waren wahrscheinlich inzwischen mit dem Essen fertig, die Frau, die meine Ehefrau ist, las sicher die Zeitung – sie schaffte es tatsächlich nie, die Zeitung morgens zu lesen –, und das Kind, das meine Tochter ist, saß sicher in der Badewanne und spielte mit einem kaputten Schiff, das für sie aus irgendeinem Grund das Schiff des Großvaters war.
Sie hatte ihren Großvater nur ein einziges Mal getroffen und da war sie knapp drei Jahre alt. Sie hat nur eine schwache Erinnerung an ihn, aber sie erinnert sich, daß Großvater sehr alt war und sie machte sich Sorgen darüber, daß er jederzeit sterben könne. Sie redete ständig darüber und ich fragte sie einmal, ob sie Angst vor dem Tod habe.
«Nein!» hatte sie mir versichert.
«Wie sieht denn der Tod deiner Meinung nach aus?» bohrte ich weiter.
«Ja... wie eine Treppe eben!»
Und da merkte ich, daß sie zitterte, ihr kleiner, flaumiger Körper bebte und ich nahm sie in meine Arme, um sie und mich zu trösten und vermutlich tat ich dasselbe, was der Polizist mit dem blonden Mädchen versuchte.
Ich stieg aufs Gaspedal, bei 4000 Umdrehungen schaltete ich in den Vierten, machte das Radio an und steckte mir eine neue Zigarette zwischen die Lippen. Die Nacht war noch tiefer geworden, der Verkehr hatte nachgelassen, und ich war auf dem Weg zu Andreas. Ich war für eine kurze Weile glücklich.