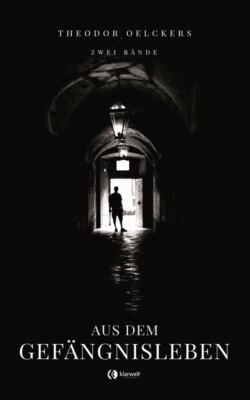Читать книгу Aus dem Gefängnisleben - Theodor Oelckers - Страница 4
I. Untersuchungshaft im Stockhause zu Leipzig. 1849—1850.
Оглавление„Since law itself is perfect wrong,
How can the law forbid my tongue to curse.”
King John.
Am 12. Mai 1849, morgens nach 6 Uhr, erschien in meiner Wohnung zu Leipzig ein Gerichtsdiener, der mir einen Zettel einhändigte. Es war ein vom dortigen „Kriminalamt“ ausgefertigter Verhaftungsbefehl, aus dem ich ersah, dass man auf Grund des Verdachtes „hochverräterischer Handlungen“ meine Verhaftung angeordnet hatte. Es blieb mir nichts übrig, als mich anzukleiden und dem Manne zu folgen. An der Haustür war ein zweiter Gerichtsdiener postiert, der die Nachhut bildete, während ich mich mit dem ersten zunächst nach dem Polizeihause verfügte.
Jene Volkserhebung im Mai des genannten Jahres zu Gunsten des damals auf dem Papiere vollendeten deutschen Verfassungswerkes war gescheitert und im ganzen Lande füllten sich die Gefängnisse mit Leuten, die sich unmittelbar oder mittelbar bei der Bewegung beteiligt hatten. Die zumeist Beteiligten hatten sich Indes fast sämtlich geflüchtet. Ich selber hatte hierzu keinen Grund zu haben geglaubt, da ich bei meiner überdies nur mittelbaren Beteiligung eine keineswegs hervorragende oder einflussreiche Rolle gespielt hatte. Wenn ein Angeklagter oder Verdächtiger einen Fluchtversuch macht, so pflegt man darin eine Bestätigung des Verdachts zu erblicken; dagegen war man weit entfernt, den Umstand, dass ich ruhig in meiner Wohnung ausharrte, während Alles flüchtete, zu meinen Gunsten auszulegen. Die betreffenden Untersuchungsakten enthalten viele dem ähnlich charakteristische Züge; ich behalte mir vor, gelegentlich darauf hinzuweisen, werde mich übrigens aber enthalten, im Einzelnen auf die Untersuchung und die in derselben erörterten Gegenstände einzugehen, denn dies würde allein den Raum eines Buches in Anspruch nehmen. Meine Aufgabe soll vielmehr nur sein, meinen Aufenthalt in den sächsischen Gefängnissen zu schildern und hinsichtlich der Untersuchung werde ich mich im Allgemeinen daraus beschränken, die Eindrücke anzudeuten, die dieselbe auf mich machte.
Es fiel mir damals sehr auf, dass Verhaftete ohne alle Förmlichkeit empfangen wurden. In einem Falle wenigstens, den das Gericht, wie ich bald fand, für einen der ernstesten erachtete, die überhaupt vorkommen können, und wo nicht nur möglicher-, sondern wahrscheinlicher weise ein Todesurteil in Aussicht stand, hätte meiner Ansicht nach der Vorstand des Gerichtes selbst den Verhafteten empfangen sollen; ich erwartete eine derartige ernste Form um des Gerichtes eigener Würde willen, und zugleich auch meinetwegen insofern, als dadurch mein Vertrauen nicht geschwächt, sondern gesteigert worden sein würde. Was sollt‘ ich denken, als ich einen Mann, den man des Hochverrats anschuldigte und vielleicht bald zum Schwerte verurteilt sehen sollte, nur ebenso wie etwa einen unbedeutenden Marktdieb behandeln sah?
Nachdem ich ein paar Stunden erst im Vorsaal des Polizeihauses, dann in den unmittelbar angrenzenden Räumen des Kriminalamts gewartet hatte, weil ich lange vor Beginn der Geschäftszeit eingetroffen war, wurde ich durch einen Aktuar einem Verhör unterzogen. Man legte mir zunächst einen großen gedruckten Zettel vor, der kurz vorher, noch während des Kampfes in Dresden, in Leipzig öffentlich angeschlagen gewesen war. Die angeblichen Verfasser dieses Plakats — es standen darunter die Namen einer Anzahl damals in Leipzig ziemlich bekannter Leute — erklärten, dass sie, nachdem sie sich vergebens bemüht die Volksbewegung in Leipzig selbst in einer ersprießlichen Weise zu leiten, entschlossen seien, sich nach Dresden zu begeben, um sich dort am Kampfe für die Einführung der Reichsverfassung zu beteiligen, während sie erwarteten, dass ihnen ihre Leipziger Mitbürger Zuzug dorthin senden würden. Der erste der unter diesem Plakate befindlichen Namen war mein eigner, und so war es allerdings natürlich, dass man mich für den Inhalt nicht nur als mitverantwortlich, sondern als hauptsächlich verantwortlich betrachtete. Dies Dokument schien demnach den Anlass zu meiner Verhaftung gegeben zu haben. Auf Befragen erklärte ich, dasselbe sei mir bekannt und zwar aus den Zeitungen, die es bereits mitgeteilt hatten, doch sei es von mir weder verfasst noch unterzeichnet und mein Name ohne mein Wissen wie ohne meine Zustimmung daruntergesetzt worden. Die betreffende Druckerei, welcher ich unbekannt war, hatte das Originalmanuskript ausgeliefert und auch den Namen des (inzwischen geflüchteten) Auftraggebers angegeben. Die unterzeichneten Namen waren sämtlich von einer Hand, aber nicht von derjenigen, die den Text des Papiers geschrieben hatte, und die in der Folge zu Rate gezogenen Schriftkundigen erklärten, dass weder die eine noch die andere Handschrift die meinige sei. Aber diese Erklärung sollte mir ebenso wenig frommen als der Umstand, dass ich in Wahrheit das Papier weder verfasst noch unterzeichnet hatte. Man legte Gewicht auf den Umstand, dass ich mich bald nach dem Erscheinen jenes Plakats wirklich in Dresden befunden (freilich völlig untätig, aber das gab man nicht zu, obwohl man mir nicht die leiseste Spur von Tätigkeit nachzuweisen vermochte), und dass ich nicht in Zeiten gegen den von mir behaupteten Missbrauch meines Namens Verwahrung eingelegt hatte. Ähnliche Anschuldigungen tauchten nach und nach in Menge auf, desgleichen ein oder zwei Papiere (eines betraf einen Waffenankauf), die wirklich meine Unterschrift trugen, und die Akten schwollen bald umso gewaltiger an, als man mir (vermutlich jener nicht von mir herrührenden Unterschrift wegen) die sehr unverdiente Ehre erwies, mich gewissermaßen zu einem dux gregis zu machen und daher mir zum Teil ganz fremde Angelegenheiten in die mich betreffenden Akten aufzunehmen, die daher mit „O. und Genossen“ bezeichnet waren.
Ich kam sehr unerfahren in jenes erste Verhör und hätt’ es Zuhörer gegeben (die anwesenden drei Schöppen zahle ich nicht als solche), so würden sie vielleicht manchmal meine rührende Aufrichtigkeit belächelt haben. Ich zweifle auch nicht, dass sich der ungebildetste Handlanger an meiner Stelle instinktmäßig „gescheiter“ benommen haben würde. Indes konnte ich — obwohl ich recht gut wusste, wessen sich die Unterliegenden zu befahren haben, wenn eine Volkserhebung niedergeworfen worden ist, zumal wenn die Sieger durch ausgestandene Angst doppelt und dreifach gereizt sind, und obwohl es hier galt, nach langwieriger geheimer Inquisition auf Grund eines Indizienbeweises verurteilt zu werden, nach dessen Führung man eben erst einen wirklichen Beweis erwarten möchte — ich konnte mich nicht wohl so benehmen, wie ein solcher gescheiter Mann aus dem Volke, und hätt’ ich’s selbst versuchen wollen, so würde das mir nicht einmal in gleicher Weise nützlich gewesen sein. Indes benahm ich mich in einem andern Sinne fehlerhaft und ich will deutlich zu machen suchen, wie ich in diesem Falle gefehlt zu haben glaube. Will man sich nicht zu unwürdigen Spitzfindigkeiten verstehen (und das vermochte ich nicht d. h. ich verstand nicht „praktisch“ zu sein, wie man solches Verhalten auch wohl bezeichnet), so muss man in einer Lage, wie es die meinige war, entschieden zwischen zweierlei wählen: entweder man muss sich dazu verstehen, den Prozess formell als berechtigt gelten zu lassen und auf diesem Standpunkte sich selbst zugleich mit der Sache zu verteidigen; oder, wenn man dies der Sache wegen nicht will (wenn man diese nicht als ein Verbrechen behandeln lassen mag), muss man das Gericht für inkompetent erklären, sich demzufolge entschieden weigern sich irgendwie auf die Untersuchung einzulassen, sich also als Gefangener durchaus passiv verhalten und alles Mögliche über sich ergehen lassen1. Mein Fehler war nun, eine solche Wahl nicht zu treffen, sondern unentschieden zwischen dem einen und dem andern Verhalten zu schwanken und mich daher, während meiner Ansicht nach das Gericht in der Tat nicht kompetent war, gleichwohl auf eine Erörterung meiner Handlungen, überhaupt alles dessen was zur Sprache kam und was als verbrecherisch bezeichnet wurde, einzulassen, und dadurch brachte ich mich selbst in ein schiefes Verhältnis. Wenn ich von Nichtkompetenz des Gerichts spreche, so verstehe man mich recht: bezüglich meiner persönlichen Handlungen konnte es natürlich nicht anders als kompetent sein, aber es lagen meiner Ansicht nach gar keine Handlungen vor, die als individuelle betrachtet werden durften, es lag nicht sowohl eine Tat, als ein Ereignis vor, nämlich ein großer Volksaufstand, der, wie ich meinte, ebenso wenig vor ein Kriminalgericht gehörte, als ein Gewittersturm. Individuen sind verantwortlich für das, was sie für sich versuchen oder vollbringen; aber wie mag man sie für das bestrafen wollen, was Völker tun! Die Lage eines Angeschuldigten, der bei einem Aufstande, bei einer Revolution beteiligt war, ist eine ganz exzeptionelle. Er für seine Person hat nichts getan, wie überhaupt Individuen als solche nichts getan haben: er hat vielmehr als Glied des Ganzen, des Volkes gehandelt, nur zugleich mit dem ganzen Volke dürfte man ihn daher zur Verantwortung ziehen; aber das Volk ist keine Person (was durch dasselbe geschieht, ist daher nicht sowohl als Tat, als vielmehr als Ereignis zu betrachten), es lassen sich die betreffenden Gesetze, die angeblich verletzt sein sollen, gar nicht auf dasselbe beziehen; diese Gesetze können nur von Individuen verletzt werden, können sich daher auch nur auf Individuen und deren Handlungen beziehen. Es erscheint widersinnig, unbegreiflich, den Einzelnen für Taten der Gesamtheit verantwortlich zu machen. Dies kann denn nur gezwungener weise und künstlich geschehen, indem man die Gesamthandlung in Bruchteilchen zerlegt und dieselben unter Benennungen, die ihnen nicht wirklich gebühren (Verschwörung, Aufruhr, Hochverrat) den Individuen zur Last legt. Da sich ein Volksaufstand überhaupt nicht nach den Artikeln eines Strafgesetzbuches behandeln lässt, so muss man also, um diese gleichwohl in Anwendung zu bringen, die Tat der Gesamtheit — den Aufstand — als solche leugnen oder ignorieren, sie vielmehr, wie gesagt, in die Taten vieler Einzelnen zerlegen und diese alsdann Verschwörung, Aufruhr, Hochverrat usw. benennen. Nur indem das Gericht solcherlei Handlungen supponiert, verschafft es sich die Möglichkeit in Wirksamkeit zu treten oder den Schein dessen, was ich hier unter Kompetenz verstehe. Ich führe diesen meinen damaligen Gedankengang an, weil es zur Schilderung meines Gefängnisses gehört, zu zeigen, in welchem Lichte mir Alles erschien: in den Augen des Gefangenen waren es nicht kompetente Richter, sondern Feinde, welche den Kampf für die Einführung der Reichsverfassung2, diesen Kampf um ein rechtmäßig erworbenes Gut der Nation, als ein Verbrechen behandeln wollten, indem sie sich herbeiließen, einseitig die "eine der kämpfenden Parteien, die unterlegene, zur Verantwortung zu ziehen, als handle es sich um einen bloßen Aufruhr oder Ähnliches. Kurz, man betrachtete sich als in den Händen der Gewalt und als ein Opfer der Parteirache und ich brauche nicht hinzuzufügen, dass solche Anschauungen wenig geeignet waren, das Gefängnis zu versüßen.
Indes ließ ich mich, wie gesagt, auf Erörterungen ein. Anfangs erfüllte es mich mit unwilligem Staunen, wenn man eine ehrliche und streng der Wahrheit entsprechende Angabe mit ungläubigem Lächeln aufnahm — so naiv war ich! Als ich erst Gelegenheit gehabt hatte, die Ungläubigen näher kennen zu lernen, wunderte ich mich nicht mehr.
Während ich in meiner Arglosigkeit bei Andern immer noch mehr oder weniger bona fides vorausgesetzt hatte, fand ich zu meiner Überraschung, dass sie bei mir am Ende wohl gar einen größeren Mangel an derselben voraussetzten, als den ihrigen. Ja der Folge hab’ ich in den verschiedensten Lebensverhältnissen diese Erfahrung häufig machen müssen.
Noch unmittelbar vor dem ersten Verhöre, als ich mich in einem ganz unbewachten Vorzimmer bei offenen Türen allein befand, hatt’ ich Gelegenheit gehabt, ungehindert zu entweichen; ich ließ sie unbenutzt, denn ich hielt die Flucht für einen unwürdigen Schritt, während ich im Begriff stand, vor Gericht zu gehen. Bald bereute ich, die Gelegenheit nicht benutzt zu haben, denn ich fand, dass ich über meine Lage in einem Irrtum gewesen.
Nach dem Verhöre erklärte man mir, ich müsse in Haft bleiben und brachte mich in das sogenannte Stockhaus, welches die Gefängniszellen enthielt. Es stand in Verbindung mit dem Gerichtslokale, so dass man die Straße nicht zu betreten brauchte, um aus dem einen ins andere zu gelangen. Im höchsten Stockwerke dieses Gefangenhauses befand sich eine kleine Anzahl Zellen, welche die besten waren. Auch die Räume für die Wechselschuldner enthielt dieses Stockwerk. Aus der für mich bestimmten Zelle musste erst ein anderer Bewohner entfernt werden und man sperrte mich daher einstweilen in ein Gemach, das seines bedeutenden Umfanges wegen nicht wohl Zelle heißen konnte. Damals war es ganz leer, sollte aber bald eine größere Anzahl Gefangener verschiedener Art, meist sogenannte Maigefangene, aufnehmen.
Der Beamte, von dem ich verhört worden war, hatte mich selber dem Stockmeister übergeben und mich auch mit letzterem bis in dieses Gemach begleitet. Man teilte mir hier vertraulich und wie zu meinem Troste mit (was ich übrigens schon wusste), dass in einer benachbarten Zelle bereits ein Unglücksgefährte, der Advokat Dr. Bertling, einquartiert sei, mich aber ersuchte man, nachdem man meinen Hut in Verwahrung genommen, alle Gegenstände, die ich etwa bei mir führte, abzuliefern. Ich hatte schlechterdings nichts bei mir als einige Taler Geld.
„Sie führen doch keine Waffen bei sich?“ fragte der Stockmeister und wiederholte der Aktuar in besorglichem Tone. Ich sollte im Laufe der nächsten Tage belehrt werden, dass ich mich bei einer „Verschwörung“ beteiligt, ja das Haupt einer Verschwörung gewesen sei und aus obiger Frage erkannte ich jetzt schon, dass man mich wirklich für einen gefährlichen Mann hielt. Indes begnügte man sich mit meiner verneinenden Antwort und verschonte mich mit einer in solchen Fällen sonst üblichen Durchsuchung der Taschen. Nachdem mir der Aktuar angedeutet, dass ich keine Aussicht habe, diese Räume in der schnelle wieder zu verlassen und dass ich mir daher vor Allem Schlafrock und dergleichen Dinge kommen lassen möge, verließen mich die beiden Herrn. Der Stockmeister erschien Indes bald wieder, um mich in die mir bestimmte benachbarte Zelle zu bringen. Sie hatte, gleich den andern in diesem Teile des Hauses gelegenen Zellen wenigstens Licht und eine ungehinderte Aussicht durchs Fenster. Es war ein ziemlich hohes, zwar schmales, aber nicht zu kurzes Gemach, so dass man auf- und abgehen konnte; das kreuzweis und sehr stark vergitterte Fenster befand sich nach Gefängnisbrauch etwas in der Höhe, man musste daher auf einen Schemel steigen, um hinauszusehen. Dieser ganz einfache Schemel, ein ebenso einfacher aber großer Tisch, eine Matratze am Fußboden mit einer äußerst unzulänglichen dünnen wollenen Decke und ein leider unentbehrlicher Gegenstand, der aber hier in verhältnismäßig glimpflicher Form auftrat, bildeten das Gerät des Gemachs. Hinter dem eisernen (von außen zu heizenden) Ofen lag ein alter abgekehrter Besen. Auch fehlte es nicht an einem großen mit Wasser gefüllten Kruge. Solche Kleinigkeiten erscheinen kaum erwähnenswert; aber der Gefangene mustert Alles genau in seinem engen Raume. Auf der untern Seite des Schemels fand ich eine Tasche, bestehend aus einem Stückchen alten Tuches, das mit Brotteig aufgeklebt war; darin hatte ein früherer Gefangener die Gegenstände aufbewahrt, die nicht für das Auge seiner Wächter waren. An der Tür waren einige gedruckte Verhaltungsregeln zu lesen, deren Verlegung nach Befinden mit „körperlicher Züchtigung“ geahndet werden sollte. Diese, die körperliche Züchtigung, war damals durch die Grundrechte gesetzlich abgeschafft — tröstlicher Gedanke für einen Untersuchungsgefangenen, sich in der Gewalt von Leuten zu befinden, die das Gesetz in solcher Achtung hielten! Ich erinnere mich Indes, dass später (nachdem die Sache in öffentlichen Blättern gerügt worden war) andere Verhaltungsregeln angeheftet wurden, die nicht mehr von körperlicher Züchtigung sprachen. Gleichwohl würde man irren, wenn man glauben wollte, die Prügelstrafe sei damals in Sachsen durch die deutschen Grundrechte wirklich auch Tatsächlich abgeschafft gewesen. Aus dem Munde des Direktors der Strafanstalt zu Hubertsburg habe ich ausdrücklich das Gegenteil gehört. Dieser Herr pflegte die Prügelstrafe zwar, wie es scheint grundsätzlich, nicht in Anwendung zu bringen, hielt sich aber nach wie vor dazu befugt, weil ihm von seinen Oberen eine gegenteilige Weisung nicht zugegangen war; ohne letztere war also das bestehende Gesetz (in diesem Falle die Grundrechte) für diese Beamten gar nicht vorhanden! — In meiner Zelle fand sich auch ein Nagel, wo man wenigstens ein Kleidungsstück oder ein Handtuch aufhängen konnte, und man ließ ihn mir ausnahmsweise, denn der Regel nach enthielten diese Zellen nicht einmal einen Holzpflock, geschweige einen eisernen Nagel.
Während der ersten Tage war es ein äußerst öder Aufenthalt, bis ich mir einige der nötigsten Gegenstände verschafft hatte, um „mein Zimmer“ etwas wohnlicher zu machen. Es ist immer das Klügste, sich vor allen Dingen die Lage so behaglich als möglich einzurichten, in der man sich gerade befindet; man erträgt dann den Mangel einer besseren leichter und bleibt fähiger, eine solche herbeizuführen. Wenn auch nicht eigentlich in Geduld gefasst, war ich doch wenigstens äußerlich ruhig und der Stockmeister sagte mir bald das Kompliment, dass er selten einen so ruhig gefassten Untersuchungsgefangenen gesehen habe. Was hätte auch unruhiges Benehmen und Toben gefrommt! Wer sich der Notwendigkeit mit Bewusstsein und entschlossen fügt, beherrscht sie, trotzdem dass er sie nicht ändern kann, und auf solche Entschlossenheit ist auch unsere Willensfreiheit beschränkt. Übrigens hoffte ich, wie fast jeder Neuling im Gefängnis, auf sehr baldige Entlassung.
Den Nachmittag und den folgenden Tag (Sonntag) ließ man mir Ruhe in meiner Zelle. Das Gefängnis hatte ich bis dahin bloß durch einen achttägigen Aufenthalt im Universitätskarzer vor langen Jahren kennen gelernt und ich konnte daher jetzt für all die Eindrücke empfänglich sein, die eine solche Lage auf den Neuling zu machen vermag. Der unter solchen Umständen Eingesperrte ist gern geneigt, Alles für einen groben Missgriff und Irrtum zu halten, der gewiss bald aufgeklärt und ausgeglichen sein werde; an eine Dauer des Zustandes glaubt man anfangs nicht leicht. Am meisten beschäftigt einen gewöhnlichen Gefangenen natürlich die gegen ihn gerichtete Anklage, die Erwägung, wie man sie werde begründen und wie sie sich werde entkräften lassen können. Bei mir war dies weniger der Fall, wie sich nach meinen oben erörterten Ansichten über diese Untersuchung schon von selbst versteht. Ich sann hauptsächlich nur, wie ich es am besten vermeiden könne, Andere mit in dieselbe zu verwickeln. Soweit aber derartige Gedanken bei einem Neuverhafteten einer andern Betrachtung Raum lassen, wird sich vor Allem das Unwürdige, das Beleidigende des Zustandes selbst fühlbar machen. Wenn ein Rasender oder ein Mordlustiger eingesperrt wird, so ist das so natürlich als notwendig; es empört aber das Gefühl, einen ruhigen, gesetzten Mann, der Niemands Leben noch Eigentum bedroht, wie ein wildes Tier behandelt zu sehen. Man findet darin etwas so Niedriges, Kleinliches, Läppisch kindisches und eben deshalb Beleidigendes, dass dieser Umstand — auch abgesehen von all den Erbärmlichkeiten einer geheimen Inquisition — schon allein genügte, um zwischen dem Gefangenen und allen irgendwie beteiligten Beamten eine unübersteigliche moralische Kluft zu befestigen. Es ist leicht gesagt, dass man alle Übelstände nur dem einmal bestehenden Systeme, nicht aber den Beamten zur Last legen dürfe, die diesem Systeme selber gehorchen müssen. Man weiß, dass sie sich freiwillig herbeigelassen, solchem Systeme zu dienen, sie halten es aufrecht und sind daher auch dafür verantwortlich.
Ein durch lange Haft Abgehärteter kann sich endlich auch einigermaßen an das Drückendste, an die Langeweile eines notgedrungenen Müßigganges gewöhnen. Im Anfange aber fällt es oft schwer, die bleiernen Stunden zu ertragen. Der Gefangene wird müde nur im engen Raume auf und ab zu schreiten, über seine Angelegenheit zu sinnen, von der er oft weit weniger weiß als seine Peiniger, und sich an der Vorstellung seines , wie er kaum zweifelt, nahen Triumphes zu weiden oder auch wohl Rachegedanken zu nähren , denn eine solche Untersuchungshaft weckt Leidenschaften, deren man sich bis dahin vielleicht kaum für fähig hielt. Der Geist wird solcher, und anderer Betrachtungen endlich überdrüssig und man sucht nach einer ruhigeren und mehr mechanischen Beschäftigung, um sich zu erholen. Man blickt etwa durchs Fenster und beobachtet den Wolkenzug, man zählt die Tauben, die auf den benachbarten Dächern sitzen oder man rechnet auch wohl aus, wie viele tausend Ziegel das große Dach des alten Rathauses gegenüber enthalten mag; dann streckt man sich auf die Matratze am Boden, mustert all die mannichfachen kleinen Flecken oder Risse an Decke und Wänden, findet, wie sie Gestalten, Gesichter, Bilder aller Art geben, oder lauscht auch auf die mancherlei eigentümlichen Geräusche im Hause, die man sich anfangs durchaus nicht zu erklären vermag, bis endlich mit gewaltigem Gerassel die Tür aufgeschlossen wird.
Es könnte scheinen, als müsse die beständige Hoffnung und Erwartung, bald frei zu werden, die Untersuchungshaft leichter ertragen helfen; ich möchte indes das Gegenteil glauben. Eben weil man eine solche Haft als einen vorübergehenden Zustand betrachtet, in welchem man nicht heimisch werden kann noch will, kommt man nicht leicht zum Behagen. Ich bemerkte schon, dass ich es für geraten halte, sich vor Allem in der Gegenwart wohl einzurichten und die künftigen besseren Tage zunächst sich selber zu überlassen. Soll das Leben nicht eitel Plage sein, so darf freilich nichts als bloßes Mittel des weiterhin zu Erstrebenden getan werden, sondern jedes Mittel muss auch ein für sich Bestehendes und in der eigenen Vollendung seinen Zweck Erreichendes sein, wie es überall in der schaffenden Natur der Fall ist. Nun würde aber ein seltener Charakter dazu gehören, um auch in der Untersuchungshaft stets diese Maximen zu befolgen.
Gegen viele unter gleichen Umständen Gefangene war ich insofern noch glücklich, als ich gleich in den ersten Tagen auf mein Verlangen Schreibmaterial und Bücher erhielt. Auch selbst die Gewohnheit des Tabakrauchens hilft den Zustand des Gefängnisses erträglicher machen und es war ein wirklicher Genuss, als ich nach mehrtägiger Entbehrung wieder die erste Zigarre rauchte und ein Buch las. Letzteres war, offen gestanden, bei dieser Gelegenheit nicht die Hauptsache, aber ich habe es nicht vergessen: es waren Daumers Geheimnisse des christlichen Altertums. Nie habe ich ein Buch mit größerem Behagen gelesen. Der Gefangene war Indes anfangs noch allzu mangelhaft eingerichtet; es fehlte am Feuerzeug und der Schließer hatte nur aus Gefälligkeit zwei oder drei seiner eignen Zündhölzchen verabreicht, die nun geschont und gespart sein wollten, denn es konnte ein Tag vergehen, bevor man sich neue verschaffte. Die erste Zigarre musste daher ohne Unterbrechung in Glut erhalten und bevor sie erlosch, musste gleich noch eine zweite daran angezündet werden. Übrigens dankte ich die anfängliche Entbehrung nur dem Umstande, dass ich versäumt hatte, mich mit dem nötigen zu versorgen, denn verboten war der Tabak mir und der Mehrzahl meiner Nachbarn nicht; die große Masse der Bewohner des Hauses durfte freilich höchstens verstohlen rauchen, wenn es überhaupt möglich ward. Ich gestehe, dass ich, bevor mir dieser elende Genuss ward, den Schließer beneidete, der sein schlechtes Kraut behaglich rauchte, wenn er ab und zu ging. Und er ging nicht selten ab und zu. Große Stille herrschte überhaupt nicht. Neben dem beständigen und mannichfachen Lärm der Straße im lebendigen Mittelpunkte der Stadt fehlte es auch im Hause nicht an Geräusch. Schon das Schließen benachbarter Zellen lärmte gewaltig, an der Tür der eigenen Zelle machte es aber (ausgenommen wenn die sanftere Hand der Frau Stockmeisterin aufschloss) ein Getöse um Tote zu erwecken.
Die Zelle war durch zwei Türen geschlossen, zwischen denen sich nur der Raum befand, den die Schwelle einnahm. Die innere Tür hatte einen von außen verriegelten kleinen Laden oder Klappe, etwa einen Fuß groß ins Geviert, so dass man bequem den Kopf hindurchstecken, auch allerlei Gegenstände, namentlich Ess- und Trinkgeschirr hindurchreichen konnte, wenn der Schließer nicht Zeit oder Lust hatte, die Tür selbst zu öffnen. Nach dieser Einrichtung, nämlich der zwiefachen Tür, versteht sich schon von selbst, dass es hier kein Spähloch gab, keinen „Judas“, wie man es sehr bezeichnend in französischen Gefängnissen nennt, dieses scheußlichste aller Foltermittel, das ich später an anderem Orte nur allzu genau kennen lernen sollte.
Ich gehörte, wie gesagt, unter die Bewohner der wenigen bevorzugten Zellen, deren Insassen Bücher und sogar Schreibmaterial bekommen konnten und z. B. auch nicht, wie die Anderen, genötigt wurden, sich eigenhändig mit der Reinigung eines der schlimmsten Gegenstände des barbarischen Gefängniswesens, nämlich der Nachtkübel, zu befassen. (Auch dies Vergnügen war mir auf spätere Tage vorbehalten.) Allsonnabendlich wurde von dienstbaren Geistern im Hause (gewöhnlich eingesperrten Frauen, denen das für eine Erholung galt) die Zelle gründlich ausgefegt und Tisch und Schemel gewaschen, während sich der Bewohner auf dem Vorsaal erging. Solche und ähnliche kleine Wohltaten erfolgten übrigens, denk’ ich, keineswegs auf Grund einer besonderen Weisung, sondern waren nur der menschenfreundlichen Gefälligkeit des Stockmeisters zu danken. Derartige Beamte sind meistens humaner nicht nur als ihre schriftliche Instruktion , sondern auch als ihre Obern, was leicht erklärlich ist: sie sehen im Gefangenen mehr ihres Gleichen, den Menschen, denn sie sind keine studierten Leute, folglich auch der Natur weniger entfremdet und tragen, was die Hauptsache ist, keinen juristischen Zopf.
Ich hatte anfangs des Abends kein Licht, auch war es in den langen Sommertagen entbehrlich. Als jedoch der Augustmonat kam, wo es zeitig zu dunkeln beginnt, machte sich das Bedürfnis geltend. Auf mein Verlangen gab man mir die Erlaubnis, Licht zu brennen, jedoch widerstrebend und mit der Bemerkung: „hier müssen gar Viele im Dunkeln sitzen.“ Das hatte seine Richtigkeit und in der Mehrzahl der Zellen, die sich in den unteren Stockwerken des Hauses befanden, sah es in jeder Hinsicht weit trauriger aus, als in der meinigen und den benachbarten. Lichtbrennen würde in jenen Zellen aber auch höchst überflüssig gewesen sein: die Gefangenen hatten dort schlechterdings kein anderes Gerät in der Zelle als den Strohsack, den Wasserkrug, einen hölzernen Esslöffel und den Nachtkübel. In einem solchen kleinen Gemache mussten oft mehrere Gefangene zugleich stecken, was gleichwohl für die armen Teufel eine Wohltat war, weil es sie gegen die Marter der Langeweile schützte. Die verschiedenen Matratzen wurden dann bei Tage auf einander gelegt und bildeten einen ordentlichen Sitz. Auch gab es ein derartiges größeres Gemach, was bisweilen wohl ein paar Dutzend Bewohner fassen musste. Dort ging’s manchmal lustig zu. Die Leute unterhielten sich mit Ausführung kleiner dramatischer Szenen, wodurch meist das Gerichtswesen, namentlich die Verhöre persifliert wurden; sie unterwarfen unerfahrene Neulinge allerlei Neckereien, ergötzten sich mit Pfänderspielen und dergleichen, schoben auch wohl Kegel, die sie samt der Kugel aus Brotkrume geknetet hatten. Brotkrume ist überhaupt ein Gegenstand, der in Gefängnissen ebenso mannichfache Anwendung findet, wie in der gewerblichen Welt Kautschuk und Gutta-Pertscha. Mir selber hat sie später noch sehr wesentliche Dienste leisten müssen. Mit Brot wurden diese Gefangenen übrigens gut und reichlich genug versorgt; ihre sonstige „Gefangenenkost“ (die als solche, d. h. als deutsche Gefängniskost vielleicht noch nicht die schlechteste, aber freilich ganz ohne Fleisch war und mit der ich mich, indem ich sie durch anderweite Zutaten verbesserte, selber längere Zeit begnügt habe) bekamen sie in Töpfen, für deren Reinigung, glaube ich, auch jeder selbst sorgen musste, so gut er konnte. Wer den seinigen nicht leerte, fand sicherlich Gehilfen, denn die meisten dieser Leute erfreuten sich eines wahren Wolfshungers, der bei ganz magerer Kost, sei sie noch so reichlich, leicht einzutreten pflegt.
Der Mai verging und der Juni kam mit warmen wunderschönen blauen Sommertagen, die wohl bisweilen eine melancholische Sehnsucht erweckten nach dem Grün dieser Sommerszeit. Ich sah von letzterem nur die wenigen jungen Linden auf dem Naschmarkte. Indes fehlte es in der Zelle selten an Blumen während der besseren Jahreszeit. Im Übrigen genoss man den Sommer, (dessen Hitze in diesen Gemächern auch bisweilen drückend wurde), so gut es sich an einem vergitterten Fenster genießen ließ. Der Blick durchs Fenster auf den damals stets außerordentlich belebten Naschmarkt unten hätte überhaupt stets Unterhaltung gewähren können, wär ich nicht durch meine ganze Lage so reizbar gemacht worden, dass mich eine Menge Dinge ärgerten, woran Andere sich wahrscheinlich zu ergötzen vermochten. Mir würde vollkommene Ruhe und Stille am willkommensten gewesen sein; nun aber ärgerte mich sogar die Musik, die damals zu allen Tageszeiten aus der benachbarten Wache der Kommunalgarde erschallte, weil ich sie hören musste. Auch der noch näher gelegene Börsensaal diente während der Nacht als Wachlokal und außer dem beständigen Waffenlärm ertönte denn auch noch Gesang und schallendes Gelächter. Man sehnte sich zu schlafen und konnte nicht dazu kommen. Schwere Leiden verursachte mir namentlich auch eine Ziehharmonika, die sich allabendlich nach neun Uhr längere Zeit unbarmherzig in unmittelbarer Nähe hören ließ und noch Jahre nachher genügte ein einziger Ton eines solchen Instrumentes, um mich in die unbehaglichste Stimmung zu bringen.
Es ist ein eigentümlich Ding um die kleinen Leiden. Ich gehörte unter die Leute, die (nach der Ansicht besser geschulter Philosophen freilich sehr unphilosophisch,) überall nach Zwecken suchen und so kam ich bezüglich der kleinen Leiden zu der Überzeugung, dass sie als Mittel zur Ertragung der großen dienen, die man über jenen einigermaßen oder auch ganz vergisst. Auch einem Gefangenen können die kleinen Leiden, an denen es zum Glück nirgends fehlt, sein großes Missgeschick ertragen helfen. Wie würde sich der gefangene Napoleon befunden haben bei voller Freiheit innerhalb der Insel, mit einer Art Hofstaat usw.? Gewiss viel schlechter als bei den kleinlichen Neckereien, denen er unterworfen war und die ihn weniger an sein großes Unglück, an seinen gefesselten Zustand denken ließen. Ohne diese Quälereien würde er vielleicht aufs Neue nach dem Opiumfläschchen von Fontainebleau gegriffen haben. Ein Mann war vom Kriegsgerichte zum Tode verurteilt worden und sollte am nächsten Morgen erschossen werden. Im Gefangenhause, wo er die letzte Nacht zubringt, bedauert man, ihm das vorhandene bessere Gemach nicht geben zu können, weil es lange nicht gereinigt ist und gerade jetzt von Flöhen und Wanzen wimmelt. Aber ebendeshalb verlangt er dies Zimmer, denn er fürchtet jedenfalls eine schlaflose Nacht zu haben und hofft diese unter den kleinen Plagen leichter überstehen zu können. Ähnliches ließe sich wohl in Betreff kleiner und großer Freuden sagen: die letzteren drücken den gewöhnlichen Menschen, während ihn nur die ersteren wahrhaft beglücken. Kleine Leiden hindern aber auch häufig, Großes zu vollbringen. Sie wirken lähmend, sie machen den Mann zu einem unschlüssigen Hamlet. Daher so viele Pygmäen und der Mangel an großen Männern. Unter kleinen Leiden gewöhnt man sich leicht ans Mückenseihen, während man Kamele verschluckt. Darum mag es wohl wahr sein, dass ein großer Schmerz etwas Erhebendes hat, aber nur für große Seelen, für solche von denen gesagt ist:
„Alles geben Götter, die unendlichen,
Ihren Lieblingen ganz,
Alle Freuden die unendlichen,
Alle Schmerzen die unendlichen ganz.“
_________
Mein Leben in der Zelle verging also hauptsächlich unter Lesen, Auf- und Abgehen und Schauen durchs Fenster. Von Feder und Papier machte ich anfangs wenig Gebrauch; es fehlte mir die Geduld zu längeren schriftlichen Arbeiten besonders deshalb, weil ich fortwährend eine Endschaft der Haft erwartete und daher Alles auf diesen glücklichen Zeitpunkt verschob.
Man gewöhnt sich schwer an den Gedanken, ein großes Stück, vielleicht ein Viertel, ein Drittel des ganzen Lebens verlieren zu sollen, zumal wenn es sich um den wichtigsten Teil desselben handelt. Ich verglich in dieser Hinsicht die ganze Lebenszeit mit einem Stabe: wird von diesem das untere Ende abgeschnitten, so bleibt noch immer ein brauchbarer Stab übrig; desgleichen, wenn man das obere Ende abschneidet; wird aber ein Stück aus der Mitte herausgeschnitten, so ist der Stab vernichtet. So hatte derjenige, den ein Los wie das meinige in jüngeren Jahren traf, noch immer eine Zukunft vor sich; wer im höheren Alter davon getroffen wurde, der hatte das Seinige schon geleistet und sich ausgelebt; wer aber der besten mitteln Jahre beraubt ward, sah seine Lebensbahn zerrissen und so gut wie vernichtet.
Inzwischen füllte sich das Haus mehr und mehr mit „politischen Gefangenen“ und nur spärlich waren die Glücklichen, die sich bald wieder in Freiheit gesetzt sahen. In den ersten Tagen hatte ich nicht gewusst, wer meine unmittelbaren Nachbarn waren, bis ich endlich bekannte Stimmen hörte. In diesem hochgelegenen dritten Stockwerke sprachen die Gefangenen damals ganz ungehindert mit einander durch die Fenster, denn in der Tiefe vernahm man bei dem geräuschvollen Verkehr der Straße nicht leicht etwas davon und selbst die in späterer Zeit an die Haustüre postierte Schildwache konnte nichts davon bemerken, wenn die Unterhaltungen etwas vorsichtig geführt wurden. Zur Linken hatte ich das erwähnte große Gemach, was ich gleich nach meiner Verhaftung zeitweilig betreten. Es hatte sich bald gefüllt, enthielt aber außer „politischen“ gelegentlich auch andere Gefangene und daher vermied ich es, mich nach jener Seite auf Gespräche einzulassen. Zur Rechten hatte ich aber den schon vor mir verhafteten Dr. Bertling, mit dem ich denn auch bald zu verkehren begann. Ein Zeichen war verabredet, wenn der eine den andern ans Fenster wünschte, desgleichen, wenn man von dem andern bis auf weiteres nichts hören wollte, weil man nicht allein war oder sich sonst nicht ungestört wusste. Während wir das damals sehr bunte und mannichfache Treiben auf dem Naschmarkte musterten, gehörte unter unsere täglichen Unterhaltungen auch das Füttern der Tauben, die unter tumultuarischem Drängen oft den ganzen Raum des Fensters dicht ausfüllten. Möglich, dass sich nicht alle Gefangenen , wie wir, bloß an dieser Fütterung erfreuten und dass im Winter, wo die Öfen geheizt waren, mancher der gefiederten Geiste in das Innere der Zelle geriet, um nicht wieder an die freie Luft, sondern in den Topf zu kommen, der außerdem jahrein jahraus nichts Fleischartiges enthielt. Das Öffnen und Schließen der Kaufläden in unserm Gesichtskreise, deren Inhaber mit ihren kleinen Eigentümlichkeiten, Alles dies kannten wir aufs Genaueste. Markttags konnte ich oft lange Zeit einer jungen Verkäuferin gegenüber am Eingange des Rathauses zusehen, deren Handel mit Grützwaren und trocknen Hülsenfrüchten sehr schwunghaft und deren äußerst flinkes Abwägen und Tüten füllen ebenso ergötzlich war, wie das hurtige und saubere Aufbinden und Ordnen ihrer vielen großen und kleinen Säckchen am Morgen und das nicht minder ordentliche Einpacken gegen Abend. Wichtiger als solche Bilder der Außenwelt war es indes für den Gefangenen, wenn sich die Tür öffnete und ein „Schiff“ kam, wie es der Gefängnishumor nannte, nämlich eine Sendung von außen, bestehend aus Gegenständen denen Eingang gestattet war. An der ostensibeln Schiffsladung, besonders sofern sie aus Lebensmitteln bestand, lag uns weniger; das Schiff war aber wichtig, weil es häufig zum Einschmuggeln von Gegenständen und Mitteilungen dienen musste, die nur insgeheim passieren konnten. In späterer Zeit wurden jedoch die Schiffe einer sehr genauen Durchsuchung unterworfen und man musste auf andere Mittel des Verkehrs mit der Außenwelt bedacht sein. Zeitungen waren uns politischen Untersuchungsgefangenen, soviel mir bekannt in Folge einer Weisung des Justizministeriums, entzogen; sie konnten daher nur insgeheim eingebracht und von Zelle zu Zelle mitgeteilt werden. Kaum begreif ich fest den Eifer, womit man nach diesen armseligen Papieren griff, wenn man einige Tage, vielleicht eine Woche gar keins zu Gesicht bekommen hatte. Aber man wollte den Verlauf des baden’schen Aufstandes kennen, man wollte wissen, wie sich die Dinge in Schleswig-Holstein gestalteten, desgleichen was die Französische Republik und das „Mondkalb“ machte, wie zu jener Zeit nicht ich, aber viele andere Leute den allerdings damals eben so wenig wie heute der Schlauheit, aber heute noch ebenso sehr wie damals der Klugheit ermangelnden Louis Napoleon nannten, und vor Allem wollte man aus den Blättern Näheres über den Gang der uns zu allernächst berührenden Reaktion mit Allem was sie in ihrem Gefolge hatte erfahren.
Unter die mancherlei Mittel, Zeitungen und Anderes von Zelle zu Zelle zu befördern, gehörte eine eigentümliche Einrichtung beim sonntäglichen „Gottesdienst“. Das Haus enthielt seine Gefängniszellen in drei Stockwerken und die über einander gelegenen Vorsäle dieser drei Stockwerke konnten durch Öffnung einiger in den Fußboden befindlichen Falltüren gewissermaßen in einen einzigen Raum verwandelt werden. Diese Falltüren öffnete man, wenn der Gottesdienst beginnen sollte, desgleichen öffnete man alsdann die äußeren Zellentüren, und von den inneren die oben erwähnte Klappe. So konnte jeder Bewohner, ohne irgendeinen seiner Nachbarn zu sehen, Alles hören was der auf dem Vorsaal des mitteln Stockwerkes stehende Geistliche sprach. Auch an gemeinschaftlichem Gesange fehlte es nicht, bei dem man freilich ganz vergaß, dass man sich mitten in dem musikalischen Leipzig befand. Zur üblichen Stunde öffnete also ein Schließer die Klappe in der Tür und fragte: Wollen Sie mit beten? Auf die bejahende Antwort wurde dann ein Gesangbuch verabreicht. Anfangs lehnte ich es stets ab und ließ meine Klappe sogleich wieder schließen; bald aber lernte ich die Vorteile dieser sogenannten Andachtsstunde begreifen. In unserm (dem obersten) Stockwerk wohnten, wie schon erwähnt, auch die in Haft befindlichen Wechselschuldner; diese brauchten beim Gottesdienst nicht bloß durch eine Klappe zu gucken, ihre Pforte öffnete sich ganz und sie konnten sich beliebig auf dem Vorsaal bewegen. Unter diesen Leuten fehlte es nun nie an einer gefälligen Seele, die irgendetwas Überflüssiges aus einer politischen Zelle nahm, um es in eine andere zu stecken, wo Mangel herrschte. Während wir in den Zellen so reich an Verkehrsmitteln waren (von allen habe ich bis jetzt noch nicht gesprochen), musste es komisch erscheinen, wenn man anderseits, namentlich in den Gerichtsräumlichkeiten, bisweilen aufs Ängstlichste die geringste Annäherung unter politischen Gefangenen zu hindern suchte, um „Kollusionen zu verhüten.“ (Ich sage bisweilen, denn im Allgemeinen und besonders in den ersten Monaten meiner Haft, achtete man wenig darauf, wenn ich im Gerichtslokale mit andern Gefangenen sprach.) Aber das waren nun eben nur Maßregeln, die, ohne irgendwelchen Nutzen für das verfolgende Gericht, für den Gefangenen zur peinlichen Schikane wurden; wenigstens galt das rücksichtlich politischer Gefangenen, wie wir es waren. Etwaige Besprechungen und Verständigungen können für Angeschuldigte kaum von Nutzen sein, sobald es sich nicht darum handelt, sie dessen, was sie getan oder nicht getan haben, zu überführen, sondern nur darum, zu beschließen was ihr Schicksal sein solle.
Inzwischen hatte ich fort und fort Verhöre zu bestehen. Bisweilen folgten sie rasch aufeinander, bisweilen vergingen zwei bis drei Wochen, bevor man wieder etwas von mir wissen wollte. Alles was ich zu sagen vermochte, hatte ich gleich anfangs ausführlich mitgeteilt und hatte daher später keine erhebliche Auskunft weiter zu geben; jedes Verhör diente vielmehr nur, meine eigene Kenntnis zu bereichern. So ließ sich, ohne dass es direkter Fragen bedurfte, erlauschen, wer zur Untersuchung gezogen war und wer nicht, wer geflüchtet und wer gefangen war, und dies zu wissen war mir aus dem Grunde wichtig, weil ich darauf bedacht sein musste, keinen noch Erreichbaren durch eine Aussage zu gefährden. In einem Buche, das ich in einem der Vorgemächer des Gerichtes fand und welches das Verzeichnis der sämtlichen Gefangenen mit Angabe des Grundes ihrer Haft enthielt, sah ich bei meinem Namen zu dem Worte „Hochverrat“ nachträglich noch „und Aufruhr“ eingeschaltet. Ich machte diese Entdeckung rein zufällig, denn man hatte es nicht für nötig erachtet, mir mitzuteilen, dass ich nicht mehr bloß Hochverräter, sondern auch noch Aufrührer sei. Wozu auch! Es schien, wie wenn sich Alles, von Anfang bis zu Ende, ganz von selbst verstände.
In einer Zeit politischer Parteikämpfe, wie die unsrige, muss der „Hochverrat“ häutig eine ähnliche Rolle spielen wie weiland etwa die Hexerei und er wird dann ebenso zum imaginären Verbrechen wie diese es ist. Fleiß, Geschicklichkeit, dadurch erworbener Wohlstand, Schönheit, desgleichen aber auch Hässlichkeit, Armut und ein rotes Auge konnten zur Hexe machen. Ebenso mannichfach und zahllos sind die Bedingungen, unter denen man heut zu Tage zum Hochverräter werden kann.
Durch eine Vergleichung mit dem Hexen- und Ketzerwesen ließe sich der sogenannte Hochverrat vielleicht am besten charakterisieren; mit wenig Worten zu sagen was er ist, wär’ ich nicht im Stande, wohl aber weiß ich, dass man einen unbequemen Patriotismus und überhaupt jede Bürgertugend mit diesem gehässigen Namen belegen kann, wenn’s sein muss. Auch zur Hexe und zum Ketzer konnte jede Tugend machen.
Nur freilich kann, ebenso wie an Hexen und Ketzern, auch an „Hochverrätern“ durchaus nichts für Tugend gelten. Die politischen Parteileute sind da ganz wie die orthodoxen Theologen: wer nicht glaubt wie sie und nicht nach ihrer Formel betet, ist verloren und verworfen, und wenn er sich auch früh und spät ausschließlich guten Werken widmete.
Man empfand einen unbeschreiblichen Ekel beim Anblicke der unaufhörlichen Schreiberei, deren Gegenstand man sein musste. Man dachte an die ergötzliche aber zugleich so bitterwahre Schilderung Vansens vom Verhör und vom „Hineinverhören.“ Richelieu meinte, um einen Mann an den Galgen zu bringen genüge es, ein Paar geschriebene Zeilen von ihm zu haben. Wie unbeholfen müssen Richelieus Leute gewesen sein!
Es braucht keine Zeile, überhaupt schlechterdings nichts, nicht einmal ein wirklicher Verdacht vorzuliegen, wenn man einen Mann an den Galgen bringen will, und dies kann man bewerkstelligen, ohne eine juristische Form zu verletzen.
Ich verglich bereits den Zustand eines in Untersuchung Befindlichen mit dem einer Fliege unterm Mikroskop; ich könnte ebenso sagen, man sieht sich behandelt wie ein Stoff in der Hand eines Chemikers: zerstoßen, zerrieben, mit Säuren übergossen und in der Retorte zerquält. Das Übelste dabei ist aber, wenn man sich zu der Annahme berechtigt glauben muss, dass all’ diese Quälerei, die nimmer enden zu wollen scheint, durchaus nichts weiter sei als eine leere Form, wenn man sieht oder zu sehen meint, dass das Ergebnis für bereits ermittelt gilt und über des Angeschuldigten Schicksal so gut wie beschlossen ist.
Der Mann, den man in einem Wagen in finsterer Nacht immer und immer in engem Kreise herumfährt, während er nach einem fernen Ziele zu reisen meint, ist bitter enttäuscht, wenn er sich am Morgen noch dicht am Ausgangspunkte findet; aber welche Qual, solch‘ unnütze Fahrt mit vollem Bewusstsein machen zu müssen!
Die einzigen Zeugen bei den Verhören, die altherkömmlichen drei Schöppen — gewöhnlich alte ehrsame Bürgersleute, die sich bei ihrer Figurantenrolle herzlich langweilten, wenn sie nicht schlummerten — schüttelten oft, sobald sie sich nur von mir beobachtet wussten, teilnehmend mit dem Kopfe, wenn sie mich immer und immer wieder abhören sahen, und verstiegen sich im Vorgemache auch wohl bis zum Darbieten einer vertraulichen Prise, begleitet mit einem Worte des Bedauerns und der Verwunderung über den Gang der Dinge. Mir war selbst die Teilnahme dieser armen Leute wohltuend, die ihr Stück Brot nicht im Schweiße des Angesichts, sondern durch Langeweile verdienten. Wenn man sich wie im Käfig fühlt und sich gleichsam von Fragen umgeben glaubt, die nur höhnen, necken und quälen, so freut man sich doppelt, wenn man darunter auch ein menschliches und teilnehmendes Gesicht entdeckt.
Bei diesem Gefängnisse gab es keinen Hof, keinen Raum unter freiem Himmel, wo man sich hätte ergehen und frische Luft schöpfen können. Der einzige Spazierplatz war der Vorsaal vor unsern Zellen und die einzige frische Luft diejenige, die da durch die offenen Fenster hereinkam. Aber auch diesen Raum durfte man nicht so ohne weiteres besuchen: man musste sich an den Arzt wenden und dieser untersuchte, ob der Gefangene solcher Erholung bedürftig sei! Einige der Gefangenen ließ man später einen Raum beim Schlosse Pleißenburg zu gelegentlichem Spaziergange benutzen. Für mich war davon keine Rede, ich galt bereits für zu sehr „graviert“ und durfte nicht aus dem Hause. Indes wurde mir auf dem Vorsaal, einem etwa achtzehn Schritt langen Raum, nachdem ich mich an den Hausarzt gewendet, (der es wirklich für nötig hielt, mich deshalb erst zu untersuchen!) der Spaziergang gestattet und zwar jedes Mal eine Stunde, jedoch nicht täglich. Zum Glück war der Schließer oder der Gerichtsdiener, der die Zelle zu diesem Zwecke zu öffnen pflegte, nicht so pedantisch, nur eine einzige auf einmal zu öffnen: es wurden immer gleich mehrere aufgeschlossen und so fanden wir Gelegenheit zu kleinen Versammlungen, von denen zwar der Vorstand des Gerichts (wie ich fand, erteilte die humoristische Sprache der damaligen Gefangenen diesem Herrn den Titel: Kriminalissimus) vermutlich nichts wusste, die aber in der Tat ganz harmloser und Gemütlicher Natur waren, da wir bezüglich der „Untersuchungen“ wirklich nichts zu verabreden hatten, wenn sich auch die Stimmung häufig in kritischen Bemerkungen Luft machen mochte. An diesen geselligen Zusammenkünften hatte unter Andern auch der später geflüchtete und vor einiger Zeit in England verstorbene Dr. von Franck Teil, dem damals die Furcht vor seiner wahrscheinlichen Auslieferung nach Österreich zu schaffen machte. Da trieb man denn gelegentlich geradezu Kinderspiel und das war umso nötiger und heilsamer, je mehr uns sonst Alles, was wir sahen und was man mit uns vornahm, zwar auch wie Spiel, aber wie ein grausames Spiel erschien. Wenn Franck inmitten des eine Reitbahn vorstellenden Saales als Stallmeister stand und nach seinem Kommando den Schließer oder einen Mitgefangenen, der Ross und Reiter zugleich vorstellte, Schule reiten ließ oder wenn er an den Voltigierübungen , wo ein alter Tisch als Pferd diente, oder auch an einem energischen Dauerlaufe teilnahm, dann sah er so wenig als wir andern wie ein Hochverräter aus. Wurden wir derartiger Übungen müde, dann war gewöhnlich eine Flasche Wein oder das Nötige zu einem Glase Grog in einer der Zellen vorhanden und die zugemessene Stunde (die sich Indes sonntags bisweilen stark ausdehnte) verging natürlich nur allzu schnell.
Es waren das, wie gesagt, nur Stunden harmloser Erholung und nichts weiter. Was die Seitens der Gerichte so sehr gefürchteten „Kollusionen“ anlangt, so war davon hier nicht die Rede; weit eher hätten solche in den Räumen des Gerichts selbst stattfinden können, denn hier fand sich, zumal da man oft stundenlang müßig in den Vorgemächern warten musste, Gelegenheit, Bekannten zu begegnen, mit denen man sonst nirgends zusammenkommen konnte; hier wurden auch, stets im Beisein eines Beamten, die Besuche von Freunden oder Angehörigen empfangen und die ganze Lage — Einsperrung, Zwang und argwöhnische Überwachung — gab da dem Gefangenen das natürliche Recht, gerade diese Gelegenheiten zum Austausche schriftlicher Mitteilungen zu benutzen. Es ist kein Widerspruch, wenn ich hier von argwöhnischer Überwachung spreche, nachdem ich der bequemen Gelegenheit, ungestört mit Gefangenen und andern Personen im Gerichtslokale zu verkehren, erwähnt habe; letzteres gilt von zufälligen Begegnungen; bei angemeldeten ordentlichen Besuchen fehlte die lästige Beaufsichtigung nie. Ein Beamter, der in der Regel Zeuge der Besuche war die ich empfing, war bei dieser Gelegenheit, ohne sich übrigens feindselig zu zeigen, so plump, immer der ungeladene Dritte im Gespräche sein zu wollen, während er nur zur Rolle des Aufpassers befugt war, und drängte sich dabei, beide Hände in den Hosentaschen, förmlich zwischen den Besuchten und den Gast.
Ich erwähnte schon, dass mir gleich anfangs eine gewisse Vernachlässigung wünschenswerter Formen aufgefallen war (während mir das Wesentliche als bloße Formalität behandelt erschien!) und vielleicht hat solche Vernachlässigung nirgends nachteiligere Wirkungen, als bei einem Gerichte. Schon die äußerst unansehnlichen Räumlichkeiten machten einen üblen und gewiss nicht den ehrfurchterweckenden Eindruck, auf den meiner Ansicht nach auch schon die äußerlichen Einrichtungen, selbst der Eingang zu den Hallen der Themis berechnet sein sollten. Man konnte beim Eintritt ins Vorgemach glauben, den Laden eines Trödlers zu betreten. Wartete man in diesem engen Vorgemache, so hatte man zuversichtlich Gelegenheit, binnen einer halben Stunde das gesamte Personal, vom Vorstand abwärts bis zum letzten Schreiber, den gleich zur Hand befindlichen Abtritt besuchen zu sehen. Die Verhöre so gravierter Leute, wie ich es war, fanden zwar in der Regel in einem besonderen Zimmer statt, wo keine andern Zeugen als die drei Schöppen anwesend waren; bisweilen aber, wenn es kürzere oder unwichtigere Befragungen galt, wurde ich auch vernommen, wo eine ganze Reihe Protokollanten neben einander beschäftigt waren. Nicht genug dann dass ich selber mit meinem Monstrum von Hochverrat und Aufruhr vollauf zu tun hatte, ich musste auch zuhören, wie dicht an meiner Linken einem Menschen wegen eines veruntreuten Regenschirmes bang und heiß gemacht wurde, während sich dicht an meiner Rechten ein schlauer Jude bezüglich einer gestohlenen Uhr weiß zu waschen suchte und gleichzeitig wurden unmittelbar hinter meinem Rücken Gespräche mannigfacher Art geführt. Auch hörte ich wohl eine der Kuppelei verdächtige Dame sich an meiner Seite in Gründen erschöpfen, weshalb sie, ohne dessen für sich selbst benötigt zu sein, eine Wohnung mit so zahlreichen Gemächern gemietet habe. Während der Messzeit, wo es Überfluss an kleinen Dieben gab, stand man da manchmal buchstäblich im Gedränge und ganz gegen meinen Willen musste ich Einblicke in manchen Spitzbubenprozess gewinnen. Öfters bin ich da von solchen armen Teufeln um ein „Stückchen Zigarre“ angebettelt worden und ich schätzte mich glücklich, wenn es sich tun ließ, ihnen ein Paar Zigarren zuzustecken, die sie aber in den meisten Fällen nicht rauchen sondern nur kauen konnten. Und dazu wär’ ihnen selbst ein schon gebrauchtes „Stückchen“ willkommen gewesen!
Welch’ widerliches Ragout von schmutzigen zerlumpten Gestalten, Spitzbuben, jungen und alten Haken, Jammer und Elend, Gestank und Schergenkauderwelsch! Wie froh war man, wenn man sich endlich aus dieser Kriminalistischen Küche erlöst sah, wie tief atmete man, wenn man sich endlich wieder allein in seiner Zelle befand!
Ich sage allein, denn unter die Leiden des Gefängnislebens gehörte es für mich, einen Zellengenossen zu haben. In einem so kleinen Raume, der alle sonst nötigen Gemächer — alle, „zu Ehren und Unehren“ — in sich allein vereinigt, will man gern allein sein und selbst mit einem Freunde würde man da nicht immer beisammen sein mögen, geschweige denn mit ganz fremden Personen. Mehrere Monate lang war ich in dieser Beziehung, vielleicht rein zufällig, vielleicht auch weil man mich als besonders Gravierten isoliert halten wollte, verschont geblieben und es überraschte mich äußerst unangenehm, als mir eines Tages die Frau Stockmeisterin , die uns fast täglich besuchte, wenn unter ihrer Aufsicht ihre Untergebenen uns mit frischem Wasser und andern nötigen Dingen versorgten, die Mitteilung machte, dass ich einen Gesellschafter erhalten werde. Die damalige Überfüllung des Hauses, wo in allen Zellen (die meinige und die meines Nachbars Bertling ausgenommen) zwei, drei und wohl noch mehr Gefangene beisammen stecken mussten, wurde als Grund angeführt und ich musste mir die neue Einquartierung gefallen lassen. Bald nach der Ankündigung traf mein unwillkommener Gesellschafter selbst ein, den man aus einer überfüllten Zelle in die meinige brachte. Er war, wie er mir sagte, von Haus aus Mediziner, d. h. er hatte es werden wollen, war aber etwas Anderes geworden, was so vager Natur zu sein schien, dass es sich nicht recht bestimmt bezeichnen ließ; nebenbei oder auch wohl hauptsächlich war er Spieler von Profession und verbüßte soeben eine Strafe von sechs oder acht Wochen Gefängnis, wozu er wegen verbotenen Glücksspieles verurteilt worden war. Ein solches kleines Missgeschick schien ihm regelmäßig alle Jahre einmal zu begegnen; ich glaube, er bezog das Stockhaus so regelmäßig, wie manche Leute alljährlich zur bestimmten Zeit ins Bad zu reisen pflegen. Er war daher bereits daran gewöhnt und darauf eingerichtet. Einige für den Gefängnisaufenthalt nötige Gegenstände führte er in einer Reisetasche bei sich und diese letztere gewährte, indem er seine Wohnung damit verließ und ebenso später damit wieder heimkehrte, den Vorteil, seine Nachbarn glauben zu machen, er sei auf einer Geschäftsreise gewesen. In den ersten Augenblicken war ich etwas misstrauisch gegen diesen Mann. Ich hatte so viel gehört und gelesen von agents provocateurs, Gefängnisspionen und dergleichen, dass mir ein solcher „nichtpolitischer“ Zellengenosse ziemlich verdächtig erschien. Es gab zwar bei mir nichts Erhebliches auszuhorchen, was ich nicht schon selbst in den Verhören ausgesagt gehabt hätte und ich hatte daher einen Spion nicht zu fürchten, wohl aber würde mir ein moralischer Ekel dessen Gegenwart äußerst widerlich gemacht haben, während mir schon die Gesellschaft eines unverdächtigen Gefangenen sehr lästig war. Ich konnte mich indes bald von der Harmlosigkeit des Mannes überzeugen. Er war wenig geschwätzig, einen großen Teil des Tages verschlief er und außerdem beschäftigte er sich mit einer Stickerei in bunter Wolle. Mit allen Einrichtungen des Hauses war er durch die Praxis auf das Genaueste vertraut und konnte mir, der ich noch etwas neu war, in dieser Hinsicht alle verlangte Auskunft geben. Auch sonst war er in mancher Beziehung nützlich. Als bloßem Polizeigefangenen gestattete man ihm auf sein Ansuchen allwöchentlich einen Ausgang; er war dann beinahe den ganzen Tag abwesend und kehrte mit Neuigkeiten beladen zurück. Gleichwohl war ich froh, als seine Frist endlich abgelaufen und ich wieder allein war. Auch hatte mich seine Gegenwart in meinem Verkehre mit den Nachbarn gestört. Im Laufe der nächsten Monate erhielt ich noch zweimal, zum Glück nur auf ganz kurze Zeit, Zellengenossen. Das eine Mal brachte man mir spät abends einen Herrn, der Verhaftet worden, weil er, durch Wein aufgeregt (er war selber Weinreisender), in unangenehme Berührung mit Polizeibeamten geraten war. Ein ziemliches Räuschchen brachte er noch mit in die Zelle und nötigte mich, wie es Neuverhaftete gewöhnlich tun, den ganzen Hergang seiner Sache haarklein erzählen zu hören, um mir deutlich zu machen, wie empörendes Unrecht ihm widerfahren. Abgesehen von seiner damaligen, durch Wein und Ärger verursachten Aufregung war er ein wirklich artiger Mann; mir war er aber jedenfalls im Wege, besonders als er sich ganz überflüssiger Weise aus seinem Gasthause ein Abendessen mit Wein kommen ließ und gleich nach dem ersten Schlucke aus dem Glase einen Teil vom Überflusse seines Innern von sich gab und zwar quer über den Tisch weg auf meine Bücher und Schreibereien, die da ausgebreitet lagen. Anfangs hatte er gemeint, er befinde sich nicht bei einem Gefangenen, sondern einem Beamten gegenüber; jetzt erst kam er dahinter, mit wem er’s zu tun hatte. Als ich auf meinem Tische wieder eine notdürftige Ordnung hergestellt und gerettet hatte, was zu retten war, bat er sich ein Blatt Papier aus und schrieb einen fulminanten Brief an den Polizeidirektor. Ich machte ihn aufmerksam, dass er seinen Zweck, sich schnellstmöglich wieder in Freiheit gesetzt zu sehen, durch eine solche Epistel schwerlich erreichen werde. Er sah das ein und schrieb eine andere, die aber, glaub‘ ich, ebenfalls nicht an ihre Adresse gelangte, was gut für mich war, denn man hätte es mir als Missbrauch des mir verstatteten Schreibmaterials auslegen können, dass ich einen Andern Gebrauch davon machen lassen und würde mir selbst vielleicht diese Vergünstigung entzogen haben. Man schleppte endlich eine zweite Matratze in die Zelle, auf die er sich scheltend und seufzend streckte, um zu seinem und meinem Glück bald zu entschlafen. Am Morgen schritt er, noch immer im Innersten empört, tobend und stampfend noch etliche Stunden bei mir auf und ab, dann ward er abgerufen und ich begegnete ihm nur gelegentlich noch einige Male im Gerichtslokale wieder. Mein dritter und letzter Zellengenosse im Leipziger Stockhause war ein junger Mensch, ein deutscher Jude aus Galizien, wie er mir angab, der die Universität in Leipzig beziehen wollte, zunächst aber der Polizei in die Hände gefallen war, weil seine Papiere nicht recht in Ordnung sein mochten. Auch wollte er, sei es aus jugendlicher Renommisterei, oder sei es, weil die Polizei es ihm eingeredet hatte, den politisch Verdächtigen ein Bisschen spielen. Man brachte ihn mir an einem kalten Winterabend frisch vom Bahnhofe und ich musste notgedrungen seine Geschichte anhören. Jener Herr Weinreisende war, trotz den kleinen Exzessen die auf Rechnung des Weines kamen, ein sehr anständiger Mann. Der junge verfolgte Studiosus war aber bei aller Nüchternheit ein unangenehmer Genosse, geschwätzig, zudringlich, unreinlich, und leider musste ich seine Gesellschaft etliche Tage erdulden. Es war mir geradezu ein Gräuel, Tag und Nacht in einem solchen Gemache mit andern Personen eingesperrt zu sein. Das mag für Geschmacksache gelten, denn manche andere Gefangene haben sich ausdrücklich Gesellschaft erbeten. Diese vermisste ich freilich auch oft schmerzlich genug, aber jenem beständigen Beisammensein in einer Zelle, die zu Allem dienen muss, zog ich die Einsamkeit vor, die zwar etwas melancholischer, dafür aber auch ein wenig sauberer war. Wenn ich in der Folge spät abends auf dem Vorsaal noch Schritte vernahm und Schlüssel klappern hörte, bekam ich jedes Mal einen Schrecken, weil ich fürchtete, man werde mir einen just aufgegriffenen Zellengenossen bringen und gerade spät abends, wo die Stürme des Hauses schwiegen und sozusagen „in der stillen Zelle die Lampe freundlich wieder brannte“, war mir eine solche Überraschung doppelt peinlich.
Bloß ein einziges Mal brachte man mir wirklich noch einen Gast, aber während er mir seine Geschichte (keine Leidens- sondern eine Kneipengeschichte) erzählte, beschloss ich auch, ihn um keinen Preis bei mir zu behalten. Ich machte bei dem Beamten, der bereits einen Strohsack für ihn hereinschleppen lassen, den Umstand geltend, dass ich, was in der Tat so war, nur noch wenig Tage in diesem Hause zuzubringen hatte und diese gern in Ruhe hinbringen wollte. Man begriff dies und entfernte den Mann samt Strohsack sofort wieder nach der großen Nachbarzelle zur Linken, die ohnehin stark bevölkert war und wo der neue Ankömmling, wie ich nachher erfuhr, sehr gefiel.
_________
Neben meinem großen Prozesse, der für mich selber stets etwas Mystisch-Nebelhaftes behalten hat, was mir keine konkrete Gestaltung gewinnen wollte und dessen Dimensionen ich daher nie recht festzustellen vermochte, neben diesem großen Hochverratsprozesse lief noch ein kleiner Prozess her, der aber schon älteren Ursprungs und bereits im vorhergehenden Jahre (1848) aus Anlass eines damals durch mich veröffentlichten Aufsatzes gegen mich eingeleitet worden war. Also ein Pressprozess. Über dem großen hatte ich diesen kleinen schon ganz vergessen. Er meldete sich gerade in der Zeit wieder, wo ich den oben erwähnten Spieler zum Zellengenossen hatte. Die Anklage enthielt ebenfalls etwas von Hochverrat (Versuch oder Vorbereitung zum Hochverrat, mir sind diese Unterschiede entfallen); aber das war neben der Hauptangelegenheit natürlich nur Kleinigkeit und es würde damals einen Gefangenen wenig gerührt haben, wenn man ihm noch zwanzig solcher Prozesse aufgebürdet hätte, obwohl bei den meisten zum wenigsten Gefängnis, wo nicht Zucht- und Arbeitshaus im Hintergrunde knurrte. Daher war auch dieser Prozess in meinen und in den Augen meiner Mitgefangenen bloß ein kleines Ereignis und für mich war er nur insofern wichtig, als ich mich zeitweilig mit dem Gedanken trug, ihn zur Bewerkstelligung meiner Flucht zu benutzen. Leider ließ ich mich von diesem Plane ablenken.
Dass in mir und Andern der Gedanke an Flucht bereits öfters aufgetaucht war, versteht sich von selbst. Als wir einst auf unserm Vorsaal standen, wo man über die Dächer drüben den Turm der Nicolaikirche emporragen sah und als Jemand von der weiten Aussicht sprach, deren man dort genösse, äußerte ich, das ungleich niedrigere Stockhaus beherrsche doch eine viel weitere, denn von da aus habe man Aussichtwohl sieben Meilen weit nach Hubertsburg, Zwickau und Waldheim (den drei großen Strafanstalten des Landes). Während ich diesen Scherz aussprach, begann ich mich im Stillen zu schämen, dass ich mir diese Aussichten geduldig vorbehalten lassen wollte, und war von Stund’ an ernstlicher auf Befreiung bedacht. Indes behielt ich meinen Plan zunächst streng für mich und äußerte darüber nichts bei unsern Zusammenkünften. Diese fanden, wie erwähnt, nicht gerade täglich statt, waren auch nicht stets zu offenen Mitteilungen geeignet, denn bisweilen traf es sich, dass ein uns weniger bekannter Gerichtsdiener zugegen war, dem wir nicht trauen mochten. Ohne Wächter ließ man uns natürlich nicht auf dem Saale beisammen, Indes fand auch der bestellte Wächter öfters Anlass, sich auf einige Augenblicke oder Minuten zu entfernen.
Wir hatten aber behufs gegenseitiger Mitteilungen auch eine ordentliche Nachtpost eingerichtet, von der ich anfangs nichts gewusst hatte. Bald war ich Indes davon in Kenntnis gesetzt und zur Teilnahme aufgefordert worden. Ich beteiligte mich jedoch erst, nachdem ich meinen Zellengenossen, den Spieler, wieder losgeworden war. Mit Ausnahme der Zelle meines isoliert wohnenden Nachbars Bertling hatten die übrigen mir ebenfalls sämtlich zur Rechten gelegenen Zellen zwar je zwei oder drei Bewohner, aber das waren lauter „Maigefangene“ oder doch sonst zuverlässige und geprüfte Leute. Die Nachtpost befördern Briefe und Pakete, letztere so groß als sie nur immer durch die Fenstergitter zu bringen waren. Wir besaßen einen starken etwa dritthalb Ellen langen Stock, der bei Tage einen Faulenzerposten in einem großen Blumentopfe hatte. Bei Nacht begann er sich in Bewegung zu setzen und nützlich zu werden, denn er war gleichsam unser Postpferd. An dem einen Ende wurde das zu befördernde Packet, welches allerlei Gegenstände, Zeitungen, Manuskripte, Bücher, Zigarren, Flaschen usw. enthalten konnte, gut und sicher mit Bindfaden festgebunden. Nun reichte man nach dem Nachbarfenster hinüber zuerst das entgegengesetzte Ende des Stabes und ließ diesen erst los, sobald der Nachbar durch einen kräftigen Ruck angezeigt, dass er ihn fest erfasst hatte. Einen langen Bindfaden, der noch am Packet befestigt war, behielt man inzwischen größerer Sicherheit wegen noch in der Hand und ließ ihn erst nachgleiten, wenn ein zweites Zeichen meldete, dass auch das Packet drüben sicher in Empfang genommen war. Dies behutsame Verfahren war sehr wohl berechnet: der Empfangende konnte durch einen plötzlichen Schrecken, durch ein plötzliches Aufschließen seiner Tür möglicherweise veranlasst werden, das Ganze aus den Händen zu lassen; die Sendung samt Postpferd würde dann auf die Straße hinunter gefallen sein, wenn sie der Absendende nicht an dem erwähnten Bindfaden festgehalten hätte. Es versteht sich, dass man vor dem Absenden und Empfangen jedes Mal das Licht auslöschte oder bedeckte. So ging die Nachtpost von Zelle zu Zelle (deren nur fünf beteiligt waren), hin und zurück an des Hauses Fronte, oft mehr als einmal an einem Abend. Lag der helle Mondschein auf dem Hause, so pflegten wir die Post in der Regel nicht gehen zu lassen. Am liebsten wählte man zur Beförderung solche Augenblicke, wo es sehr geräuschvoll auf der Straße unten zuging, z. B. wenn um halb zehn Uhr der Zapfenstreich der Kommunalgarde vorüberrasselte, denn dann sah nicht leicht jemand nach unsern Fenstern. Das Packet war stets mit einem der Farbe des Hauses entsprechenden Papiere umwickelt. Überhaupt ließen wir’s an keiner erdenklichen Vorsichtsmaßregel fehlen und so hatte sich z. B. auch für diese und andere Dinge eine besondere Sprache gebildet, damit wir uns den Schließern nicht so leicht durch ein unvorsichtig entschlüpftes Wort verraten möchten. So hieß das Postpacket und überhaupt jedes heimlich zugestellte Packet die „Semmel“. Wenn des Morgens, noch im Finstern, Frühstück und frisches Wasser gebracht wurde, wobei — eigentlich wohl gegen die strenge Hausregel — unsre Zellen einige Minuten geöffnet blieben, nützte ich die Gelegenheit stets, mir auf dem Vorsaal einige Bewegung zu machen und warf dann gelegentlich auch in die von Gefangenen wimmelnde große Nachbarzelle, wo nur die schon erwähnte Klappe in der Tür geöffnet war, eine große „Semmel“ d. h. ein Packet Zeitungen, denn diese Zelle konnte bei der Nachtpost nicht füglich beteiligt werden.
Auf verabredete Zeichen musste man bei all diesen Dingen streng halten. In der Nacht, wo der Weinreisende bei mir war, hatte ich die Post soeben erhalten, konnte sie aber natürlich in Gegenwart dieses Fremden, dessentwillen überdies Beamte und Schließer noch ab- und zugingen, nicht zurückbefördern. Nun redete mich mein Nachbar, der nichts von der Anwesenheit eines Gesellschafters bei mir wusste, fortwährend in jener wohl rohesten Mitteilungsweise zwischen Gefangenen, nämlich durch die Klopf- oder Wandsprache an (der etwaige technische Name ist mir entfallen), die darin besteht, dass man Alles durch Klopfen vorbuchstabiert; indem
1 Schlag = a ist, 2 Schläge = b u.s. w. bis z. Dieses Mittel, das selbstverständlich eigentlich nur angewendet wird, wo die Kunst des geheimen Verkehrs zwischen Gefangenen noch in der Kindheit ist, erfordert nicht nur viel Zeit und Geduld, sondern hat auch den Nachteil, dass gar nicht beteiligte Dritte zuhören und nachbuchstabieren können. Ich habe selber in stiller Nacht, wo man dieses Pochen und Picken, wozu sich die Leute gewöhnlich ihrer Holzlöffel bedienten, von allen Gegenden des Hauses vernahm, bisweilen lange Gespräche verfolgt, die in dem Stockwerk unter mir geführt wurden. Wir machten von dieser Sprache nur selten und im Notfall Gebrauch, und als mich mein Nachbar jetzt anredete, konnt’ ich mich nicht auf das Zeichen besinnen, welches besagt, dass das Gespräch zu unterlassen sei. Ich Tat als hört’ ich nichts; aber meinem Gesellschafter fiel das eigentümliche Pochen auf. „Da nebenan will man etwas, es pocht beständig,“ sagte er. Ich musste dem Ding ein Ende machen und erklärte dem Manne: Ja, das Klopfen ist hier unsre Sprache; mein Nachbar will eine Auskunft, die ich ihm jetzt nicht geben kann. — Und nun klopft’ ich die Worte: „Ein Fremder da.“ Der Nachbar wollte wissen, was für ein Fremder, und wir wechselten noch einige Worte. Der Fremde selber, der nicht wusste das von ihm die Rede war, sah staunend zu und begriff nichts von dem zwar etwas mühseligen aber höchst einfachen Verfahren. Wenig fehlte, dass ihm das Gefängnis interessant geworden wäre. Vergebens hofft‘ ich, ihn sogleich wieder entfernt zu sehen, um die Post abschicken zu können; ich musste nun den ganzen Apparat während des folgenden Tages in meiner Zelle verborgen halten, was unangenehm war, da möglicherweise einmal eine Durchsuchung stattfinden konnte. Indes ist meine Zelle im Leipziger Stockhause niemals einer solchen unterworfen worden. Als uns später der Poststab abhandenkam, lieferte ein Zigarrenkästchen, das man zerschnitt, und der allezeit reichlich vorhandene Bindfaden den Stoff zu einem neuen.
Es trägt, denk’ ich, dazu bei, den Zustand eines in derartiger Untersuchungshaft befindlichen Gefangenen zu charakterisieren, wenn ich so scheinbar regellos, wie es bisher geschehen, von einem Gegenstande zum andern springe. Eine ruhig fortlaufende und besser geordnete Erzählung würde die Wahrheit weniger genau zurückspiegeln.
Ich komme wieder zum Pressprozess. Dieser gehörte vor die Öffentlichkeit und vor die Geschwornen, während man uns das gleiche Verfahren rücksichtlich des Prozesses wegen der sogenannten Maiunruhen nicht zu Teil werden ließ: diesen wollte man nicht in den hellen Sonnenschein des öffentlichen Verfahrens treten lassen und so blieben wir dem alten schriftlich-geheimen Inquisitionsverfahren verfallen. Anlass zu meinem Pressprozesse hatte ein Artikel des im J. 1848 von mir herausgegebenen Wochenblatts Deutsche Eisenbahn gegeben. Das Blatt erschien in Altenburg; der dort lebende Verleger war von dem altenburgischen Gericht wegen jenes Artikels zur Verantwortung gezogen worden, der Mann hatte sich auf mich berufen, man hatte deshalb nach Leipzig berichtet und nun war hier wegen des nämlichen Gegenstandes die Anklage auch gegen mich gerichtet worden. Über ein Jahr war seitdem verflossen, ich war inzwischen in Folge anderer Vorgänge in Haft gekommen und jetzt endlich entschloss man sich, die lange in Aussicht gestellten, aber nunmehr nur ausnahmsweise auf Pressvergehen und damit Verwandtes zur Anwendung gebrachten Geschworenengerichte in Wirksamkeit treten zu lassen. Ich erhielt vom Gericht eine darauf bezügliche Zuschrift eingehändigt und bald nachher auch die Namensliste der Geschwornen. Die betreffende Sitzung war auf den 10. September anberaumt. Es war die erste Schwurgerichtssitzung in Sachsen und mit meinem Falle sollte sie eröffnet werden.
An dem genannten Tage brachte man mich in einem Fiaker am frühesten Morgen, obwohl die Sitzung erst drei oder vier Stunden später beginnen sollte, nach dem „Schützenhause“, dessen geräumige Hallen für die Gelegenheit erlesen worden waren. Die später sehr zahlreiche Zuhörerschaft war natürlich noch nicht versammelt, dagegen war bereits eine Compagnie Kommunalgarde und eine desgleichen Militär aufgestellt. Als ich mit meinen Begleitern über den Korridor des Hauses nach dem für die Angeklagten bestimmten Abtretezimmer ging, begegneten wir einigen zu dem am Hause aufgestellten Militär gehörigen Offizieren, welche artig grüßten; noch mitten im Gruße ward es ihnen aber plötzlich klar, dass sie einen der Angeklagten vor sich hatten und ich wünschte, es hätte ein Photograph den plötzlichen Übergang von dem artigen Mienenspiel zu einem aus großer Verlegenheit und pflichtschuldiger Zurückhaltung gemischten Ernste fixieren können. Ich habe später noch auf vielen Gesichtern manch ähnlichen komischen Moment zu bemerken Gelegenheit gehabt.
Der Artikel, dessen Veröffentlichung der Staatsanwalt auf Grund des sächsischen Kriminalgesetzbuchs einer Vorbereitung zum Hochverrate gleichachtete d. h. also als eine gegen die sächsische Regierung gerichtete Handlung darstellte, dieser Artikel war gleichwohl in Sachsen gar nicht verbreitet, auch nicht daselbst entdeckt worden und nicht daselbst aufzutreiben; es lag nur das von Altenburg eingesandte Exemplar vor. Für die Schwurgerichtssitzung brauchte man, ich weiß nicht mehr weshalb, ein zweites und man hatte sich wegen dessen Beischaffung an mich gewendet, weil man nicht erst nach Altenburg schreiben wollte, in Sachsen aber das Blatt, wie gesagt, nicht zu haben war. Ich musste wohl ein gefälliger und gefügiger Angeklagter sein, da ich mich dazu verstand ein Duplikat des corpus delicti selber zur Stelle zu schaffen. Übrigens war der fragliche Aufsatz nicht mein eigen Werk, sondern nur der im wörtlichen Auszüge gegebene wesentliche Inhalt einer damals erschienenen Flugschrift von dem bekannten Struve. Ich übernahm die Mühe meiner Verteidigung selbst, jedoch weniger meinetwegen, denn eine Verurteilung konnte mir unter den Umständen ziemlich gleichgültig sein, als vielmehr aus Freude darüber, dass ich endlich einmal ein öffentliches Gericht erlebte. Den Geschworenen wurden in Betreff meiner zwei Fragen vorgelegt: bezüglich der einen, ob ich eine den Hochverrat vorbereitende Handlung begangen, verneinten sie meine Schuld, bejahten sie aber hinsichtlich der zweiten Frage, bei der es sich um ein milderes Vergehen (dessen Benennung mir entfallen ist) handelte. Wegen dieses letzteren verurteilte mich denn der Gerichtshof zu einjähriger Gefängnisstrafe, was in dem betreffenden Falle das höchstmögliche Strafmaß war. Eine Verurteilung zu Gefängnis war für mich ganz ohne Bedeutung, denn ich war ohnehin gefangen und man ließ mich merken, dass man nicht daran dächte, mich in der Bälde freizulassen.
Während sich die Geschworenen zur Beratung und Abstimmung zurückgezogen hatten (sie brauchten sehr viel Zeit, um sich zu einigen), war auch ich in das Abtretezimmer zurückgekehrt und hier bot sich mir in einem anstoßenden Gemache, wo ich wenigstens auf Augenblicke ganz allein sein konnte, eine gute Gelegenheit zum Entweichen. Das offene Fenster winkte lockend und es hätte nur geringe Entschlossenheit dazugehört, um mir hinaus und hinab zu helfen. Die Höhe war unbedeutend, überdies einige Hilfsmittel zur Hand, gefährlich war die Sache so gut wie gar nicht, im Garten unterm Fenster kein Mensch zu sehen. Ich unterließ das kleine Wagstück, weil ich eine noch bessere und bequemere Gelegenheit in Aussicht hatte. Ich entschloss mich nämlich, in Betreff des mir gewordenen Urteils Berufung einzulegen. In diesem Falle stand eine neue Gerichtsverhandlung in Aussicht, die, da es sich dabei nicht mehr um das Schuldig sondern nur um das Strafmaß handelte, ohne Geschworene aber ebenfalls öffentlich beim Oberappellationsgericht in Dresden stattfinden sollte. Bis dahin konnte mindestens ein Monat vergehen, ich vermochte inzwischen einige nötige Vorbereitungen zu treffen, hatte alsdann die längeren Oktoberabende und die Reise nach Dresden und durfte mit Wahrscheinlichkeit, ja fast mit Gewissheit darauf zählen, während dieser Reise mein Entkommen zu bewerkstelligen.
Ein Zwischenfall oder vielmehr einige Zwischenfälle veranlassten mich, leider! auch diesen Plan aufzugeben, noch bevor die Zeit zur Ausführung herangekommen war. Von einem der Gerichtsdiener, die uns aus den Zellen nach dem Gerichtslokal und umgekehrt zu begleiten pflegten, wurde ich eines Tages in sehr auffälliger Weise angeredet. Während wir die Treppen mit einander hinaufstiegen, sagte der Mann zu mir: „Warum laufen Sie nicht davon? ich halte Sie nicht, mir ist das ganz einerlei; sagen Sie mir‘s, sobald‘s Ihnen gelegen ist.“
Das hieß rund heraus geredet. An teilnehmende Äußerungen Seitens der Mehrzahl dieser Leute war ich gewöhnt und wusste auch, dass ihnen dabei recht von Herzen ging; was sie sagten. „Noch keine Aussicht bald entlassen zu werden?“ war eine der gewöhnlichen Fragen, die man von ihnen hörte. Laut auflachen musst‘ ich, als einmal bei solcher Gelegenheit der Gerichtsdiener in seiner Naivität mit einem tiefen Seufzer sagte: Ja, hier geht jetzt Gewalt vor Recht! — Vertrauliche Äußerungen konnten daher nichts Überraschendes für mich haben. Die unumwundene Aufforderung zur Flucht aber, die mir mein damaliger Hüter beinahe im Tone des Vorwurfs machte, als müsste er mich ausschelten, dass ich mich nicht längst aus dem Staube gemacht, diese Aufforderung kam mir zu plötzlich, als dass ich ihr auf der Stelle hätte folgen können; vielleicht erschien sie mir im Augenblicke auch ein Bisschen verdächtig. Sofort konnt’ ich diesen Helfer auch nicht wohl beim Worte nehmen: man hätte jedenfalls erst eine günstige Stunde und zwar die Abendzeit abwarten müssen. Im Übrigen bedurft’ ich keiner Vorbereitung, denn ich war allezeit gerüstet. Auch mit einer Kopfbedeckung (die man jedem Verhafteten wegzunehmen pflegte) war ich versehen, um plötzliche Gelegenheiten nützen zu können. Ich hatte mir längst eine Mütze heimlich einbringen lassen und da mir diese nicht zweckdienlich schien, noch eine; die letztere hatt’ ich stets in meiner Rocktasche.
Der Vorschlag des Gerichtsdieners — wenn ich nicht irre hieß der Mann Noack — gab mir natürlich Stoff zum Nachdenken. Ich nahm Gelegenheit, mich bei einigen seiner Kollegen nach ihm zu erkundigen. Leider hört’ ich da seinen Charakter nicht sehr loben, Indes beschränkte sich alles Üble, was man ihm nachsagte, im Grunde nur darauf, dass er der Flasche etwas zugetan sei. Das war für mich bloß ein Grund zu größerer Behutsamkeit. Mochte der Mann übrigens sein wie er wollte: in einer Zeit, wo die Kerkertüren nicht mehr von Engelshand geöffnet werden, konnten mir die Dienste eines Herrn Noack nicht anders als sehr annehmbar erscheinen. Das Unbequeme war zunächst nur, dass man einen solchen Geist nicht alle Stunden beliebig zitieren konnte; die Leute wechselten im Dienste ab und es konnten bisweilen Tage, vielleicht sogar Wochen vergehen, bevor man Gelegenheit fand, mit dem nämlichen Manne wieder zusammenzukommen.
Um die nämliche Zeit geriet mir eines Tages, während ich mich im Gerichtslokale befand, ein Zettelchen in die Hand. Das geschah fast täglich, aber der Inhalt war nicht immer so wichtig wie diesmal. Nach meiner Zelle zurückgekehrt las ich nämlich auf dem Papierchen die dunkle Nachricht, dass man damit umgehe, „mich von hier wegzubringen.“ Man hatte damals einzelne Personen, namentlich solche deren Untersuchung geschlossen war, nach andern Gefängnissen gebracht, weil man den Raum im Stockhause anderweit brauchte. Wollte man es ebenso mit mir machen? An und für sich wäre das gleichgültig gewesen, aber unter den jetzigen Umständen war mir der Gedanke äußerst störend. Kam ich in ein andres Haus, etwa ins Schloss Pleißenburg, so konnten dadurch meine bisherigen Pläne vereitelt werden, ausgenommen derjenige, der sich an die Reise nach Dresden knüpfte und an den ich, Tor genug! jetzt schon gar nicht mehr dachte.
Bald kam ich Indes dahinter, dass ich den Inhalt jenes Zettelchens falsch verstanden hatte. Ich ward unterrichtet, dass es sich um eine Translokation ganz anderer Art handelte und dass das mysteriöse Papierchen in einem nahen Verwandtschaftsverhältnisse mit jener unverblümten Aufforderung Herrn Noacks stand. Der Gedanke liegt nahe, dass noch dem einen oder andern Gefangenen ein ähnlicher Vorschlag gemacht worden sein mochte, und da wir nun untereinander so vielfach verkehrten, könnt’ es auffällig scheinen, dass ich über derartige Angelegenheiten lange im Dunkel blieb; Indes darf das nicht Wunder nehmen: ich schwieg über diese Dinge gegen meine Mitgefangenen und sie schwiegen, vermutlich aus gleichen Gründen, gegen mich darüber. Man hatte nie zu vergessen, dass man durch Ruchbarwerdenlassen eines solchen Geheimnisses nicht nur das Gelingen des eigenen Planes, sondern vor Allem auch diejenigen Personen gefährdete, die sich zu dessen Förderung etwa herbeilassen mochten. Ich würde daher ebenso töricht als gewissenlos gehandelt haben, wenn ich einem andern Gefangenen alsbald etwas von dem Noack’schen Antrage u. dergl. mitgeteilt hätte. Ich war in Allem, was bloß meine eigne Person betraf, sehr aufrichtig, bisweilen wohl auch allzu aufrichtig, so dass es dann den Anschein haben mochte, als säße mir das Herz auf der Zunge. Es hatte dies zum großen Teil seinen Grund darin, dass ich während der Verhöre oft an ganz andre Dinge dachte, weil ich mich für den Prozess, zumal nachdem ich das Verfahren etwas näher angesehen hatte, gar nicht mehr ernstlich zu interessieren vermochte; es kam mir dann nur darauf an, schnell von dem lästigen Frager wegzukommen, und so behandelte ich, teils aus Ekel und Überdruss, teils aus Geringschätzung, das Ganze geradezu fahrlässig und zerstreut. Aber ich kam stets augenblicklich zur strengsten Wachsamkeit zurück, sobald es sich um etwas handelte, was andre mit berührte, und ich besaß namentlich da, wo die Möglichkeit einer Gefährdung andrer denkbar war, eine eiserne und nie zu erschütternde Verschwiegenheit. Ich habe auf diese Weise, von jenem ersten Verhöre bezüglich des oben erwähnten Plakates an bis zum Schlusse der Untersuchung, eine Menge Dinge mir aufbürden lassen, mit denen ich teils wenig, teils aber auch gar nichts zu schaffen gehabt hatte, die man aber in Ermangelung eines Andern auf meine Rechnung schrieb. Übrigens rühm’ ich mich dessen nicht, denn des entgegengesetzten Verhaltens ist nur die Feigheit des Lumpen und Schurken fähig.
In Folge der mir gemachten Eröffnungen hatt’ ich also den Plan, auf der Dresdener Reise zu entweichen, wieder aufgegeben. Diese Reise fand Indes, da ich einmal Berufung eingelegt hatte, wirklich statt und zwar, wenn ich mich recht erinnere, am 9. Oktober. Zur Flucht sollte sie nicht mehr dienen, obwohl sie, wie sich fand, die trefflichste Gelegenheit dazu dargeboten hätte; auch ihr ostensibler Zweck war mir völlig gleichgültig, und dennoch war sie nicht ganz zwecklos für mich: sie sollte mich wieder einmal in freie Luft führen. An diese, d. h. aus dem Leipziger Stockhause heraus, bin ich während meines ersten dortigen Aufenthalts, der reichlich elfthalb Monate dauerte, überhaupt nur dreimal gekommen: das erste Mal, als ich zur Schwurgerichtssitzung fuhr, ein zweites Mal als ich mich nach dem gegenübergelegenen Rathause begab, um dort eine von mir ausgestellte Urkunde zu unterschreiben, und dann auf dieser Dresdener Reise.
Zu dieser hatt’ ich ein recht abscheuliches raues Oktoberwetter. In Dresden, wo wir uns zunächst nach dem Rathause in Neustadt verfügten, hatte man beim dortigen Gericht für nötig erachtet, Quartier für mich bereit zu halten d. h. man hatte zu meiner Aufnahme während der Zeit, die zwischen dem Schlusse der Gerichtssitzung und dem Abgange des Dampfwagens übrig sein würde, eine Zelle erlesen, in der noch ein Maigefangener saß, dessen Untersuchung jedoch schon geschlossen war. Das mochte gut gemeint sein, denn die Zelle war, wie man versicherte, unter allen verfügbaren die beste und der damalige Bewohner ein anständiger Mann, dessen Gesellschaft mir nur hätte angenehm sein können. Ich hatte jedoch nicht Lust, Zellenstudien in Dresden zu machen; ich wollt’ es vorziehen, die übrigbleibende Zeit zu einem Spaziergange (versteht sich unter den schützenden Fittichen des begleitenden Gerichtsdieners) zu benutzen und lehnte daher die Gastfreundschaft des Dresdener Gefängnisses ab. Man ließ mich denn auch gewähren, da man sah, dass mein Begleiter keine Einwendung gegen die Erfüllung meiner Wünsche machte; förmlich gestatten mochte jedoch der Dresdener Beamte den Spaziergang gleichwohl nicht. Er bemerkte, dass wir uns nach dem Schlusse der Gerichtssitzung nach dem Bahnhofe zu verfügen hätten, dass dahin jedoch verschiedene Wege führten und wir ungehindert zwischen dem geradesten oder einem großen Umwege wählen könnten. Wir wählten denn in der Tat von Neustadt aus zunächst den Weg über die Brücke und gelangten endlich über diese nämliche Brücke zurück nach dem Bahnhofe.
Bevor wir diesen sehr krummen Weg machen konnten, musste Indes die Gerichtsverhandlung überstanden werden. Im Hofe des Gebäudes, wo diese Sitzung, die erste ihrer Art, statthaben sollte, waren wieder eine oder zwei Compagnien Soldaten aufgestellt. Ob man sie der Sicherheit wegen für nötig hielt oder ob sie die Feierlichkeit erhöhen sollten, weiß ich nicht. Mich schlug beinahe das Gewissen, als ich so große Anstalten getroffen, so viele Menschen in Bewegung gesetzt und dann im Saale drinnen eine recht stattliche Zuhörerschaft, sowie den Gerichtshof selbst versammelt sah, welcher letztere, ich weiß wieder nicht ob der Feierlichkeit willen oder weil er in einem etwas dunkeln Winkel saß, seinen Tisch mit brennenden Kerzen fast überfüllt hatte; nicht zu vergessen den Verteidiger (dessen Wahl ich, weil mich die Sache ganz und gar nicht mehr kümmern, dem Gericht überlassen hatte), der sich fortwährend mit einem starkparfümierten Taschentuche den Schweiß von der Stirn trocknete und wie ein Espenlaub zitterte und stammelte, sobald er zu sprechen hatte. Er trat hier vermutlich zum allerersten Male als öffentlich-mündlicher Verteidiger auf, ich aber hätte, wäre mir etwas am Erfolge gelegen gewesen, dem Oberappellationsgericht wohl ein wenig grollen dürfen, dass es mir einen so zagen und schwachen Kämpen erlesen. Das Beste was er getan beschränkte sich darauf, dass er sich recht sorgfältig angezogen hatte. Wir saßen dicht beisammen an einem kleinen Tischlein zur Seite. „Ergreifen Sie doch nun das Wort“, flüsterte er mir zu, als er sich selbst und noch mehr die Zuhörer durch einige Worte gefoltert hatte. Du lieber Gott! mir lohnte es ja gar nicht mehr der Mühe, in dieser Sache das Wort zu ergreifen; aber mich schlug, sag’ ich, beinahe das Gewissen, wenn ich beim Anblick dieser Szene mit Allem was Drum und Dran hing bedachte, dass das Alles, nachdem es einzig zum Zwecke der Ausführung meiner Flucht veranstaltet worden, jetzt eigentlich ganz zwecklos, nämlich eines aufgegebenen Planes wegen vor sich gehen musste.
Es schien altherkömmlich in Sachsen zu sein, dass richterliche Beamte bei jeder sich darbietenden Gelegenheit es sich angelegen sein ließen, ihre Reden und Vorträge mit einer volltönenden Lobeserhebung bezüglich ihres eigenen, nämlich des sächsischen Richterstandes, einzuleiten. Wenigstens entsinn’ ich mich nicht, dieses Exordium jemals vermisst zu haben. So war es auch bei Gelegenheit der Schwurgerichtssitzung in Leipzig geschehen, wo mich nach der Ansicht der Anwesenden ein ganz unerwartet hartes Urteil getroffen hatte, und auch hier versäumte der Vorsitzende des Gerichtshofes nicht, in seiner Eröffnungsrede dem eigenen Stande diesen Tribut zu zollen. Man sagte mir damals, dass sich die sächsischen Obergerichte zu einem übereinstimmenden Verfahren bezüglich der Urteile in den „Maiprozessen“ vereinigt hätten, ja man erzählte, es sei förmlich über die Frage abgestimmt worden, ob man auch Todesurteile fällen werde oder nicht. Wenn dem so war und man eine gewisse Übereinstimmung in formeller Beziehung erzielt hatte, so erlebte ich dagegen bei dieser Gelegenheit in meinem eigenen Falle ein auffälliges Beispiel von herrschender Nichtübereinstimmung im Wesentlichen. Kurz vorher hatte das Appellationsgericht zu Zwickau den Umstand, dass ein inkriminierter Aufsatz in einer stürmischen und wildaufgeregten Zeit geschrieben worden, ausdrücklich als Milderungsgrund gelten lassen. Hier dagegen ließ man diesen Milderungsgrund ausdrücklich als Erschwerungsgrund gelten: weil ich meinen inkriminierten Aufsatz in aufgeregter Zeit drucken lassen, war ich umso straffälliger. So geradezu entgegengesetzte Ansichten hegten zwei Gerichte des nämlichen kleinen Landes, zu der nämlichen Zeit und unter den nämlichen Umständen.
Eine unangenehme Erscheinung ist mir stets auffällig gewesen, die allerdings nicht einem einzelnen Stande, sondern im Allgemeinen dem sächsischen Charakter (d. h. dem Charakter des jetzt sogenannten sächsischen Volkes im Lande Meißen) zur Last fällt. Es ist dies ein gewisses Klugtun im gereizten Tone, ein Eifern und Rechthabenwollen, welches sich manchmal bis zur hämischen Bitterkeit steigert und an gewisse krankhafte Zustände erinnert. Der Mann kann dabei das trefflichste Herz besitzen und von der besten Gesinnung beseelt sein, äußerlich aber erscheint er oft so, dass man das Gegenteil vermuten muss. Er weiß nichts mit würdevoller Ruhe und edler Gelassenheit vorzutragen, gerät vielmehr leicht in einen geradezu bissigen Ton, wie wenn er sehr geärgert und erbost wäre. Um das Alles noch unangenehmer zu machen, kommt dazu der außerordentliche Überfluss an Worten, an glatten, aber mark- und charakterlosen Phrasen und namentlich auch das nichts weniger als sonore Organ dieser Sachsen, die häufig eine dünne quäkende Stimme haben und daher den breiten vollen Vokalen, namentlich dem a und au, nie ihr Recht widerfahren lassen.
Zugegeben, dass das Äußerliche Nebensache ist und die wahre Würde auch ohne selbiges bestehen kann — doch, wir sind sinnliche Wesen, nehmen mit unseren Sinnen wahr und so müssen denn die Formen einen starken Eindruck auf uns machen. Darum ist es wünschenswert, dass öffentliche Beamte gut zu repräsentieren wissen. Es ist leider nicht anders: der „gemeine Mann“ achtet das Achtungswerte nur dann, wenn es auch achtungswert erscheint. Wie an Stimme fehlt es da häufig auch an Haltung. Ich kannte einen Gerichtsbeamten, einen Mann in schon vorgerückten Jahren, der die Leute nicht gerade anzusehen vermochte: nur scheu und wie verstohlen hob sich der hyänenartige Blick bisweilen, um gleich wieder am en zu kriechen und der Mann hat mir kein einzig Mal offen ins Auge gesehen. Sein Inneres genau kennen zu lernen hatte ich keine Gelegenheit; sein Äußeres aber würde mir vorschweben, wenn ich eine vom bösen Gewissen geplagte Person zu schildern hätte. All die oben angegebenen Übelstände steigern sich bei jungen Beamten bisweilen noch durch das allzu jugendliche Äußere. Dieser Fehler vermindert sich freilich mit der Zeit von selbst, bevor es aber dahin kommt, macht es einen misslichen Eindruck, wenn ein blutjunger Mensch, in welchem der Gegenüberstehende eben nur den Knaben sehen kann, in ernsten Dingen einen gesetzten, vielleicht ergrauten Mann abzuhören hat; Indes weiß der gesetzte Mann den Umständen Rechnung zu tragen; wahrhaft nachteilig kann es aber wirken, wenn ein solcher Jüngling als richterlicher Beamter mit ungebildeten Personen zu tun hat, ihnen vielleicht gar den Eid abnimmt und sie mit einer eingebildeten persönlichen Wichtigkeit nicht in würdevollem sondern affektiertem und naseweisklingendem Tone an die ernste Bedeutung der Handlung erinnert. Von „Leuten aus dem Volke“ hab’ ich da öfters, wenn sie das Gerichtslokal verließen, kritische Bemerkungen gehört, die sehr ungehörig sein mochten, aber sie spiegelten treu den Eindruck wieder, den diese Leute empfangen hatten. —
Der Gerichtshof ermäßigte das erste Urteil, welches mir eine einjährige Gefängnisstrafe zugesprochen hatte, um zwei Monate. Wär’ ich hier aber auch dieser ganzen Strafe ledig geworden, so würde man mich ja doch nicht freigelassen haben und der ganze Vorgang konnte mir daher nicht anders als gleichgültig sein. Der Angeklagte „ist wieder nach Leipzig zu transportieren“, lauteten die Schlussworte des Vorsitzenden. Ich nahm dankend aber freilich etwas kühl Abschied vom Herrn Verteidiger, der ganz so ausgesehen hatte, als bedürfte er selber der Verteidigung, und trat den beabsichtigten Spaziergang an, der Indes durch einen rauen und heftigen Wind verleidet wurde.
Als ich am Abend wieder zu Leipzig in meiner Zelle eintraf, machte ich gegen den Schließer zufällig eine unbedeutende Bemerkung in Betreff des Dr. Franck.
Der Schließer (wir hatten deren mehrere, die übrigens nicht immer die nämlichen blieben), der Schließer blickte mich verwundert an: „Wissen Sie es denn nicht?“
„Was denn?“
„Franck ist ja gestern entsprungen.“
Der Mann wunderte sich, dass ich davon noch nichts wusste. Mir war nicht nur die Tatsache neu, ich hatte auch nicht das Geringste von Vorbereitungen zu dieser Flucht, ja nicht einmal von der Absicht gewusst, denn Franck und seine Vertrauten waren so vernünftig gewesen, für sich zu behalten, was andere nicht berührte. Franck war bei den in Sachsen vorgekommenen Bewegungen nicht beteiligt gewesen; er war Österreicher, hatte im vorhergehenden Jahre in Wien eine namhafte Rolle gespielt und er sah jetzt seiner Auslieferung an Österreich entgegen. Jedermann gönnte ihm von Herzen sein glückliches Entkommen und ich glaube, selbst das Gericht verschmerzte diese Entweichung noch leicht genug, da es in dem Entflohenen eigentlich nur einen in Verwahrung gehaltenen Fremden verlor. Die Häupter seiner eigenen Lieben konnte es dagegen noch zählen, ohne ein teures Haupt zu vermissen.
Unter den letzteren hoffte Indes noch manches auf gleiche Erlösung und nachdem ich die guten Gelegenheiten dazu, die ich mir selber verschafft, unklugerweise unbenutzt gelassen hatte, sah ich umso erwartungsvoller neuen Eröffnungen des Herrn Noack und einer Verwirklichung dessen entgegen, was mir das oben erwähnte Zettelchen verbeißen hatte.
_________
Man war endlich bereit, die Untersuchung zum Schlusse zu führen. Nachdem ich es im Sommer und Herbste fortwährend mit Verhören zu tun gehabt hatte, kam endlich im Winter eine Periode, wo ich fast täglich den vorgeladenen zahlreichen Zeugen vor- und beziehentlich gegenübergestellt wurde. Vorgestellt wurde man da häufig in der Weise, dass man selber gar nichts davon bemerkte (oder doch nichts davon bemerken sollte).
Das Alles war sehr peinlich und langweilig. Ich war damals in meiner Zelle mit einigen literarischen Arbeiten beschäftigt, die ich bald zu beendigen wünschte, und nun musst’ ich die beste Zeit des Tages müßig im Gerichtslokal zubringen, wohin man mich gewöhnlich morgens bei Zeiten rief, bevor noch die erwarteten Zeugen eingetroffen waren.
Man brauchte mich oft kaum fünf Minuten, manchmal auch gar nicht, aber ich musste unter müßigem Warten oft drei Stunden verlieren. Hier ließ man es sich jetzt auch ganz anders als früher angelegen sein, uns zu überwachen und diese Überwachung artete unter den Umständen oft in eine wahre Quälerei aus.
In einem Raume, der so klein war, dass man sich von Andern nicht wohl fern halten konnte, musste man mit mehreren Mitgefangenen und andern Personen oft mehr als eine Stunde warten und dabei wo möglich Niemand ansehen, geschweige denn Jemand grüßen oder gar anreden. Und es traf sich, zufällig oder nicht, dass hier meist ein unfreundlicher Gerichtsdiener als Beobachter aufgestellt war. Ging vielleicht ein (nicht gefangener) Bekannter grüßend vorüber, was in diesem Vorzimmer häufig geschah, so musste man sich hüten, den Gruß auch nur durch ein Kopfnicken zu erwidern, wenn man nicht riskieren wollte, sich in brutalem Tone eine Aufforderung zum Schweigen („Se han jar nischt zu reden!“) zu herrschen zu hören, denn ein Kopfnicken galt da schon für Sprechen.
Während der letzten Tage des Kampfes in Dresden war ich in Gesellschaft einer Anzahl anderer Leute von Leipzig aus dorthin gefahren und zwar nicht auf der Eisenbahn, sondern auf der über Grimma usw. führenden Straße. Einige jener Leute hatten es passend gefunden, diese Fahrt zu einer Art Agitationsreise zu machen, man hatte unterwegs da und dort eine Volksversammlung veranstaltet, die Bekanntmachungen der „provisorischen Regierung“ verteilt und zur Förderung der Interessen aufgemuntert, für die in Dresden gekämpft wurde. Meine Beteiligung an alldem beschränkte sich auf eine einzige Handlung: ich hatte eine kleine Volksversammlung, die man in Grimma veranstaltete, mit einigen Worten eröffnet. Nun kamen aber nicht nur alle in Grimma gehaltenen Reden, sondern überhaupt Alles, was in den von uns berührten andern Städtchen wirklich oder angeblich (und bei Weitem das Meiste war angeblich) geschehen, auf meine alleinige Rechnung, denn die fraglichen „Agitatoren“ waren längst geflüchtet und unerreichbar. Da waren nun Zeugen vorgeladen, nicht bloß aus Leipzig, sondern auch aus Liebertwolkwitz, Grimma, Colditz, Waldheim, Rossen und ich weiß nicht woher noch. Oft sah ich mich, wie gesagt, auch Leuten vorgestellt oder nur gezeigt, rücksichtlich deren ich nie erfuhr, woher und wer sie waren, wo sie mich und was sie von mir gesehen hatten oder haben sollten. Wenn derlei Erscheinungen so überreichlich und massenhaft kommen, wird man umso leichter müde auf all’ die kleinen und großen Unrichtigkeiten, die dabei unterlaufen, Gewicht zu legen und sie zu berichtigen zu suchen; man wird eben des Ganzen überdrüssig und lässt daher alle Einzelheiten passieren. Das heißt dann die Untersuchung erleichtern, während sie entschieden aufhört, auch nur diesen Namen zu verdienen. Vieles ist mir unter diesen Umständen zur Last gelegt worden, nicht nur was ich nicht begangen, nicht nur wovon ich gar nichts wusste, nein, auch Manches wovon ich bestimmt wusste, dass es überhaupt gar nicht begangen worden. Bei solchen Gegenüberstellungen von Zeugen (oder Mitangeklagten) lassen sich Studien machen, die anziehend aber zugleich auch niederschlagend sind: Schwäche, Dummheit, Niederträchtigkeit, Feigheit zeigen sich da als die herrschenden Eigenschaften der menschlichen Natur, unter denen Gutmütigkeit und Redlichkeit nur die Rolle der Aschenbrödel spielen dürfen. Nur durch solche Studien aber und dadurch, dass man die Personen, Seitens deren man einer Untersuchung unterworfen ist, selber einer zwar im Stillen geführten aber gründlichen Untersuchung unterwirft, mildert man das Langweilige und Unausstehliche des Zustandes. Was einfach hätte sein können, musste umständlich und verwickelt werden und das geschah zum Teil auch dadurch, dass man zu meinen Prozessgenossen Leute machte, mit denen ich bei den fraglichen Vorgängen schlechterdings nichts zu tun gehabt hatte und in keine Berührung gekommen war. Mein „Hochverratsprozess“ ward mir mehr und mehr, statt sich zu lichten und zu sichten, zum unerquicklichen Wirrwarr, zur chaotischen Masse, wo sich mit dem Meinigen ganz Fremdartiges mengte: mir war als blickt’ ich in einen Kasten, worin ein Liederlicher ganz verschiedenartige Dinge im schmutzigen Gemisch durcheinander geworfen hat und ich wandte mich voll Ekels ab, um fortan geschehen zu lassen, was da immer wollte.
Einem ähnlichen Eindrucke können die Untersuchungsrichter am Ende selbst nicht entgehen, das Bedürfnis einer Sichtung macht sich dringend fühlbar und man sucht diese in Untersuchungen, wo man den Inquisiten eines Kapitalverbrechens für hinreichend überführt erachtet, durch ein sogenanntes artikuliertes Verhör zu bewerkstelligen.
Auch mir kündigte man endlich an, dass die Untersuchung mit einem solchen geschlossen werden sollte. Das war denn eine Art Resümee des Ergebnisses der Untersuchung, indem alle für wesentlich geltenden und namentlich alle für entschieden ermittelt erachteten Punkte in die Form einzelner, möglichst kurz und bündig gefasster Fragen gebracht waren, welche der Inquisit ebenso bündig und womöglich nur mit Ja oder Nein beantworten sollte.
Ein artikuliertes Verhör kann allenfalls als Eselsbrücke dienen, um einen Leser der Mühe zu überheben, das Aktenlabyrinth genau zu durchwandern; es kann ebenso gebraucht werden, wie bequeme Rezensenten bisweilen die Inhaltsübersicht eines Buches benutzen.
Mir ist eine einzige von den vielen Fragen meines artikulierten Verhörs im Gedächtnis geblieben. Der Untersuchungsrichter las nämlich Frage so und so viel, welche lautete: „Sie sind politischer Schriftsteller?“
Auf diese Frage, die mir in jenem Augenblicke hinterlistig und verfänglich und keineswegs wie von einer redlichen Unparteilichkeit eingegeben vorkam, wollt’ ich weder mit Ja noch Nein, sondern mit einer Erörterung antworten.
„Ja, wenn man so fragt“ — begann ich im Tone des Unwillens. Aber der Untersuchungsrichter, der nicht mit einer feierlichen Gemessenheit, wie es bei einem solchen artikulierten Verhöre wohl hätte der Fall sein sollen, sondern mit einer ganz außerordentlichen Eile verfuhr; fasste die erste Silbe meiner Rede blitzschnell als gegebene Antwort auf ohne des Folgenden zu achten.
„Ja!“ wiederholte er, mir ins Wort fallend, indem er das vermeintliche Ja niederschrieb. Ich erhob sofort Einspruch dagegen, erklärte die übrigens selbstverständliche Bedeutung des von mir gesprochenen Ja und verlangte sofortige Berichtigung. Er konnte mir nicht leugnen, dass er sich übereilt und dass ich Recht hatte, meinte aber, es sei nicht passend, die Berichtigung gleich an der betreffenden Stelle anzubringen, sondern sie werde sich füglicher später nachtragen lassen. Ich gab mich damit zufrieden und die Berichtigung wurde nachträglich beigefügt. Wenn jene seltsame Frage einfach beantwortet werden sollte, so konnte dies nur mit Nein geschehen, denn mein schriftstellerisches Fach war die Belletristik, und der Umstand, dass ich in einem zeitweilig von mir redigierten Unterhaltungsblatte in einer Zeit, wie es die damalige (nämlich das Jahr 1848) war, Gegenstände der Politik nicht ausschloss oder dass ich vor Jahren ein publizistisches Büchlein geschrieben, konnte mich durchaus nicht zum politischen Schriftsteller machen. Man bezeichnete mich aber, der Wahrheit entgegen, ausdrücklich als solchen. Es scheint demnach, dass es damals gewissermaßen schon für ein Vergehen galt, „politischer Schriftsteller“ zu sein oder dass dieser Beruf wenigstens als Erschwerungsgrund bei andern Vergehen geltend gemacht werden konnte. Auch hat man später in den Entscheidungsgründen darauf Gewicht gelegt und dabei bemerkt, es sei von mir selber eingeräumt worden, dass ich politischer Schriftsteller sei; zwar habe ich diese Angabe geändert, jedoch erst nachträglich und daher sei kein Gewicht auf die Änderung zu legen. Und doch hätte man sich, da ja die Tätigkeit eines Schriftstellers eine öffentliche ist, so leicht überzeugen können, dass ich allezeit vorherrschend belletristisch und nur ausnahmsweise publizistisch tätig gewesen war! Dies eine Beispiel möge genügen. Dass ich aber völlig gerechtfertigt war, wenn ich unter solchen Umständen auf Flucht dachte, werden auch diejenigen zugeben, die einem Gefangenen dieses natürliche Recht sonst nicht unbedingt zugestehen. —
Ich räsonierte damals in folgender Weise:
„Ein Hochverratsprozess solcher Art ist ein Unglück nicht bloß für die davon betroffenen Einzelnen, er ist namentlich ein Unglück für das Land und zwar hauptsächlich aus dem Grunde, weil das Ansehen der Gerichte, die dadurch in eine schiefe Stellung geraten, notwendigerweise darunter leidet. Alles, das Ganze wie das Einzelne, die Richter wie die Angeklagten, befinden sich dabei in einem Ausnahmeverhältnisse und daher scheint mir‘s, soll ein so leidiger Prozess einmal stattfinden, geradezu wünschenswert, dass man gleich auch ein Ausnahmegericht dafür einsetzte. Schlechter würden sich die Angeklagten deshalb nicht befinden, für das öffentliche Wohl aber wäre dadurch außerordentlich gewonnen: es wäre der Wahrheit die Ehre gegeben und das Ansehen der ordentlichen Gerichte brauchte nicht gefährdet zu werden, was unausbleiblich geschieht, wenn die öffentliche Stimme (gleichviel, ob sie sich laut oder nur leise vernehmen lassen darf) ganz anderes Urteil spricht, als diese Gerichte.
Ein Gericht zieht niemals Personen wegen ihrer Handlungen bei Gelegenheit und zum Besten einer siegreichen revolutionären Bewegung zur Verantwortung. Ist aber durch diese Tatsache nicht das Gericht, wenn es Personen wegen der nämlichen Handlungen bei Gelegenheit einer nicht siegreichen revolutionären Bewegung verfolgt, ist durch diese einfache Tatsache nicht das Gericht selbst alsdann entschieden gerichtet? Es ist dadurch ad absurdum geführt, und darum ist beklagenswert, wenn es Bestimmungen des Gesetzbuchs, welche Verbrechen, wie Verschwörung, Aufruhr, Hochverrat betreffen, auf Volkserhebungen und Revolutionen anwenden will, die mit jenen Verbrechen inkommensurabel sind und auf welche daher vernünftiger- und gerechterweise die erwähnten Bestimmungen gar keine Anwendung finden können. Das sollte man im Namen der öffentlichen Moral begreifen. Dieseleiden zu sehen, schmerzt den Gebildeten ungleich tiefer, als das ihn persönlich treffende Unglück.
Unter Revolution verstehe ich nicht ein Werk der Willkür, sondern ein naturgemäßes Ereignis; ich nenne „Revolutionen“ alle in organischer Verknüpfung stehenden Entwickelungsphasen der Völker (und der Menschheit). Einen gewaltsamen Umsturz, der nur das willkürliche Werk Einzelner, nicht aber ein gleichsam naturwüchsiges Ereignis ist, nenne ich nicht Revolution.
Nicht nur in der Sprache des gemeinen Lebens, sondern auch in Schriften findet man freilich oft das Wort Revolution (von dessen Etymologie abzusehen ist) gemissbraucht und als gleichbedeutend mit Verschwörung und Aufruhr genommen. Diese Verwechselung ist umso mehr zu rügen, wenn sie geflissentlich gemacht wird und nicht bloß auf Sprachliederlichkeit beruht. Verschwörungen, mit dem was sie etwa in ihrem Gefolge haben, sind Unternehmungen Einzelner, willkürliche und absichtliche Handlungen; Revolutionen dagegen sind gleichsam vom Hauche Gottes angeregte Erscheinungen und daher für die einzelnen Menschen, die dabei nur Werkzeuge des Geistes der die Gesamtheit beseelt, etwas Unwillkürliches. Diese, die Revolutionen, kommen daher nie nach dem Belieben einer mehr oder minder großen Anzahl von Individuen, sie kommen wie der Sturm, dessen Brausen man hört, ohne dass man weiß, von wannen und wohin er fährt. Verschwörungen und willkürlich durch Einzelne erregte Aufstände hingegen sind, im Gegensatze zum Gotteswerke der Revolutionen, bloß Menschenwert; sie haben nie den beabsichtigten Erfolg, während die Revolutionen (auch wenn sie momentan zu misslingen scheinen) stets ihren Zweck vollkommen erreichen, denn sie sind Ratschluss Gottes. Eine Gesetzgebung, die unter dem Einflusse der Parteisucht, der Augendienerei und des Unverstandes tätig ist, vernachlässigt diesen Unterschied und dann darf sich der alte Fall von den Schiffern, die den Sturmvogel töten, in schlimmerer Weise wiederholen: nicht genug, dass die Parteiangst die Sturmvögel vor dem gleichwohl unabwendbaren Sturme tötet, die Parteirache tötet sie auch noch nach dem Sturme.
Alldem würde nicht so sein können, wo Staat und Gesellschaft identisch wären. Dass jedes Gemeinwesen ohne diese Identität ein Unding ist, beginnt man in unsern Tagen wohl mehr und mehr einzusehen, aber in der Wirklichkeit stehen einander beide, Staat und Gesellschaft, noch schroff als Gegensätze gegenüber. Staat nennt sich da die Gesamtheit Alles dessen, was unmittelbar im Dienste der herrschenden Macht steht, namentlich das Bürokratenheer und Alles was Schergendienst tut, aber die Masse der Gesellschaft oder das Volk ist da nur wie ein Stoff, den der „Staat“ bearbeitet und ausnützt. Während es nur ein einiges. Ganze geben und jeder Einzelne ein Glied dieses Ganzen sein sollte, gibt es da nur den leidigen Zwiespalt zwischen zwei ganz verschiedenen Welten, derjenigen des Volkes und der Beamtenwelt. Während im wahren Staate ein jeder, der eine nützliche Hand regt, Staatsdiener sein würde, ist im falschen, d. h. in dem nicht mit der Gesellschaft identischen Staate, zwar wohl jeder Büttel, keineswegs aber der einflussreiche Gewerbetreibende, nicht der Großhändler, nicht der Mann der Wissenschaft oder Kunst, geschweige denn der schlichte Arbeiter ein Staatsdiener.
Eben deshalb verstehen auch diejenigen Regierenden, welche nicht an einen lebendigen Staatsorganismus glauben (sie kennen nur eine Staatsmaschine), wenn sie vom gegenwärtigen Zeitalter als einem revolutionären sprechen, unter Revolutionen ganz einseitig nur all’ diejenigen einzelnen Erscheinungen (bloße Pöbeltumulte nicht ausgenommen), durch die sie sich selbst in ihrer dem Volke oder der Gesellschaft gegenüber isolierten Existenz gefährdet sehen.
Sie haben keine Ahnung davon oder sträuben sich es anzuerkennen, dass Revolutionen gleichsam die tieferen Atemzüge der Menschheit während ihres Entwickelungsganges find. Daher die Begriffs- und Sprachverwirrung. Das Zeitalter ist allerdings revolutionär und es kann nicht anders, weil es sich nach einem Zustande der Ordnung sehnt. Alle Fürsten aber, deren Regierungen, deren Staatswesen nicht identisch sind mit der Gesamtheit, mit der Gesellschaft, sind im Stande der Rebellion gegenüber der Ordnung.
Die Staatsstreiche zählen wir nicht (ebenso wenig wie einen willkürlich erregten Pöbelaufruhr) unter die Revolutionen; sie sind bloß willkürliche Handlungen Einzelner, d. h. Verschwörungen und Gewalttaten wider die Ordnung, deren Gelingen nur ein scheinbares, jedenfalls nur ein zeitweiliges ist. Es ist ein Auflehnen gegen die Ordnung, wenn man, sei es plötzlich oder nach und nach, an die Stelle des organischen Gemeinwesens, das sich nur naturgemäß aus sich selbst entwickeln kann, einen Beamten-, Polizei- oder Militärmechanismus setzt. Das heißt den Baum mit Schmarotzergewächsen umgarnen, die ihn auf die Dauer zu Grunde richten können; bei einem gesunden und kräftigen Volksbaum kommt es aber dahin nicht: er weiß sich über lang oder kurz stets mittels der Revolution der Rebellen wider die Gottesordnung zu entledigen.
„Revolutionen werden nicht zum Vorteil des Volks gemacht“ — so heult es nicht bloß augendienerisch von hundert Kanzeln, nein, es sind sogar die eigenen Worte eines Professors der Geschichte und Staatswissenschaft. Als ob Revolutionen überhaupt je gemacht werden könnten! (Und wenn man sich auf den Standpunkt desjenigen stellt, der jener Bemerkung fähig ist, d. h. wenn man Revolution schlechthin als gleichbedeutend mit willkürlich versuchtem Umsturz nimmt, warum gedenkt man dann nicht zugleich der Fürstenkriege oder auch nur der Luftlager usw.? Diese werden allerdings gemacht, aber etwa zum Vorteil des Volkes?) Wenn man ein Land, wo der Despotismus mit seinem ganzen Gefolge Jahrhunderte hindurch ungestört geblieben, z. B. Spanien, mit einem solchen vergleicht, das durch Revolutionen erschüttert und gereinigt worden, z. B. England, so erkennt man die eigentliche Bedeutung der Revolutionen für die Völker. Auch die Reformation war ein Stück der großen Revolution, an welcher die Menschheit unter der höchsten Leitung noch heute arbeitet und fort und fort arbeiten wird. Rebellionen und Konspirationen sind allerdings nicht für die Völker, denn sie arbeiten stets nur dem Despotismus in die Hand. Aber „Revolutionen werden nicht fürs Volk gemacht“ können nur Jene sagen, welche die großen geschichtlichen Vorgänge nicht anders zu betrachten wissen, als etwa Unternehmungen industrieller Spekulation und nach deren Abschluss für jeden Teilnehmer seinen Gewinnanteil sofort und bar ausgezahlt verlangen. Wer in Gottes Weinberge arbeitet, findet seinen wahren Lohn schon in der Arbeit selbst und in dem Bewusstsein, dass er das Rechte tut. Jene Verstandeslosen würden auch eigentliche Naturstürme, Erdbeben und Gewitter, sobald sie ihnen unbequem, verdammen, wenn sie sie den sogenannten Revolutionären oder auch dem Pöbel und „unbesonnenen jungen Leuten“ in die Schuhe schieben könnten; sie sind aber gehalten zuzugeben, dass diese Dinge unmittelbar aus Gottes Hand kommen und Gott, der allein Große, ist nun freilich jugendlich poetisch und voll reifer Weisheit zugleich; seine Weisheit erkennen Indes die altklugen Ruhefaseler nur deshalb an, weil sie seine Allmacht nicht leugnen können und wer die Macht besitzt, der hat in ihren Augen allemal auch Weisheit. Hätt’ er nicht die unbestrittene Allmacht, so wären sie fähig, auch den Allweisen Geist des Weltalls unter die Schwindelköpfe zu zählen, unter die „Schwärmgeister“, wie man zu Luthers Zeit sagte. Die Menschen urteilen nun einmal gern nach dem Augenfälligen; sie erschrecken mehr beim Anblick eines Kornfeldes, das der Hagel platt geschlagen, als beim Anblick der Fluren einer ganzen Provinz, die durch lange Dürre oder Nässe zu Grunde gerichtet sind; sie tadeln einen Feldherrn, der in einem kurzen Feldzuge zum Ziele kam, weil er tausend Mann in einem energischen Gefechte opferte, und sie loben dagegen den Zauderer, der kein Gefecht wagte, aber inzwischen 10,000 Mann durch Seuchen verlor. Der Zustand der faulen Ruhe, welcher fälschlich auch wohl Ordnung genannt wird, ist eine solche Seuche.
Danach gäbe es denn eigentlich nur zwei Revolutionäre: Gott — Gott in der Geschichte — und den Volksgeist, oder streng genommen nur einen, Gott, der den Volksgeist lenkt.
Revolutionen gelingen daher stets, Konspirationen nie, wenn dem auch bei ersteren momentane Niederlagen, bei letzteren momentane Triumphe zu widersprechen scheinen.
Fasst man den Gang der Geschichte vom höheren (nämlich vom religiös-philosophischen, dem allein wahren) Standpunkte auf, so kennt dieselbe gar keine fehlgeschlagenen Unternehmungen. Nur schlechte oder übelverstandene Absichten werden vereitelt, die Tat aber schlägt zum Guten aus, auch wenn das Gegenteil erstrebt ward. Wenn eine Sache, nachdem sie (scheinbar!) zehnmal misslungen, endlich dem elften Unternehmer gelingt, so darf dieser seine zehn Vorgänger nicht für Stümper halten (sie waren vielleicht oft sogar klüger und tüchtiger als er), denn er ist nicht der alleinige Vollbringer, er vollendete nur das von jenen begonnene und fortgesetzte Werk. Das soll man erwägen, wenn irgendwo etwas Gutes und Großes vollbracht wird: man gedenke dann, nicht geringschätzig, sondern mit gebührender Pietät und Dankbarkeit Derer, die dort und da scheinbar vergeblich gerungen haben, scheinbar vergeblich verblutet und verkommen sind. Nach dem augenblicklichen und scheinbaren Erfolge das Verdienst des Mannes und seiner Handlung beurteilen, ist ebenso dumm als pöbelhaft. Die Sieger bei Leipzig hätten nicht siegen können, wenn Schill und Andre, die man ihrer Zeit Tollköpfe schallt, nicht vorher gekämpft hätten. Wird also nach langem vermeintlich fruchtlosem Ringen endlich eine entscheidende Schlacht gewonnen, so soll man nicht die darin Gefallenen allein die gefallenen Sieger nennen, sondern auch alle die dazu rechnen, die in all den vorhergegangenen unentscheidenden oder „verlorenen“ Schlachten gefallen sind, d. h. man soll den ganzen Kampf (mag er auch Jahre, ja Jahrhunderte lang dauern) als einen zu betrachten wissen. Ob ein Kämpfer eine Minute, einen Tag oder ein Jahr vor der siegreichen Entscheidung streitet, macht für sein Verdienst keinen Unterschied. Dem ruhmlos Gefallenen, der keinen Erfolg sah, mag es an seinem Bewusstsein genügen; Ihr aber habt die Pflicht der Pietät gegen ihn zu erfüllen. Jeder Verstoß gegen diese ist schon wahre Lästerung des Heiligen Geistes, um wie viel mehr aber ist solche Lästerung das Gebaren derjenigen, die sich nicht scheuen, gleichviel ob aus Augendienerei, auf Kommando oder nur des Stück Brotes willen, die reinsten Bestrebungen, die Handlungen zu denen ein warmer Patriotismus trieb, als Verbrechen zu bezeichnen, um auf solche Weise das Verbrechen selbst zu beschönigen und zu verfechten! — Aber
„Gesichert ist jeglich Los
Nach Gottes vollkommenem Plan:
Misslingen ist bloß
Ein Pöbelwahn.“
In dem angedeuteten Sinne kann man an gescheiterte Unternehmungen nur glauben, wenn man allzu kurze Zeiträume der Geschichte im Auge hat und daher eine Phase des Ereignisses für das ganze Ereignis nimmt, wie wenn man nur die Mondsichel ansehen und sagen wollte: es ist dem Monde nicht gelungen sich zur Scheibe zu runden. Man betrachtet gern nur, was einzelne Menschen tun, die freilich kurzlebig und bald erschöpft sind, und erwägt nicht, dass das größere Wesen, das Volk — die Menschheit — fortlebt, fortwirkt und seiner Ziele vollkommen sicher ist.
Nur der Kurzsichtige oder der auf schnellen Gewinn zählende Krämergeist spricht von fehlgeschlagenen Unternehmungen auch in Betreff geschichtlicher Vorgänge, weil er bloß einzelne Ereignisse sieht und nicht bemerken kann, wie sich in organischer Folge alles zur lebendigen Kette schlingt, darin kein Glied fehlen darf und keins überflüssig ist. Schweren Tadel aber verdient es, wenn Gebildete und Denkende, die denn doch über den nächsten Augenblick hinaussehen sollten, angesichts einer scheinbaren Erfolglosigkeit ermatten und des Wirkens überdrüssig werden.
Für solche ist das Leben und der Kampf der Menschheit freilich nur Danaidenmühe. Für die frischen und mutigen Geister aber ist ein Fortschreiten der Menschheit nur sofern denkbar, als sich die Probleme steigern und die Lösung immer schwieriger wird. Der Philister, der sich Ehren und Schande halber vor dem faulen Stillstand bekreuzt (der doch sein Herzensideal), versteht unter Fortschreiten ein Gemütliches Abwickeln des Knäuels, eine Beseitigung, nicht Lösung, der Schwierigkeiten und hofft fort und fort nur, einen festen Boden der Ruhe zu gewinnen, wo er sagen könne: wir sind ein für alle Mal fertig. Daher denn solche Äußerungen wie etwa: „Wenn sich die Zustände geordnet, abgeklärt haben werden“ — damit sie dann ungestört auf dem faulen Stuhle sitzen können! Als ob Leben ohne unausgesetzte Bewegung denkbar wäre!
Wohlverstanden aber, es gelingt nur, was im Sinne der Gesamtheit unternommen wird. Wer sich von der Gesamtheit sondert, geht irre. So sind auch nur die Regierungen, die mit der Gesamtheit organisch eins sind, stark und dauernd; unsicher in ihrem Bestehen und zu fortwährenden Missgriffen verurteilt sind hingegen die andern, die gesondert außerhalb der Gesamtheit stehen; sie können deshalb nicht anders als desultorisch sein und stetig an ihnen ist bloß blinde Angst und blinde Selbstgefälligkeit, beides abwechselnd oder beisammen.
Was dem Einzelnen in Bezug aufs Ganze gelingt, ist nie sein alleiniges Werk, er ist dabei vielmehr nur Werkzeug des Ganzen. Sieht man einzelne Männer, z. B. Luther gegen das Papsttum, Thomasius gegen die Hexenverfolgung siegreich, so sind sie so zu sagen nur die Repräsentanten der siegenden Gesamtheit, denn sie sind nur gegen das siegreich, was sich bereits überlebt hatte und im Geiste der Gesamtheit schon gerichtet war, so dass es nur noch einer Berührung mit dem Finger bedurfte, um zu stürzen. Vor dem Stürmenden fallen da nur die schon untergrabenen Festen, die bald von selber in Trümmer gefallen sein würden. Wer aber noch im Schwang Gehendes angreift, wo der Geist des Volkes oder der Menschheit nicht die allezeit nötige Vorarbeit getan hat, wird einen vergeblichen Versuch machen und meist als Opfer fallen. Danach ist das Verdienst einzelner Männer zu bemessen, solcher wie der genannten oder wie z. B. eines Washington! Sie fügen den Schlussstein in die Wölbung, sie setzen dem Ganzen die Krone auf, vollenden das Haus, halten bisweilen auch wohl nur die Einweihungsrede. Sie vollendeten, aber schufen nicht ein ganz Neues. Alles war schon vorhanden. Man weiß, dass Werke des Menschengeistes, philosophische Systeme, auch dichterische Werke ersten Ranges (wie Hamlet, Faust) nicht wie eine Minerva aus des Meisters Haupte sprangen, sondern seit Jahrhunderten wuchsen und sich mehr und mehr entwickelten, bis eine auserwählte Menschenhand, der es gegeben (denn freilich ist es nicht jeder ersten Besten gegeben), sie gleichsam als reife Früchte brechen konnte. Die Geschichte aber, oder besser gesagt der Volksgeist knüpft auch allgemeine Erscheinungen immer gern an einzelne Namen (so z. B. das Christentum an den Namen Jesus); dies aus dem Grunde, weil er gern symbolisiert und gern versinnlicht. Aber die Einzelnen machen die Erscheinungen nicht, ihr Verdienst ist allein, dass sie die von der Gesamtheit gezogene und gezeitigte Frucht zu brechen verstehen. Die eigentlich Selbständigen aber, d. h. diejenigen, die nicht auf der gemeinsamen Grundlage stehen mögen und die eine von ihnen selbst willkürlich gezogene, nicht die vom ganzen Zeitalter gemeinsam gezeitigte Frucht pflücken wollen, scheitern stets, gelten für Sonderlinge, auch wohl für Verbrecher oder tragische Helden und schaffen nie Dauerndes. Kein einzelner Mensch ist wahrhaft mächtig, außer insofern er als Vertreter der Gesamt-, der Volksmacht handelt. Die Souveränität des Volkes ist daher nicht nur etwas Reelles, sondern das allein Reelle; die des Einzelnen aber (er müsste denn ein Robinson sein) ist Chimäre, Täuschung. Jeder muss dem Strome folgen; versucht er das Gegenteil, so geht er unter.
Nichtig und eitel ist eben Alles, was sich vom Organismus des Ganzen trennt; das Einzelne ist nur vollkommen indem es ein Glied des Ganzen. In diesem Sinne sollte die Geschichte der Menschheit aufgefasst und dargestellt werden. Man hat alsdann die ganze Menschheit in all ihren Zeiten, Generationen und Individuen als ein mit dem Weltganzen in harmonisch-organischer Beziehung stehendes, auch für sich organisch Ganzes zu behandeln, so dass man z. B. die spätesten Nachkommen von den frühesten Vorfahren nicht als schlechterdings getrennt betrachten darf, sie sind vielmehr wie gemeinschaftlich handelnd und also die frühesten Menschen als noch lebend, die spätesten aber — im Geiste des Historikers, wie sie es im Geiste Gottes wirklich sind — als schon lebend, kurz, das Ganze als eine lichte Handlung in einer Gegenwart aufzufassen und darzustellen. Ohne solche Rücksicht auf einen allgemeinen Zusammenhang ist die Geschichte bloß eine Anekdotensammlung.
Ebendeshalb haftet die Menschheit aber auch in historischer Beziehung nicht nur für Alles was durch sie geschehen ist, sondern auch für Alles was noch durch sie geschieht, solidarisch, d. h. die Vollbringer des Heutigen sind nicht wir allein, sondern nach Verhältnis (und daher oft mehr als wir) alle früheren Jahrhunderte. (Wir können nicht beliebig das Werk liegen lassen und ein neues beginnen, wir müssen fortsetzen.) Versuche man doch nun, allen Zeitaltern ihren genau ermittelten Anteil an dem, was wir nach menschlicher Weise Verdienst oder Schuld nennen, zuzuweisen!
Nur in Bezug aufs Weltganze, das auf strenger Gerechtigkeit beruht, ist jenes so oft gehörte Wort, „die Weltgeschichte ist das Weltgericht,“ mehr als eine klingende Phrase, denn eine solche ist es, wenn es auf unser praktisches Leben und auf die Geschichte, soweit wir sie übersehen, angewendet wird und wenn man dabei etwa an das Urteil der Nachwelt denkt. Unser Stückwerk von Geschichte, wo selbst unlängst Vergangenes oft in undurchdringliches Dunkel gehüllt bleibt und wo jeder Einzelne, anstatt das Geschehene wirklich als ein Objekt zu erforschen, sich dasselbe vielmehr subjektiv und sehr willkürlich konstruiert, kann nicht gerecht richten. Die Historiker oder überhaupt die Menschen haben nur das Streben, zur Gerechtigkeit zu verhelfen, suchen daher das Dunkel zu lichten und liefern Apologien und Entlarvungen, wenn sie so glücklich sind, den Stoff dazu aufzufinden, aber jedenfalls ist, was sie liefern, immer wieder ein zweifelhaftes, der Berichtigung harrendes Werk. Daher ist allein das Gewissen des Menschen das wahre Weltgericht, sofern es Individuen zu richten gilt. Die Menschheit als Ganzes aber kann nicht durchs Gewissen richten, sondern richtet durch den Erfolg, indem sie das Nichtige erfolglos lässt und das Rechte unwiderstehlich zum Ziele führt. In dieser Weise richtet sich eigentlich (auch abgesehen vom Gewissen) jede Tat sofort durch sich selbst, aber nicht durch ihren äußerlich erscheinenden Erfolg, nach welchem der Pöbel sie zu beurteilen pflegt. (Wie man ihn Indes auch verstehen mag: annehmbar bleibt Schillers Vers jedenfalls schon deshalb, weil er das Gericht in die wirkliche Welt verlegt, während es die Herren Sünder zu ihrer größeren Bequemlichkeit gern in eine rein fingierte verlegen möchten.)
Man pflegt die neue Zeit, nämlich unser Jahrhundert oder auch schon die drei letzten Jahrhunderte, das revolutionäre Zeitalter zu nennen. Genau genommen ist die ganze Geschichte der Menschheit, seit den Urzeiten, fortwährend revolutionär; unserm Blicke erscheint Indes die neuere Zeit vorzugsweise so, und so mag die Bezeichnung immerhin gelten, die, sobald wir uns einmal über den Unterschied (den Gegensatz!) zwischen Revolution und Unordnung verständigt haben, ein Ehrenname unserer Zeit ist. Die Menschheit ringt seit einigen Jahrhunderten auffälliger und sichtlicher nach der Ordnung; aber die Feinde der Ordnung, die sich ihr nicht fügen mögen, die in Eitelkeit sich zu überheben und zu sondern suchen (nach Art des „Teufels“, durch den man das Streben, sich vom Weltganzen, von Gott, zu sondern, versinnlicht hat), diese Feinde der Ordnung (gleichsam die Teufel der Politik) möchten den Namen des „revolutionären Zeitalters“ gern zu einem Schimpfwort machen. Es gehört große Keckheit oder seltsame Verblendung dazu, über Bestrebungen, wie die Geschichte sie namentlich seit drei bis vier Jahrhunderten in so steter Folge zeigt, in einem Tone absprechen und richten zu wollen, als handelte es sich etwa um Übertretung polizeilicher Vorschriften. Die bloß Verblendeten würden nur Mitleid verdienen; aber welcher Name könnte Jene treffend bezeichnen, die trotz besserer Überzeugung den Befreiungskampf der Menschheit lästern, nur um sich selbst sogenannte Vorteile zu sichern; die in den Augen des Ehrenmannes Nachteile und Schande sind! Dem Kurzsichtigen und Übelbelehrten könnte man ein engherziges Urteil allenfalls dem einzelnen Ereignisse gegenüber verzeihen, dessen Ursachen und Folgen er nicht zu erkennen vermag; aber ein großes, mehr als dreihundertjähriges, so organisch gegliedertes, so konsequentes geschichtliches Drama in seiner Bedeutung zu verkennen, ist unverzeihlich. Sie wollen da nach dem Erfolge richten, sie deren Leben siebzig oder achtzig Jahre währt, als ob sie den wahren Erfolg gesehen hätten! Sie verwechseln ihr armes individuelles Vermögen mit dem der Menschheit, vor welcher tausend Jahre sind wie ein Tag (denn vor Gott ist alle Zeit wie ein Moment).“
Das waren die Betrachtungen des Gefangenen.
Die Untersuchung war also geschlossen. Die Quälerei der Verhöre und Konfrontationen war vorüber. Jetzt wurde mir das Zeitungslesen auch wieder förmlich gestattet und das war, obwohl ich schon längst keinen Mangel an Zeitungen gehabt hatte, doch nicht ganz gleichgültig, denn man wird des fortwährenden Heimlichtuns umso eher überdrüssig, je weniger Neigung man von Haus aus dazu hat. Schlimm genug, wenn man sich notgedrungen dazu entschließen muss.
Man ließ mich jetzt auch (nicht in der Zelle sondern im Gerichtslokale) die Arten lesen. Es war gestattet, Notizen danach zu machen, jedoch nur mit Bleistift. Ich machte indes von dieser Befugnis gar keinen Gebrauch, begnügte mich, die Sachen durchzublättern und las nur dasjenige, was mir neu war; damit hatte ich auch vollauf zu tun, denn die Akten „O. und Genossen“ enthielten an Namen und Sachen, an schriftlichen und gedruckten Beilagen sehr Vieles, was mir noch völlig unbekannt war. Dieses Aktenlesen, das sich in die Länge zog, weil sich nicht täglich Zeit und Gelegenheit dazu fand, beschäftigte mich im Januar und Februar 1850.
Inzwischen war ich auch dem Gerichtsdiener Noack bisweilen begegnet und hatte bald die Überzeugung gewonnen, dass er es mit seinem Antrage ernstlich meinte. Ich zweifelte daran umso weniger, als ich fand dass ihn dabei, wenigstens zum Teil, eigennützige Absichten leiteten. Die Flucht sollte also unter seiner Mithilfe stattfinden, es war beschlossene Sache. Zur Ausführung sollte es im Februar kommen. Eine besondere Selbsttätigkeit war meinerseits nicht erforderlich: mein „Retter“ wusste Alles genauer als ich, für Alles war, wie er mir sagte, bereits gesorgt und ich brauchte nur einfach mitzugehen, wenn mir zur bestimmten Zeit die Tür geöffnet werden würde.
Dass im Februar unsere kleinen Versammlungen auf dem Vorsaal noch um Vieles wichtiger als früher für mich wurden, versteht sich von selbst. An meinem Nachbar bemerkte ich eine fieberhafte Ungeduld und er wunderte sich seinerseits über meine gelassene Ruhe.
Indes finden sich mehr noch als bei allen andern gerade bei derartigen Unternehmungen oft noch kleine Hindernisse, die beseitigt, einzelne Umstände, die abgewartet sein wollen, und so verzögerte sich Noacks Werk (ob er Anderer Werkzeug war, brauchte mich nicht zu kümmern, während ich es unmittelbar mit ihm allein zu tun hatte; Indes bedarf es kaum der Erwähnung , dass mir in jener Zeit noch manches Zettelchen von andrer Seite in die Hand glitt, welches mich über meine Angelegenheiten belehren sollte,) Noacks Werk, sag’ ich, verzögerte sich noch manchen Tag. Endlich aber bezeichnete er mir Tag und Stunde genau. Wenn ich nicht irre war es der 24. Februar, wo die Befreiung stattfinden sollte.
Sechs Uhr abends erschien als der geeignetste Zeitpunkt. Um diese Zeit, d. h. kurz bevor sich die Beamten zu entfernen pflegten, fanden sich oft noch Besuchende im Gerichtslokal ein, um mit Gefangenen zu sprechen, die dann aus ihren Zellen herab geholt wurden. Den Gerichtsdienern wurde damals im Stockhause jeder Gefangene, den sie verlangten, ohne irgend eine Förmlichkeit übergeben; waren der Stockmeister oder dessen Untergebene anderweit beschäftigt, so gaben sie dem betreffenden Gerichtsdiener auch wohl den Schlüssel, damit er sich den verlangten Gefangenen selber aus der Zelle holen konnte. In Bezug auf mich war jetzt ein zwiefaches Verfahren möglich: entweder holte mich Noack unter dem Vorwande, dass mich ein Gerichtsbeamter verlangte, um sechs Uhr aus der Zelle und ging mit mir, anstatt ins Gerichtslokal, ins Weite; oder ich befand mich um die angegebene Zeit im Gerichtslokale und er nahm mich von da aus mit hinweg unter dem Vorwande, mich in meine Zelle zurückzuführen. Letzteres erschien als das Passendste, da ich mit der Aktendurchsicht noch nicht ganz zu Ende war und mich daher bis sechs Uhr im Gerichtslokal aufhalten konnte. Von da aus sollte ich also fortgebracht werden oder „die nordwestliche Durchfahrt“ auffinden, wie man das Wort Flucht im Beisein Uneingeweihter auch wohl zu umschreiben pflegte. Es war Indes stets mehr als ein diensttuender Gerichtsdiener anwesend, es konnte sich treffen, dass Noack um sechs Uhr gerade anderweit beschäftigt war und mich inzwischen einer seiner Kollegen wirklich in die Zelle zurückbrachte. Für diesen Fall war verabredet, dass mich Noack alsdann in der angegebenen Weise wieder aus der Zelle holen sollte, was gar nichts Auffälliges haben konnte, denn man wurde nicht selten, besonders um die genannte Stunde, wiederholt gerufen.
Zwischen fünf und sechs Uhr an dem verabredeten Tage las ich Akten, natürlich mit wenig Andacht. Auch ich war begreiflicherweise jetzt höchst ungeduldig und ein solcher Zustand ist umso peinlicher, je mehr man sich außen ruhig und gleichmütig zu zeigen hat. Die Minuten bis sechs Uhr schlichen entsetzlich träge und ich saß auf Kohlen. Ich las gar nicht mehr, aber ich musste aufs Blatt blicken und zum Schein auch dann und wann eins umwenden. Endlich kam der so heiß ersehnte Augenblick und das Unglück wollte, dass Noack noch einen andern Auftrag erhielt. Ich hoffte, mich bis zu seiner Rückkehr bei meinen Arten aufhalten zu können. Aber es schlug sechs Uhr, man forderte mich auf, Feierabend zu machen und mich nach meiner Zelle zu verfügen. Das war unangenehm, aber es war deshalb nichts verloren; die Sache ward dadurch nur ein klein wenig umständlicher.
Nicht lange befand ich mich in meiner Zelle, als ich auf dem Saale Jemand kommen höre. Schlüssel klappern. Ich stehe bereit. Ich höre meines Nachbars Bertling Tür aufschließen, ich höre, wie man dessen Zelle verlässt und wieder schließt und wie sich die Tritte zweier Personen entfernen, bis Alles still wird. Jetzt ahnt mir Unheil, doch mag ich nicht sogleich daran glauben. Ich harre noch eine Sekunde, eine Minute nach der andern, bis ich zu der traurigen Überzeugung komme, dass man mich im Stich gelassen hat. Ich habe dem armen Teufel deshalb keinen Groll nachgetragen, denn sein Benehmen war, obwohl nicht löblich, doch natürlich genug. Es mochte ihm im Augenblicke der Ausführung zu gewagt erschienen sein, gleich zwei auf einmal, aus ihren Zellen zu holen und mit hinweg zunehmen; mit bloß einem schien ihm die Sache leichter und sicherer und da er somit zu wählen hatte, wählte er von den beiden natürlich den, der ein bemittelter Mann und von dessen Seite ihm daher eine pekuniäre Belohnung gesichert war.
Immerhin aber verbrachte ich den Abend in sehr unbehaglicher Stimmung, obwohl ich mich übrigens so leicht wie immer in das Unabänderliche fügte. Sonst würde ich jetzt Anlass gehabt haben, bitter zu bereuen, dass ich nicht meinen ersten und eigenen Plan festgehalten und die Fahrt nach Dresden zum Entweichen benutzt hatte. Seitdem aber beschäftigte ich mich eine lange Zeit hindurch nicht mehr mit Fluchtgedanken, obwohl man mir solche zutraute und mich ziemlich scharf zu überwachen suchte, was früher, wo ich flüchten wollte, nicht geschehen war.
Während des Abends und der Nacht irrte mich noch einige Mal ein Geräusch, es war als bewegte sich etwas in der Nachbarzelle — war der Nachbar noch anwesend? war die Sache plötzlich verschoben worden? Aber es war Täuschung; und ein ganz eigentümliches Gefühl war’s, diese leere Zelle neben mir zu wissen, die ich so genau kannte und in der ich mich während dieser Nacht so zu sagen mehr als in meiner eigenen befand, wie ein Gespenst auf der Stätte weilend, die von allen Lebendigen verlassen ist.
Des Morgens nach sechs Uhr (im Februar also noch vor Tagesanbruch) pflegte uns, wie schon erwähnt, ein Schließer das Frühstück zu bringen und unsere Wasserkrüge frisch zu füllen. Wir kamen bei dieser Gelegenheit gewöhnlich aus unsern Zellen, um einige Worte zu wechseln Ich hörte ihn nebenan schließen, ich konnte mir seine Überraschung vorstellen, denn ich wusste ja, dass der Tee, den Bertling des Morgens zu trinken pflegte, diesmal vergebens gekocht war. Nun öffnete er auch meine Zelle. Der arme Bursche war über die gemachte Entdeckung offenbar gewaltig erschrocken, er war noch sichtlich betreten, doch suchte er seine Überraschung zu bergen und es war ihm vermutlich lieb, dass ich nicht wie gewöhnlich zu dem Nachbar hinausging und auch nicht nach ihm fragte.
Diese Flucht, die ihrer Zeit ziemliches Aufsehen erregte, hatte, wie es in solchen Fällen gewöhnlich geschieht, mancherlei unangenehme Folgen für die Zurückbleibenden. Man ließ es sich natürlich angelegen sein, uns genauer zu überwachen. In den Zellen nahm man uns, was bis dahin nicht geschehen war, das Licht allabendlich um zehn Uhr weg. Die Spaziergänge auf dem Vorsaal wurden sorgfältiger beaufsichtigt und es kam nicht leicht mehr zu geselligen Zusammenkünften. Wurde man hinab nach dem Gerichtslokale gerufen oder von dort nach der Zelle zurückgebracht, so sah man sich fortan nicht mehr von einem, sondern von zwei Gerichtsdienern begleitet, damit diese nicht bloß den Gefangenen, sondern auch einander gegenseitig überwachen möchten; auch konnten sie die Gefangenen nicht mehr so ohne Weiteres aus den Zellen holen: es wurde auf einer hierzu bestimmten Tafel Abholung und Zurücklieferung jedes Gefangenen aufgezeichnet und am Eingange zu den Räumen des Stockhauses war fortwährend ein aufsichtführender Gerichtsdiener postiert. Man beschloss, wie es in den andern Stockwerken des Hauses bereits der Fall war, auch bei uns außen vor den vergitterten Fenstern noch Lattengitter (unbewegliche „Jalousien“) anzubringen, die so eingerichtet waren, dass sie zwar Licht von oben her einließen, aber die Aussicht nach der Straße völlig abschnitten. Indes kam es dazu nicht sogleich und ich vermochte daher mit dem neuen Nachbar, den ich erhielt, auch ferner den Nachtpostverkehr zu unterhalten.
Es waren nach der Vereitelung meiner Flucht wieder einige Wochen vergangen, als man mir eines Tages gegen Ende März ankündigte, dass man mich, da meine Untersuchung geschlossen und meine Gegenwart also nicht mehr notwendig sei, nunmehr in das Landesgefängnis zu Hubertusburg abliefern werde, um mich dort die in Folge des Spruches der Geschwornen mir zugeteilte zehnmonatliche Gefängnisstrafe verbeißen zu lassen. Mir konnte das recht sein, ja ich konnte es als eine Wohltat betrachten, weil es mir die Aussicht eröffnete, mich eine längere Zeit hindurch wenigstens des täglichen Genusses der freien Luft erfreuen zu können.
Die mancherlei kleinen Vorbereitungen, welche hierzu Seitens des Gerichts wie meinerseits erforderlich waren, nahmen einige Tage in Anspruch. Den 30. März (Sonnabend vor Ostern) sollte die Abreise stattfinden. Am vorhergehenden Abend stand ich noch in lebhaftem Verkehre mit meinem Nachbar, von dem ich Abschied nahm. Vermutlich ist dies das letzte Mal gewesen, dass die von uns eingerichtete Nachtpost im Leipziger Stockhause ihren Dienst Tat. Wir beide, mein Nachbar und ich, dachten nicht, dass wir ein Jahr später eine ähnliche, aber weit unangenehmere Reise gemeinschaftlich mit einander antreten würden.
Am nächsten Morgen in aller Frühe nahm ich denn, wie ich hoffte auf Nimmerwiedersehen, Abschied vom „Stockhause“ und stieg mit einem Gerichtsdiener und zwei Soldaten in einen Fiaker, der uns nach dem Leipzig-Dresdner Bahnhofe brachte.
1 Für seine Person wird sich der politische Angeschuldigte unter solchen Umständen, welchen Ausgang auch der Prozess nehmen mag, kaum übler befinden. Indes besitzt ein Gericht immer noch Mittel, ihn allenfalls zum Sprechen zu bringen: es findet sich z. B. ein Denunziant, der ihn irgend eines gemeinen Verbrechens beschuldigt, welches in gewissen Zusammenhang mit der politischen Angelegenheit gebracht wird, so dass der Angeschuldigte, indem er sich bezüglich dieser Anschuldigung verteidigt, gezwungen ist, sich zugleich auf Erörterung der politischen Angelegenheit einzulassen.
2 Es schien in der Tat, als vermeide man geflissentlich so viel als möglich auch nur die Erwähnung derselben. Natürlich! die Reichsverfassung und der Kampf um dieselbe konnten nicht Gegenstand einer Kriminaluntersuchung sein; zu dieser bedurfte es der Verschwörung, des Aufruhrs, Hochverrats.