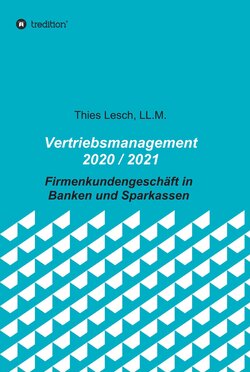Читать книгу Vertriebsmanagement 2020 / 2021 - Thies Lesch - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDie Entwicklung des Firmenkundenvertriebs in den Banken und Sparkassen
Das Firmenkundengeschäft bildet nicht nur den historischen Nukleus des Bankgeschäftes, sondern es ist auch heute noch ein zentrales Standbein von jeder Universalbank. In Deutschland war der wichtigste historische Wachstumsmotor für das Bankgeschäft die Industrialisierung, die in Deutschland erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts an Fahrt aufnahm. Ab 1870 begann ein Gründungsboom an Unternehmen, wie an Banken. Erst in diesem Kontext wurden Depositenkassen gegründet – Zweigstellen von Banken, die ausschließlich dazu bestimmt waren Einlagen von (Privat-)Kunden entgegenzunehmen und so den wachsenden Kapitalbedarf der Industrie zu decken. In die gleiche Periode fällt der flächendeckende Aufbau des Sparkassennetzes sowie der Genossenschaftsbanken in Deutschland. Es entsteht damit die auch heute noch als 3-Säulen-Modell bekannte Marktstruktur der Universalbanken.
1961 wurde das Bundesaufsichtsamt für das gesamte Kreditwesen (BAKred) gegründet und bildete den Schlusspunkt für das Regulierungsmodell, dass bereits 1934 mit dem KWG - als Reaktion auf die Pleite der Danat-Bank am 13. Juli 1931 - begonnen wurde. Dieses Modell blieb bis in die neunziger Jahre hinein nahezu unverändert, trotz Herstatt Pleite - die ihrerseits den Beginn des Ringens um eine adäquate Einlagensicherung bildete.
Kulturell zeichnete sich der deutsche Markt für Firmenkundenkredite dadurch aus, dass es keine großartige Differenzierung im Pricing von Risiken gegeben hatte. Ein Unternehmer bzw. ein Unternehmen war entweder kreditwürdig – oder er bzw. es war es nicht. Die steuerlichen Rahmenbedingungen in Deutschland waren auch dergestalt, dass es keinen besonderen Anreiz gab, Gewinne zu thesaurieren. Also haben kreditwürdige Unternehmen auch gern und großzügig ausgeschüttet.
Die Einführung von Basel II (beginnend ab 2004) durch den BCBS und die veränderte Haltung der Unternehmen zu Ihrer Hausbank zwangen die Kreditinstitute zu einer risikoadjustierten Preisgestaltung ihrer Kredite. Basel II verlangte eine Eigenkapitalzuweisung (also eine Unterlegung), welche die Kreditrisiken (also das Risiko des erwarteten Verlustes aus dem Zahlungsausfall des Schuldners) berücksichtigt. Gleichzeitig begannen sich die Kunden für mehr Banken zu öffnen und ihr Geschäft aufzuteilen. Erst das durch Basel II verpflichtend eingeführte Rating für die Kreditnehmer führte in Deutschland zur Wiederkehr der alten Sichtweise, dass sich der Zins an der Gefahr des Zahlungsausfalles bemessen muss.
Bis zu dieser Zeit war der Kundenbetreuer für die Firmenkunden auch gleichzeitig meistens der erste Sachbearbeiter, der die Kundenanfragen und Kundenwünsche primär auf den Tisch bekam und bearbeiten musste. Die Gewinnung von vertriebsaktiver Zeit wurde bis zu den neunziger Jahren nur vereinzelt thematisiert; sie war in jedem Fall durch die Bindung mit den Sachbearbeitungsthemen in der Regel nicht ausreichend bemessen. Die Veränderung begann in der Breite durch die Einführung der Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft (MaK), die nunmehr in den MaRisk aufgegangen sind. Es wurde eine Funktionstrennung etabliert, die Markt / Vertrieb von Risiko / Marktfolge bis in die Geschäftsleitung hinein aufteilen muss. Diese Funktionstrennung ist der institutionalisierte Grundstein der heutigen Rolle der Firmenkundenbetreuer, da die Schnittstelle zum Kunden einer Bank hierdurch von den zeitlich intensiven Tätigkeiten der Kreditsachbearbeitung ganz erheblich entlastet wurde.
Dieser individuelle Zugewinn an vertriebsaktive Zeit – auf Institutsebene mag es sich durchaus nivellieren - trifft auf eine Vertriebskultur, die über Jahrzehnte gewachsen ist und kaum Erfahrungen damit hat, aktiv auf den Kunden zuzugehen bzw. diese neuen zeitliche Ressourcen proaktiv zu nutzen. Kulturell war man das Antragsgeschäft gewohnt, das heißt: der Kunde kam zur Bank und sagte was er wollte, bzw. bat darum. Kredite wurden nicht verkauft, sie wurden nachgefragt. Zusätzlich hat dieses Marktbearbeitungsmodell dazu geführt, dass die Hauptaufmerksamkeit auf Kunden lag, die sich in irgendeiner Form bemerkbar gemacht haben. Unauffällige oder stille Kunden wurden tendenziell ignoriert.
Basel II und Basel III haben den Banken geholfen, im Kreditrisiko nicht nur in Schwarz und Weiß zu denken, sondern auch die Graustufen dazwischen zu erkennen und vor allem differenzierter zu bepreisen. Die zwingend notwendige Profitabilisierung des Firmenkundengeschäftes wurde so in Angriff genommen – allerdings muss man konstatieren, dass sich auf der Kundenseite zeitgleich erhebliche Veränderungen aufgetan haben. So gab es verschiedene Vorstöße des Staates, um die Thesaurierung von Gewinnen attraktiver zu gestalten. Die Unternehmen haben angefangen ihre Kapitalquoten zu steigern und somit an Unabhängigkeit von und Selbstbewusstsein gegenüber ihren Banken gewonnen. Auch die Unternehmer verstehen heute, welche Maßnahmen sich wie auf die Bonität des Unternehmens auswirken und agieren entsprechend. Also hat auch die Professionalität der Kunden in der Breite ganz erheblich zugenommen.
Damit steigt das Anforderungsniveau an jede Bank bzw. an jeden Firmenkundenberater und gleichzeitig steigt auch der potentielle Wettbewerb zwischen den Banken, wenn Kunden auf der einen Seite selbstbewusster werden und auf der anderen Seite einen geringeren Fremdfinanzierungsbedarf als in der Vergangenheit vor sich her tragen. Marktzyklen können diese Entwicklung vorübergehend abfedern oder auch verstärken - aber eben nur vorübergehend.
Hinzu kommt, dass mit der nunmehr aktiven Bewirtschaftung des Eigenkapitals einer Bank der zusätzliche Verkauf von Dienstleistungen und weiteren Produkten (Cross Selling) an die Kunden einen deutlich gewachsenen Stellenwert bekommen hat. Ausgehend von einem Kredit oder einer Betriebsmittellinie als Ankerprodukt sollen und werden weitere Kundenbedürfnisse identifiziert, adressiert und abgedeckt. Diese Entwicklung ist in den Instituten bzw. Institutsgruppen recht heterogen verlaufen, allerdings ist davon auszugehen, dass Wettbewerbsdruck und Digitalisierung mittelfristig zu einer tendenziellen Harmonisierung führen müssen.
Die Firmenkunden bleiben eine heterogene Kundengruppe, gerade auch im klassischen deutschen Mittelstand, mit ihrerseits hohen Anforderungen an ihre Bank und ihren Berater. Wir erleben Verschiebungen in der Produkt- und Wettbewerbslandschaft, sowohl durch Digitalisierung und FinTechs, wie auch durch veränderte Marktteilnehmer. So ist beispielsweise das Teilsegment der fremdfinanzierten mobilen Ausrüstungsinvestitionen inzwischen (seit der Finanzkrise 2008) deutlich in der Hand der sogenannten Captives, der herstellergebundenen Leasinggesellschaften, und der Kreditfinanzierer, die entweder herstellergebunden sind oder eine POS-Kooperation mit einem Händler eingegangen sind. In diesem Teilmarkt gehen bereits über 50 % des Marktes an den Universalbanken vorbei
Ein Marktbearbeitungsmodell mit einem Antragsgeschäft als Mittel- oder Ankerpunkt hat seinen Zenit deutlich überschritten und ist zwingend ein Auslaufmodell!