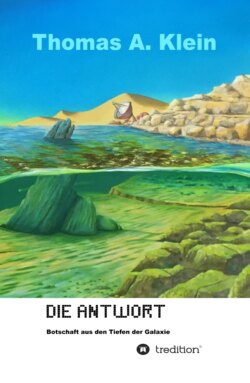Читать книгу Die Antwort - Botschaft aus den Tiefen der Galaxie - Thomas A. Klein - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 1
Das Nass umspülte seine müden Glieder. Den ganzen Tag hatte er sich die Berührung des Wassers herbei gesehnt, war unstet in seinen Arbeitsräumen auf und ab gegangen, hatte nach Luft gerungen und konnte sich nicht auf das Wesentliche konzentrieren. Zwar waren die meisten Räume des Labors mit Wasser geflutet, doch musste er sich auch immer wieder im Trockenen aufhalten. Je älter er wurde, desto schwerer fielen ihm die harten Stunden der Arbeit an Land. Das Atmen in der trockenen Luft war für ihn eine Tortur, sein Körper fühlte sich trocken, steif und zu nichts zu gebrauchen an; so kam es einer Erlösung gleich, wenn er des Abends in die Fluten steigen und endlich wieder frei durchatmen konnte.
Doch die Arbeit musste gemacht werden. Vorbei die Zeit, in der sich die Wissenschaft im Meer, im natürlichen Lebensraum der Elaborä, entwickeln konnte. Nur an Land waren tiefere Einsichten zu erwarten. Das Meer verbarg zu viele der Einsichten, die die Elaborä nur hier, nur ohne die schützende, lebensfreundliche Schicht des Wassers, den Tiefen des Raumes entreißen konnten. Die Sterne und Planeten, ja selbst der Mond, waren vom Meer aus so gut wie nicht zu beobachten.
So blieb nur die Möglichkeit dem Wasser den Rücken zu kehren und den angestammten Lebensraum zu verlassen, um in einer feindlichen Umwelt diesen Geheimnissen auf die Spur zu gehen. Hier fand man die Antworten, die sich schon Generationen herbeigesehnt hatten.
Denn schon seit Jahrhunderten hatten die Bewohner des Planeten auf diesen Tag gewartet. Was Generationen von Wissenschaftlern erhofft und erwartet hatten, war gerade noch in seinen zitternden Gliedern gelegen. Die Computeranalyse war eindeutig. Warum gerade er? Wie sollte ausgerechnet er mit dieser Erkenntnis umgehen? Wie sollte er sie formulieren? Wie sie publik machen?
Dabei hatte ihn die Nachricht nicht unvorbereitet getroffen. Seit Monaten arbeitete er an der Dechiffrierung des Signals. Zuerst hatte er widerwillig und nur sporadisch die Arbeit aufgenommen. Der Auftrag, den Marschall Traul ihm gegeben hatte, war ihm sogar zuwider gewesen. Vielleicht hatte der Militär ihn ja gerade auch deshalb ausgesucht. Denn auch ihm schien die ganze Sache mehr als lästig zu sein. Walg hätte viel lieber seine eigentliche Arbeit, die mathematische Forschung, fortgeführt. Doch nun war er in diesem Projekt gefangen und konnte den anderen so wichtigen Fragen seines beruflichen Lebens nicht nachgehen. Erst viel später war er von dem Projekt, und der Nachricht, die es zu dechiffrieren galt, gefangen genommen worden. Die Faszination, die von den gewonnenen Erkenntnissen ausging, ließ ihn nun nicht mehr los. Dennoch hatte seine Skepsis, dem ganzen Projekt gegenüber, ihn bis zum heutigen Tag einen gebührenden Abstand bewahren lassen. Er konnte nicht einmal sagen, wieso ihn gerade heute, die Fakten letztendlich doch überzeugt hatten. Mit jeder Stunde, die er sich mit den Daten vertraut gemacht hatte, hatte sich eine mächtige Wand über ihm aufgebaut; so groß, so gewaltig, dass ihre Existenz zu leugnen, irgendwann sinnlos wurde. Eine Wand aus Wasser, die rasend auf ihn zueilte. Gleich einer unwiderstehlichen Woge, die auf ihrem Weg aufs trockene Land alles mit sich riss. Und nun war sie über ihm zusammengebrochen, hatte auch den letzten Zweifel hinweg gespült wie Treibgut an einem einsamen Strand. Doch was nun? Wie sollte er nun vorgehen, da in ihm Gewissheit geworden war, woran er so lange gezweifelt hatte?
Inzwischen war er sich sicher, dass gerade er als Projektleiter erwählt worden war, war kein Zufall. Wer wäre besser geeignet, etwas zu bestätigen, wovon er doch selbst so wenig überzeugt war? Seine Kollegen waren schon viel früher überzeugt, ja geradezu euphorisch gewesen, und ließen keinen Zweifel daran, dass sie glaubten einen Kontakt hergestellt zu haben. Einen Kontakt, den er selbst niemals für möglich gehalten hätte. Zwar glaubte auch er, dass der Planet, auf dem sie lebten, nicht der einzig bewohnte in der Galaxie sein konnte, doch dass es jemals einen Kontakt zu jenen anderen Wesen geben sollte, hielt er für absolut ausgeschlossen. Viel zu gewaltig waren die Dimensionen, die es zu überwinden galt. Da half kein Hoffen; die Physik und mit ihr die Gesetze der Mathematik, sprachen mit großer Sicherheit gegen eine solche Kontaktaufnahme.
Und nun war es an ihm, die vorliegenden Daten auszuwerten. Auf der anderen Seite: Was sollten sie schon zeigen? Konnten die Reihen an Zahlen, die er vor sich liegen hatte, mehr offenbaren als nur die Tatsache, dass es dort draußen noch jemanden gab? Konnten sie mehr über eine fremde Welt erzählen? Konnte man wirklich von einem Kontakt sprechen?
Und doch, es war eine Nachricht. Eine Nachricht aus den Weiten des Alls. Alle gewonnen Daten deuteten darauf hin. Sie waren nicht allein. In den unendlich erscheinenden Weiten des Universums gab es noch weiteres Leben. Leben, das weit genug fortgeschritten war, um mit ihnen in Kontakt zu treten.
So unglaublich dies alles auch scheinen mochte, nun musste er doch eingestehen, dass es wahr war. Zunächst hatte er noch nach allen anderen denkbaren Möglichkeiten, die die Struktur des Signales hätten erklären können, gesucht. Ein außergewöhnlicher Pulsar vielleicht? Die immer wiederkehrenden Strukturen des Signals deuteten auch darauf hin. Wie oft schon war man, seit man das Projekt gestartet hatte, ähnlichen Quellen nachgegangen, und hatte am Ende doch immer wieder feststellen müssen, dass die Ursache für die Radioquelle eine natürliche war.
So war er in der sicheren Annahme an die Arbeit gegangen, auch dieses Signal würde seine wahre, seine natürliche Quelle schon bald offenbaren. Doch so sehr er auch suchte, solange er forschte, er fand keine natürliche Erklärung für die Struktur des Signals. Die Frequenz, die immer wiederkehrenden Muster mussten einen künstlichen, einen bewusst erstellten Ursprung haben. Wieder und wieder hatte er sich die Zahlen vorgenommen, hatte sie in seinem Rechner hoch und runter laufen lassen, hatte versucht und verworfen. Doch so sehr er sich auch mühte, so sehr er versuchte, seine Zweifel zu beweisen, so sehr war in ihm immer mehr zur Gewissheit geworden, was er niemals für möglich gehalten hätte. Traul würde nicht begeistert sein, wenn er ihm davon berichtete.
Seit man das Projekt vor Jahrhunderten gestartet hatte, waren Generationen von Forschern gekommen und gegangen. Waren über ihre unermüdliche Arbeit alt geworden, um schließlich zu sterben. Auch der nächsten Generation sollte es nicht anders ergehen. Wieder und wieder erschienen hoffnungsvolle Forscher auf der Bildfläche; nur um am Ende eines langen, eines arbeitsreichen Lebens ernüchtert zu erkennen, dass sie nichts erreicht, dass sie nicht die kleinste Spur von dem gefunden hatten, wonach sie schon so lange gesucht hatten. Und dennoch einte sie alle, dass sie der festen Überzeugung waren, ihr Werk würde eines Tages gelingen. Alles Hoffen indes blieb über Jahrhunderte vergebens; früher oder später mussten sie alle ihr Sehnen fallen und davon treiben lassen. Wieso man nicht längst aufgegeben hatte, war Walg ein Rätsel. Nichts rechtfertigte den ungeheuren Aufwand und die Bereitstellung so vieler Mittel, die man an anderer Stelle doch so viel nötiger hätte verwenden können. Nichts, außer vielleicht den Ergebnissen, die ausgerechnet er nun in Händen hielt.
War dem so? War die Erkenntnis, dass sie nicht alleine waren, dies alles wert? Er war sich noch immer nicht sicher, doch seine Gehirne begannen langsam, die Sache von einer anderen Seite zu betrachten.
-
„Saug den Schlamm hier drüben ab!“ Die Anweisungen Professor Guils waren eindeutig. Jarg machte sich an die Arbeit, doch sie fiel ihm schwer. Der Gesichtssinn war nicht gerade der stärkste, nicht der ausgeprägteste Sinn der Elaborä. Viel lieber hätte er mit seinem Gehör die feine Struktur wahrgenommen. Doch die Überreste der längst verendeten Lebewesen hoben sich viel zu schwach von der glatten Steinoberfläche ab, als dass er sie hätte erhören können. So musste er sich auf seine vier Augen verlassen, die ihm sonst doch nur zur Kommunikation dienten. Vorsichtig, mit zusammengekniffenen Augendeckeln, begann er das aufgewirbelte Sediment wegzusaugen. Konzentriert folgte der Schüler den geübten Bewegungen des Professors, der sich ganz offensichtlich weit mehr auf seinen Gesichtssinn verlassen konnte. Die jahrelange Arbeit an Land hatte die Augen des Älteren geschult; wie kaum ein anderer konnte er sie einsetzen und Dinge erkennen, die andere Elaborä niemals wahrnehmen würden.
Konzentriert auf die immer deutlicher hervortretende Gesteinsschicht fiel es Jarg schwer, mit zwei seiner Augen den Ausführungen des Professors zu folgen. In schillernden Farben, gerade in leuchtendem Gelb, schmückte der Ältere seine Erkenntnisse aus: „Hier, siehst du das?“
Jarg kam näher. Sein von den umherwabernden Sedimenten getrübter Blick konnte nur zögerlich erkennen, was der Professor meinte. Doch als er es endlich sah, färbte sich auch seine Haut in einem kräftigen gelblichen Ton.
Ein Augenpaar auf ihren Fund gerichtet, das andere auf den Professor, sah er den Gelehrten sagen: „Ein Zeugnis längst vergangener Zeiten.“
„Was ist das?“, wollte Jarg wissen.
„Das müssen wir im Labor genauer untersuchen.“, befand Guil, mit einem mehr ins Bläuliche driftenden Ton. „Aber es sieht nach einem Krebstier aus, das wohl vor langer, langer Zeit hier gelebt hat. Auf alle Fälle ist es ein sehr gut erhaltenes Fossil. So etwas findet man nur äußerst selten. Es gibt zwar unzählige Fossilien, doch die meisten sind klein; oder man findet nur Bruchstücke von komplexeren Lebensformen. Doch so ein großes, zusammenhängendes und dazu hoch entwickeltes Lebewesen, kommt nur sehr selten ans Licht.“
„Kann es ein Vorfahr von uns sein?“
„Vielleicht. Wer weiß?“
„Wie alt ist es?“
„Das kann ich so, nicht genau sagen. Der Gesteinsschicht nach, in der wir es gefunden haben, auf alle Fälle aber sehr alt.“
„Stammt es gar aus der Zeit, vor dem großen Sterben?“
„Nein.“, erläuterte Guil leicht amüsiert, „Das nun auch wieder nicht. Es dürfte, grob geschätzt so circa hundert Millionen Jahre alt sein. Das große Sterben dagegen ereignete sich vor gut drei Komma zwei Milliarden Jahren.“
Jargs Hautfarbe wich einem kräftigen Grünton.
„Was ist?“, wollte der Professor wissen.
„Ach, nichts! Mich verunsichern nur diese ungeheuren Zeitspannen.“
„Nun ja, die können einen schon verunsichern. Aber du hast keinen Grund dazu. Betrachte sie einfach nur mit Ehrfurcht.“
„Ich werde es versuchen. Doch leicht fällt mir das nicht.“
Professor Guil schmunzelte aufmunternd, ehe Jarg nachhakte: „Wie kam es zu dem großen Sterben?“
„Das weiß man nicht wirklich. Es gibt dazu verschiedenen Theorien.“
„Was für Theorien?“
„Die eine besagt, dass ein riesiger Meteorit alles Leben zerstört habe. Nach einer anderen haben sich einfach die klimatischen Bedingungen dramatisch geändert. Noch eine andere geht davon aus, dass das Leben sich selbst seiner Grundlagen beraubt hat.“
„Wie meinen Sie das?“
„Nun, der Theorie zufolge gab es wohl eine Spezies, die etwas zu erfolgreich gewesen war, die dem ökologischen System zu viel abverlangt hat, sodass alles aus dem Gleichgewicht geriet. Aber wenn du mich fragst, so ist diese Theorie die mit Abstand unwahrscheinlichste.“
„Wieso?“
„Weil sich das Leben immer in einem Gleichgewicht einpendelt. Auch wenn es durch äußere Einflüsse in einen Zustand des Ungleichgewichtes gerät, so pendelt es sich doch meist sehr schnell wieder in einen stabilen Zustand ein. Und eine zu erfolgreiche Art, wird so ganz automatisch in ihrem Erfolg gebremst.“
„Aber Tatsache ist doch, dass das Leben damals diesen Zustand nicht wieder erreicht hat.“
„Das stimmt so nicht ganz!“
„Wieso? Damals ist doch alles Leben ausgestorben.“
„Nicht alles. Nur beinahe!“
„Aber es gibt doch über einen langen Zeitraum keinerlei Nachweis irgendwelchen Lebens.“
„Auch das stimmt nicht!“
„Wie meinen Sie das?“, fragte Jarg abermals unsicher. Sein Panzer wurde dabei immer grüner und tat seine Unsicherheit kund.
„Dass wir keine Fossilien aus einer gewissen geschichtlichen Epoche des Planeten finden, heißt noch lange nicht, dass es kein Leben gab. Sicher kein „höheres“, noch nicht einmal vielzelliges Leben. Doch einige wenige Einzeller haben die große Katastrophe, welcher Natur sie auch immer war, wohl überlebt. Wir können heute dicke Flöze mit ihren Stoffwechselprodukten nachweisen. Der Planet hat sehr schnell wieder über eine nicht unbedeutende Biomasse verfügt. Und wenn es auch nicht viele Arten gab, so quoll er doch geradezu vor Leben über.“
„Sie wollen sagen, aus diesen wenigen Mikroben, ist dann alles um uns herum entstanden?“
Professor Guil bestätigte die Frage, indem er gleichzeitig das Fossil aus seinem Bett hob.
Jarg schaute ehrfurchtsvoll von dem Fossil zu der sie umgebenden Landschaft. All die Pflanzen, all die Tiere, die um sie herum gediehen und in dem natürlichen Element der Elaborä um ihre Köpfe schwammen, entstanden aus nur wenigen Arten Einzellern? Was für ein unglaublicher, aber auch was für ein erhabener Gedanke.
Doch bei all der Faszination, die von diesen Überlegungen ausging, beschäftigte ihn eines noch mehr: „Kann es wieder passieren?“
„Was meinst du?“, erkundigte sich nun der Gelehrte.
„Kann abermals alles Leben vernichtet werden?“
Skeptisch blickte Guil drein: „Das kann man wohl leider nicht gänzlich ausschließen.“
„Aber immerhin können wir ja gegensteuern.“
Der Professor hob fragend einen Augendeckel.
„Wir haben ja auch schon solche Krisen gehabt!“, erklärte Jarg und fügte hinzu: „Und haben sie erfolgreich gemeistert.“
„Was meinst du?“
„Damals, als wir vor einigen Jahrhunderten, nachdem wir alle unsere Feinde nahezu ausgerottet hatten, viel zu viele wurden, haben wir selbst unsere Zahl drastisch reduziert.“
„Ja, da hast du recht. Sieht so aus, als könnten wir vieles beherrschen.“
Guil zwinkerte seinem Studenten zu, doch irgendwie blieb da ein Hauch von Skepsis in seinem Blick.
-
Tief hörte er in die Schlucht hinab, die sich zu seinen Füßen in die scheinbar unendlich Weite erstreckte. Er musste aufpassen. Niemand sollte sehen, dass er hier alleine war und alle anderen beobachtete. Zwar war es nicht verboten alleine zu sein, verdächtig machte man sich damit aber allemal. Doch er konnte nicht anders, er brauchte immer wieder Zeit für sich. Wie sonst sollte er seiner Passion nachgehen?
Die Spalte durchbrach die Plateaus, die sich links und rechts davon erhoben. Weit konnte er in den Grat hinab hören, in jene Tiefen, in denen Wesen, die sich eher optisch orientierten, gänzlich verloren waren. Doch auch wenn sich die Elaborä, die sich ja nur wenig auf ihre Augen verließen, ohne Licht oder bei schlechter Sicht mittels ihres Gehörs hervorragend orientieren konnten, mieden sie dennoch jene Abgründe und blieben in den eher flacheren Zonen des Ozeans. Wie eh und je waren sie von seinen Artgenossen bevölkert. Überall wuselte es, und alle Elaborä gingen ihrer Arbeit nach oder waren auf dem Weg dahin. Alle, bis auf ihn. Er hatte dem eintönigen Alltag noch nie etwas abgewinnen können. Das ständige Untertauchen in der Masse; niemals allein, niemals ein Moment der Ruhe. Wozu all die Mühe? Was sollte der Aufwand? Musste es nicht noch etwas anderes geben, als nur tagein, tagaus zu arbeiten?
Nicht zum ersten Mal musste er sich diese Fragen stellen: Was ist es, was die Elaborä vorantreibt? Woraus beziehen sie ihre Motivation?
Ihm selbst war das stetige Streben nach Fortschritt, das ewige Ringen um bessere technische Lösungen, zutiefst suspekt. Der Fortschritt sollte ihr aller Leben leichter, angenehmer machen. In Wahrheit machte der Druck seine Mitelaborä krank. Wieso konnte man sich nicht mit dem zufriedengeben, was man hatte? Oder zumindest die ganze Sache mit dem Fortschritt etwas ruhiger angehen? Das Leben musste doch noch mehr bereit halten. War es nicht so schon kurz genug?
So war er zufrieden mit seiner Aufgabe, sich immer wieder um einige heranwachsende Elaborä zu kümmern. Eine Aufgabe, die ihm genügend Zeit ließ, sich seiner eigentlichen Leidenschaft zu widmen. Nur selten musste er Seminare besuchen, musste sich in pädagogischen- und Rechtsfragen weiterbilden. Ansonsten hatte er, solange seine Schützlinge in der Schule waren, viel Zeit sich anderen Dingen zu widmen.
Mit seinen Ansichten und Wünschen stand er allerdings ziemlich alleine da. Niemand konnte seine Empfindungen teilen. Überhaupt, die anderen waren so ganz anders als er. Keiner hatte einen Sinn für all die Schönheit um sie herum. Niemand benutzte seine Augen in der Art, wie er es tat. Keiner sah, wie das sich fächernde Licht die obersten Wasserschichten durchbrach und unzählige Felsformationen aus dem Dunkel herausschälte. Die Bündel der Lichtstrahlen, die sanft, unzähligen Fingern gleich, das flüssige Medium erhellten. Mächtige, spitze Klippen, die sich unter und über Wasser vom hellen Himmel abhoben, wie die Luft vom flüssigen Element. All das nahm kaum einer wahr. Eigentlich war es auch nicht verwunderlich, denn der Gesichtssinn war hier unter Wasser meist von nur eingeschränktem Nutzen. Viel zu oft war das Element, für das sie geboren worden waren, zu trübe, als dass man sich auf seine vier Augen alleine hätte verlassen können. Auch die Tatsache, dass die Elaborä in ihrer gesamten Entwicklungsgeschichte immer wieder das trockene Land aufgesucht hatten, änderte daran nicht wirklich viel. Die Spezies war auf ein Leben unter Wasser geprägt. Die visuelle Wahrnehmung war bei ihnen allen vorhanden, doch sie spielte nur eine untergeordnete Rolle. Sicher würden die meisten der Elaborä von sich behaupten, sie sähen gut, doch die größte Bedeutung hatten ihrer aller Augen nur für die Kommunikation. Kaum jemand kam auf die Idee, dass man auch seine Umwelt mit den Augen erfassen konnte. Sicher sahen alle, wie es um sie herum aussah, doch kaum einer nahm es bewusst wahr; nahm die Schönheit um sie alle herum aktiv in sich auf. Schlimmer noch, es hatte für niemanden eine Bedeutung. Wie sollte so jemals Beachtung finden, was er schuf? Was er tat, tat er wohl einzig für sich allein. Oder sollte es unter den Milliarden gehetzten Elaborä andere geben, die genauso empfanden wie er? Andere, die die Schönheit zu schätzen wussten und sich nicht nur im Farbenspiel ihrer Unterredungen ergötzten? Wie wahrscheinlich war das? Das Auswählen der Embryonen verhinderte wohl das Aufkommen anderer Wahrnehmungen. So gesehen war er ein Unfall der technisierten Zuchtwahl.
Er nahm den Stift und zog eine Linie. Dunkel durchbrach sie den hellen Zeichengrund. Stark und mächtig einerseits und doch verloren in der Einöde des weißen Papiers. Nur eine Ahnung der Tiefe, ein Hauch der unergründlichen Gefahr, tat sich mit der Linie auf. Er musste noch viele Details einarbeiten, bis das Gefühl, das ihn nun durchdrang, auch im Anblick des Bildes wahrhaftig werden würde. Doch seine Werkzeuge waren nicht ideal. Sie waren für ganz andere Zwecke gemacht. Ja, er war nicht der Einzige, der zeichnete; doch die anderen taten dies ausschließlich um technische Entwürfe zu fertigen. Kurze Skizzen einer Idee zu einer neuen technischen Lösung. Ein neuer Motor, ein neues Boot, oder eine Rakete, mit der man nach den Sternen griff. Früher, vor Jahrhunderten, war das Zeichnen aus eigener Hand noch weit bedeutsamer gewesen. Heute übernahm diese Arbeit zumeist ein Computer. Selbst das Schreiben ging heutzutage kaum noch jemanden von der Hand. Dazu gab es mittlerweile Geräte, die erkennen konnten, was ihr Besitzer ausdrückte und was er niedergeschrieben haben wollte. Wann immer etwas wichtig genug war, kopierte die Maschine die Farben der Rede und speicherte sie ab. So war es für Bonar nicht einfach, die alten Werkzeuge, Papier, Stifte oder gar Farben zu besorgen. Nicht zum ersten Mal machte er sich Gedanken, seine Utensilien selbst herzustellen. Werkzeuge, mit denen er die Allmacht der Natur viel besser würde darstellen können. Doch vorerst musste er sich mit dem zufriedengeben, was er hatte.
Nun saß er da und wusste nicht, wie er die Szene einfangen sollte. Das Farbenspiel des einfallenden Lichtes fächerte Felsen und Pflanzen in einer ganz außergewöhnlichen Vielfalt vor ihm auf. Wenn auch die Farben lange nicht von der Überschwänglichkeit waren, wie dies auf dem trockenen Land der Fall war, so offenbarten sie dennoch eine ungeheure Pracht. Die Farben, die hier vorherrschten, boten einen krassen Kontrast zur Welt oberhalb des Wasserspiegels. Dort offenbarten kräftige Gelb- und Ockertöne, erdrückendes, scharf abgegrenztes Grau und Schwarz, eine feindliche, eine abstoßende Umwelt. Auch solche Szenen hatte er gemalt, übten sie doch, gerade ihrer Feindlichkeit wegen, eine kaum zu widerstehende Faszination aus; lieber waren ihm aber dennoch die lebendigen Unterwasserszenen. Dies war seine Heimat, hier waren er und seine Artgenossen zuhause. Er wollte festhalten, was er sah. Er wollte den Augenblick bewahren. Ja mehr noch, er wollte über das Visuelle hinaus, auch alle seine anderen Eindrücke festhalten. Die Reflexionen des Schalls von den harten schroffen Felswänden und dem weichen sandigen Boden genauso, wie den Geruch der Tiere, die um ihn herum schwammen, und den Pflanzen, die sich sanft in der Strömung wogen; den seichten Wasserdruck, verursacht durch die ständig wechselnde Strömung. Wie sollte dies alles auf einer zweidimensionalen Fläche gelingen? Es würde nicht einfach sein, doch er musste es versuchen.
„Wie kommen Sie voran?“
Erschrocken fuhr Walg, ob des unfreundlichen Farbtons der Frage, von seiner Arbeit hoch. Das Geräusch, das der Marschall beim Eintreten, allein um auf sich aufmerksam zu machen, gemacht hatte, noch immer in den Gliedern. Was sollte er sagen? Was sollte er Marschall Traul, dem obersten Leiter des Projektes, offenbaren? Noch hatte er nicht viel herausgefunden. Die Sprache der fremden Lebensform, behielt ihre Geheimnisse noch weitgehend für sich.
Trotz seiner Abgebrühtheit, zeichnete sich auf seinem Panzer eine leichte Grünfärbung ab, als er zu antworten begann: „Es ist nicht leicht.“
Traul blickte unzufrieden drein; die Hände, an deren Gliedern das überschüssige Fett unter den Platten hervorquoll, provokant in die Seiten gestützt. Ein Ausbund an Überheblichkeit. Und dennoch verursachte sein Anblick, bei einem jeden, der ihm gegenüber stand, ein kaum zu ertragendes Gefühl des Verlorenseins. So jämmerlich, ja krank, der Militär auch wirken mochte, die Macht, die von ihm ausging, vermochte es, einen jeden zu erdrücken. Nein, dieser Elabora wollte keine Ausflüchte sehen. Natürlich war es nicht leicht. Wie sollte es auch? Doch war ihm der Mathematiker nicht auch deshalb empfohlen worden? Wenn es jemanden gelingen würde, dann diesem Walg. Und wenn er scheiterte, so war das ganze Projekt der Mühe nicht wert. Und das wäre eine Option, die ihm alles andere als ungelegen käme. Er hatte Wichtigeres zu tun. Als oberstem Militär musste er für Ordnung und Sicherheit sorgen. Der Auftrag der Regierung war eindeutig: Er musste störende Elemente ausfindig machen und eliminieren. Zum Glück fügten sich die meisten der Elaborä in ihre Aufgaben; doch gab es auch welche, die aufwieglerisch, die gefährlich waren. Fand er solche, so zögerte er nicht; niemals sollte wieder jemand von diesen hören. Er hoffte nur, dass er mit diesem Wissenschaftler nicht in ähnlicher Weise verfahren musste. Eine Person, die derart im öffentlichen Interesse stand, konnte er nicht so leicht verschwinden lassen. Umso wichtiger war ihm, was der Mathematiker zu berichten hatte.
„Die Frequenzen des Signals sind ganz eindeutig von irgendetwas ganz bewusst gesendet worden.“
„Was soll das heißen?“
„Sehen Sie selbst.“ Walg reichte dem Marschall den Computerausdruck. „Das Signal hat eine Trägerfrequenz von 21,6 Gigahertz. Auf ihr befinden sich immer wiederkehrende Sequenzen, die einen Binärcode vermuten lassen.“
Traul schaute ihn fragend an.
„Ein Binärcode ist eine Verschlüsselung von Information in zwei Zeichen. Zum Beispiel Schwarz und Weiß.“
„Ich weiß, was ein Binärcode ist!“ Trauls Hautfarbe explodierte geradezu. Was fiel diesem Walg nur ein? Er war nicht dumm, auch wenn dieser wissenschaftliche Kram ihm am liebsten gestohlen bleiben konnte. Er musste seinem Gegenüber dessen Grenzen aufzeigen. Ihm zeigen, wer die Macht hatte. So hackte er, in einem an Unfreundlichkeit kaum zu überbietenden Farbton nach: „Aber was wollen Sie mir damit sagen?“
„Nun, das ist eben nicht einfach.“
„Ich bin nicht hier um etwas Einfaches zu hören!“, echauffierte sich der Militär, „Was haben Sie heraus gefunden?“ Walg wäre am liebsten verschwunden. Die arrogante Art des überfressenen Marschalls ließ in ihm sämtliche Alarmglocken klingeln. Doch er konnte nicht einfach gehen, er war von diesem Machtelabora und den Mitteln, die dieser freigeben konnte, abhängig.
„Alles, was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass das Signal von einer Intelligenz weit außerhalb unseres Planetensystems ausgesendet worden ist.“, entgegnete Walg unsicher.
„Was macht Sie da so sicher?“, entgegnete Traul spöttisch.
„Nun, den Ursprung des Signals können wir sehr genau bestimmen. Er liegt in einem System, das gut zehntausend Lichtjahre von uns entfernt ist.“
„Das ist verdammt weit weg.“
„Eigentlich nicht! Eigentlich ist es unsere direkte kosmische Nachbarschaft. Nicht einmal weit in der Galaxie, die unsere Heimat bildet. Wenn man bedenkt, dass das Universum ein Alter von einhundertzweiundfünfzig Milliarden Jahren und damit eine Ausdehnung in der gleichen Größenordnung in Lichtjahren hat … “
„Was soll das Geschwätz?“, unterbrach ihn der Marschall ungehalten, „Erzählen Sie mir etwas, was man sich auch vorstellen kann.“
„Sehr wohl. Die Beschaffenheit des Signals weist ganz eindeutig auf einen nicht natürlichen Ursprung hin.“
„Es deutet darauf hin? Es könnte aber auch ganz anders sein!“
„Nein, eigentlich nicht. Kein natürliches Phänomen kann solch eine Struktur einer Radioquelle verursachen.“ Die Bestimmtheit, mit der Walg dies erörterte, hielt den Marschall zunächst davon ab, weitere Zweifel anzubringen.
„Und was wollen diese …, diese Fremden von uns?“
„Da bin ich leider noch ganz am Anfang. Ich kann ihre Sprache nicht verstehen. Hier, sehen Sie sich das hier an.“ Walg nahm einen Computerausdruck und zeigte seinem Vorgesetzten den entsprechenden Abschnitt. „Sehen Sie hier. Die binäre Verschlüsselung gibt hier ganz eindeutig Töne wieder. Doch sie folgen keinem Muster, bilden keine Objekte ab.“
„Kein Muster? Wieso sind Sie dann so sicher, dass es sich um eine nichtnatürliche, sondern um eine bewusst erstellte Botschaft handelt?“
„Um natürlichen Ursprungs zu sein, ist die Quelle zu gut strukturiert. Sie hat, wie gesagt, immer die gleiche Trägerfrequenz. Und die Struktur darauf ist zu geordnet, als dass sie rein zufällig sein könnte. Die Laute, die Sie hier sehen, können nicht durch puren Zufall entstanden sein. Sie stellen eine uns vollkommen fremde, eine uns unverständliche Art der Wahrnehmung dar. Wir haben schon alles Mögliche versucht, doch sind bislang noch nicht hinter deren Geheimnis gekommen. Die Klänge, die wir abspielen konnten, bilden eine Harmonie, ich möchte schon fast von einer Schönheit sprechen. Doch sie sind vollkommen abstrakt. Ganz so, als ob man sie nur geschaffen habe, um sich daran zu erfreuen.“
„Was reden Sie da? Sich erfreuen? Was soll das für einen Sinn haben? Was ist schon Freude?“
Walg schaute den Marschall beinahe hilfesuchend an. Dieser erwiderte den Blick herablassend, ja fast demütigend; so als wolle er sagen: Habe ich es nicht gleich gesagt? Da ist nichts! Sie reden es sich nur ein.
Walg fuhr sich verteidigend fort: „Dass ich sie noch nicht verstehe, kann aber auch ganz andere Gründe haben. Es scheint einfach, dass die Nachricht ganz anders aufgebaut ist, als wir es bei unserer Kommunikation gewohnt sind. Ich muss mich von meiner Art zu denken, von meiner Art, die Umwelt wahrzunehmen, lösen. Vielleicht habe ich dann mehr Erfolg. Wie ich Ihnen gerade gezeigt habe, habe ich die Töne ihrer Orientierung herausfiltern können. Doch sie ergeben keinen Sinn, sind nur eine zufällige Aneinanderreihung überwiegend hoher und tiefer Töne. Aber es gibt ja auch noch ganz andere Bereiche der Nachricht.“
„Was meinen Sie?“
„Viele Bereiche geben ganz eindeutig keinen Schall wieder. Ich versuche darin eine Sprache, eine Schrift zu erkennen. Doch leider ist auch dies sehr schwierig. Wir haben noch nicht den Schlüssel gefunden, mit dem wir den Zugang zur Dechiffrierung in Händen halten.“
„Und wie lange denken Sie, wird dies dauern?“
„Wer kann das sagen? Wir brauchen einfach die richtige Idee, den richtigen Ansatz. Dann kann alles sehr schnell gehen.“
„Kann! Es kann aber auch sein, dass Sie noch ewig nach etwas suchen, das Sie niemals finden werden?“
Walg machte eine verlegene Geste.
„Mehr können Sie nicht sagen?“
Die Frage, mit unverhohlener Abneigung vorgetragen, ließ einen kalten Schauer über Walgs Rücken gleiten.
„Nein! Im Moment nicht.“, versuchte er verzweifelt, sich zu verteidigen, „Es tut mir leid, wenn ich mich nicht verständlicher machen kann. Es ist wohl nicht gerade einfach, eine offensichtlich vollständig anders geartete Lebensform zu verstehen. Aber es wird uns noch gelingen. Irgendwann werden wir die Sprache der Fremden entschlüsseln, oder soll ich besser sagen, übersetzen können.“
„Dann sehen Sie zu, dass Sie dies möglichst schnell erreichen. Ich muss dem Senat Ergebnisse vorweisen. Ohne werden Ihnen früher oder später die Mittel gestrichen.“, blitzte Traul.
Walg blieb die Absicht des Marschalls nicht verborgen. Ein Abbruch der Untersuchungen des Radiosignals käme diesem wohl mehr als gelegen. Der Militär hatte genug mit anderen Aufgaben zu tun, als dass er sich um eine Botschaft kümmern konnte, die sich am Ende doch als nutzlos herausstellen würde. So versicherte Walg, in der Hoffnung keinen weiteren Schaden anzurichten, nur: „Ich tue, was ich kann!“
-
Der triste Bau, in den er jeden Abend kehrte, um dort die Nacht zu verbringen, war bei seiner Rückkehr schon gut gefüllt. Die meisten seiner Mitbewohner waren bereits von ihrer Arbeit nach Hause gekehrt. Viel lieber hätte er in einer natürlichen Höhle gewohnt, die er mit weit weniger Elaborä hätte teilen müssen. Doch diese waren, nachdem sie über Jahrzehnte hinweg verpönt gewesen waren, nun nur noch den Besseren vorbehalten. Man hatte die Höhlen mit allerlei Luxus ausgestattet, sodass sie der einfachen Behausung der durchschnittlichen Unterwasserbewohner weit überlegen waren. Große Glasfronten boten einen perfekten Schutz vor Strömungen und die Räume waren nicht nur weit besser gegen Temperaturschwankungen isoliert, sondern verfügten zudem über Heizungen. Ganz abgesehen davon, war das Wasser in ihnen viel klarer, als in den heruntergekommenen uralten Bauten, die immer noch einen Großteil der Städte bildeten und mit denen nun Bonar vorliebnehmen musste. Aus Mangel an natürlichen Höhlen war man dazu übergegangen, künstliche anzulegen. Dazu trieb man entweder Stollen tief in das Felsenreich, oder man versah andere Bauten mit einem natürlich wirkenden Ambiente: künstlich angelegten Überhängen, Seegraswiesen und Muschelbänken. Doch beides, sowohl eine natürliche, als auch eine künstlich angelegte Höhle, waren für Bonar unerreichbar. Solange man keine gehobene Stellung innehatte, musste man sich mit den alten, schlecht isolierten und zudem trüben Behausungen zufriedengeben, die in rechten Winkeln eine zwar praktische, aber doch wenig einladende Architektur boten. Bonar hätte schon gerne ein anderes Zuhause gehabt, doch dafür seine Freiheit zu opfern, wäre ihm nie in den Sinn gekommen. Es wäre es nicht wert gewesen.
Überall bereiteten sich seine Mitbewohner auf die Nacht vor. Die meisten waren einfache Arbeiter, nur wenige gingen niederen Tätigkeiten in der Verwaltung nach. So waren um diese Zeit die Reinigungsräume zum Bersten voll, während die anderen Räume noch mehr Platz boten. Wer die Zeit hatte, studierte die Zeitungen; überall stachen die bunten Seiten mit den ihrer Sprache nachempfundenen Mustern aus der eher grauen Umgebung hervor. Wie einfach es doch war, ihre Sprache wiederzugeben. „Grün und Gelb“ - Ja, „Blau und Rot“ - Nein. So simpel es auch war, die Erfindung der Schrift und mehr noch die Möglichkeit sie massenhaft zu drucken, war ein Wendepunkt in der Entwicklung der Elaborä gewesen. Doch auch wenn diese Technik längst veraltet war, war sie noch immer effektiv. Genau genommen war sie ja auch in den neueren Medien immer noch präsent. Denn die Muster ihrer Schrift blieben natürlich die gleichen, egal ob gedruckt oder auf einem Bildschirm dargestellt. Doch die Neuen Medien gewannen immer mehr an Bedeutung, die kleinen Computer, auf denen man sehr viel schneller aktuelle Nachrichten abrufen konnte, wurden immer beliebter. Vielleicht würden sie doch eines Tages die althergebrachten Zeitungen ablösen. Wer wusste das schon?
Die Strömung zog Bonar hinein, tief durch die Gänge, die alle Räume des Baus miteinander verbanden, vorbei an den Speise-, den Wasch- und nicht zuletzt den Auditorräumen mit ihren Teleauditoren. Eine Vielzahl dieser Räume bot den Bewohnern ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Von einfach gestrickten Programmen für die Massen, über Dokumentationen und Abenteuerfilmen, bis hin zu den Nachrichten. Er mochte es nicht besonders, sich in einen dieser Räume zu begeben und sich, von den zumeist seichten Programmen, berieseln zu lassen. Auch wenn ihm die akustische Illusion, selbst im kurzen Vorbeischwimmen, eine atemberaubende Umgebung vorgaukelte. Nur zu den Nachrichten fand er sich zumeist dann doch in einem der Räume ein. Gerade zu einem Zeitpunkt, da viele die Säle wieder verließen. Den meisten war es egal, was um sie herum geschah. Doch Bonar wollte wissen, was da draußen, rund um den Planeten, so vor sich ging. Er wollte wissen, was für Pläne die planetenumspannende Regierung hatte und wo diese durch Katastrophen und Unfälle durchkreuzt wurden. Dass es zumeist nur Erfolgsnachrichten zu verkünden gab, machte ihn zuweilen etwas stutzig. Funktionierte ihr Gemeinwesen wirklich immer so reibungslos? Wenn man genau hinsah, gab es da schon Stimmen, die dies bezweifelten. Doch wer sah schon immer so genau hin?
Er ließ sich weiter treiben, vorbei an hunderten seiner Mitbewohner, von denen er, obwohl sie jeden Abend hier zusammen kamen, kaum einen kannte. Er würde wohl kaum von einem anderen vermisst werden, wenn er sich des Abends nicht einfinden würde. Vielleicht würde einer denken: -Wo ist denn diese komische Krake, die immer wie aus einer anderen Welt wirkt?-, und würde sich doch umdrehen, um seine Ruhe, im dichten Gedränge der eng aneinander geschmiegten Körper, zu finden. Was spielte es schon für eine Rolle? War es nicht egal, wer die Nacht neben, unter oder über einem verbrachte. Dass sie einander Schutz, Wärme und Geborgenheit gaben, war entscheidend; wer dies tat, war dagegen belanglos. Was hatte es schon für einen Nutzen, jemanden näher zu kennen? Sie waren eine Gemeinschaft und in dieser waren sie stark. Der Einzelne zählte dagegen nichts.
Ein paar gab es allerdings doch, die ihn wohl vermissen würden: die jungen Elaborä, die ihm zugewiesen waren. Sie zu unterweisen war seine Aufgabe. Er war kein Lehrer, doch hatte er einige Heranwachsende in nichtschulischen Belangen zu betreuen. Es war seine Aufgabe sie zu unterstützen, ihnen Hilfestellungen zu geben oder ihnen den rechten Weg zu weisen. Er sollte ihnen Halt geben und sie in Dingen, die sie zum ersten Mal taten, einweisen. Die Halbstarken würden ganz sicher registrieren, sollte er einmal nicht zur Nachtruhe erscheinen. Sie würden sich plötzlich ziemlich verloren in einer Umwelt wiederfinden, in der sie sich kaum allein zurechtfinden konnten. Dass sie dann ein anderer Elaborä unter seine Obhut nehmen würde, war nicht gerade wahrscheinlich. Niemand übernahm gerne Arbeit, zu der er nicht verpflichtet worden war.
Das Verhältnis zu seinen Schützlingen war jedoch ein loses. Kaum entwickelte sich einmal eine engere Beziehung. Keiner seiner Betreuten entwickelte für ihn ähnliche Gefühle, wie er für sie. Doch was waren schon Gefühle. Würde ihn jemand danach befragen, wo sollte er dann nur anfangen? Wie konnte man jemanden Gefühle beschreiben, der sie noch nie bewusst wahrgenommen hatte? In den Schulen wurde den jungen Elaborä viel beigebracht, doch was Gefühle waren, erklärte ihnen niemand.
„Ein Gefühl! Lass es mich mal so erklären.“, wagte er einmal einen Versuch, als die Rede darauf kam. „Es gibt sehr viele verschiedene Arten von Gefühlen. Ein sehr Starkes, wenn nicht sogar das stärkste überhaupt, ist das Gefühl des Hungers.“
„Hunger?“
„Ja, Hunger ist wie gesagt eines unserer stärksten Gefühle. Es gibt auch weitere Gefühle, wie etwa das Gefühl, das Wärme und Kälte verursacht; oder die Strömung des Wassers, die wir auf unserem Körper verspüren; oder den Geruch, den eine Seegraswiese verströmt.“
Sein Gesprächspartner schüttelte abermals verständnislos den Kopf „Ja, ich verstehe schon. Aber was ist daran so besonders?“
„So besonders? Nun, alles was wir wahrnehmen, verbindet uns mit unserer Umwelt. Ohne unsere Gefühle, ohne unsere Sinneswahrnehmungen, würden wir unsere Umwelt nicht begreifen.“
Er verschwieg, dass dies nur ein Teil der Wahrheit war, die er für sich gefunden hatte. Gefühle waren nicht nur dazu da, die Welt um sie herum wahrzunehmen, sie waren dazu in der Lage, eine ganz eigene zu erschaffen.
„Alles schön und gut, aber was hat es für einen Sinn sich mit so etwas zu beschäftigen? Wieso machen Sie nicht etwas Sinnvolleres? Wieso beschäftigen Sie sich nicht mit Mathematik?“
„Rechnen?“
„Ja, die Mathematik ist die Grundlage unserer Zivilisation!“
Das hatte Bonar gerade noch gefehlt. Dieses elfmalkluge Geschwätz eines Kindes, das noch so viel zu lernen hatte und welches dieses irgendwo aufgeschnappt und nun Wort für Wort von sich gab, ohne die tieferen Zusammenhänge zu kennen. „Bist du denn gut in Mathematik?“
„Es geht so.“, gab der Kleine fahl zu.
„Was ist denn fünf und zehn?“
Die Aufgabe war zu einfach, als dass er den kleinen Plagegeist damit hätte loswerden können.
„Fünf, sechs, sieben, zehn, elf…“, begann dieser, seine zehn Finger zur Hilfe nehmend, für sich zu rechnen. „Fünfzehn!“, brach er schließlich heraus.
„Ja, richtig! Und was ist 14 mal 21?“
Das war eindeutig besser. Der kleine Sago würde lange brauchen, bis er das richtige Ergebnis, 314, heraus haben würde. Bis dahin hatte er seine Ruhe und konnte sich ungestört seinen Bildern widmen.
-
Wieder war ein Tag vergangen. Ein Tag wie so viele davor. Das Gespräch mit Marschall Traul lag schon einige Wochen zurück, doch ging es ihm seither nicht mehr aus den Gehirnen. So wenig er anfangs motiviert gewesen war, den Auftrag erfolgreich zu beenden, so sehr fürchtete er nun, man könne ihn ihm wieder entziehen. Mit Traul war nicht zu spaßen. Er war ein alter Militär und auch wenn es schon lange keine Schlachten mehr zu schlagen galt, war er gewohnt zu kämpfen. Er durfte nicht den Fehler machen ihn zu unterschätzen. Des Marschalls aufgedunsenes Äußeres hatte schon so Manchen getäuscht. Denn nichts, was den Erfolg der Elaborä gefährden könnte, würde er akzeptieren; und sei es nur, dass Mittel unnötig verschwendet wurden. Dass Walg überhaupt der Auftrag übermittelt worden war, das Projekt zu übernehmen, war Traul nun zutiefst zuwider. Lieber heute als morgen hätte er es gerne eingestellt gesehen. Und er würde jede sich bietende Gelegenheit nutzen, damit es auch soweit kommen würde. Nein, wenn er keine Ergebnisse lieferte, so würde Traul früher oder später den Kampf gewinnen und das Projekt ganz einstellen. Was sollte auch eine Suche nach etwas, was sich am Ende doch nur als das Leuchten eines ungeheuer weit entfernten Sternes entpuppen würde. Vor einigen Wochen noch wäre es ihm gleichgültig gewesen. Doch nun war er sich, und all seine Kollegen mit ihm, sicher, dass es kein Zufall sein konnte. Es war eine Nachricht! Und nicht nur etwa das zufällige Mithören, einer nicht für sie bestimmten Nachricht. Daran gab es nicht mehr den geringsten Zweifel. Und ihre Aufgabe musste es sein, sie zu entschlüsseln. Sie mussten herausfinden, was diese Fremden von ihnen wollten. Mussten Wege finden, den Wissensstand der anderen zu erkennen. Vielleicht konnten sie daraus etwas lernen? Vielleicht konnten sie davon profitieren? Doch wieso verstanden sie es nicht, die Nachricht zu entschlüsseln?
Seine Gedanken schwirrten wirr umher, als seine Glieder auf dem abendlichen Weg die ersten Wellen des Ozeans berührten. Sie machten etwas falsch. Sie mussten anders an die Sache herangehen. Nur, wie? Wie hatten die fremden Wesen ihre Nachricht erstellt? Wie konnte man hinter einen Code kommen, von dessen Schöpfer man nicht die geringste Ahnung hatte? Wie sahen die Wesen wohl aus? Wie war deren Wahrnehmung? Empfanden sie ähnlich, wenn sie des Abends ihre Glieder ins erfrischende Nass streckten, wie er es gerade tat? Einer Erlösung gleich war auch heute der erste Kontakt mit dem Wasser. Noch spülte die Brandung leicht um seine Füße, doch gleich schon würde das Wasser tiefer, die Strömung stärker und er würde unwiderstehlich in die Tiefe gezogen werden. Er liebte diesen Moment und zog es auch deshalb vor, alleine zurückzukehren. Er hätte, wie die meisten seiner Kollegen, auch das Schienenboot nehmen können. Gleich hinter dem Observatorium hätte er in das mit Wasser gefüllte Gefährt steigen können und wäre in Windeseile wieder zurück gewesen. Doch das Wasser im Boot war immer so stickig und der erfrischende Moment des Eintauchens weit weniger befriedigend. Seine Kollegen sahen dies ganz offensichtlich anders und bevorzugten die Fahrt mit dem öffentlichen Transportmittel. Es war auch sehr ungewöhnlich, dass ein Elabora das Alleinsein bevorzugte. Gerne gesehen war es schon gar nicht. Doch einem Wissenschaftler seines Formates vergab man gerne diese Schrulligkeit. Was seinen Kollegen dadurch nicht alles entging, dachte Walg bei sich, als ihn auf einmal ein ganz anderer Gedanke verstörte. Ein Gedanke, der nicht vollkommen neu war. Ein Gedanke, der ganz offensichtlich, doch der zu Ende zu denken so unendlich schwer war. Natürlich konnte man nicht davon ausgehen, dass die fremden Wesen eine ähnliche Umwelt hatten, wie sie selbst. Vielleicht lebten sie ja gar nicht im Wasser? Vielleicht waren ihre Sinne ganz anders ausgerichtet, als sie es bei den Elaborä waren? Vielleicht nahmen sie ihre Umwelt ganz anders wahr? Wenn dem so war, so müsste ihre Nachricht gezwungener maßen eine ganz andere Natur haben, als eine Nachricht, die von Elaborä erstellt werden würde. Ja, das ergab Sinn. Er musste sich von seinen eigenen Gedanken, von seinen eigenen Erwartungen lösen. Nur, wie sollte ihm das gelingen? Wie konnte er sich von seiner Welt, von seinen Erfahrungen lösen, um in eine ganz andere, eine vollkommen fremde Welt einzutauchen? Wenn er nur ansatzweise gewusst hätte, wie die Welt der Fremden aussah, welche Erfahrungen und Sinneseindrücke sie bestimmten, so hätte er einen Punkt gehabt, an dem er ansetzen hätte können. Doch er hatte keinen solchen Punkt. Er konnte sich nicht vorstellen, was für die Fremden wichtig war, wie ihr Leben verlief und was für ein Bild sie sich von ihrem Dasein machten.
Langsam nur war er bei all diesen Gedanken in das flüssige Element des Ozeans getaucht. Nun umspülten seine Augen die ersten Wellen. Kurz verwischte das scharfe Bild der luftumspülten Landschaft, um bald schon ein weit weniger scharfes der Unterwasserlandschaft zu liefern. Innerlich schaltete er von seinen Augen auf seine Ohren um. Hier unten waren sie von weit größerem Nutzen. Die Augen? Was machte er mit seinen Augen? Er hatte sie noch immer geöffnet, doch die Bilder, die sie nun lieferten, waren im Wasser weit weniger von Bedeutung. Er hörte seinen Weg. Die Sinneshaare an seinem Körper erfühlten die Strömung. Und wenn er das Echo der steilen Felswand hörte, wusste er, dass er links abbiegen musste. Ganz selbstverständlich eben. Doch konnte es auch anders sein?
Die Strömung trug ihn den Abhang entlang. Wie einfach es war, sein Ziel zu erreichen, wenn man den richtigen Weg nur kannte. Dagegen mühte sich ein Ortsfremder zuweilen vergeblich gegen die Strömung, seinen Körper am Boden laufend gegen das mächtige Element stemmend und dabei doch kaum vorankommend. Erging es ihm in seiner Arbeit genauso? Gab es bei der Entschlüsselung der Nachricht einen weit einfacheren Weg? Würde ihn die Strömung des Wissens weiter tragen, wenn er sie erst einmal gefunden hatte?
Er hörte zuerst die Gestalt, ehe er sie, in dem von vielen Schwebeteilchen getrübten Wasser, auch optisch wahrnehmen konnte. Ein einzelner Elabora. Was machte er da? Leicht versteckt hinter einem kleinen Riff. Normalerweise hätte er ihm kaum Beachtung geschenkt, doch etwas war anders an diesem Elabora. Er saß auf einem Felsvorsprung, oberhalb der Stadt, die Walgs Heimat war und hielt etwas in Händen. Tausende von Fischen schwammen um ihn herum, als hätten sie keine Angst vor ihm und bräuchten nichts fürchten. Wahrscheinlich hatten die Fische mit dieser Einschätzung sogar recht, denn die Gestalt war ganz offensichtlich nicht damit beschäftigt, sich ein Abendessen zu besorgen. Aber was tat sie da? Walg schwamm näher heran, konnte aber weder von vorne noch von der Seite erkennen, was der Fremde vor sich hielt. Er ließ sich zu ihm hinab treiben und verankerte seine Glieder auf dem festen Grund neben dem eigenartigen Elabora.
„Was tun Sie da?“, erkundigte er sich.
Der Fremde sah ihn erschrocken an. Er hatte ganz offensichtlich nicht damit gerechnet, aufgespürt zu werden. Dass er nun erwischt worden war, war ihm sichtlich peinlich.
Er war erwischt worden, leugnen hatte keinen Zweck, daher antwortete er zögernd: „Ich zeichne!“
„Sie… zeichnen?“
Noch immer erschrocken, in der Angst in große Schwierigkeiten zu geraten, und obwohl er den Fremden noch nie gesehen hatte, erklärte Bonar: „Ich nehme unsere Welt optisch wahr und halte die Eindrücke in einem Bild fest.“
Niemand wusste von seinen Aktivitäten. Keiner würde ihn verstehen. Zwar war nichts, was er tat, verboten, doch gern gesehen war es mit Sicherheit dennoch nicht. Es bedeutete ja auch nicht, dass etwas, das nicht verboten war, damit auch erlaubt war. Vielleicht war nur noch niemand auf die Idee gekommen, es in den Verbotskatalog mit aufzunehmen. Wie also würde der aufdringliche Fremde seine Äußerung aufnehmen? Brachte er sich damit selbst in Gefahr?
Vor Walg begann sich derweil alles zu drehen. War es das? War es so einfach? Er wusste nicht, was er sagen, wie er dem Fremden danken sollte. So sagte er nur: „Danke!“
„Wieso danken Sie mir?“, wunderte sich Bonar in Erwartung einer ganz anderen, einer viel unfreundlicheren Erwiderung.
„Weil Sie mir geholfen haben!“
„Ich habe Ihnen geholfen?“, gab Bonar erstaunt zurück.
„Ich glaube Sie haben mich auf den richtigen Weg geführt, weg aus der Gegenströmung, hinein in einen Strudel, der mich ganz leicht ans Ziel bringen könnte.“
„Sie sprechen in Rätseln!“
„Ja, das glaube ich. Wie könnte ich…? Wissen Sie was, kommen Sie morgen mit. Ich werde Ihnen zeigen, woran ich arbeite und was für einen Dienst Sie mir und meiner Sache erwiesen haben.“