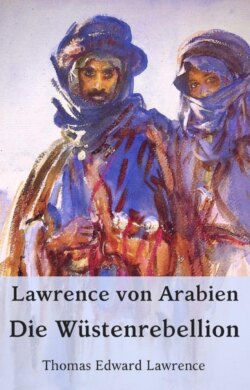Читать книгу Lawrence von Arabien - Die Wüstenrebellion - Thomas Edward Lawrence - Страница 6
1. Storrs landet in Djidda
ОглавлениеAls wir endlich im Außenhafen von Djidda vor Anker gingen, angesichts der weißen Stadt, die schwebend hing zwischen dem flammenden Himmel und seiner Spiegelung, die leuchtend über die weite Lagune hin wallte, da kam Arabiens Glut gleich einem gezückten Schwert über uns und machte uns stumm. Es war ein Oktobermittag des Jahres 1916, und die steile Sonne hatte, wie Mondlicht, alle Farben ausgelöscht. Man sah nur Licht und Schatten, weiße Häuser und schwarze Straßenschlünde; davor der fahl schimmernde Dunst über dem Innenhafen; dahinter breitete sich in blendendem Glanz ein meilenweites Meer von Sand und verlor sich gegen den Saum einer niedrigen Hügelkette, die nur eben wie hingehaucht lag in dem fernen Geflimmer der Hitze.
Hart nördlich von Djidda lag eine zweite Gruppe schwarzweißer Gebäude, die in der Spiegelung wie Kolben auf und ab tanzten, während das Schiff vor Anker rollte und einzelne Windstöße Glutwellen durch die Luft trugen.
Oberst Wilson, der britische Geschäftsträger beim jungen arabischen Staat, hatte uns seine Barkasse entgegengeschickt; und erst als wir den Fuß an Land setzten, überzeugten wir uns von der Wirklichkeit dieser schwebenden Fata Morgana. Unser Weg zum Konsulat führte uns an dem weißen Mauerwerk der noch unfertigen Hafenmole vorbei und durch die enge, stickige Gasse der Lebensmittelhändler. Allerorten, vom Dattelverkäufer bis zu den Fleischbänken, schwirrten Scharen von Fliegen gleich Stäubchen in den schmalen Sonnenstreifen, die durch die Ritzen und Löcher der hölzernen und sackleinenen Schutzdächer bis in die dunkelsten Winkel der Buden stachen. Die Luft war wie ein heißes Bad.
Wir erreichten das Konsulat; und daselbst, in einem schattigen Raum, ein offenes Gitterfenster im Rücken, saß Wilson, in hoffnungsvoller Erwartung der frischen Brise von der See, die in den letzten Tagen ausgeblieben war. Er erzählte uns, daß Scherif Abdulla, der zweite Sohn Husseins, Großscherifs von Mekka, soeben in der Stadt eingezogen sei. Ronald Storrs und ich waren von Kairo aus das Rote Meer heruntergefahren, um uns mit Abdulla zu unterreden. Dieses gleichzeitige Eintreffen war also eine glückverheißende Fügung; denn Mekka, die Hauptstadt des Scherifats, ist für Christen unzugänglich, und Geschäfte, wie die Storrs', konnten füglich nicht durchs Telephon erledigt werden. Meine Anwesenheit segelte unter der Flagge einer Vergnügungsreise; Storrs aber, Orientalist und Sekretär bei der Residentschaft in Kairo, war der Vertrauensmann Sir Henry Mc Mahons bei all den heiklen Verhandlungen mit dem Scherif von Mekka. Die glückliche Vereinigung seiner Landeskenntnis mit der Erfahrung und dem Scharfsinn Sir Henrys und dem gewinnenden Wesen Claytons hatten einen so starken Eindruck auf den Scherif gemacht, daß diese ungemein schwierige Persönlichkeit in den bedingten Abmachungen eine ausreichende Sicherung sah, um den Aufstand gegen die Türkei zu beginnen, und daß er auch späterhin England die Treue hielt während eines an Wechselfällen und gefährlichen Krisen überreichen Krieges.
Abdulla erschien bei uns in feierlichem Aufzug, auf einer Schimmelstute reitend, mit einem Gefolge reichbewaffneter Sklaven zu Fuß und begleitet vom ehrfürchtig schweigsamen Gruß der Bevölkerung. Er war noch ganz erfüllt von seinem jüngsten Erfolg bei Taif und in glücklichster Stimmung. Ich selbst sah ihn zum erstenmal, Storrs hingegen war ein alter Freund von ihm und stand mit ihm auf bestem Fuß. Mein erster Eindruck von ihm, während sie miteinander sprachen, war der einer beständigen Vergnügtheit. Der Schalk saß ihm in den Augenwinkeln, und trotz seiner fünfunddreißig Jahre hatte er auch schon Fett angesetzt, vermutlich von allzu vielem Lachen. Er scherzte mit allen Anwesenden auf die liebenswürdigste Art. Als sich dann die Unterhaltung ernsten Gegenständen zuwandte, schien allerdings die Maske des Frohsinns zu verschwinden, wie er denn auch seine Worte mit Sorgfalt wählte und seine Gründe scharfsinnig darzulegen wußte. Freilich hatte er es auch mit einem Mann wie Storrs zu tun, der in der Diskussion hohe Anforderungen an seinen Gegenpart stellte.
Ich hielt mich beobachtend im Hintergrund und suchte mir ein Urteil über ihn zu bilden. Der Aufstand des Scherifs hatte in den letzten Monaten nur geringe Fortschritte gemacht (war sogar zum Stillstand gekommen: der Anfang vom Ende bei jedem Kleinkrieg) und meiner Meinung nach lag das an einem Mangel an Führung; denn nicht Verstand, Urteil, politische Einsicht, sondern nur die Flamme der Begeisterung vermochten die Wüste in Brand zu setzen. Mein Besuch galt hauptsächlich dem Zweck, den überragenden Führergeist für die Sache ausfindig zu machen und seine Eignung daraufhin zu prüfen, ob er den Aufstand bis zu dem mir vorschwebenden Ziel vorwärts zu tragen imstande wäre. Im Laufe des Gesprächs kam ich mehr und mehr zu der Überzeugung, daß der ausgeglichene, kühle und nüchterne Abdulla nicht der Prophet war, den ich suchte: vor allem nicht der Prophet mit dem Schwert, der allein – wenn die Geschichte wahr spricht – Erhebungen zu Erfolg zu führen vermag. Sein Wert mochte vielleicht später nach glücklichem Vollbringen zur Geltung kommen.
Storrs zog mich in die Verhandlung, indem er Abdulla nach seiner Ansicht über den gegenwärtigen Stand des Feldzugs fragte. Dieser wurde sofort ernst und sagte, er wünschte die Engländer von der dringenden Notwendigkeit ihrer sofortigen und persönlichen Mitwirkung bei der Sache zu überzeugen, was er folgendermaßen begründete:
Durch unser Versäumnis, die Hedjasbahn zu unterbrechen, seien die Türken in der Lage, fortgesetzt Truppen und Material zur Verstärkung nach Medina zu senden.
Faisal sei von der Stadt vertrieben worden; und der Feind sei bereits dabei, eine fliegende Kolonne aller Waffengattungen aufzustellen, um mit ihr gegen Rabegh vorzurücken.
Die Araber in den Bergen längs des Weges nach Rabegh seien infolge unserer Säumnis zu schwach an Artillerie, Maschinengewehren und sonstigem Material, um den Vormarsch ernstlich aufhalten zu können.
Hussein Mabeirig, der Scheikh der Rabegh-Harb, habe sich auf seiten der Türken gestellt. Sobald die Kolonne von Medina vorrücke, würden sich die Harb anschließen.
Danach also bliebe seinem Vater nichts anderes übrig, als sich an die Spitze seines Volkes von Mekka zu stellen und angesichts der Heiligen Stadt im Kampf zu sterben.
In diesem Augenblick läutete das Telephon: Der Großscherif wünschte Abdulla zu sprechen. Er wurde vom Stand unserer Unterredung unterrichtet und bestätigte sogleich, daß er äußerstenfalls so handeln würde. Die Türken würden nur über seine Leiche in Mekka eindringen. Das Telephon klingelte ab; Abdulla wandte sich ein wenig lächelnd zu uns und fragte, ob zur Verhütung solchen Unheils eine englische Brigade, wenn möglich aus mohammedanischen Truppen bestehend, in Suez transportbereit gehalten werden könne, um, wenn die Türken von Medina vorrückten, nach Rabegh geworfen zu werden. Was wir über diesen Vorschlag dächten?
Ich antwortete, daß ich seine Meinung der ägyptischen Regierung unterbreiten würde, daß aber England nur sehr ungern Truppen der entscheidenden Verteidigung Ägyptens entziehen würde (obgleich er nicht glauben dürfe, daß der Kanal irgendwie ernstlich durch die Türken bedroht sei), und daß England noch weniger geneigt wäre, etwa Christen zur Verteidigung der Heiligen Stadt zu Hilfe zu schicken, da gewisse mohammedanische Kreise in Indien, die an dem unverjährbaren Recht des Türkischen Reiches auf die Haramein festhielten, unsere Beweggründe und unser Handeln falsch auslegen würden. Ich glaubte aber, daß ich seine Vorschläge vielleicht wirksamer unterstützen könnte, wenn ich über die Rabegh-Frage auf Grund persönlicher Einsicht in die dortigen Verhältnisse und Stimmungen zu berichten in der Lage wäre. Auch würde ich Faisal gern sehen, um mich mit ihm über alles Notwendige zu besprechen, namentlich über die Möglichkeit einer längeren Verteidigung durch die Stämme seines Berglandes, wenn wir sie mit Material unterstützten. Mein Wunsch sei, von Rabegh die Sultanistraße gegen Medina hinaufzureiten bis zum Lager Faisals.
Storrs legte sich ins Mittel und unterstützte mich nach Kräften, indem er darauf hinwies, wie außerordentlich wichtig es für das Britische Oberkommando in Ägypten sei, durch einen geübten Beobachter eingehend und rechtzeitig über die Lage unterrichtet zu werden. Abdulla ging ans Telephon und versuchte die Einwilligung seines Vaters für meine Bereisung des Landes zu erhalten. Der Scherif nahm den Vorschlag mit entschiedenem Mißtrauen auf. Abdulla setzte die Gründe auseinander, wies auf die Vorteile hin und übergab dann Storrs das Hörrohr, der seine ganze diplomatische Kunst bei dem Alten spielen ließ. Storrs in vollem Schwung zuzuhören, war ein Genuß, allein schon der arabischen Sprache wegen, aber auch eine wirksame Lektion für jeden Engländer, wie man mit argwöhnischen und widerspenstigen Orientalen umzugehen hat. Es war schlechthin unmöglich, ihm länger als einige Minuten zu widerstehen, und auch in diesem Falle erreichte er seinen Zweck. Der Scherif verlangte wieder nach Abdulla und ermächtigte ihn, an Ali zu schreiben und ihm anheimzustellen, mir die Erlaubnis zum Besuch Faisals zu geben, falls er es für angemessen hielte und nichts Besonderes dagegen vorläge. Abdulla veränderte unter Storrs' Einfluß diesen bedingten Bescheid in eine klare schriftliche Anweisung an Ali, mich so schnell wie möglich mit guten Reittieren zu versehen und unter voller Sicherheit zum Lager Faisals zu bringen. Da das alles war, was ich, und ein gut Teil von dem, was Storrs begehrte, begaben wir uns zu Tisch.
Die Stadt Djidda hatte uns schon auf dem Weg zum Konsulat gut gefallen. Nach dem Mittagessen, als es ein wenig kühler war oder wenigstens die Sonne nicht mehr so hoch stand, machten wir uns daher auf den Weg, um geführt von Young, dem Sekretär Wilsons, einem Mann, der sich in den Dingen von einst besser auskannte als in den Dingen von heute, die Sehenswürdigkeiten zu besichtigen.
Djidda war in der Tat eine merkwürdige Stadt. Die Straßen waren schmale Gassen, im Basarviertel holzüberdeckt, und da, wo sie offen waren, blickte der Himmel nur durch einen schmalen Spalt zwischen den hohen Firsten der weißgetünchten Häuser. Diese, aus Korallenkalkstein gebaut, waren vier bis fünf Stockwerk hoch, durch viereckige Balken versteift und mit weiten Bogenfenstern versehen, die durch graue, vom Boden bis zum Dach laufende Holztäfelungen verbunden waren. Die Fenster in Djidda hatten keine Scheiben, dafür aber eine Fülle schönen Gitterwerks, und einige der Umrahmungen zeigten sehr feine Flachornamentik. Die schweren, zweiflügeligen Türen aus Teakholz waren reich geschnitzt, oft mit viereckigen Gucklöchern versehen und mit Angeln und Ringklopfern von kunstvoller Schmiedearbeit. Man sah auch viel Stuckplastik, und an älteren Häusern reichgeschnittene Steinknäufe und Pfosten an den zum Innenhof gehenden Fenstern.
Die ganze Bauweise erinnerte an den zierlichen Fachwerkstil aus dem Elisabethanischen Zeitalter, namentlich in der überladenen Manier von Cheshire, jedoch auf eine kapriziös spielerische Art bis zur äußersten Spitze getrieben. Die Fronten der Häuser waren filigranartig durchbrochen und getüncht, so daß sie aussahen wie aus Pappe geschnitten für irgendeine romantische Bühnendekoration. Jedes Stockwerk überragte das andere, kein Fenster saß gerade, und oftmals standen selbst die Wände schief. Djidda war fast wie eine tote Stadt, so lautlos und still. Die winkligen Gassen waren mit feuchtem, mit der Zeit festgetretenem Sand bedeckt, so daß man geräuschlos wie über einen Teppich schritt. Alle die Gitter und Nischen fingen jedes laute Wort ab. Es gab weder Wagen – dazu waren die Straßen zu schmal – noch Hufgeklapper, noch lärmendes Treiben. Alles war gedämpft, gedrückt und fast wie verstohlen. Die Haustüren schlossen sich lautlos, wenn wir vorübergingen. Man hörte kein Kindergeschrei, kein Hundegebell; und nur in dem noch halb schlafenden Basar sahen wir einige Fußgänger. Die wenigen, die wir trafen, magere Gestalten mit haarlosen, narbigen, wie von Krankheit verwüsteten Gesichtern und zusammengekniffenen Augen, glitten rasch und scheu an uns vorbei, ohne uns anzublicken. In ihren dürftigen weißen Kleidern, mit den Käppchen auf den geschorenen Schädeln, roten baumwollenen Überwürfen und bloßen Füßen sahen sie einer wie der andere aus, fast wie uniformiert.
Die Luft war tödlich beklemmend, wie leblos: nicht glühend heiß, sondern voll eines gewissen Moderduftes, eines Hauchs von Alter und Erschöpfung, wie wir ihn noch in keiner anderen Stadt gespürt hatten: keine Orgie von Gerüchen wie in Smyrna, Neapel oder Marseille, sondern ein Muff von Verbrauchtsein, von Ausdünstung vieler Menschen, von ständigem, heißem Badedunst und Schweiß. Man hätte meinen können, Djidda wäre seit Jahren von keinem frischen Windzug durchlüftet worden, und die Straßen bewahrten jahraus jahrein, seit die Häuser standen und solange sie stehen würden, immer die gleiche Luft. Im Basar gab es auch nichts Gescheites zu kaufen.
Am Abend läutete das Telephon; der Scherif wünschte Storrs zu sprechen und fragte ihn, ob wir Lust hätten, seine Musikkapelle zu hören. Storrs fragte erstaunt, was das für eine Kapelle wäre, und beglückwünschte Seine Heiligkeit zu dieser entschieden kulturfördernden Erwerbung. Der Scherif erzählte, daß beim Hauptquartier des türkischen Hedjas-Kommandos ein Trompeterkorps gewesen war, das jeden Abend vor dem Generalgouverneur gespielt hatte; und als der Generalgouverneur durch Abdulla bei Taif gefangengenommen wurde, geriet mit ihm auch seine Kapelle in Gefangenschaft. Die Kriegsgefangenen wurden zur Internierung nach Ägypten geschickt, mit Ausnahme der Kapelle, die in Mekka zurückbehalten wurde, um die Sieger mit ihren Weisen zu erfreuen. Scherif Hussein legte das Hörrohr auf den Tisch in seiner Empfangshalle, und wir, einer nach dem andern feierlich zum Apparat gerufen, hörten die Musik in dem fünfundvierzig Meilen entfernten Palast von Mekka. Storrs gab unser aller hoher Befriedigung Ausdruck, und der Scherif, seine Huld überbietend, erklärte, daß die Kapelle in Eilmärschen nach Djidda gesandt werden sollte, um bei uns im Hof zu spielen. »Und«, fügte er hinzu, »ihr macht mir dann das Vergnügen, mich von dort aus anzuläuten, damit ich euren Genuß teilen kann.«
Am nächsten Tag besuchte Storrs Abdulla in seinem Zelt außerhalb der Stadt beim Grab der Eva. Sie besichtigten zusammen das Lazarett, die Baracken, die städtischen Behörden und erfreuten sich an der Gastfreundschaft des Bürgermeisters und des Gouverneurs. Zwischendurch sprach man von Geld, vom Titel des Scherifs, seinen Beziehungen zu den übrigen Fürsten Arabiens und von der allgemeinen Kriegslage: unverbindliche Gemeinplätze, wie sie zwischen Gesandten zweier Regierungen üblich sind. Mich langweilte das, und ich hielt mich meist fern; denn es stand bei mir fest, daß Abdulla nicht der Führer war, den wir brauchten.
Als interessanter erwies sich die Gesellschaft von Scherif Schakir, Abdullas Vetter und bestem Freund. Schakir, ein Grande von Taif, war von Kindheit an Spielkamerad der Söhne des Großscherifs gewesen; und noch jetzt betrieb er alles – im Privat- wie im Staatsleben – gleichsam als Spiel im Großen, mit allen Mitteln seines Reichtums, seines Mutes und Selbstvertrauens. Nie zuvor war ich einem Menschen von so jäher Gemütsart begegnet: in einem Augenblick umspringend von frostiger Würde zu einem Wirbelwind von Ausgelassenheit – stürmisch, leidenschaftlich, kraftvoll, herrlich. Sein Gesicht, von Blatternarben bis auf die letzten Haarwurzeln zerfressen, spiegelte wie die Fensterscheibe eines fahrenden Wagens alles zugleich, was drinnen und draußen vorging. Bei der Belagerung von Taif hatte Abdulla den Oberbefehl gehabt; Schakir aber machte mit den Truppen einen ungestümen Vorstoß, der durch das Übermaß an Tollkühnheit fehlschlug. Die Araber wagten nicht, dem schon in eine Bresche Eingedrungenen zu folgen; und Schakir mußte umkehren, allein und unverwundet, seine Leute verfluchend und verlachend und wilden Hohn hinüberrufend zu dem verdutzten Feind, der sich dadurch rächte, daß er Schakirs schönes Haus in Taif mit Petroleum übergoß und es samt seiner kostbaren Sammlung arabischer Handschriften niederbrannte.
Am Abend kam Abdulla zum Diner zu Oberst Wilson. Wir empfingen ihn im Vorhof an der Treppe des Hauses. Hinter ihm kam sein glänzendes Gefolge von Bedienten und Sklaven, und hinter diesen eine bleiche Schar abgemagerter Gestalten mit bärtigen, kummervollen Gesichtern, in zerlumpte Uniformen gekleidet und verrostete Blechinstrumente tragend. Abdulla wies mit der Hand nach ihnen hin und krähte entzückt: »Meine Kapelle!« Wir brachten sie im Vorhof auf Bänken unter, und Wilson schickte ihnen Zigaretten, während wir zum Speisesaal hinaufstiegen, dessen Balkonläden in Hoffnung auf eine frische Seebrise weit und begierig geöffnet waren. Als wir uns gesetzt hatten, begann die Kapelle, unter den Flinten und Säbeln von Abdullas Gefolge, eine Reihe herzbrechender türkischer Weisen zu spielen, wobei jedes Instrument seine eigenen Wege ging. Uns taten von dem Lärm die Ohren weh; aber Abdulla strahlte.
Wir hatten genug von türkischer Musik und verlangten nach etwas Deutschem. Ein Adjutant trat auf den Balkon und rief der Kapelle auf türkisch zu, etwas Ausländisches zu spielen. Darauf stimmten sie, etwas wackelig zwar, »Deutschland über alles« an, just in dem Augenblick, als der Großscherif in Mekka an sein Telephon kam, um unserer Festmusik zu lauschen. Wir wollten noch mehr deutsche Musik hören, und sie spielten: »Ein feste Burg«. Mitten drin aber versackten sie in ersterbenden Dissonanzen der Trommeln. Die Felle waren durch die feuchte Luft Djiddas aufgeweicht. Sie riefen nach Feuer, worauf Wilsons Diener und Abdullas Leibwache ganze Haufen von Stroh und Kisten heranschleppten. Über der entfachten Glut wurden die Trommeln unter Hin- und Herdrehen erwärmt, und dann legten sie los mit etwas, wovon sie behaupteten, es sei der »Haßgesang«; aber wir konnten darin nichts irgendwie Europäisches entdecken. Einer der Gäste wandte sich an Abdulla und sagte: »Es ist ein Trauermarsch.« Abdulla bekam große Augen; doch Storrs legte sich rasch rettend ins Mittel und brachte durch ein geschicktes Wort alle zum Lachen. Zum Beschluß des Festes sandten wir den kummervollen Musikern eine Belohnung, aber sie schwangen sich zu keiner rechten Freude an unserer Anerkennung auf und baten nur, nach Hause geschickt zu werden.