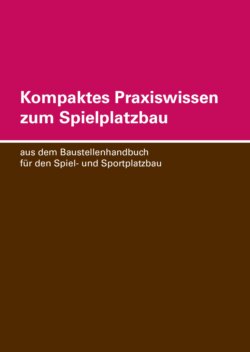Читать книгу Kompaktes Praxiswissen zum Spielplatzbau - Thomas Bauer, Thomas Eisel, Ulrich Keller - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEinfriedungen
Aufgabe von Einfriedungen
Gemäß DIN 18034 sind zum Spielen ausgewiesene Flächen gegenüber Straßen, Gleiskörpern, tiefen Wasserläufen, Abgründen oder Kraftfahrzeugstellplätzen mit einer wirksamen Einfriedung abzugrenzen.
Pädagogisch betreute Spielanlagen sind ebenfalls mit einer nicht ohne weiteres übersteigbaren Einfriedung zu umgeben, wenn die Sicherheit außerhalb der betreuten Spielzeiten nicht gewährleistet ist.
Ballspielbereiche sind gem. der Norm zusätzlich mit Schutzgittern von 400 cm Höhe gegen Verkehrsflächen und Nachbargrundstücke abzuschirmen.
Über die Vorgaben der Norm hinaus erfüllen Einfriedungen folgende Funktionen:
• Abhalten von Tieren
• Vermeidung von Müllablagerungen
Höhere Zäune sind daneben auch eine gute Befestigungsmöglichkeit für diverse Spiele, wie Mal- und Klangtafeln, sowie für Kletterpflanzen.
Die Bestimmungen des jeweiligen Bebauungsplans bzw. des jeweils geltenden Nachbarrechts über Art und Höhe der erlaubten Einfriedungen sind einzuhalten.
Anforderungen an Einfriedungen
Einfriedungen sind so zu gestalten, dass sie ausreichend hoch sind, nicht zum Hochklettern verleiten und keine Gefährdung für Kinder darstellen. Als ausreichende Höhe wird ein Maß von mind. 100 cm angesehen.
• Einfriedungen müssen stabil ausgeführt sein.
• Holzpfosten mit Erdkontakt sind regelmäßig auf ihre Stabilität und Funktionstüchtigkeit zu überprüfen.
• Zäune dürfen nicht zum Hochklettern einladen und nicht bekletterbar sein, da sie sonst ihre Schutzfunktion nicht mehr erfüllen.
• Verletzungsgefahren an Einfriedungen lassen sich vermeiden, wenn an Zäunen, Gittern und Mauern keine spitzen, scharfkantigen und hervorspringenden Teile oder Stacheldraht angebracht werden.
Arten von Einfriedungen
Lebende Einfriedungen
Für lebende Einfriedungen gelten die gleichen Sicherheitsanforderungen wie für tote.
Hecken und Strauchreihen
Hecken für Spielplätze sind i. d. R. freiwachsende Hecken bzw. lockere Blütenhecken. Seltener, und dann v. a. nur in betreuten Einrichtungen, kommen auch geschnittene Hecken zur Verwendung. Hierbei ist immer auch der hohe Pflegeaufwand mit rund zwei Schnitten pro Jahr zu beachten.
| Pflanzenname botanisch | Pflanzenname deutsch |
|---|---|
| Carpinus betulus | Hainbuche |
| Amelanchier lamarckii | Felsenbirne |
| Cornus mas | Kornelkirsche |
| Coryllus avellana | Haselnuss |
| Deutzia x magnifica | Maiblumenstrauch |
| Deutzia scabra | Maiblumenstrauch |
| Forsythia x intermedia | Forsythie |
| Kerria japonica | Kerrie |
| Kolkwitzia amabilis | Kolkwitzie |
| Philadelphus coronarius | Pfeifenstrauch |
| Philadelphus x virginalis | Pfeifenstrauch |
| Ribes alpinum ’Schmidt’ | Alpen-Johannisbeere |
| Ribes aureum | Gold-Johannisbeere |
| Spiraea nipponica | Spierstrauch |
| Spiraea thunbergii | Spierstrauch |
| Syringa vulgaris | Gemeiner Flieder |
Tab. 2: Geeignete, ungiftige Pflanzen für Hecken
Benjeshecken
Benjeshecken oder Totholzhecken sind Hecken, die durch Samenanflug oder Initialpflanzungen entstehen. Das Prinzip der Benjeshecke besteht darin, diese nicht durch Neuanpflanzung, sondern durch Windanflug und Samen aus dem Kot rastender Vögel aufbauen zu lassen. Dazu wird Gehölzschnitt (Äste, Zweige, Reisig) durcheinander, als Haufen oder in Streifen, als Wall locker gestapelt oder noch besser einfach abgekippt. Dies dient wiederum dem Schutz der heranwachsenden Pflanzen. Die Vorteile einer solchen Anlage bestehen zum einen in ihren günstigen Herstellungskosten, da nicht Pflanzen, sondern „Saatgut“ auf natürliche Weise bzw. autochthon eingebracht wird und Schnittholz sowieso oft als „Abfall“ vorhanden ist. Darüber hinaus bietet das locker gelagerte Totholz unmittelbar Lebensraum für zahlreiche Vogelarten (v. a. für Heckenbrüter), Kleinsäuger und Insekten. Auch Kinder und Jugendliche lassen sich sehr gut unter Anleitung und Betreuung beim Bau und Beobachtung einer solchen Hecke an die Themen Natur- und Umweltschutz heranführen.
Spaliere
Auch Spaliere eignen sich als begrünte Einfriedung von Spielplätzen. Der Pflegeaufwand ist dabei höher als bei anderen Einzäunungsarten. Spaliere haben aber gleichzeitig den großen Vorteil, sehr raumsparend auf kleiner Fläche eine ansehnliche, grüne Wand zu schaffen. Geeignet sind in erster Linie Obstgehölze sowie Beerensträucher.
Weidenzäune
Lebende Weidenzäune sind eine gute Möglichkeit, Kinder in den Spielplatzbau mit zu integrieren und ihnen Kenntnisse über Pflanzen und deren Wachstum, aber auch gewisse handwerkliche Fähigkeiten zu vermitteln. Lebende Weidenzäune müssen selbstverständlich die gleichen Sicherheits- und Stabilitätsanforderungen erfüllen wie tote Einfriedungen.
Die frischen Weidenruten können auf verschiedene Arten zu einem Zaun verflochten werden, wie z. B. folgende Abbildungen zeigen:
Bild 1: Variante mit geflochtenen Weidenruten (Quelle: Andres)
Bild 2: Variante mit senkrecht gesteckten Weidenruten (Quelle: Andres)
Bild 3: Variante mit bogenförmig gesteckten Weidenruten (Quelle: Andres)
Tote Einfriedungen
Folgende Zäune in verschiedenen Ausführungen sind für Spielplätze geeignet:
• Holzzäune (z. B. Staketenzaun)
• Maschendrahtzäune mit Holzpfosten oder Metallpfosten (weniger Wartungsaufwand)
• Stabgitterzäune aus Metall
Holzbohlenzäune erfüllen die Anforderung, nicht besteigbar zu sein, nicht und sind daher ungeeignet. Zudem besteht hier meist die Gefahr von Spreißeln. Stacheldrahtzäune sind auf Spielplätzen aufgrund des hohen Verletzungsrisikos ebensowenig zu verwenden.
Bei Holzzäunen sind die Anforderungen des konstruktiven Holzschutzes zu beachten, um die Haltbarkeit zu verlängern und eine wirtschaftliche Lebensdauer zu erreichen.
• Einsatz von für den Verwendungszweck geeigneten Holzarten, wie z. B. Lärche, Douglasie oder auch kesseldruckimprägnierte Kiefer.
• Hirnholzflächen, die direkt der Witterung ausgesetzt sind, werden abgedeckt (Pfostenkappen), abgeschrägt, zugespitzt oder abgerundet, sodass kein Niederschlagswasser stehen bleiben kann.
• Konstruktionshölzer an Ober- und Unterkanten sind dachförmig oder schräg auszuführen.
• Direkter Boden- und Erdkontakt ist bei allen Bauteilen zu vermeiden. Bei Holzpfosten empfiehlt sich daher die Verwendung von sog. Pfostenschuhen (H-Ankern).
Farbgestaltung
Holzzäune müssen nicht immer nur einfarbig und holzfarben sein. Auch hier bietet sich die Einbindung der Kinder an, indem Holzzäune gemeinsam farbig gestaltet werden.
Mauern
Mauern werden seltener verwendet, da diese meist zu kostspielig sind. Grundsätzlich sind aber auch Beton- oder Natursteinmauern für den Einsatz auf Spielplätzen gut geeignet. Sie lassen sich nicht nur zur Gliederung von Räumen einsetzen, sondern auch als Sitz- und Balanciermöglichkeit. Je nach Material sind vielfältige Gestaltungen möglich, von runden, organischen bis hin zu kantigen, geometrischen Formen.
Zugänge
Gemäß FLL-Richtlinie sollten sich „Zuwege zu den Wohngebieten hin öffnen und auf die Besonderheiten des Spielplatzes aufmerksam machen“. Sie sind nach Möglichkeit abseits von Durchgangsstraßen in Nebenstraßen anzuordnen.
Die sichere Gestaltung der Ausgänge von Spielplätzen an nicht vermeidbaren, verkehrsreichen Straßen wird z. B. durch Geländer zwischen Grundstück und Fahrbahn oder durch dichte Pflanzstreifen erreicht.
Spielplätze sollten sich in Wohnungsnähe befinden. Die DIN 18034 gibt dazu folgende Entfernungen vor:
| Für Kinder | Entfernung |
|---|---|
| unter 6 Jahren | 200 m in Sicht- und Rufweite der Wohnung |
| von 6 bis 12 Jahren | bis 400 m Fußweg |
| ab 12 Jahren | bis 1.000 m Fußweg |
Tab. 3: Entfernung zwischen Spielplatz und Wohnung nach DIN 18034
Spielplätze sollten in ihrer Lage und Zugänglichkeit so angelegt sein, dass Kinder diese selbstständig erreichen können.
Beleuchtung
Aus- und Zugänge sowie die dorthin führenden Verkehrswege sind ausreichend zu beleuchten. Die genannten Bereiche innerhalb des Grundstücks sind ausreichend beleuchtet, wenn z. B. Wegführung, Hindernisse und Treppen deutlich erkannt werden können.
Weitere Hinweise finden sich bspw. in der DIN EN 12 464-2 „Licht und Beleuchtung - Beleuchtung von Arbeitsstätten, Teil 2: Arbeitsplätze im Freien“.
Wegeführung
Verbindungsstrukturen, wie Stege, Brücken, Hangel- und Balancierstrecken, lassen sich in ihrer Attraktivität verbessern, wenn sie Höhenpunkte verknüpfen oder durch unterschiedliche Materialzonen, wie Sand, Wasser oder Vegetation, führen.
Für Wartungs- und Rettungsfahrzeuge sind ausreichend breite Wege einzuhalten (gem. der jeweiligen Landesbauordnung) und mit einer tragfähigen Unterkonstruktion bzw. Unterbau zu versehen.
Hauptlaufrichtungen sind von Spielgeräten freizuhalten und so anzuordnen, dass die Spielflächen für Eltern und Aufsichtspersonen gut einsehbar sind.
Eingänge, Ausgänge und Notwege zu und von einem Spielplatz, die sowohl für die Öffentlichkeit zugänglich als auch für die Nutzung durch Rettungsdienste vorgesehen sind, sollten jederzeit zugänglich und frei von Hindernissen sein.
Wege sollten aus sicherheitstechnischen Gründen so gestaltet sein, dass sich die Hauptlaufrichtungen nicht mit den Spielflächen kreuzen.
Tore
Tore sollten stets selbstschließend sein, um ein Offenstehen und die Gefahr durch herausrennende Kinder auszuschließen. Ihre Mindestbreite sollte 150 cm nicht unterschreiten, damit auch Personen mit Kinderwägen, Kinder mit Rollfahrzeugen etc. bequem ein- und ausgehen können.
Aus- und Eingänge sollten deutlich sichtbar sein, z. B. durch farbige Hervorhebungen markiert.
Für Wartungs, Rettungs- und Hilfsfahrzeuge sollten ausreichend breite Tore mit rund 300 cm Breite vorgesehen werden. Am besten geeignet sind dafür zweiflüglige Metalltore.
Tore in Kindertageseinrichtungen sind gem. GUV-V S2 z. B. mit für Kinder unerreichbaren Drückern zu versehen, um unerlaubtes Verlassen und Betreten zu verhindern.
Absturzsicherungen
In Deutschland ist nach A-Abweichung DIN EN 1176-1 ab 100 cm Fallhöhe ein Geländer erforderlich, ab 200 cm Fallhöhe eine Brüstung.
In Europa müssen Geräte, die für Kinder unter 36 Monaten leicht zugänglich sind, bereits ab 60 cm Fallhöhe eine Brüstung (= geschlossene Absturzsicherung) aufweisen.
Für Aufenthaltsbereiche, die mehr als 100 cm über einer anderen Fläche liegen, sind Vorkehrungen zu treffen, die ein Abstürzen verhindern. Zur Höhe von Umwehrungen sind die allgemeinen Bestimmungen im Baurecht der Länder sowie im Arbeitsstättenrecht zu berücksichtigen. Unabhängig davon müssen Umwehrungen nach GUV-SR S2 mind. 100 cm hoch sein, nach DIN EN 176-1 nur 60 bis 85 cm, bzw. 70 cm bei Fallhöhen von 200 cm.
Umwehrungen müssen kindersicher gestaltet sein und dürfen nicht zum Rutschen, Klettern, Aufsitzen oder Ablegen von Gegenständen verleiten.
Anforderungen an Geländer und Brüstungen
• Begrenzung der Öffnungsweite in den Umwehrungen für mind. eine Richtung auf ≤ 11 cm. Die entsprechende Regelung der GUV-SR S2 für Krippenkinder legt die Öffnungsweite von Absturzsicherungen und Treppen ohne Setzstufen auf max. 8,9 cm fest. Außerdem sind an Treppen gut erreichbare Handläufe in mind. 60 cm Höhe anzubringen.
• Abstand von ≤ 4 cm zwischen Umwehrung und zu sichernder Fläche
Umwehrungen verleiten bspw. nicht
• zum Rutschen, wenn bei Treppen die Abstände zwischen den Umwehrungen am Treppenauge sowie den Umwehrungen zu den Treppenhauswänden nicht größer als 20 cm sind. Andernfalls sind die Umwehrungen so auszubilden, dass sie abschnittsweise durch Gestaltungselemente unterbrochen sind.
• zum Klettern, wenn leiterähnliche Gestaltungselemente vermieden werden.
• zum Aufsitzen und Ablegen von Gegenständen, wenn hierfür keine nutzbare Breite vorhanden ist.
| Fallhöhe in m | Art der Absturzsicherung | Höhe nach DIN | Höhe nach GUV |
|---|---|---|---|
| bis 60 cm | keine Sicherung erforderlich | entfällt | entfällt |
| ab 100 cm | Geländer | 60 bis 85 cm | 100 cm |
| ab 200 cm | feste Brüstung | 70 cm | 100 cm |
Tab. 4: Höhe der Absturzsicherung nach DIN und GUV
Arten von Absturzsicherungen
Vorkehrungen für die Sicherung bei Absturzgefahren bis 100 cm Höhe können z. B. sein:
• Geländer und Brüstungen
• Pflanzbeete mit entsprechend hoher, undurchdringbarer Bepflanzung (Dies muss allerdings ganzjährig gewährleistet sein.)
• hohe Pflanztröge
Absturzsicherungen an Brücken
Wenn eine Brücke über einen gepflasterten Fahr- bzw. Gehweg geführt werden soll, sind folgende Sicherungsmaßnahmen erforderlich:
• Die Brücke bzw. ihre Einbindung ins Gesamtkonzept ist so zu gestalten, dass kein Anreiz zum Beklettern besteht, die Brücke sollte z. B. kein Bestandteil eines Klettergeräts sein.
• An der Brücke ist ein Geländer oder eine Brüstung mit einer Höhe von mind. 100 cm vorzusehen.
• Die Absturzsicherung ist so zu gestalten, dass sie nicht zum Aufsitzen, Beklettern oder Ablegen von Gegenständen verleitet.
Modellierungen, Böschungen und Hügel
Naturähnliche, sanfte Geländemodellierungen, wie Hügel, Böschungen und Mulden, sollten weitere Bestandteile der Spielflächen sein, bieten sie doch in hohem Maße Möglichkeiten für spielerische und körperliche Aktivitäten. Geländeneigungen sollten allerdings nicht steiler als 1:2 ausgebildet werden, besondere Kletterbereiche nicht steiler als 1:1.
Mögliche Absturzstellen sind durch Zäune, Hecken, Brüstungen etc. ausreichend zu sichern.
In stark bespielten Böschungsbereichen muss allerdings mit entsprechenden Böschungssicherungen ein Freilegen von unterirdischen Bauteilen, wie z. B. Betonfundamenten, verhindert werden. Ebenso sind Auswaschungen und Erosionen durch Böschungssicherungen zu verhindern.
Gräben, Höhlen und Spielmulden erweitern das Spektrum der Spielmöglichkeiten. Nicht zuletzt bieten sie Kindern einen gewissen Rückzugsraum und zahlreiche Versteckmöglichkeiten. Für deren Ausbildung und Gestaltung gelten sinngemäß dieselben Anforderungen wie für Böschungen.
Treppen und Rampen
Nicht immer sind Stufen innerhalb von Spielplätzen zu vermeiden, sodass bei barrierefreien Anlagen entsprechende Alternativen mit Rampen vorgesehen werden müssen. Ansonsten bieten Stufen auch verschiedene Spielmöglichkeiten und können durch die Höhenunterschiede Flächen sehr gut gliedern.
Stufenanlagen
Treppen und Rampen müssen so beschaffen sein, dass sie entsprechend ihrem Bestimmungszweck von Kindern sicher benutzt werden können. Voraussetzung für sicheres Gehen auf Treppen sind ausreichend große, rutschhemmende Trittflächen mit gleichmäßigen Treppensteigungen, die mit dem üblichen Schrittmaß übereinstimmen.
Detaillierte Vorgaben zu Stufenanlagen macht die Unfallverhütungsvorschrift für Kindertageseinrichtungen GUV-V S2 der gesetzlichen Unfallversicherung:
• Scharfe Kanten sind stets zu vermeiden. Fertigstufen sind nur mit abgefasten Kanten einzubauen. Bestimmte Steinarten, wie z.B. Muschelkalk oder Taunusschiefer, sind nicht geeignet.
• Stein- und Holzelemente sind so anzuordnen, dass die freie Fallhöhe untereinander max. 60 cm beträgt.
• Bei Stufenanlagen ist das Steigungsverhältnis von 1:1 nicht zu überschreiten.
Die Steigung von Stufen muss gem. DIN EN 1176-1 konstant sein. Sie müssen mind. drei Stufen haben und die Stufen müssen einen gleichmäßigen Abstand besitzen sowie einheitlich konstruiert und waagerecht sein. Die Stufentiefe muss mind. 14 cm betragen.
Einzelstufen sind aufgrund der hohen Stolpergefahr zu vermeiden oder deutlich farblich zu kennzeichnen.
Gemäß BGI/GUV-I 561 „Treppen“ der gesetzlichen Unfallversicherung sind als Freitreppen von Kindergärten und -krippen mit einem Auftritt von 32 bis 30 cm und einer Steigung von 14 bis 16 cm auszubilden. Handläufe sind i. d. R. ab fünf Stufen anzubringen und zwar beidseitig, wenn die Treppenbreite mehr als 150 cm beträgt.
Weiteres regeln die Landesbauordnungen der jeweiligen Bundesländer.
Bild 4: Schema Einbau der Stufen (Quelle: Andres)
Geeignete Stufenarten
• Blockstufen
• Stellstufen
• Legstufen
Geeignete Stufenmaterialien
• Beton mit gefasten Kanten
• Naturstein (Nachbearbeitung der scharfen Kanten notwendig)
• Holz (z. B. Knüppelstufen aus Robinienholz)
• Gummigranulate bzw. synthetischer Fallschutz
Barrierefreie Treppenanlagen
Gemäß DIN 18024 gelten hierfür folgende Vorgaben:
• Treppen dürfen nicht gewendelt sein, sondern müssen einen geraden Verlauf haben.
• Die Mindestbreite der Stufen beträgt 120 cm.
• Beidseitig sind Handläufe (Durchmesser 3,0 bis 4,5 cm) in 85 cm Höhe anzubringen. Anfang und Ende des Treppenlaufs sind rechtzeitig und deutlich erkennbar zu machen (z. B. durch taktile Kennzeichnung an den Handläufen).
• Der äußere Handlauf muss 30 cm waagerecht über Anfang und Ende der Treppe hinausragen. Der innere Handlauf am Treppenauge darf nicht unterbrochen werden. Die Orientierungssicherheit muss durch taktile Geschoss- und Wegebezeichnungen gegeben sein.
• Treppenläufe mit mehr als drei Stufen müssen auf der ersten und letzten Stufe über die gesamte Trittbreite durch einen 50 bis 80 mm breiten kontrastierenden Streifen gekennzeichnet werden.
• Stufenunterschiede sind nicht zulässig.
Niveauwechsel nach DIN 32984
Treppenantritt und -austritt sind durch Aufmerksamkeitsfelder (AMF) zu kennzeichnen. Das Aufmerksamkeitsfeld für den Antritt muss direkt vor der untersten Setzstufe liegen. Das Aufmerksamkeitsfeld für den Austritt muss hinter der obersten Trittstufe beginnend liegen.
Barrierefreie Rampen
Gemäß DIN 18024 sind hierzu folgende Vorgaben zu erfüllen:
• Das Gefälle von Rollstuhlrampen darf max. 6 % betragen, ohne Quergefälle.
• Die Breite der Rampe muss mind. 120 cm betragen.
• Eine ausreichende Entwässerung der Rampe muss gegeben sein, auch in den Ruhepodesten.
• Die Bewegungsflächen am Anfang und Ende der Rampe müssen mind. 150 x 150 cm betragen.
• Die Länge der einzelnen Rampenläufe darf höchstens 600 cm betragen. Ist die Rampe länger und weist Richtungsänderungen auf, so sind Zwischenpodeste mit einer nutzbaren Tiefe von mind. 150 cm erforderlich.
• In der Verlängerung der Rollstuhlrampe darf keine abwärtsführende Treppe angeordnet werden.
• Auf beiden Seiten von Rampenläufen und -podesten sind in einer Höhe von 10 cm Radabweiser anzubringen, z. B. durch Tiefbordsteine. Diese sind jedoch nicht erforderlich, wenn die Rampen seitlich durch eine Wand begrenzt werden.
• Beidseitig sind Handläufe anzubringen, die mind. 30 cm über Anfang und Ende der Rampe waagerecht hinausragen. Wenn die Handläufe unterfahrbar sind, dürfen sie auch vor und hinter der Rampe in die Bewegungsflächen hineinragen. Handläufe und Radabweiser sollen dabei, laufseitig gesehen, senkrecht in einer Ebene übereinander liegen. In einer Höhe von 85 bis 90 cm über OFF (Oberkante Fertigfußboden) der Rampenläufe und -podeste sind die Oberkanten der Handläufe anzubringen.
Handlauf muss ca. 30 cm in den Plattformbereich ragen
Bild 5: Längsschnitt durch barrierefreie Rampe (Quelle: Andres)
Radabweiser, Einbauhöhe 10 cm über OK Belag
Bild 6: Querschnitt durch barrierefreie Rampe (Quelle: Andres)
Geeignete Materialien für barrierefreie Stufen und Rampen sind Betonpflaster, Asphalt und Natursteinbeläge mit ebenen, aber nicht glatten (wie z. B. sandgestrahlten) Oberflächen.
Checkliste: Zugänge und Einfriedungen
□ Sind funktionstüchtige Absturzsicherungen entsprechend der Fallhöhen geplant bzw. vorhanden?
□ Sind die Zäune ausreichend standfest? Wie ist der Zustand der Holzpfosten? Stehen Drähte oder Holzteile heraus?
Zäune sind grundsätzlich immer in die jährliche Wartung und Kontrolle miteinzuschließen.
□ Entsprechen die Höhen der Einfriedungen und Absturzsicherungen den Vorgaben der Unfallverhütungsvorschriften? Als ausreichende Höhe wird ein Maß von 100 cm angenommen. Außerdem sind Einfriedungen gegen Hochklettern zu schützen.
□ Sind Kanten von Natur- und Betonsteinen ausreichend abgerundet?
□ Sind Stufen regelmäßig ausgebildet oder besteht Stolpergefahr?
□ Sind Aus- und Zugänge innerhalb des Grundstücks beleuchtet?
Gemäß GUV-SR S2 sind diese so zu beleuchten, dass die Wegführung, Hindernisse und Treppen deutlich erkannt werden können.
□ Weisen barrierefreie Rampen das max. Gefälle und die erforderlichen Mindestbreiten auf?
Gemäß DIN 18024 sind nach max. 600 cm Rampenlänge Ruhepodeste ohne Gefälle einzuplanen. Das max. Gefälle darf 6 % nicht überschreiten, die Mindestbreite der Rampe muss 120 cm betragen.