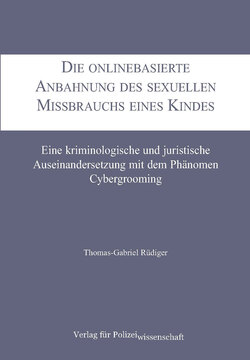Читать книгу Die onlinebasierte Anbahnung des sexuellen Missbrauchs eines Kindes - Thomas-Gabriel Rüdiger - Страница 13
ОглавлениеIV. Der digitale Raum
Eine Grundbedingung des Phänomens Cybergrooming ist, dass die Vorgehensweise in irgendeiner Form (auch) über das Internet stattfindet. Dabei ist nicht jeder Bereich von Relevanz. Der Bereich muss einerseits tatsächlich von Kindern bzw. Minderjährigen genutzt werden, andererseits muss die Möglichkeit bestehen, mit ihnen in irgendeiner Form in Kontakt zu treten, zu kommunizieren und zu interagieren. Daher erscheint es notwendig, zunächst die für das Phänomen relevanten Grundmechanismen des digitalen Raumes zu erörtern, um dann näher auf die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen einzugehen.
IV.1 Entwicklung des digitalen Raumes
Der digitale Raum befindet sich seit etwa 30 Jahren in einem stetigen Wandlungs- und Entwicklungsprozess. Die ersten Versuche mit dem digitalen Austausch von Informationen gab es bereits 1962 mit der Entwicklung eines Systems der „Advanced Research Project Agency“ (ARPA) – dem „Arpanet“194. Dieses Vorgängersystem des heutigen World Wide Web sollte zunächst nur dem akademischen Bereich in Verzahnung mit militärischen Institutionen als Kommunikationsmöglichkeit dienen. Eine Nutzung durch Privatanwender war damals noch nicht absehbar195. Ab 1993 wurde dann die Vernetzung der Informationen für Privatanwender durch die Freigabe des World Wide Web und die ersten grafischen Web-Browser mit Einbindung von Medieninhalten durch CERN möglich196. Das frühe WWW war überwiegend geprägt von Informationsaufnahme: Der Nutzer konnte Daten oder Medien suchen und finden. Dennoch kam es bereits in den Anfangsjahren zu digitalen Kommunikationen – Chat-Gesprächen – zwischen den Nutzern. Nachdem bereits 1988 ein Protokoll zur Live-Kommunikation mehrerer Menschen über den digitalen Raum (sog. „Relay Chats“) entwickelte wurde, entstanden die ersten regulären Chat-Räume. Diese Chats zeichnete bereits ein bis heute immer wieder thematisiertes Merkmal der Internetnutzung aus – das Gefühl einer sehr weitgehenden Anonymität197. Später wurden daraus die „Internet Relay Chats“ (IRCs), die insbesondere im Zusammenhang mit der anonymen Kommunikation über Proxy Server im Darknet genutzt werden198.
Etwa ab 2000 begannen sich die Nutzungsangebote und damit einhergehend auch das Nutzungsverhalten strukturell zu verändern. Dieser Entwicklungsprozess wird oft mit dem Schlagwort „Web 2.0“ verbunden199. Das „2.0“ lehnt sich an die typischen Versionsnummern von Computerprogrammen an, wobei eine neue Ziffer vor dem Punkt stets eine markante neue Version spricht200. Damit sollte ein Neuaufbruch im digitalen Raum begrifflich werden, der zunächst nur für den Wirtschaftssektor stehen sollte, sich aber letztlich verallgemeinernd über die Netznutzung gelegt hat201. Hierbei kann Web 2.0 nicht technisch so beschrieben werden, „[…] dass Internetauftritte so gestalten werden, dass ihre Erscheinungsweise in einem wesentlichen Sinne durch die Partizipation ihrer Nutzer (mit-)bestimmt wird“202. Die Attraktivität entsprechender Internetauftritten hängt demgemäß maßgeblich davon ab, dass ihre Nutzer die Gestaltung durch Textbeiträge, aber auch das Bereitstellen eigener Medien aktiv mitgestalten. Diese Mitgestaltung wird oft unter dem Begriff des „user generated content“ erfasst203. Das Aufkommen der ersten großen Online-Netzwerke – also Plattformen, die auf eine besondere Vernetzung der Nutzer untereinander setzten, darunter Myspace (2002), LinkedIn (2003) und 2004 bereits Facebook – verstärkte diesen Trend. Auch sonst setzten immer mehr Webseiten auf die Attraktivität der User-Interaktion. Dabei begann sich für diese Webseiten – auch bedingt durch ihre Vielfältigkeit in den Erscheinungsformen – ein neuer Oberbegriff herauszubilden: „Social Media“ bzw. „Soziale Medien“204. Hierunter können alle Onlineangebote verstanden werden, die eine Interaktion oder Kommunikation unter Nutzern ermöglichen205. Schmidt und Taddicken weisen darauf hin, dass die Verwendung von „social“ oder „sozial“ vor „Medien“ an sich redundant sei, da alle Medien sozial seien206. Der Begriff „Soziale Medien“ konnte sich gegenüber „Soziale Netzwerke“ durchsetzen, da nicht alle Webseiten, die auf eine soziale Interaktion zwischen Nutzern setzen, auch per se eine langfristige Vernetzung erfordern. Der Begriff des Netzwerkes erscheint also als unnötige Einschränkung, denn das Kennzeichen Sozialer Medien – die Möglichkeit einer onlinebasierten sozialen Interaktion oder Kommunikation mit anderen Personen – ist in den unterschiedlichsten Webseiten bzw. Programmen zu finden207. Neben den klassischen Sozialen Netzwerken, Chat-Räumen und Foren haben sich in den letzten Jahren auch Blogs und Messengers etablieren können, wobei im letzten Bereich aktuell WhatsApp mit einer Nutzerzahl von monatlich annähernd 1,5 Milliarden208 Menschen heraussticht.
Bereits 1997 startete mit Ultima Online eines der ersten sog. „Massively Multiplayer Online Roleplaying Games“ (MMORPGs): Spiele, die nicht mehr gegen den Computer, sondern gegen und mit anderen Spieler, oft auf der gesamten Welt, gespielt werden, was auch mehr Menschen zu diesem Spielen bewegt hat209. Nach 2000 etablierten sich zudem onlinefähige Smartphones und Tablets. Mit diesen Geräten wurden Formen von interaktiven Programmen wie Messengers – etwa WhatsApp oder auch Kik –, aber auch weitere soziale Netzwerke beispielsweise Instagram, Snapchat oder auch Tumblr beliebt210. Eine generelle Besonderheit ist, dass eine Vielzahl der Programme bzw. Webseiten bis heute kostenfrei angeboten werden, mit Ausnahmen v. a. im Gaming-Bereich211.
Im digitalen Raum zeichnet sich eine Art Generationenbruch bei der Akzeptanz und Nutzung Sozialer Medien ab. Nach der JIM Studie 2017 kommunizieren 94 Prozent der 12- bis 19-Jährigen über WhatsApp, 57 Prozent nutzen Instagram, 49 Prozent Snapchat und lediglich 25 Prozent nutzen mehrmals die Woche Facebook und nur 9 Prozent Twitter212. Ähnliche Ergebnisse liefert auch der Social Media Atlas, nachdem 98 Prozent der 14- bis 19-Jährigen WhatsApp nutzen, 84 Prozent Instagram und 82 Prozent Snapchat213. Hingegen nutzen nur 61 Prozent dieser Altersgruppe Facebook, verglichen mit 89 Prozent der 20- bis 29-Jährigen und 84 Prozent der 30- bis 39-Jährigen. Diese Altersgruppen nutzen dagegen seltener Instagram (lediglich 58 Prozent der 20- bis 29-Jährigen und 39 Prozent der 30- bis 39-Jährigen) und Snapchat (39 Prozent der 20- bis 29-Jährigen und 22 Prozent der 30- bis 39-Jährigen)214. Es zeigt sich also der Trend, das v. a. jüngere Menschen Instagram und Snapchat nutzen, ältere dagegen Facebook als primäre Plattform nutzen. Es gibt aber auch Überschneidungen dieser Altersgruppen. So weist neben WhatsApp YouTube eine gleichmäßige Altersverteilung auf. Der Nutzungswert bei den drei zitierten Altersgruppen lag bei YouTube zwischen 100 und 86 Prozent Nutzung und bei WhatsApp zwischen 81 und 98 Prozent215.
Obwohl all diese Programme mehr oder wenig starke Unterschiede in der Gestaltung und dem Design aufweisen, bieten sie alle weitestgehend die Möglichkeit einer – teilweise auch anonymen – Kommunikation zwischen den Nutzern, sei es in Form von verbaler, schriftlicher oder multimodaler Interaktion216, auch mit Webcams. Dementsprechend sind sie alle mögliche Viktimisierungsorte bei Cybergrooming-Delikten. Da alle Formen Sozialer Medien für die Betrachtung relevant sind, sollen sie nun näher betrachtet werden.
IV.1.1 Soziale Netzwerke
Das primäre Kennzeichen Sozialer Netzwerke ist eine vertiefende Möglichkeit der langfristigen Vernetzung und der damit einhergehenden Interaktion der Nutzer untereinander217. Dies steht im Kontrast beispielsweise zu klassischen Chat-Räumen, die nicht per se auf eine Vernetzung der Nutzer setzen, sondern auf die Kurzfristigkeit der Kommunikation. Diese Vernetzung geschieht typischerweise durch eine direkte Online-Kontaktaufnahme zwischen den Nutzern. Facebook als aktuell prototypisches Soziales Netzwerk erfordert zwar originär die Kontaktaufnahme über eine sog. Freundschaftsanfrage, jedoch kann der Nutzer selbst durch Privatsphäre-Einstellungen bestimmen, welche seiner Beiträge für Fremde sichtbar sind. Als Alternative gibt es seit 2011218 die Möglichkeit, durch das Abonnieren den öffentlich geposteten Inhalten von Nutzern zu folgen, ohne eine Freundschaftsanfrage tätigen zu müssen und wenn diese Nutzer das anbieten219. Dies geschieht prinzipiell ähnlich wie bei Twitter220; dort ist keine primäre Vernetzung über eine Freundschaftsanfrage o. Ä. vorgesehen221. Auf Twitter ist die Grundfunktion, einzelnen Nutzern zu folgen, sodass eine Chance besteht, dass deren Statusnachrichten („Tweets“) in der eigenen angezeigten Timeline erscheinen.
Nur wenn ein Nutzer sein Profil auf privat gestellt hat, ist eine vergleichbare Freundschaftsanfrage notwendig, die durch den Angefragten bestätigt werden muss. Eine besondere Beachtung hat Twitter dadurch erfahren, dass Donald Trump im Rahmen seines Wahlkampfes und auch in der Präsidentschaft Twitter als primäres Medium nutzt222. Dies hat für Aufsehen gesorgt, da sich die reinen Nutzungszahlen der beiden Programme massiv unterscheiden. So sollen in Deutschland 20,5 Mio. Menschen Facebook monatlich nutzen, aber lediglich 1,6 Mio. Twitter223. Diese Differenz zeigte sich auch in einer weiteren Studie: 33 Prozent der Gesamtbevölkerung über 14 Jahre nutzten Facebook 2017 zumindest wöchentlich, aber lediglich 3 Prozent Twitter224. Weltweit soll Facebook knapp 2 Milliarden Nutzer haben225, Twitter lediglich 330 Mio.226.
Twitter und Facebook unterscheiden sich noch in einem weiteren wesentlichen Punkt. Bei Facebook können Postings im Prinzip beliebig lange sein. Bei Twitter gab es zunächst eine Zeichenbegrenzung auf 140 Zeichen, die dann 2017 auf 280 Zeichen verdoppelt wurde227. Twitter ist daher nicht auf eine allzu intensive Diskussionskultur – im Sinne von langen einzelnen Postings – zwischen „Tweeter“ und Lesenden ausgelegt, sondern eher auf schnelle und kurze Diskussionen. Dies steht ganz im Gegensatz zu Facebook, das durch seine Struktur das gegenseitige Kommentieren und damit die intensive Diskussion in den Fokus stelle228. Dennoch stellt Twitter eine wichtige Plattform für Debatten durch das „Retweeten“ von Tweets dar229. Neben Facebook und Twitter hat sich eine Vielzahl diverser Sozialer Netzwerke mit differenten Schwerpunkten etablieren können. Neben Business-Netzwerken wie Xing230 und LinkedIn231 gibt es auch reine Plattformen für die Vernetzung von Akademikern wie ResearchGate232 oder Academia233. Auch sog. Flirtplattformen wie Tinder234 oder Lavoo235 gehören zu den Sozialen Netzwerken, da sie ebenfalls Austausch und Vernetzung der Nutzer untereinander und das Teilen und Verbreiten von Medien ermöglichen.
Obwohl durch ihre Kommunikationsmöglichkeiten alle Sozialen Netzwerke das Risiko einer Kontaktaufnahme von Tätern mit Kindern beherbergen, sind fast ausschließlich Gerichtsverhandlungen zu Fällen mit Facebook recherchierbar236. Dies kann verschiedene Hintergründe haben. Einerseits kann es schlicht an einer zeitlichen Komponente liegen: Ein recherchierbares Gerichtsverfahren spiegelt so gut wie nie ein aktuelles Geschehen wider, vielmehr liegt nach der Tat ein oft nicht unerheblicher Zeitraum. Hier könnten Nutzungsentwicklungen schlicht noch nicht abgebildet sein. Andererseits mag dies auch daran liegen, dass die Zielgruppe der Täter unter den klassischen Sozialen Netzwerken aktuell am ehesten in signifikanter Menge auf Facebook anzutreffen ist: 2017 gaben 15 Prozent der Jugendlichen von 13–17 Jahren Facebook und nur 4 Prozent Twitter als eine relevante Plattform an237. Zum Vergleich YouTube wurde von 62 Prozent, WhatsApp von 40 Prozent und Instagram von insgesamt 27 Prozent als relevant eingestuft238. Von Kindern in der Altersgruppe von 6–11 Jahren wird Twitter überhaupt nicht angegeben und Facebook wird nur von ca. 9 Prozent der Kinder als relevant eingestuft239. Andererseits muss bei der Relevanz von Facebook für Cybergrooming bedacht werden, dass durch die Verwendung von Profilbildern sowie die Möglichkeit der Nutzung des Facebook Messengers Tätern eine relativ leichte Anbahnung ermöglicht wird. Denn damit vereint Facebook die Möglichkeiten der Anbahnungs- und Missbrauchsplattform in sich, was die Plattform auch zukünftig für Täter weiterhin interessant macht. Mittlerweile werden jedoch auch vermehrt Presseberichte über Cybergrooming-Sachverhalte, die über Instagram angebahnt wurden, veröffentlicht240. Beispielhaft wurde durch das Landgericht Stralsund ein 41 Jahre alter Täter verurteilt, der sich gezielt als 13 Jahre altes Mädchen ausgegeben hat, um so Kinder über Instagram und Whatsapp anzusprechen und in der Folge pornografische Medien auszutauschen241. Dies könnte darauf hindeuten, dass aufgrund der hohen Attraktivität von Instagram bei Jugendlichen und Kindern – die noch detaillierter erörtert wird – Facebook auch perspektivisch als primärer Ort der genannten Viktimisierung beispielsweise in Gerichtsverfahren abgelöst werden könnte.
IV.1.2 Messenger und Chat-Räume
Instant-Messenger sind Soziale Medien, die in überwiegender Form als Kommunikationsmedium auf Smartphones verwendet werden und dabei auf eine geschlossene bzw. halbgeschlossene Kommunikationsgruppe setzen242. Im Gegensatz zu klassischen Sozialen Netzwerken, die typischerweise auch eine Möglichkeit zum Austausch von direkten Nachrichten zwischen Nutzern bieten, stehen bei Messenger weniger die Vernetzung und das Verfolgen von Aktivitäten anderer Nutzer im Mittelpunkt der Nutzung. Vielmehr ist der Kernaspekt von Messenger der Austausch von Informationen, aber auch Mediendateien, wie Bildern und Videos, zwischen zwei Nutzern oder im Rahmen kleinerer Gruppen243. Bedingt durch die i. d. R. kostenfreie Versendung von Nachrichten hat die Etablierung von Messengern die Nutzung von SMS und MMS zurückgedrängt.244 Das hat auch Einfluss auf das Cybergrooming, da entsprechende Nachrichten zunehmend über Messenger verschickt werden245. Dabei werden Nachrichten und Medien wie im Internet üblich unabhängig davon übertragen, ob der jeweilige Empfänger zu dem Gesprächszeitpunkt auch online ist. Typischerweise müssen sich die Nutzer kennen, um miteinander zu kommunizieren, beispielsweise bei WhatsApp über die Handy-Nummer. Dies stellt einen zumindest theoretischen Unterschied zu klassischen Chaträumen dar, wo die Anmeldung oft lediglich einen Nutzernamen braucht246. Eine höhere Anmeldungsstufe stellt die Angabe einer E-Mail-Adresse dar247. Dies kann in den Chat-Räumen dazu führen, dass sich viele Nutzer immer wieder mit einem neuen Namen bzw. neuen Zugangsdaten anmelden. Insbesondere die Flüchtigkeit des Anmeldeprozesses steht im Kontrast zu Instant-Messengern wie WhatsApp248 (Handynummer) oder z. B.
KakaoTalk249 (verifizierte Handynummer). Es gibt auch Mischformen zwischen Messengern und Chat-Räumen. So ist es mittlerweile möglich Skype auch auf Smartphones mobil zu nutzen, wobei die Möglichkeit einer Live-Videoübertragung besteht250. Der bei Jugendlichen beliebte Kik Messenger251, den bereits Ende 2015 immerhin ca. 40 Prozent in den USA nutzten252, setzt beispielsweise auf eine Vermischung: Zur Anmeldung benötigt der Nutzer, im Gegensatz zu WhatsApp, nicht nochmals die Angabe einer Mobilfunknummer. Für die Kontaktaufnahme mit anderen Nutzern reicht zudem, wie bei klassischen Chat-Räumen, ein freigewählter Nutzername und eine E-Mail-Adresse. Die Funktionsweise unterscheidet sich dann nur in Nuancen von WhatsApp, wobei Kik Messenger einen eigenen Browser aufweist. Die Übergänge zwischen Chat-Räumen und Messenger, v. a. auf demselben Endgerät wie einem Smartphone, sind fließend und nicht immer klar bestimmbar. Die Gemeinsamkeit liegt zunächst darin, dass beide Formen die Möglichkeit des schnellen und unkomplizierten Austauschs von Nachrichten, Bildern und Videos bieten. Messenger können auch je nach Vorgehen bei der Anmeldung das Gefühl einer relativ anonymen Kommunikationsmöglichkeit zwischen unbekannten Nutzern eröffnen253. Die Nutzerzahlen, v. a. von WhatsApp, zeigen die Relevanz der Messenger auch in Deutschland. So stieg der Anteil der Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren in Deutschland, die WhatsApp zumindest wöchentlich nutzen, von 58 Prozent im Jahr 2016 auf 64 Prozent 2017254. Trotz der grundlegenden Schwäche, dass typischerweise Täter über Messenger nur auf in irgendeiner Form bereits bekannte Kinder bzw. Handynummern einwirken können, verdeutlichen die Nutzerzahlen und auch die leichte Möglichkeit von Videolivestreams und Medienaustausch die Relevanz für Cybergrooming. Anders liegt die Lage wiederum bei Chatrooms, die in den letzten Jahren offenbar an Relevanz verloren haben und gleichzeitig nicht die Möglichkeit des direkten Austausches von Medien ermöglichen. Diese können von Tätern daher nur für das Einwirken auf ein Treffen genutzt werden. Geht es dem Cybergroomer dagegen um einen Missbrauch durch digitale Medien, muss er auf andere Soziale Medien überleiten.
IV.1.3 Video- und Bildplattformen
In den letzten Jahren hat sich eine Kommunikationsform über Medien wie Bilder und Videos im Netz etablieren können, die eine besondere Bedeutung für Cybergrooming hat. Mit Ausnahme von Onlinegames existiert kaum noch eine Form von Sozialen Medien, die nicht in irgendeiner Form die Möglichkeit des Teilens und Verbreitens von Medien oder sogar von Videolivestreams beinhaltet. Dabei ist die steigende Verbreitung dieser Plattformen eine folgerichtige Entwicklung der steigenden Verbreitung von Smartphones. War es vor deren Verbreitung ein eher aufwendiges Unterfangen, eigene Bilder im Internet hochzuladen, meist mit mehreren Zwischenschritten, vereinfachte die Kombination aus integrierter Kamera und Internetanbindung diesen Prozess ungemein. Hierbei haben sich einige relevante Plattformen herausgebildet. Im Videobereich ist YouTube die dominierende Plattform. So sollen sich 2013 bereits 1 Milliarde Menschen monatlich eingeloggt haben und annähernd 1,5 Milliarden im Jahr 2017255. Bei den Bilderplattformen sind Instagram und Snapchat aktuell die beliebtesten Plattformen. Sie stellen, ähnlich wie YouTube, nicht das geschriebene Wort in den Mittelpunkt, sondern Bilder oder Videos, die Nutzer hochladen, kommentieren und mit Likes u. a. bewerten können. Snapchat, das 2011 online ging, war zunächst eine der wenigen Plattformen, die Nutzern versprachen, Medien so versenden zu können, dass sie beim Empfänger nur für eine vorgegebene Zeit vorhanden sind256. Daher bekam es relativ schnell den Ruf einer Sexting App, also einer Plattform für vorwiegend eigenproduzierte Nackt- und Erotikbilder sowie erotischer Nachrichten (sog. Sexts257) zur sexuellen Stimulanz anderer Personen258. Das im Jahr 2010 gegründete Instagram hat mittlerweile ähnliche Funktionen wie Snapchat und beginnt es zu verdrängen259. Instagram hatte im September 2013 lediglich 150 Mio. Nutzer, schaffte es aber die Nutzerzahlen bis September 2017 auf 800 Mio. fast zu verfünffachen260. Snapchat kam im selben Zeitraum bis 2017 auf lediglich 173 Mio. Nutzer weltweit261. In Deutschland nutzen einer Studie zufolge 9 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren mindestens wöchentlich Instagram und sechs Prozent Snapchat262. Eine weitere relevante Plattform stellte bis August 2018 die App Musical.ly da. Diese soll zeitweise fast 250 Mio. Nutzer weltweit263 und 8,5 Mio. Nutzer in Deutschland gehabt haben264. Bei Musical.ly nahmen die Nutzer kleine 15-sekündige Karaokeclips auf, die von anderen Nutzern bewertet werden konnten. Aufgrund von Berichten von Jugendschützern über massive sexuelle Übergriffe auf Kinder265 in der Form, dass Kinder sexuell angesprochen wurden, wurde die App mit dem Programm TikTok fusioniert266. Die wesentlichen Mechanismen, die zu den Übergriffen geführt hatten, blieben allerdings gleich.
Alle diese Programme haben für die Cybergrooming-Begehungsweise eine besondere Bedeutung. Einerseits sind sie v. a. bei jungen Menschen beliebt, was sie für die T atbegehung durch klassische Täter relevant erscheinen lässt. Andererseits erhöht dies auch die Wahrscheinlichkeit von sexuellen Handlungen, auch Missbrauchshandlungen zwischen Gleichaltrigen. Eine Entwicklung, die sich, wie noch zu zeigen sein wird, tatsächlich bereits nachvollziehen lässt. Bedingt durch den Trend, sich auch im digitalen Raum selbst zu präsentieren, ist es zudem relativ einfach Kontakt zu einem Kind aufzunehmen und so einen Cybergrooming-Prozess einzuleiten.
IV.1.4 Onlinespiele und andere virtuelle Welten
Onlinegames als Genre der Sozialen Medien267 sind bedingt durch ihre Attraktivität für Kinder und Jugendliche von besonderer Relevanz für das Untersuchungsfeld268. Onlinegames können zu den übergeordneten virtuellen Welten gezählt werden269. Nach Paschke basieren virtuelle Welten „[…] auf einem internetgestützten Netzwerk von Computern und ermöglichen synchrone soziale Interaktionen von Menschen, die durch Avatare repräsentiert werden, in einer persistenten dreidimensionalen Umgebung […]“.270 Virtuelle Welten sind demnach bereits begrifflich nicht reale Nachbildungen, sondern künstliche – fiktive – der physischen Welt271. Prinzipiell können solche Nachbildungen – entgegen der zitierten Definition von Paschke – auch in einem spielerischen Kontext durch das Gestalten beispielsweise mit Lego, Playmobil oder andere Spielzeugwelten erfolgen272. Für das Untersuchungsfeld sind nur virtuelle Welten von Relevanz, die computerbasiert sind273. Für computerbasierte virtuelle Welten können unterschiedliche Klassifizierungen vorgenommen werden, v. a. nach dem Ziel des Programmes, ob also ein Spielziel vorgegeben wird274. So gibt oder gab es virtuelle Welten wie „Second Life“275 oder „Red Light Center“276, die überwiegend nicht durch einen spielerischen Aspekt geprägt sind. Dies bedeutet nicht, dass dort nicht auch gespielt werden kann. Beispielsweise sind bei Second Life teils umfangreiche und Minispiele von Nutzern selbst erstellt worden, die auch mit anderen zusammengespielt werden277. Die Programmierer haben den Nutzern jedoch kein übergeordnetes spielerisches Ziel vorgegeben wie „Besiege den Gegner“, „finde einen Schatz“ und dergleichen. Vielmehr wird der kommunikative und selbstgestalterische Aspekt hervorgehoben, und es wird nur der Rahmen gesetzt, in dem sich der Nutzer bewegen kann278. Solche Formen virtueller Welten werden auch als Metaversen279 oder Lebenssimulationen (Life Sims) bezeichnet280. Virtuelle Welten werden typischerweise durch drei Eigenschaften charakterisiert: eine immersive Erfahrung sowie eine konsistente und persistente Welt281. Unter Immersion wird das Versinken in diese Form der virtuellen Welt verstanden. Das bedeutet, dass es dem Nutzer zumindest theoretisch möglich sein muss, die vorhandene Außenwelt auszuklammern und sich als Teil dieser neuen Welt zu verstehen. Dies wird typischerweise über Ankerpunkte realisiert, an denen sich der Nutzer orientieren kann. In den meisten Metaversen und allen Formen von Spielen stellen diese Ankerpunkte sogenannte Avatare dar282. Avatare stellen virtuelle Figuren der Nutzer dar, die sie in vielen Fällen zumindest oberflächlich selbst gestalten und anpassen können und mit denen sie sich in der virtuellen Welt bewegen. Neue Entwicklungen im Bereich der sog. „Virtual Reality“ versprechen zudem eine besonders immersive Spieleerfahrung283. Bruns definiert Virtual Reality als „[…] Computersysteme, die den Nutzern über das Ansprechen von ein oder mehreren Sinnen das Gefühl geben, sich an einem anderen Ort oder in einer anderen Welt zu befinden. Die reale Welt soll dabei zugunsten der virtuellen Welt aus dem Bewusstsein des Nutzers verdrängt werden“284. Dabei wird Virtual Reality zumeist unter Zuhilfenahme sog. Head-Mounted-Displays umgesetzt285. Solche ‚Brillen‘ besitzen zumeist pro Auge einen Bildschirm und versuchen Umgebungsgeräusche und Umgebungslicht auszublenden286. Immerhin 44 Prozent der deutschen Internetnutzer im Jahr 2017 haben bereits einmal eine solche VR-Brille ausprobiert287. Obwohl gegenwärtig im Bereich des Massenmarktes Virtual Reality vornehmlich für digitale Spiele angewandt wird, gibt es doch auch Bemühungen „Social Virtual Reality“ umzusetzen, also die Konzepte der Metaversen mit denen von VR zu verbinden288.
Solche Lebenssimulationen werden, vermutlich auch bedingt durch ihre Gestaltung, eher weniger von Minderjährigen genutzt. Dennoch sind auch solche Programme aus kriminologischer Sicht nicht ganz uninteressant, wie die Nachstellung des Kindesmissbrauchs durch Avatare in Second Life verdeutlicht289.
Die zweite große Form virtueller Welten sind Onlinespiele290, also computerbasierte Welten mit Onlinefunktion, in denen der Betreiber den Nutzern ein Spielziel vorgibt. Dieses Spielziel kann ganz banal sein und muss auch nicht unbedingt vom Nutzer verfolgt werden. Computerspiele sind dabei nicht erst ein Phänomen der letzten Zeit. Bereits 1948 soll das erste Patent auf das funktionsfähige Computerspiel „Cathode Ray Tube Amusement Device“ vergeben worden sein291. „Tennis for two“, das wohl erste bekanntere Computerspiel überhaupt, zunächst noch auf einem Oszilloskop, wurde bereits 1958 durch William Higinbotham entwickelt und war als Zeitvertreib für Besucher angedacht292. Im Jahr 1961 entwickelte das Massachusetts Institute of Technology (MIT) mit „Spacewar!“ ein Computerspiel, das zum ersten Mal tatsächlich auf digitaler Technik basierte293. 1972 entstand nach der Idee von „Tennis for Two“ mit dem berühmten „Pong“ das erste als stationärer Automat kommerziell vermarktete Computerspiel294. In der Folge entwickelten sich digitale Spiele technisch als auch von der gesellschaftlichen Bedeutung her immer schneller weiter. Ab etwa 2000 machten digitale Spielen einen wichtigen weiteren Schritt. Sie gingen immer häufiger online. Das bedeutete, das Spieler immer häufiger mit- und gegeneinander über das Internet spielen konnten, womit sich auch das Risiko von Übergriffen im Rahmen der Kommunikation eröffnet295.
Dabei sind Onlinespiele und Metaversen durchlässig und zeigen oft Kennzeichen des anderen Typs auf296. Ein wichtiges Bindeglied zwischen Metaversen und Onlinespielen ist, dass es stets zu einer onlinebasierten Interaktion und/oder Kommunikation zwischen den Nutzern kommt. So können Interaktionen stattfinden, wenn Spieler zufällig gegeneinander kämpfen, sich in Gruppen zusammentun oder auch die Avatare sich in der virtuellen Welt nur begegnen297. Gleichzeitig beinhalten nahezu alle Onlinespiele in irgendeiner Form die Möglichkeit zur Kommunikation. Dies kann in Form von internen Chats oder privaten Nachrichten, die E-Mails gleichen, stattfinden, aber auch per Voice-to-Voice-Übertragung298. Voice-to-Voice kann sowohl das Programm selbst ermöglichen als auch externe Programme wie TeamSpeak299. Letztere laufen im Hintergrund und ermöglichen auch dort Kommunikationsformen, wo sie nicht vorgesehen sind. McGonical weist auf einen weiteren Aspekt für den Erfolg von Onlinespielen hin, v. a. von solchen, die in soziale Netzwerke eingebunden. Demnach machen es „[…] Soziale Netzwerke für uns sowohl einfacher als auch lustiger, stabile, aktive Bindungen zu Menschen aufrechtzuerhalten, die uns zwar wichtig sind, mit denen wir uns im Alltag aber leider nicht oft genug treffen und unterhalten können […]“300. Dies gilt v. a. dann, wenn auch Familienmitglieder und Freunde spielen. Vor allem für Jugendliche sollen die sozialen Kontakte während und durch das Spielen einen hohen Stellenwert einnehmen301. In einigen Spielen gibt es zudem die Möglichkeit, dass sich Spieler in virtuelle Gemeinschaften, Gilden, Clans, Allianzen etc., zusammenschließen, die teilweise komplexe arbeitsteilige Gruppenstrukturen herausbilden302. Nach Fritz „[…] fließen die Aktivitäten der Spieler […] in ein soziales Resonanzfeld ein, das die Spieler an das Spiel und die Mitspieler bindet“303.
Die Bedeutung von virtuellen Welten, aber v. a. von digitalen Spielen ist in wirtschaftlicher wie auch gesellschaftlicher Sicht kaum zu überschätzen. Insgesamt 34,1 Mio. Deutsche spielen zumindest gelegentlich digitale Spiele, wobei das Durchschnittalter bei 35,5 Jahren liegt304. Dabei generieren diese Spiele weltweit zwischen 61,7 Mrd. und 77,5 Mrd. Euro. Für Deutschland wird der Gesamtumsatz der Spieleindustrie auf 3,3 Mrd. Euro geschätzt305. Damumentiertit generiert die Spielindustrie mittlerweile mehr Handelsumsatz als die Musikindustrie (ca. 1,55 Mrd. Euro) und die Kinofilmbranche (ca. 1,17 Mrd. Euro) zusammen306. Eine Vielzahl von Spielen setzt dabei auf den Kauf von virtuellen Zusatzgütern: So kann sich ein Spieler z. B. ein leistungsstärkeres Schwert oder Spielfortschritte für echtes Geld kaufen307. Seit 2007 stieg der Anteil virtueller Güter und Zusatzleistungen am Gesamtumsatz der Spieleindustrie kontinuierlich auf 266 Mio. Euro 2016 an. Zusammen mit den Einnahmen aus Abonnements in Spielen (2016 ca. 173 Mio. Euro) generieren virtuelle Spielinhalte zusammen 439 Mio. Euro308. Dies liegt auch an der Bedeutung von Onlinespielen309: 2014 sollen 8,53 Mio. Deutsche ab 14 Jahren zumindest gelegentlich das Internet für Online-Spiele genutzt haben, davon 1,9 Mio. täglich310. Im Jahr 2017 lag diese Quote bei 9,74 Mio. bzw. 2,03 Mio. mit täglicher Nutzung. Der Spieleverband BIU311 kommt hingegen bereits für das Jahr 2014 für alle Deutschen ab 0 Jahren sogar zum Ergebnis, dass 26,4 Mio. sie zumindest gelegentlich nutzen312.
Eines der bekanntesten Onlinespiele ist das von Blizzard seit 2004 betriebene World of Warcraft, ein Massively Multiplayer Online Role-Playing Game313 und weiterhin das „[…] Vergleichsobjekt für alle weiteren MMO-Spiele […]“314. Nach Angaben des Betreibers sollen mittlerweile mehr als 100 Mio. Accounts und fast 500 Mio. Avatare in dem Spiel erschaffen worden sein315. World of Warcraft erreichte 2010 mit mehr als 12 Mio. zahlenden Nutzern seinen Höherpunkt316, aber auch 2015 sollten noch 5,5 Mio. Menschen aktiv spielen317. Eine Vielzahl von weiteren Spielen hat es geschafft, ähnlich große Nutzerzahlen zu erreichen. Alleine Zynga, der Betreiber von Spielen wie Farmville318, soll 2012 fast 311 Mio. Spieler seiner Onlinespiele verzeichnet haben319. League of Legends, eine sog. „Multiplayer Online Battle Arena“ (MOBA)320, in der sich eine bestimmte Zahl Spieler als Avatare in den namensgebenden Arenen bekämpfen, hat für das Jahr 2015 100 Mio. monatliche aktive Nutzer bekannt gegeben321. World of Tanks, ein Onlinespiel von Wargaming, bei dem Panzer gegeneinander antreten, verzeichnete 2018 über 120 Mio. Spieler322. Der Betreiber Supercell hat mit Clash of Clans und Clash Royale wohl die bekanntesten mobilen Onlinespiele der gegenwärtigen Generation veröffentlicht, die zusammen täglich von über 100 Mio. Menschen weltweit gespielt werden sollen323. Diese Liste ließe sich ausufernd weiteraufführen. Die Zahlen verdeutlichen aber bereits die immense Anziehungskraft, die Onlinespiele auf eine Vielzahl von Menschen haben.
Die Bedeutung von digitalen Spielen spiegelt sich nicht nur im Umsatz oder Nutzungszahlen wider. Es wird auch eine Vielzahl gesellschaftlicher Diskussionen durch die immense Verbreitung und Nutzung digitaler Spiele ausgelöst. Neben der seit Jahrzehnten stattfindenden globalen Debatte über die Verbindung von Aggressionen und gewalthaltigen Computer- und Videospielen324 – in Deutschland v. a. in den Medien auch unter dem Begriff der „Killerspiele“325– gibt es Diskussionen zu kriminellen Aktivitäten326 in Onlinegames und virtuellen Welten327. Daneben gibt es Fragen, ob digitale Spiele Kulturgüter sind328 und ob sog.
E-Sports dem physischen Sport gleichgestellt werden sollten329. Diese Entwicklung zeigt sich auch im Koalitionsvertrag der 19. Legislaturperiode: „Wir erkennen die wachsende Bedeutung der E-Sport-Landschaft in Deutschland an. Da E-Sport wichtige Fähigkeiten schult […] werden wir E-Sport künftig vollständig als eigene Sportart mit Vereins- und Verbandsrecht anerkennen und bei der Schaffung einer olympischen Perspektive unterstützen“330.
Onlinespiele sind insgesamt eine der erfolgreichsten Formen Sozialer Medien. Dabei treffen Nutzer aus allen Altersstufen zusammen und haben oft die Möglichkeit zur relativ unproblematischen Kommunikation. Für Cybergroomer bietet sich hierbei die Möglichkeit, im Rahmen eines spielerischen Erlebens Kontakt aufzunehmen und auf Kinder einzuwirken331. Eine Vielzahl an Fällen zeigt, dass Täter diese Möglichkeiten ausnutzen, wie noch zu zeigen sein wird.
IV.1.5 Zwischenfazit
Zunächst kann resümiert werden, dass es in allen Programmen, die die Möglichkeit einer onlinebasierten Kontaktaufnahme und Kommunikation zwischen Nutzern bieten, es prinzipiell auch zu Cybergrooming-Tathandlungen kommen kann. Es zeigt sich, dass sich diese Programme mit der fortschreitenden Digitalisierung immer weiter ausdifferenzieren. Es gibt dabei nicht die eine Plattform für Cybergrooming-Delikte. Dies ist auch folgerichtig, denn Täter werden stets da zu finden sein, wo ihre potentiellen Opfer greifbar sind. Bedingt durch die Änderungen des Mediennutzungsverhalten von Minderjährigen im Laufe der Zeit und immer neu hinzukommende Programme bzw. Plattformen, wie Instagram, Snapchat oder auch Onlinespielen, ist verständlich, warum sich die für Cybergrooming genutzten virtuellen Orte ändern. Daher erscheint es nötig im nächsten Schritt zu erheben, wie Medien in Deutschland aktuell v. a. von Minderjährigen genutzt werden.
IV.2 Mediennutzung in Deutschland
IV.2.1 Mediennutzung von Jugendlichen und Erwachsenen
Die Onlinenutzung, v. a. der Sozialen Medien, ist kein Randphänomen in Deutschland. Vielmehr nutzen nach der seit 1997 regelmäßig durchgeführten Studie von ARD und ZDF im Jahr 2017 fast 89,8 Prozent der Deutschen ab 14 Jahren (ca. 62 Mio. Deutsche) zumindest gelegentlich Onlineangebote. 1997 lag diese Zahl bei 6,5 Prozent, um sich dann kontinuierlich und zeitweise rasant zu steigern und 2010 die 70-Prozent-Marke zu erreichen332. Diese Ergebnisse werden auch durch den Digital Index, eine Studie der Initiative Deutschland 21, gestützt, der zufolge sich die Onlinenutzung der Deutschen ab 14 Jahren von 37 Prozent im Jahr 2001 auf 81 Prozent im Jahr 2017 mehr als verdoppelt hat333. Die Studie erhebt ab 2015 auch die mobile Internetnutzung. Demnach waren damals bereits 54 Prozent mobil im Internet unterwegs und 2017 64 Prozent334. Rund 31 Mio. Deutsche sollen 2017 einen aktiven Account beim Sozialen Netzwerk Facebook genutzt haben335.
Dabei zeigt sich in der Internetnutzung ein gradueller Unterschied zwischen den Generationen, v. a. bei der mobilen Nutzung. So nutzen 99 Prozent der 14- bis 19-Jährigen das Internet und 89 Prozent sind mobil online. Diese Quote sinkt mit dem Alter leicht ab, bis auf 95 Prozent Internetnutzung bei den 40- bis 49-Jährigen sowie 81 Prozent mobile Internetnutzung. Bei den 60- bis 69-Jährigen sind immerhin 74 Prozent im Internet aktiv, aber lediglich 47 Prozent mobil online. Bei den über 80-jährigen sinkt dies auf 42 Prozent Internetnutzung, 18 Prozent mobile Internetnutzung336.
Insgesamt sollen im Jahr 2015 43 Prozent der deutschen Bevölkerung ab 14 Jahren zumindest einmal wöchentlich in Sozialen Medien aktiv sein337. 2017 lag diese Quote bereits bei 64 Prozent338. Dabei sticht heraus, dass insbesondere der Messenger-Dienst WhatsApp regelmäßig täglich genutzt wird: 55 Prozent der Internetnutzer ab 14 Jahren gaben an ihn zu nutzen, gegenüber nur 21 Prozent Facebook-Nutzung339. Interessanterweise setzen viele Erhebungen zur Nutzung von Facebook erst bei 13 oder 14 Jahren an340. Dies liegt u. a. darin begründet, dass Facebook durch Abs. 4 Nr. 5 seiner AGB vorschreibt, dass die Nutzer versichern, Facebook nicht zu verwenden, wenn sie unter 13 Jahre alt sind341. Damit wird gar nicht erhoben, wie viele Kinder unter 13 sich faktisch trotzdem bei Facebook anmelden. Bei den 14- bis 19-Jährigen gaben ganze 98 Prozent an WhatsApp zu nutzen, was es nach YouTube (100 Prozent) zur meist frequentierten Social Media App für junge Menschen macht342. Insgesamt zeigt sich, dass Soziale Medien stark von jüngeren Generationen frequentiert werden. 84 Prozent in der Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen nutzen Instagram, wobei diese Quote mit der Altersstruktur stärker abfällt als bei anderen Plattformen. So nutzen nur noch 58 Prozent der 20- bis 29-Jährigen und 39 Prozent der 30- bis 39-jährigen Instagram343. Ähnlich sieht die Entwicklung auch bei Snapchat aus, dass in der jüngsten Altersgruppe der 14- bis 19-Jährigen von 82 Prozent genutzt wird, bei den 30- bis 39-Jährigen aber nur noch von 22 Prozent. Zum Vergleich ist bei WhatsApp das Verhältnis (98 Prozent zu 81 Prozent) sehr viel näher344. Diese unterschiedliche Nutzung Sozialer Medien nach dem Alter kann auch aus der dargelegten Nutzungsfrequenz von mobilem Internet resultieren.
Abbildung 5 Auszug zur Mediennutzung ab 14 Jahren in Prozent. Quelle: Heintze 2017, Nutzer-Erosion – Facebook hat ein Generationen-Problem.
IV.2.2 Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen
Die angesprochene Entwicklung zeigt sich auch bei der Mediennutzung durch Minderjährige. Nach der auf die Mediennutzung von Jugendlichen in Deutschland spezialisierten JIM Studie gaben 2016 bei den 12- bis 13-Jährigen 86 Prozent WhatsApp als wichtigste Social-Media-Plattform an, 41 Prozent YouTube und 37 Prozent Instagram345. Lediglich 1 Prozent der Kinder benannten Facebook als wichtige App. Bei den 14- bis 15-Jährigen löst Instagram mit 48 Prozent YouTube ab (34 Prozent)346. Facebook gewinnt erst bei den 18- bis 19-Jährigen an Bedeutung, bei denen es immerhin 28 Prozent als wichtig einstufen. Dies verdeutlicht, dass v. a., Facebook für Täter an Relevanz verliert, schlicht weil deren Opfergruppe sie nicht mehr nutzt.
Konkrete Werte für noch jüngere Kinder können der Studie „Kinder und Jugendliche 3.0“ entnommen werden. Demnach haben bereits neun Prozent der 10- bis 11-Jährigen einen Facebook-Account, den sie zumindest hin und wieder aktiv nutzen347. Bei den 12- bis 13-Jährigen steigt diese Quote immerhin auf 38 Prozent348. Bei den 14- bis 15-Jährigen erhöht sich die Zahl sprunghaft auf 67 Prozent; bei den 16- bis 18-Jährigen sind es bereits 88 Prozent349. Obwohl in den Medien in den letzten Jahren häufig darüber berichtet wurde, dass Facebook für Kinder und Jugendliche an Attraktivität verliere350, ist es insbesondere in den Altersgruppen der älteren Jugendlichen und Heranwachsenden immer noch das meist verbreitete Soziale Medium. Eine Studie des PEW-Instituts ergab für das Jahr 2015, dass weltweit 71 Prozent der 13- bis 17-Jährigen zumindest einen Account bei Facebook eingerichtet haben351.
Die MIKE Studie zur Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen kommt für die Schweiz zu vergleichbaren Ergebnissen. Bereits 51 Prozent der 10- bis 12-Jährigen nutzen WhatsApp und 32 Prozent Instagram als Medium. Hingegen nutzen nur 17 Prozent Facebook und sogar nur 12 Prozent Twitter als ein Kommunikations- und Vernetzungsprogramm352.
Dass von den klassischen auf Kommunikation ausgelegten Sozialen Medien insbesondere WhatsApp und Instagram, aber auch Snapchat in jüngeren Altersgruppen genutzt werden, könnte auch einem anderen Nutzungsverhalten geschuldet sein. Für viele Menschen steht bei Facebook, aber auch Twitter primär die Vernetzung mit anderen – teilweise auch unbekannten – Menschen im Vordergrund ihrer Mediennutzung353. Nutzer hatten mit Facebook und auch MySpace die Gelegenheit, mit teils aus den Augen verlorenen Klassenkameraden oder Familienangehörigen auf eine unkomplizierte Weise Kontakt aufzunehmen und zu halten. Schmidt geht davon aus, dass für Jugendliche Soziale Netzwerke „[…] vorrangig dem Abhängen in der eigenen Clique bzw. Peer-Gruppe […]“ dienen354. Über diese engen sozialen Bindungen – Freundeskreis, aber auch Schulklassen oder Vereine – hinaus werden erweiterte Netzwerke des sozialen Nahfeldes von den Jugendlichen in die Nutzung eingebunden. Kontaktanfragen von nicht oder nur entfernt bekannten Personen werden nur in einem eher geringen Umfang angenommen.
IV.2.3 Frühkindliche Internet- und Mediennutzung
Der Gesetzgeber hat u. a. in § 176 Abs. 1 StGB legal definiert, dass er Kinder als Personen bis 14 Jahren erfasst. Diese Zeitspanne von 0–13 Jahren ist relativ weit gestreckt und erfasst unterschiedliche Stufen der kindlichen Entwicklung. Für die vorliegende Betrachtung der Mediennutzung durch Kinder ist jedoch insbesondere die Altersgruppe von Relevanz, auf die sprachlich – entweder in verbaler oder schriftlicher Form – eingewirkt werden kann. Dies kann in etwa ab drei bis vier Jahren für die verbale Aufnahmefähigkeit und bei sieben Jahren für die Lese- und Schreibfähigkeiten angenommen werden355.
Die Mediennutzung dieser relevanten Altersgruppe ab ca. sechs Jahren ist in unterschiedlichen Studien für den deutschsprachigen Raum erhoben worden. Insbesondere die Studienreihe Kinder und Medien (KIM), die seit 1999 in einem Rhythmus von etwa zwei Jahren jeweils die Mediennutzung von Kindern ab sechs Jahren erhebt, ist eine grundlegende Quelle. 1999 gaben bereits 13 Prozent der Kinder an zumindest gelegentlich im Internet zu surfen356. Bereits im Jahr 2000 erhöhte sich diese Zahl auf mehr als das Doppelte (31 Prozent) und 2002 nochmals auf 52 Prozent357. Der Wert stieg bis 2008 weiter auf ungefähr 59 Prozent an358.
Dabei kann eine klare Differenzierung zwischen den Altersstufen festgestellt werden. Beispielsweise gaben 1999 nur drei Prozent der Kinder von 6–7 Jahren an das Internet zu nutzen359 gegenüber 23 Prozent der 12- bis 13-Jährigen. Eine vergleichbare Studie ergab für 2002, dass bei den 6- bis 7-Jährigen 17 Prozent bereits das Internet genutzt haben360. Dieser Trend setzt sich in den Folgejahren fort, wobei ab 2006 für die Altersgruppen 10/11 und 12/13 (84 bzw. 91 Prozent) von einer annähernden Vollnutzung ausgegangen werden kann. Für das Jahr 2016 wird die Zahl der internetnutzenden Kinder in der Altersstufe von 7–13 Jahren mit insgesamt 94 Prozent angegeben361.
Nach Kalwar und Röllecke erhöhte sich bis 2003 die Zahl der internetnutzenden 6- bis 7-Jährigen auf 38 Prozent, sinkt in der Folge jedoch auf 31 Prozent im Jahr 2006. Eventuell hat dies mit einer gestiegenen Medienkompetenz oder Risikobewusstsein bei Eltern zu tun, die die Mediennutzung reflektierter betrachtet haben könnten362. Dieser Trend scheint sich nach den KIM und JIM Studien ab 2008 umgekehrt zu haben: Die frühkindlichen 6- bis 7-jährigen Internetnutzer wiesen hier teils höchste Steigerungsraten auf. So stieg der Anteil der 6- bis 7-jährigen Internetnutzer vom Jahr 2008 – mit 20 Prozent (2012 nur leichte Steigerung auf 21 Prozent) – auf 35 Prozent im Jahr 2016. Währenddessen verzeichnete die Altersstufe der 8- bis 9-Jährigen einen Anstieg von 50 auf 52 Prozent, die der 10-bis 11-Jährigen stagnierte bei 79 Prozent und die der 12- bis 13-Jährigen wies lediglich eine Steigerung von 86 auf 94 Prozent auf363. Im Durchschnitt nutzten 2016 68,5 Prozent der 6- bis 13-Jährigen bereits das Internet, womit auch das Risiko von Cybergrooming eröffnet wird.
Abbildung 6 Entwicklung kindlicher Internetnutzung von 2008–2016. Quelle: KIM Studien 2008, 2012, 2016.
Diese Ergebnisse werden auch durch weitere Erhebungen unterstützt. Die Studie U9 des Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit im Internet (DIVSI) ergab, dass im Jahr 2014 11 Prozent der 3-Jährigen, 22 Prozent der 5-Jährigen und 40 Prozent der 7-Jährigen das Internet zumindest gelegentlich nutzen364. Gerade die Internetnutzung der 7-Jährigen entspricht den Daten der KIM Studie (35 Prozent). Dies belegt, dass Kinder bereits in jüngsten Jahren in signifikanter Höhe im digitalen Raum aktiv sind und daher prinzipiell auch Opfer von Cybergroomern werden können.
IV.2.4 Digitale Spiele als Spielsphäre von Kindern
Wie aufgezeigt, nutzen Kinder immer mehr das Internet. Hier stellt sich die Frage, welche Medien gerade junge Kinder nutzen, in denen sie tatsächlich Opfer von Cybergrooming werden können.
„ When children begin to use the internet, the first things they do are schoolwork or playing games […]“365. Zu dieser Feststellung kam die EU KIDS Online Studie – die 25.000 Kinder in 25 europäischen Staaten zu deren Nutzungsverhalten befragte – für das Jahr 2011.366. Die Studie kam zu dem Schluss, dass beide Aktivitäten ein Fundament der kindlichen Mediennutzung darstellen. Dies ist auch nicht verwunderlich, so definiert die UN-Kinderrechtskonvention das Recht auf Spielen in Art. 31 Abs. 1 als ein Grundrecht von Kindern: „Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Ruhe und Freizeit an, auf Spiel und altersgemäße aktive Erholung sowie auf freie Teilnahme am kulturellen und künstlerischen Leben“367. Dies gilt dementsprechend auch für digitale Spiele.
Nach der miniKIM Studie 2012 spielten 2012 bereits 24 Prozent der 4- bis 5-Jährigen mindestens einmal in der Woche Onlinespiele,368 während nur 8 Prozent das Internet direkt nutzen durften369. Nach der für Deutschland repräsentativen Studie „Kinder und Jugend 3.0“ spielten 2014 56 Prozent der 6- bis 7-jährigen Kinder in Deutschland im Internet digitale Spiele online370. Auch gemäß der KIM Studie 2016 ist die beliebteste digitale Freizeitaktivität von Kindern im Alter von 6–13 Jahren Onlinespiele. Insgesamt 60 Prozent gaben an, sie ein oder mehrmals die Woche zu nutzen, wobei 24 Prozent sogar jeden oder fast jeden Tag spielten371. Dabei zeigen sich in fast allen Studien eindeutige Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen. So gaben nur 19 Prozent der Mädchen an, sehr interessiert an Spielen zu sein, gegenüber 42 Prozent der Jungen372. Insgesamt spielen gemäß dieser Studie dennoch 64 Prozent der Mädchen mindestens einmal die Woche gegenüber 75 Prozent der Jungen373. Dieses Ergebnis bezieht sich insgesamt auf die Altersgruppe der 6- bis 13-Jährigen. Eine Forsa-Studie im Auftrag der DAK Gesundheit vom 9. November 2015 kam zu vergleichbaren Ergebnissen. Demnach können drei Hauptaktivitäten von Kindern herausgearbeitet werden: 1. Videos ansehen (29 Prozent), 2. Onlinespiele nutzen (29 Prozent) und 3. Chatten374 (28 Prozent)375. Dabei waren Onlinespiele die Angebote, in denen die meisten Kinder „[…] mehr als die Hälfte ihrer Online-Zeit verbringen“376. Insgesamt gaben 43 bzw. 42 Prozent der Eltern von Jungen bzw. Mädchen in der Alterskategorie von 12–17 Jahren Onlinespiele als das Medium an, mit denen die Kinder die meiste Zeit verbringen377.
Die Ergebnisse der miniKIM Studie 2014 lassen darauf schließen, dass die Nutzungszahlen perspektivisch weiter ansteigen werden und sich auch die Gender-Nutzungsverteilung egalisieren wird. Die Haupterzieher von Kindern, die digitale Spielen nutzen, gaben in der miniKIM Studie, dass 62 Prozent der Mädchen einmal oder mehrmals die Woche Computerspiele spielen, 18 Prozent sogar jeden Tag. Bei den Jungen spielen 83 Prozent in der Woche und 21 Prozent täglich378. Dabei nutzen insgesamt 18 Prozent der spielenden Kinder dieser Alterskategorie explizit Onlinespiele.379 Und bereits 4 Prozent der 2- bis 3-Jährigen und 27 Prozent der 4- bis 5-Jährigen sollen digitale Spiele nutzen380.
Insgesamt machten Kinder bis 9 Jahren 2013 in etwa 9 Prozent der ca. 31,4 Mio. deutschen Computerspieler aus, also ca. 2,8 Mio.381. Dieser prozentuale Anteil blieb bis 2017 relativ konstant, als 3,1 Mio. spielende Kinder unter 9 Jahren angegeben wurden382. Weitere 17 Prozent (ca. 6 Mio.) sind Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 19 Jahren383.
Auch bei älteren Kindern (ab 12 Jahren) und Jugendlichen ist gegenwärtig noch eine Nutzungsdifferenz erkennbar. Demnach spielen 74 Prozent der Mädchen dieser Altersgruppe mindestens in 14 Tagen, 53 Prozent sogar mehrmals die Woche oder häufiger384. Bei den Jungen lauten die entsprechenden Zahlen 94 Prozent und 80 Prozent385. Unterschiede in der Bildung sind dabei höchstens marginal: 85 Prozent der Hauptschüler und 84 Prozent der Gymnasiasten spielen mindestens einmal in zwei Wochen386.
Der bereits zitierten BIU Umfrage zufolge machen die 10- bis 19-Jährigen 19 Prozent der Spieler aus, also 5,8 Mio. Deutschen entspricht387. Auch diese Quote stagnierte und lag 2017 bei 5,9 Mio. Spielern388. Nach einer anderen Studie liegt der Anteil der deutschen Gamer von 16–24, die zumindest gelegentlich auch gegen oder mit anderen online spielen, bei 74 Prozent. In der Alterskategorie der 25- bis 34-Jährigen waren dies 60 Prozent, bei den über 55-Jährigen noch 16 Prozent389. Dabei sollte nicht aus den Augen gelassen werden, dass der durchschnittliche Spieler – insbesondere auf Grund der lange erwachsenen Spielergenerationen der 80er und 90er – in etwa 35,5 Jahre alt ist390.
Auch eine internationale Betrachtung bestätigt diese Ergebnisse prinzipiell. So ergab das EU-Projekt Net Children Go Mobile zu Kindern und Jugendlichen aus sieben europäischen Staaten in der Altersstufe 11–16, dass 33 Prozent der Befragten mobil online mit anderen Mitspielern gespielt haben und 26 Prozent an einem klassischen stationären Gerät391. Auch hier zeigt sich die Entwicklung, dass stationäre Gerät für die jüngere Generation an Bedeutung verlieren und mobile Endgeräte zulegen.
Die grundsätzlichen Entwicklungen sind auch in den USA ersichtlich, wo die Spielerzahl unter 18 Jahren insgesamt 29 Prozent ausmacht392. Dabei spielen nach einer Branchenstudie 59 Prozent aller US-Amerikaner Computerspiele. Bei einer Einwohnerzahl von ca. 320 Mio. entspricht dies einer Spielergemeinschaft von etwa 188 Mio. Menschen mit einem Durchschnittsalter von 35 Jahren393.
Eine Studie des Pew Research Center (PEW), eines Meinungserhebungsinstituts in den USA, ergab, dass 72 Prozent aller Kinder und Jugendlichen von 13–17 Jahren in den USA Computer- und Videospiele nutzen394. Dabei ist auch in den USA eine gewisse Geschlechterdifferenzierung im Gamingbereich feststellbar. So gaben 83 Prozent der 13- bis 14-jährigen und 70 Prozent der 15- bis 17-jährigen Jungen an regelmäßig digital zu spielen. Dem stehen nur 64 Prozent der 13-bis 14-jährigen und 56 Prozent der 15- bis 17-jährigen Mädchen gegenüber395. Die Studie schaute, inwiefern für die Kinder und Jugendlichen in einem spielerischen Kontext stets auch ein vertrauensbildender Prozess gegeben ist. Insgesamt 59 Prozent der Jungen gaben an, dass sie sich mit Freunden im Spiel verknüpfen, die sie nur online und nicht als Person kennen würden, während das bei den Mädchen nur 40 Prozent bejahten396.
Dieses Ergebnis ermöglicht zwei Ableitungen: Kinder sind zum einen offensichtlich bereit, unbekannte Mitspieler zumindest als Online-Freunde zu definieren, da sie die genannten Mitspieler laut Umfrage nicht persönlich kannten. Dies könnte darauf hindeuten, dass in einer spielerischen Interaktion auch stets ein vertrauensbildender Prozess gesehen werden kann. Im Rahmen der Spieleforschung, den sog. Game Studies, wird angenommen, dass es faktisch einen Mehrwert für das Spielen darstellen kann, wenn man Mitspieler vertrauen kann397. Die Mitspieler können ihre Aufmerksamkeit mehr auf das Spiel konzentrieren als auf die Frage, ob andere entsprechend ihren Interessen agieren398. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass dies natürlich auch abhängig vom Genre des Spiels ist und v. a. auf kooperative Spielmodelle und -mechanismen zuzutreffen scheint. Gerade im Rahmen gruppenspezifischer Mechanismen wie bei Gilden ist, wie bei anderen gruppendynamischen Prozessen, ein vertrauensvolles Miteinander für den Erfolg wichtig399. Bei Spielen oder Spielmodi, wo eher ein flüchtiges Gegeneinander – vor allem beim reinen Player versus Player (PvP) Spielen – im Fokus steht, ist eine Vertrauensbindung vermutlich nicht in demselben Maße von Bedeutung.
Die zweite Ableitung ist, dass Jungen offensichtlich eher dazu neigen, auch unbekannte Mitspieler als Freunde zu identifizieren, was sie zumindest so im Rahmen der Erhebung angaben. Dies kann einerseits von der gemäß den Studien insgesamt höheren Attraktivität und Nutzungsintensität digitaler Spiele für Jungen herrühren400. Es kann auch darin begründet liegen, dass Mädchen insgesamt stärker sensibilisiert sind für Risiken im digitalen Raum und somit dort vorsichtiger mit vertrauensbildenden Prozessen umgehen. Die ICLIS Studie ergab für Deutschland, dass Mädchen in der achten Klasse „[…] durchschnittlich höhere computer- und informationsbezogene Kompetenzen […]“ besitzen als Jungen401, wobei sie „[…] ihre Fähigkeiten geringer einschätzen […]“ würden als die der Jungen402. Diese Entwicklung spiegelt sich auch darin wider, dass, wie dargestellt, 56 Prozent der befragten Jungen bereit sind sich beim Onlinegaming mit Personen verknüpfen, mit denen sie nicht befreundet sind. Bei den Mädchen bejahten dieselbe Frage nur 43 Prozent403. Letzteres könnte auf ein gestiegenes Risikobewusstsein beziehungsweise entsprechende Sensibilisierung hindeuten.
Aus diesen Entwicklungen können mehrere für diese Arbeit relevante Aspekte herausgelesen werden. Einerseits sieht man, dass digitale Spiele – und damit auch solche, die eine Onlinekommunikation ermöglichen – nicht nur von Jugendlichen, sondern auch bereits von Kindern in annähernd jeder Altersstruktur genutzt werden. Gleichzeitig liegt das durchschnittliche Alter der Gamer bei ca. 35 Jahren, nicht nur in Deutschland, sondern auch in vergleichbaren Ländern wie den USA.
In diesen Spielen treffen also alle Altersstufen in einem Onlinespiel aufeinander, interagieren und kommunizieren miteinander. Durch die spielerische Interaktion erscheint es naheliegend, dass ein Vertrauensaufbau von Kindern zu ihnen unbekannten Mitspielern wie auch umgekehrt leichter erfolgen kann als beispielsweise in klassischen Sozialen Netzwerken, in denen dieses spielerische Element fehlt. Zudem kann ein Kind beispielsweise in Sozialen Netzwerken anhand von Aspekten wie der Freundesliste einer Kontaktanfrage oder geteilten Beiträgen Anhaltspunkte über dessen Alter und Identität gewinnen. In Onlinespielen hingegen ist der Bezug zum sozialen Umfeld reduziert, auch durch die Nutzung von Avataren. Dies kann Onlinespiele, aber auch virtuelle Welten allgemein auch für Sexualtäter interessant machen404. So warnte das Bundeskriminalamt im Rahmen eines Presseartikels: „Gerade die bei Kindern und Jugendlichen beliebten Onlinespiele mit unterschiedlichen Kommunikationsmöglichkeiten zum Austausch unter Gleichgesinnten bieten gute Anknüpfungsmöglichkeiten für einen Erstkontakt zwischen Tätern und Opfern“405. In Spielen ist es jedoch zumeist nicht möglich selbstproduzierte Bilder oder Videos zu teilen, sodass ein Täter für einen intensiveren Austausch mit seinem Opfer auf andere Formen Sozialer Medien – v. a. Messenger – ausweichen muss. Dass Onlinespiele als Anbahnungsplattformen nicht irrelevant sind, zeigen diverse nationale wie internationale Fälle. Im Jahr 2016 wurde der Fall des 12-jährigen Paul aus der Schweiz bekannt. Ein 35-jähriger Mann aus Düsseldorf hatte als Moderator eines Minecraft Servers Vertrauen zum Jungen aufgebaut, ihn entführt und in Düsseldorf bis zur Befreiung durch die Polizei gefangen gehalten406. In einem anderen Fall nahm ein Täter über das Spiel „MovieStarPlanet“ Kontakt zu 122 Mädchen von 10–15 Jahren auf407. Im Jahr 2011 wurde in England der 14-jährige Breck Bednar vom 18-jährigen Lewis Daynes umgebracht408. Der Täter hatte über das gemeinsame Onlinespielen Vertrauen zum Opfer aufgebaut und so ihr Treffen einleiten können409.
IV.2.5 Zwischenfazit
Es konnte herausgearbeitet werden, dass Minderjährige in Deutschland immer früher mit der Internetnutzung beginnen. Dabei hat sich herauskristallisiert, dass in jüngeren Altersstufen Angebote wie Facebook oder Twitter eine nur geringe bis gar keine Rolle spielen. Vielmehr nutzen Kindern Medienplattformen (v. a. YouTube, Instagram und Snapchat) Messenger, und zwar primär WhatsApp, sowie insbesondere Jungen Onlinespiele ab frühestem Alter. Dementsprechend erscheint es notwendig, dass sich Analysen und v. a. auch Überlegungen zu kriminalpolitischen Reaktionen primär auf diese Plattformen beziehen. Im Gegenzug kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass Kinder nicht auch auf Plattformen wie Twitter oder gar LinkedIn und Xing zum Opfer von Cybergrooming werden können. Die Wahrscheinlichkeit kann jedoch auf Basis der Nutzungszahlen als gering eingestuft werden.
IV.3 Digitaler Narzissmus als Risikofaktor für Cybergrooming
Eine Betrachtung von Cybergrooming muss sich auch damit auseinandersetzen, warum Minderjährige offenbar bereit sind sich im Internet selbst zu präsentieren, was Tätern die Möglichkeit der Kontaktaufnahme bietet. Ein möglicher Erklärungsansatz könnte im Konzept des digitalen Narzissmus liegen410. Dabei ist der Grundgedanke, dass Kinder und Jugendliche in einem durch Interaktion und Kommunikation geprägten digitalen Raum aufwachsen. Schon bevor sie sich in diesen Raum selbst verorten und verankern können, wird ihnen durch Verwandte und Bekannte oft eine digitale Identität geschaffen411. Die Nutzung Sozialer Medien ist dabei offensichtlich geprägt von einer Form der ‚Egomanie‘, die auch auf einer Form von Selbstbestätigung basiert, die sich aus Likes, Followerzahlen und Ähnlichem speist, dem ‚digitalen Narzissmus‘412. Marx und Rüdiger verstehen darunter, dass „[…] die Selbstpräsentation und die zumeist positiven Reaktionen zu Selbstbestätigung und Anerkennung führen […]“413. Der digitale Narzissmus scheint durchaus eine folgerichtige Entwicklung im Rahmen der Digitalisierung zu sein. So hatte Facebook mit FaceMash einen kurzlebigen Vorgänger. Dort wurden jeweils zwei Studentinnen mit ihren Bildern gegenübergestellt und die Nutzer konnten bestimmen welche attraktiver sei als die andere414. Dabei griff FaceMash bereits relativ früh auf, dass es im digitalen Raum häufig um bildliche Eigen- und Fremdpräsentationen und entsprechende Bewertungen geht. Eine Konsequenz dieser Entwicklung ist u. a. das Phänomen, dass Kinder und Jugendliche von sich selbst Bilder erstellen und durch andere als „hot or not“ bewerten lassen, was Ansatzpunkte für Cybermobbing, aber auch Cybergrooming liefern konnte415. Das psychische Konzept dahinter ist als „Impression Management“, also bewusste Strategien zur Selbstinszenierung und zur Kontrolle des Meinungsbildes über sich, bereits länger bekannt416. Nicht jede Selbstdarstellung ist entsprechend strategisch geplant und sich der Risiken bewusst. Dies führt oft dazu, dass Menschen durch ein offensives Preisgeben ihrer persönlichen Privatsphäre im digitalen Raum, aber auch durch unterschiedliche Formen der Selbstpräsentation Anerkennung, Aufmerksamkeit und Zuspruch bekommen wollen417. Dieser Zuspruch ist dabei nicht nur auf die eigene Peer-Group beschränkt, sondern kann auch darüber hinaus stattfinden. Dies kann ab einem gewissen Bekanntheitsgrad durch Formen des Zuspruches wie Aufruf- und Followerzahlen sowie „Likes“ u. ä. geäußert werden. Aber auch negative Reaktionen können eine entsprechende Form der Anerkennung darstellen.
So ist im digitalen Raum eine Strategie, um sog. Trolle – also Personen, die durch beabsichtigte Provokationen einen Diskurs erschweren wollen – zu begegnen, der Leitsatz: „Don’t feed the troll“418. Dieser Ansatz basiert darauf, dass Trollen keine Aufmerksamkeit zukommen soll, da dies ihr primäres Ziel darstelle419. Ähnliche Slogans können sich auch auf andere digitale, aber auch physische Phänomene erstrecken. So kann angenommen werden, dass eine Form der Selbstbestätigung auch bei Menschen relevant sein könnte, die Volksverhetzungen bzw. Hatespeech posten420. Die Studie von Rost et al. deutet darauf hin, dass ein signifikanter Anteil (im Rahmen der Studie sogar 71,8 Prozent) Volksverhetzungen und artverwandte Äußerungen im Internet unter ihrem Klarnamen posten, und zwar weil sie nur so die Anerkennung für ihre Äußerungen erhalten und im besten Fall in der jeweiligen Gruppe einen höheren sozialen Status erreichen können421. Dies könnte ein Grund sein, warum die Aufklärungsquote bei Volksverhetzungen gem. § 130 StGB über das Tatmittel Internet im Jahr 2016 bei 71,2 Prozent lag, es also offenbar keine großen Probleme bei der Ermittlung der Tatverdächtigen gab422. Dieses Phänomen zeigt sich auch in der gesellschaftlichen Debatte um Verkehrsunfälle, bei denen sog. „Gaffer“ als Täter Unfälle filmen, um sie online zu teilen oder ins Internet einzustellen423. In einer mittelbaren Form kann diese Entwicklung u.a. daran abgelesen werden, dass beispielsweise die russische Polizei Warnhinweise mit Piktogrammen zur Anfertigung von Selfies gibt424, da sich tödliche Unfälle bedingt durch waghalsige Bilder gehäuft haben. Seit 2012 sollen weltweit insgesamt 49 tödliche Unfälle aufgrund der Anfertigung von Selfies bekannt geworden sein425. Dabei posten oder streamen auch immer mehr Täter ihre Tathandlungen im digitalen Raum, was aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden die Ermittlungsarbeit fördert426. Dieses Wissen um die Zurverfügungstellung von Informationen in Sozialen Medien wird bereits z. B. im Rahmen sog. Open Source Intelligence Techniken (OSINT) von Polizeibehörden weltweit genutzt427.
Eine besondere Bedeutung nimmt in diesem Gedankengang die Vorbildfunktion von erwachsenen Familienangehörigen und Bekannten ein, aber auch von Persönlichkeiten im öffentlichen Interesse, beispielsweise Schauspielern, Musikern, Sportlern, aber auch Models. So sollen bereits 64 Prozent der Kinder und Jugendlichen ab dem 12. Lebensjahr den „Gefällt mir Button“ von Sozialen Medien einsetzen428. Damit ist dies nach „Nachrichten an andere verschicken“ (86 Prozent) und „in einer Online-Community chatten“ die dritthäufigste Aktivität von Jugendlichen in Sozialen Medien429. Entsprechend naheliegend ist dann, dass sich Minderjährige offen im Netz präsentieren und auch die Hemmschwelle zur Kommunikation und zum Austausch von Medien mit reinen Onlinebekanntschaften sinkt. Dies wird insbesondere an der Verbreitung bzw. Veröffentlichung sogenannter Selfies festgemacht, also zumeist mit der internen Kamera von Smartphones gemachter Selbstporträts einer oder mehrerer Personen. Dieser Mechanismus kann wiederum von Cybergrooming-Tätern für die Anbahnung genutzt werden.
Diese Entwicklung geht auch damit einher, dass mittlerweile einige Eltern, aber auch andere Verwandte ganz selbstverständlich Bilder und Videos der eigenen oder anderer Kinder wie auch von Situationen aus dem Lebensalltag der Familie im Internet veröffentlichen. Sicherheitsbehörden wie die Polizei Hagen430 warnen aufgrund der Sicherheitsrisiken, aber auch wegen einer für den Laien undurchsichtigen Rechtslage vor diesem Trend431. Eine Studie des Internet-Sicherheitsdienstes AVG ergab, dass 81 Prozent der unter 2jährigen Kinder in irgendeiner Form bereits mit Bildern oder Videos im digitalen Raum präsent sind432. In diesem Bericht wird davon gesprochen, dass die Kinder damit bereits „digital footprints“ – also eine Art digitale Identität – haben433. Dieser Trend setzt sich beim Heranwachsen fort: Nach einer Studie von 2016 mithilfe des Youth Insight Panels der Bauer Media Group mit 4.400 Jugendlichen in der Altersgruppe von 12–19 Jahren haben bereits 67 Prozent der Mädchen und 49 Prozent der Jungen ab 13 Jahren in Deutschland sog. Selfies – also Selbstporträts – von sich digital veröffentlicht434. Hierbei ist davon auszugehen, dass diese Kinder nicht alle erst mit 13 entsprechende Bilder gepostet haben, sondern in noch jüngeren Jahren angefangen haben. Diese Tendenz zeigt sich auch darin, dass mittlerweile Kinder selbst als Vlogger (eine Portmanteaubildung aus Video und Blogger) mit der Veröffentlichung eigenproduzierter Videos auftreten435.
Auch die Anzahl der Freundschaften bzw. Followerzahlen kann diese Entwicklung widerspiegeln. Gemäß einer Studie sollen 12- bis 17-jährige amerikanische Facebook-Nutzer im Durchschnitt 521 Facebook-Freunde haben, in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen sogar 649436. Eine andere Studie kommt für die USA auf eine durchschnittliche Anzahl von 300 Facebook-Freunden in der Alterskategorie von 18 bis 29 Jahren437. Insgesamt sollen 23 Prozent aller Facebook-Nutzer zwischen 100 und 250 Freunde, 20 Prozent zwischen 250 und 500 Freunde und 15 Prozent sogar mehr als 500 Freunde besitzen438. Diese Zahlen liegen teilweise weit über dem Limit der sogenannten Dunbar’s Number von etwa 150 Personen, mit denen ein Mensch noch eine freundschaftliche Beziehung im Sinne von Zwischenmenschlichkeit führen kann439.
Aber nicht nur Kinder und Jugendliche präsentieren sich auf diese Weise, auch Erwachsene nutzen die Möglichkeiten der Selbst- und Fremdpräsentation in Kombination mit der Vernetzung und den damit einhergehenden Rückmeldemöglichkeiten der Sozialen Medien440. Dies dient nicht allein privaten Interessen. Vielmehr ist es durch die Sozialen Medien heutzutage nicht unüblich, sog. Business-Netzwerke über Plattformen wie LinkedIn und Xing aufzubauen und durch die Eigenpräsentation zu unterhalten441. Die Entwicklung zur Selbstdarstellung lässt sich auch an Trends wie Food-Bloggen oder der Verbreitung von Selfie-Sticks ablesen, also manueller Geräte, die quasi als Verlängerung des Armes die Aufnahme von Selbstporträts aus einer unterschiedlichen Perspektiven ermöglichen.
Je mehr – v. a. eigene persönliche – Informationen öffentlich geteilt werden, umso vulnerabler können die teilenden Personen werden. So können Bilder von Kindern gerade auch Tätern einen einfachen Einstieg in eine Konversation und damit letztlich in den Cybergrooming-Prozess ermöglichen. Beispielhaft werden Fälle thematisiert, in denen sich Täter gegenüber Mädchen auf Grundlage ihrer Bilder als Modellagenten ausgeben und versuchen die Kinder mit dem Versprechen eines Fotoshootings zur Übersendung weiterer Bilder zu überreden442. Genauso ist denkbar, dass sich ein Täter beispielsweise als Talentscout von einem Lieblingsfußballverein ausgibt und ein Kind zu einem Probetraining einlädt, für das er aber ein Bild in Unterwäsche benötigt, um die Physionomie einzustufen. In solchen Fällen versuchen die Täter zu verhindern, dass Kinder ihre Eltern informieren, indem typischerweise vorgeschlagen wird, dass selbst zu unternehmen, wenn man nach Zusendung der Bilder auch tatsächlich zu einem Treffen einlädt. Sobald die Bilder übersandt sind, hat der Täter dann entsprechendes Erpressungsmaterial in der Hand. Daneben können Bilder auch immer vulnerable Informationen über Personen und damit auch die Kinder selbst beinhalten443. So ist es denkbar, dass Kinder ihr Haus, ihre Schule, auch Geschwister oder beispielsweise ihre Laufstrecke aus Fitness-Apps öffentlich posten und damit entsprechende Übergriffe erleichtern444.
In dem bereits angesprochenen Fall der App Musical.ly hat sich diese Verbindung zwischen digitalem Narzissmus und der Gefahr von Cybergrooming-Tathandlungen offen gezeigt. Jugendschützer zeigten hier auf, dass bereits junge Kinder auf Musical.ly verstanden haben, dass sie durch das „[…] Zeigen von sehr viel Haut […] Aufmerksamkeit und Anerkennung […]“ generieren konnten445. Unter szenetypischen Hashtags wie „#Bellydance“ oder „#bikini“ fanden sich entsprechende Clips. Diese wurden dann von „[…] Profilen namens „Wickedluver69“ oder „mhberlindauergeilxxl“ […] mit Lob und Herzen […]“ überhäuft. Gleichzeitig wurde aufgewiesen, dass einige der Nutzer mit Profilnamen wie „daddys_girlz“ oder „Loveyourbelly“ explizit Videos von sehr jungen Kindern in Unterwäsche oder Bikini folgten und mit Kommentaren wie „hot und sexy“ versahen und zu weiteren Videos aufforderten446. Kinder haben offenbar schnell verstanden, dass sie mit offenherzigen Videos mehr Aufmerksamkeit generieren können. Gleichzeitig können solche Videos Tätern, wenn sie sich diese z. B. direkt von den Kindern senden lassen, als Erpressungsmaterial dienen oder schlicht einen Zugang zu den Opfern bieten. Der digitale Narzissmus ist offenbar ein wichtiges Element bei der Tatbegehung. Entsprechend erscheint es sinnvoll gerade auch dort bei Präventionsmaßnahmen anzusetzen, was noch zu thematisieren sein wird.
IV.4 Relevanz der Anonymität im digitalen Raum für Cybergrooming
Ein Kennzeichen des interaktionsbezogenen digitalen Raumes ist, dass die Nutzer in sprachliche Kommunikation oder nonverbale Interaktion miteinander treten, ohne immer sicher zu sein, wer genau die Person ist, mit der die jeweilige Interaktion tatsächlich stattfindet447. Dabei ist auch nicht von Relevanz, dass viele Menschen, wie erwähnt, mit Klarnamen auftreten, da es keine Verpflichtung und dementsprechend auch keine Überprüfung gibt. Im Rahmen von netzpolitischen Debatten wird teilweise als Teil der positiven Utopie des digitalen Raumes gesehen, dass sich Menschen frei im Internet bewegen können. Als vorteilhafte Aspekt dieser Entwicklung werden zumeist die Aufrechterhaltung der Meinungsfreiheit auch in diktatorischen und autokratischen Systemen angebracht, insbesondere über Soziale Medien wie Twitter, Facebook oder Instagram. Im Rahmen des sogenannten ‚arabischen Frühlings‘ haben sich diese Sozialen Medien und auch TOR-Netzwerke als ein mitentscheidender Faktor für die politische Mobilisierung und Demokratieentwickung etabliert448. Dabei sind es letztlich nicht die Medien als solche, die helfen, sondern die weitestgehend anonyme Nutzungsmöglichkeit449. Dieses Spannungsverhältnis zeigt sich auch im Rahmen der klassischen Diskussion um Anonymität und Vertraulichkeit der Kommunikation. Nach den islamistisch motivierten Anschlägen von San Bernadino in den USA am 2. Dezember 2015, bei denen ein Ehepaar insgesamt 14 Personen ermordete, beabsichtigte das FBI das aufgefundene Mobiltelefon eines der toten Attentäter nach sicherheitsrelevanten Informationen zu überprüfen, ein iPhone 5C von Apple450. Im Februar 2016 wurde durch ein öffentliches Schreiben von Tim Cook, CEO von Apple, bekannt, dass ein Bundesgericht Apple auf FBI-Antrag zur Entschlüsselung des besagten Smartphones verpflichtet hatte451. Apple weigerte sich in der Folge diesen Beschluss umzusetzen und verwies darauf, dass die Menschen sich dann nicht mehr sicher sein könnten, ob ihre Daten oder sie geschützt seien. Diese Form der digitalen Anonymität wurde für so relevant gehalten, dass sich eine massive globale Berichterstattung anschloss und andere führende IT-Firmen wie Microsoft, WhatsApp, Twitter, Facebook und Amazon452 ihre Unterstützung für Apple verkündeten. Die Anonymität bzw. Vertraulichkeit der Kommunikation wurden von den Unterstützer von Apple höher eingestuft als der eventuelle Erkenntnisgewinn aus Informationen eines Attentäters mit Bezug zum Islamischen Staat (IS). Im Bundesstaat New York wurde zudem eine Gesetzesinitiative gestartet, die Hersteller von Smartphones verpflichten soll, einen Schlüssel für die Entschlüsselung von Smartphones bereitzuhalten453. Die Anonymität der Kommunikation erscheint als so relevant, dass sich große IT -Firmen gegen einen legitimierten Rechtsstaat wenden. Dies könnte auch ein Grund für die bisher kaum ernsthaften Versuche sein, das Internet auch für Kinder sicher zu gestalten.
Diese Entwicklung ist nicht neu. Die prinzipiell als Vigilanten-Gruppen einzustufenden, nicht hierarchisch gegliederten ‚Zellen‘ des Anonymous-Kollektivs tragen bereits im Namen diese Form der Anonymität454. Sie haben ihre Ursprünge auf der Internetplattform 4Chan, auf der sich Nutzer weitestgehend anonym über alle Themenfelder austauschen, aber z. B. auch Mediendateien zur Verfügung stellen können455. Wie bei ähnlichen Imageboards und Chat-Foren erscheinen die Nutzer dabei entweder mit selbst gewählten Pseudonymen oder sie erhalten die generalisierende Betitelung „Anonymous“456. Obwohl ein Imageboard wie 4Chan Anonymität und die daraus entstehende Handlungsfreiheit als Markenzeichen sieht, gibt es dort die Grundregel, dass keine kinderpornografischen Dateien geduldet werden457. Trotzdem kommt es auch dort immer wieder dazu458.
Die weitestgehend vorgegebene oder von vielen angenommene digitale Anonymität erscheint also als ein relevanter Aspekt der gegenwärtigen Mediennutzung. Dabei kann auch diskutiert werden, ob vielen Menschen diese Form der Anonymität überhaupt bewusst ist. Denn eine Vielzahl von digitalen Risiken basiert ja gerade darauf, dass Menschen im Netz denken, es mit echten Menschen zu tun zu haben, und gar nicht erkennen, dass derjenige ein Pseudonym nutzt und damit doch in der Anonymität verbleibt459. Im Gegenzug versucht gerade Facebook immer auch die Klarnamenpflicht durchzusetzen, jedoch ohne effektive Mechanismen der Personenidentifizierung bspw. über ein Postident-Verfahren460.
Die grundsätzliche Anonymität des digitalen Raumes findet auch dort keine Grenzen, wo sich nachweislich Kinder im digitalen Raum bewegen. So werden so gut wie keine effektiven Personen- bzw. Altersidentifizierungssysteme für Programme bzw. Webseiten eingesetzt, die von Kindern genutzt werden oder könnten461. Die Anonymität erscheint auf den ersten Blick auch durchaus für Kinder sinnvoll, da sie damit nicht klar als Kinder oder Jugendliche z. B. in Onlinespielen identifiziert werden können. Jedoch scheinen Minderjährige überwiegend dazu zu neigen, sich bei Pseudonymen Namen des gleichen Geschlechts und auch Avataren in Spielen dasselbe Geschlecht zu geben, was diesen Vorteil wieder teilweise negiert462. So konnte im Rahmen einer Studie an Spielerinnen und Spielern des MMORPG World of Warcraft zu Genderswapping463 – also dem bewussten Tauschen seines Geschlechts nicht nur, aber insbesondere im Rahmen digitaler Aktivitäten, häufig verkörpert in digitalen Spielen durch die Auswahl eines Avatars des anderen Geschlechts – festgestellt werden, dass nur 20 Prozent der Spieler überhaupt Erfahrungen mit Genderswapping gemacht haben464. Erfahrungen von Kindern in diesem Zusammenhang können im Umkehrschluss auch einen Einfluss auf die Risikoeinschätzungen zum Alter und Geschlecht des Chat- oder Spielpartners haben. Bei der genannten Studie wurde nicht nach Altersstrukturen unterschieden, sodass nicht gesagt werden kann, inwiefern Kinder und Jugendliche zu einem entsprechenden Verhalten neigen. Daneben enthalten Nutzernamen, gerade auch von Kindern und Jugendlichen, immer wieder Hinweise auf das Geburtsdatum bzw. Alter. Im Rahmen einer Analyse von 500.000 Nutzernamen von „League of Legends“ des Herstellers Riot Games konnte im Abgleich mit Angaben bei der Registrierung festgestellt werden, dass 11.630 Nutzer in der Alterskategorie 14–20 Jahre zutreffende Altershinweise in den Nutzernamen integriert hatten465.
Ähnliche Zahlen finden sich auch in anderen digitalen Bereichen. Nach einer Studie des Branchenverbandes Bitkom sollen 25 Prozent der Nutzer von Dating-Apps wie Tinder oder Lavoo bereits falsche Angaben über ihr Geschlecht, Aussehen, aber auch über das Alter gemacht haben466. In derselben Studie konnte herausgearbeitet werden, dass insbesondere die Altersgruppen von 14–29467 Jahren am ehrlichsten auftreten, wo nur 17 Prozent über die entsprechenden Punkte lügen468. Die Quote der Falschangaben stieg kontinuierlich mit der Altersstruktur und 32 Prozent der 50- bis 64-jährigen Befragten gaben zu, falsche Angaben gemacht zu haben469.
Einerseits ist es also für einen beachtlichen Anteil der Menschen im digitalen Raum durchaus akzeptabel bzw. normal, beispielsweise falsche Angaben über Aussehen, Gewicht, aber auch über kritischere Aspekte wie das eigene Geschlecht und Alter zu machen. Anscheinend neigen insbesondere jüngere Internetnutzer dazu relevante Informationen bereits durch die Wahl eines Nutzernamens (Alter und Geschlecht) und ggf. auch beispielsweise durch die Wahl eines Avatar-Geschlechts in der virtuellen Welt zu verbreiten470. So können Nutzernamen wie „Lisa12“ oder „Peter2005“ besonders vulnerable Informationen über den jeweiligen Nutzer mitteilen.
Im Umkehrschluss kann allerdings kein Nutzer Sozialer Medien sich auch nur annähernd sicher sein, mit wem er in einer Interaktion tatsächlich kommuniziert. Hierfür würden effektive Personenidentifizierungssysteme benötigt, die solche spezifischen Daten im Rahmen einer Kommunikation verifizieren, um die vorherrschende Anonymität zu durchbrechen.
IV.5 Schlussfolgerung
Der digitale Raum in seiner jetzigen Form ist geprägt von der Nutzung Sozialer Medien. Jedes Soziale Medium, das keine effektive Kontrolle, bspw. in Form von Alters- und Personenidentifizierungsmechanismen, der nutzenden Personen vornimmt, kann auch von Cybergroomern genutzt werden, sofern Kommunikation möglich ist, um mit Kindern Kontakt aufzunehmen. Dabei hat sich gezeigt, dass sich die Mediennutzung von Minderjährigen in Deutschland auf Bilder- und Videoplattformen, Messenger und Onlinespiele konzentriert. Diese Mediengruppen sind nicht als gegenseitig exklusiv zu betrachten, vielmehr nutzen v. a. ältere Kinder alle Medien aktiv selbst. Nur weil ein Kind z. B. Onlinespiele spielt, heißt das nicht, dass es nicht auch einen Account auf Instagram unterhält. Dabei können die Bilder- und Videoangebote und Onlinespiele als Anbahnungsplattformen für Cybergrooming-Prozesse dienen. Hierbei zeigt sich, dass ein Cybergrooming-Prozess sich nicht auf ein Soziales Medium konzentrieren muss. So kann ein Täter in einem Onlinespiel den Kontakt mit einem Kind aufbauen und die Kommunikation dann im Laufe des Prozesses auf einen Messenger überführen. Auf diesen kann der Täter dann den digitalen Missbrauch in Form von Videolivestreams und der Übersendung von Bildern und Videos durchführen.
Anhand des Konzepts des digitalen Narzissmus wird ersichtlich, warum Täter offenbar relativ einfach über diese Medien Kontakt mit Kindern aufnehmen können. Die digitale Gesellschaft ist davon geprägt sich im Netz zu präsentieren. Diese Selbstdarstellung wird Kindern bereits frühzeitig vermittelt und kann einerseits zu einer vulnerablen und offenherzigen Darstellung führen, wie zu Musical.ly beschrieben. Andererseits lässt dies Kinder schneller auf Kontaktanfragen eingehen. Dies ist im Bereich der Onlinespiele etwas anders gelagert, da man sich hier nicht in Form von Selfies selbst präsentiert, auch wenn die Relevanz der Darstellung über einen eventuell vorhandenen Avatar nicht unterschätzt werden sollte. In Onlinespielen hat der Täter die Möglichkeit, durch das gemeinsame Spielerlebnis Vertrauen aufzubauen und entsprechend Kontakt mit dem Kind aufzunehmen. Bei allen Plattformen kommt der Aspekt der relativen Anonymität im Internet hinzu. Diese ist davon geprägt, dass einige Nutzer sich anonym bewegen und beispielsweise über ihre Identität täuschen. Andere tun dies gerade nicht, da sie für ihre Identität im Sinne des digitalen Narzissmus Rückmeldungen erhalten wollen. Diese Unsicherheit über die Identifizierbarkeit der Identität des Gegenübers scheint einerseits ein großer Risikofaktor für Kinder bei der Begegnung mit Cybergrooming zu sein. Andererseits greifen diese Faktoren nicht, wenn es sich nicht um Cybergrooming durch einen physisch unbekannten Täter, sondern um Gewalt durch Gleichaltrige handelt. Es erscheint daher notwendig, dass kriminalpolitische Strategien bei den unterschiedlichen Täterprofilen und Modi Operandi ansetzen müssen, um effektiv zu sein.
194 Hafner/Lyon 2008, Arpa Kadabra oder die Anfänge des Internets, S. 31.
195 Hafner/Lyon 2008, Arpa Kadabra oder die Anfänge des Internets, S. 31.
196 Hafner/Lyon 2008, Arpa Kadabra oder die Anfänge des Internets, S. 305.
197 Paramonova 2013, Internationales Strafrecht im Cyberspace, S. 1.
198 Robertz/Rüdiger 2012, Die Hacktivisten von Anonymous, S. 81.
199 Schmidt 2011, Das neue Netz, S. 13 ff.
200 Schmidt 2011, Das neue Netz, S. 13 ff.
201 Schmidt 2011, Das neue Netz, S. 13 ff.
202 Münker 2009, Emergenz digitaler Öffentlichkeiten, S. 15.
203 Bauer 2011, User Generated Content, S. 8.
204 Schmidt/Taddicken 2017, Handbuch soziale Medien, S. 4.
205 Pöllmann 2018, Kulturmarketing, S. 172.
206 Schmidt/Taddicken 2017, Handbuch soziale Medien, S. 4.
207 Pöllmann 2018, Kulturmarketing, S. 172.
208 Statista 2018, Anzahl der monatlich aktiven Nutzer von WhatsApp weltweit in ausgewählten Monaten von April 2013 bis Januar 2018.
209 Götzl/Pfeiffer/Primus 2008, MMORPGS 360°, S. 40.; Wimmer 2013, Massenphänomen Computerspiele, S. 20.
210 Schmidt/Taddicken 2017, Handbuch soziale Medien. S. 9 ff.
211 Zu den unterschiedlichen Bezahlmodellen vor allem im Bereich der Onlinegames vgl. Köhler 2015, Free2Play and Pay2Win in der kritischen Würdigung, S. 213.; Wildt 2015, Digital Junkies: Internetabhängigkeit und ihre Folgen für unsere Kinder, Kapitel 3.2 (eBook).
212 Feierabend/Plankenhorn/Rathgeb 2017, Jugend, Information, (Multi-)Media, S. 35.
213 Heintze 2017, Nutzer-Erosion – Facebook hat ein Generationen-Problem, Abbildung F4.
214 Heintze 2017, Nutzer-Erosion – Facebook hat ein Generationen-Problem, Abbildung F4.
215 Heintze 2017, Nutzer-Erosion – Facebook hat ein Generationen-Problem, Abbildung F4.
216 Henning 2018, Digital und vernetzt, S. 107 ff.
217 Schmidt/Taddicken 2017, Handbuch soziale Medien, S. 10.
218 Facebook 2011, Einführung der „Abonnieren“-Schaltfläche.
219 Facebook 2018, Abonnieren - Verbinde dich mit anderen Facebook-Nutzern.
220 Twitter wird typischerweise auch als ein Microblogging-Dienst bezeichnet, da es die Anzahl der Zeichen von Postings „Tweets“ durch die Nutzer beschränkt. Vgl. Kreutzer 2018, Praxisorientiertes Online-Marketing, S. 4.
221 Hilker 2012, Social Media für Unternehmer, S. 38.
222 Vogt 2018, Digital Trump-Card?, S. 163.
223 Zu Google+ sind keine verlässlichen Daten auffindbar, da jeder Mensch der einen Account bei Google – beispielhaft für YouTube hat – automatisch auch als Nutzer bei Google+ registriert wird. Google+ soll im Laufe des Jahres 2019 eingestellt werden. Vgl. Kontor4 2018, Social Media.
224 Koch/Frees 2017, ARD/ZDF-Onlinestudie, S. 444 Tab. 11.
225 Facebook 2017, Company Info.
226 Statista 2018, Anzahl der monatlich aktiven Nutzer von Twitter.
227 Moravek 2018, Das 1x1 der Internet-Akquise, S. 196.
228 Hahn 2012, Soziale Netzwerke, Selbstinszenierung und das Ende der Privatsphäre, S. 31.
229 Hahn 2012, Soziale Netzwerke, Selbstinszenierung und das Ende der Privatsphäre, S. 31.
230 In Deutschland sollen lediglich zwei Prozent der Gesamtbevölkerung zumindest wöchentlich Xing nutzen. Vgl. Koch/Frees 2017, ARD/ZDF-Onlinestudie S. 444 Tab. 11.
231 LinkedIn soll in der Dach Region – Deutschland, Österreich und der Schweiz – im Jahr 2017 elf Mio. Nutzer gehabt haben. Vgl. Statista 2017, Anzahl der Mitglieder von LinkedIn in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
232 Ortega 2016, Social network sites for scientists, S. 102.
233 Ortega 2016, Social network sites for scientists, S. 127.
234 Faltesek 2018, Selling social media, S. 49; Ziegler, 2015, Sicher in sozialen Netzwerken, S. 86.
235 Ziegler, 2015, Sicher in sozialen Netzwerken, S. 90.
236 Das VG Meiningen verhandelte die Entlassung eines thüringischen Polizeibeamten der über Facebook Kontakt zu einem 13-jährigen Jungen aufgenommen und diesen „diverse SMS mit sexualbezogenen Inhalten“ zugesandt hat. VG Meiningen Beschl. V. 17.12.2013 – 1 E 455/13 Me, RN. 3; Auch im bereits angesprochenen Verfahren des VG Cottbus in Bezug auf den Brandenburger Polizisten, nutzte dieser Facebook um zu dem Kind Kontakt aufzunehmen. VG Cottbus Beschl. v. 14.02.2018 – 3 L 95/18, RN. 1.
237 Feierabend/Plankenhorn/Rathgeb 2017, JIM 2017, S. 33.
238 Feierabend/Plankenhorn/Rathgeb 2017, JIM 2017, S. 33.
239 Feierabend/Plankenhorn/ Rathgeb 2017, KIM 2016, S. 36
240 Röhrich 2018, Cyber-Grooming; Scheerhout 2016, Paedophiles using Clash of Clans and Instagram to groom children as young as seven; Schwandner/Braun 2017, Sexueller Missbrauch im Netz.
241 Der Täter gab den Opfern gegenüber vor, sich hässlich zu finden. Zur Untermauerung dieser Aussage übersandte er den Kindern kinderpornografische Medien und animierte so bundesweit Kinder ihm Bilder von sich selbst zu senden. Insgesamt wurden 138 einzelne Fälle abgeurteilt. Vgl. Witt 2018, Landgericht verurteilt 41jährigen wegen Cyber-Grooming.
242 Schmidt/Taddicken 2017, Handbuch soziale Medien, S. 145.
243 Rieber 2017, Mobile Marketing: Grundlagen, Strategien, Instrumente, S. 11.
244 Schmidt/Taddicken 2017, Handbuch soziale Medien, S. 145.
245 OLG Hamm, Beschluss vom 14. Januar 2016 – AZ: 4 RVs 144/15, RN. 3
246 ICQ Teen Chat 2015, Teenagers, Hangout Here!
247 Knuddels 2017, Chatten. Spielen. Flirten.
248 WhatsApp 2016, rechtliche Hinweise, Unterpunkt Registrierung.
249 KakaoTalk 2018, Kakao’s Privacy Policy, Unterpunkt 2 - Collection of Personal Information.
250 Skype 2018, Kostenloser Videochat.
251 Statista 2018, Number of registered Kik Messenger.
252 Chaykowski 2015, KIK – The Teen Messaging Giant.
253 Schulzki-Haddouti 2014, Kriminologe warnt vor KIK-Messenger.
254 Koch/Frees 2017, ARD/ZDF-Onlinestudie, S. 444 Tab. 11.
255 Statista 2017, Anzahl der monatlich aktiven bzw. monatlich eingeloggten Nutzer von YouTube.
256 Reim 2017, Ab ins Netz?!, S. 74.
257 Vogelsang 2017, Sexuelle Viktimisierung, Pornografie und Sexting im Jugendalter, S. 36.
258 Syverson 2015, New Media, New Ethics?, S. 235.
259 Diefenbach 2018, Social TV, S. 189.
260 Statista 2018, Anzahl der monatlich aktiven Instagram Nutzer weltweit.
261 Firsching 2017, Snap Inc.
262 Koch/Frees 2017, ARD/ZDF-Onlinestudie, S. 444 Tab. 11.
263 Borgböhmer 2018, Die neue Distributed-Content-Alternative.
264 Eisenbrand 2017, 8,5 Millionen deutsche Nutzer.
265 Pöting 2018, Musical.ly Unheimliche Parallelwelt im Kinderzimmer.
266 Fuest 2018, Einfach gelöscht.
267 MacCallum-Stewart 2014, Online Games, Social Narrativess, S. 36 ff.
268 Rüdiger 2016, Onlinespiele - Ein kritisches Spielfeld für Kinder und Erwachsene?, S. 1 ff.
269 Krebs /Rüdiger 2010, Gamecrime und Metacrime, S. 16 ff.
270 Paschke 2013, Erfolgsdeterminanten von Communities in virtuellen Welten, S. 18.
271 Gehmann 2012, Virtuelle und ideale Welten, S. 9 ff.
272 Krebs /Rüdiger 2010, Gamecrime und Metacrime, S. 16 ff.
273 Paschke 2013, Erfolgsdeterminanten von Communities in virtuellen Welten, S. 18.
274 Krebs/Rüdiger unterscheiden hierbei zwischen Metaversen – die keine spielerisches Ziel beinhalten – und reinen Onlinespielen, die virtuelle Welten darstellen mit einem klar definierten Spielziel. Krebs/Rüdiger 2010, Gamecrime und Metacrime, S. 16 ff.
275 vgl. zur Geschichte von Second Life Chambers-Jones 2012, Virtual economies and financial crime, S. 7 ff.
276 Mesa 2014, Brand avatar, S. 25.
277 Rymaszewski et al. 2007, Second Life, S. 15.
278 Wimmer nutzt den Begriff der „virtuellen Welten“ in Umkehrung zu dem Begriff eines Computerspiels. Demnach seien virtuelle Welten „[…] onlinebasierte Interaktions- und Kommunikationsräume ohne spezifische Spielregeln und Spielcharakter, sodass nicht von einem Computerspiel im Sinne regelbasierten Handelns gesprochen werden kann […]“. Der Autor erfasst unter dieser Definition die Metaversen bzw. LifeSimS. Wimmer 2013, Massenphänomen Computerspiele, S. 167.
279 Erstmalig soll das Konzept eines Mateversum in dem Cyberpunk Roman „Snow Cash“ von Stephenson beschrieben worden sein. Stephenson 2007, Snow Crash, S. 5; vgl. auch Erenli, 2009, Virtuelle Welten, S. 6.
280 Krebs/Rüdiger 2010, Gamecrime und Metacrime, S. 17.
281 Erenli 2009, Virtuelle Welten, S. 1 ff.; Holmer 2012, Die Grenzen persistenter Welten, S. 160; Krebs/Rüdiger 2010, Gamecrime und Metacrime S. 18 ff.
282 Erenli 2009, Virtuelle Welten S. 3 ff; Stephenson 2007, Snow Crash, S. 33.
283 Bruns 2015, Virtual Reality: Eine Analyse der Schlüsseltechnologie aus der Perspektive des strategischen Managements, S. 8.
284 Bruns 2015, Virtual Reality: Eine Analyse der Schlüsseltechnologie aus der Perspektive des strategischen Managements, S. 8.; Enigl 2017, Immersive Cinema & Virtual Reality, S. 21.
285 Enigl 2017, Immersive Cinema & Virtual Reality, S. 9.
286 Vgl. zum gegenwärtigen Stand der Hardware Feyder/Rath-Wiggins 2018, VR-Journalismus, S. 34.
287 BIU 2017, Interesse an Virtual-Reality-Brillen steigt.
288 Enigl 2017, Immersive Cinema & Virtual Reality, S. 214.
289 Castendyk 2009, Rechtliche Probleme von Onlinespielen, S. 21.
290 Zur historischen Entwicklung und Einstufung von Onlinegames und deren Subgenre vgl. u. a. Lischka 2002, Spielplatz Computer, S. 107; Quandt/Wimmer/Wolling 2009, Die Computerspieler, S. 135 ff.; Triebel 2014, Netzwerkdienste für Massively Multiplayer Online Games, S. 9 ff.
291 Das Patent wurde am 25. Januar 1947 beantragt und am 14. Dezember 1948 unter der Nummer „2455992“ beim United States Patentamt registriert. Vgl. Wolf 2012, Encyclopedia of video games, S. 476.
292 Triebel 2014, Netzwerkdienste für Massively Multiplayer Online Games, S. 7; Wimmer 2012, Massenphänomen Computerspiele, S.16.
293 Wimmer 2012, Massenphänomen Computerspiele, S. 16.
294 McGonigal 2011, Reality is broken, S. 37.
295 Krebs/Rüdiger, Gamecrime und Metacrime, S. 10 ff.
296 Triebel 2014, Netzwerkdienste für Massively Multiplayer Online Games, S. 18.
297 Krebs/Rüdiger 2010, Gamecrime und Metacrime S. 21, 33.
298 Krebs/Rüdiger 2010, Gamecrime und Metacrime. S. 42.
299 Embrick/Wright/Lukacs 2014, Social exclusion, power, and video game play, S. 27.
300 McGonigal 2011, Reality is broken, S. 110 ff.
301 Röll 2014, Über Stämme, Clans, Gilden und die Wiederverzauberung der Welt, S. 97.
302 Fritz 2009, Spielen in virtuellen Gemeinschaften, S. 137.
303 Fritz 2009, Spielen in virtuellen Gemeinschaften, S. 137.
304 BIU 2017, Nutzer digitaler Spiele in Deutschland 2016 und 2017.
305 Castendyk /Müller-Lietzkow 2017, Die Computer- und Videospielindustrie in Deutschland, S. 89 Abb. 83.
306 Castendyk /Müller-Lietzkow 2017, Die Computer- und Videospielindustrie in Deutschland, S. 90 Abb. 84.
307 Wenn ein Spiel zunächst gratis genutzt wird, nennt sich das Marketingmodell „Free to Play“. Einige bekannte Onlinespiele wie Clash of Clans und Clash Royal finanzieren sich über dieses Modell. Im Gegenzug existiert auch das Geschäftsmodell eines Abonnements, bei dem der Spieler das Spiel entweder kaufen muss oder umsonst beziehen kann, dann jedoch eine Art Gebühr für die Nutzung bezahlen muss. Krebs/Rüdiger 2010, Gamecrime und Metacrime, S. 25.
308 BIU 2017, Umsatz mit Online- und Browser-Spielen 2016.
309 Allein das Mobilspiel „Clash of Clans“ soll bereits 2013 täglich durch den Verkauf von virtuellen Gütern 2,4 Mio. US-Dollar generiert haben. Vgl. Strauss 2013, The $2.4 Mio.-Per-Day-Company: Supercell.
310 Statista 2018, Anzahl der Personen in Deutschland, die das Internet für Online-Spiele nutzen.
311 Der BIU fusionierte am 29. Januar 2018 mit dem zweiten Verband der Spieleindustrie – Game – zu dem neuen Verband der deutschen Games-Branche „Game“. Insofern in dieser Arbeit auf einen der beiden ursprünglichen Verbände Bezug genommen wird, wird weiterhin die jeweilige originäre Bezeichnung beibehalten. Vgl. Puppe 2018, Zusammenschluss von BIU und Game.
312 BIU 2014, Nutzerzahlen von Online-, Browser- oder App-Spielen.
313 Vgl. zum Begriff und den Anfängen der MMORPGs Schmitz 2007, MMORPGs heute und morgen, S. 21.
314 Kempf 2010, Die internationale Computer- und Videospielindustrie, S. 176.
315 WoW 2013, Über 100 Millionen Spieler.
316 Chiang 2010, Blizzard On World Of Warcraft's 12 Million Subscribers.
317 Statista 2015, Anzahl der Abonnenten von World of Warcraft weltweit.
318 Farmville gehört zur Gruppe der sog. Social Games eine Unterform der Onlinespiele die direkt als „Applications“ in Sozialen Medien - primär in Facebook - integriert sind. Vgl. Frieling 2011, Virtuelle Güter, S. 16.
319 Statista 2018, Durchschnittliche Anzahl der aktiven Nutzer von Zynga-Spielen pro Monat.
320 Hoffman 2016, Computerspielsysteme, S. 21.
321 Volk 2016, League of Legends now boasts over 100 million monthly active players worldwide.
322 Grimm 2018, Word of Tanks 1.0.
323 Fuest 2016, Der unfassbare Wert der digitalen Barbarendörfer.
324 Zum aktuellen Stand der wissenschaftlichen Auseinandersetzung – die eher darauf hindeutet, dass keine signifikante Verbindung besteht – vgl. u. a. Kühn et al. 2018, Does playing violent video games cause aggression?, S. 1 ff; Kunczik 2017, Medien und Gewalt: Überblick über den aktuellen Stand der Forschung und der Theoriediskussion, S. 31; Szycik et al. 2017, Excessive users of violent video games do not show emotional desensitization.
325 Joeckel 2018, Computerspiele: Nutzung, Wirkung und Bedeutung, S. 60.
326 Vgl. u. a. Krebs/Rüdiger 2010, Gamecrime und Metacrime, S. 1 ff; Laue 2011, Crime Potential of Metaverses, S.26; Richter 2007, Betrug im Spiel, S. 79; Rüdiger/Pfeiffer 2015, Game!Crime?, S. 1 ff.
327 Donath 2017, Drogen- und Suchtbericht 2017, S. 61.
328 Vgl. u. a. Bundesregierung 2017, Computerspiele sind Kulturgut; Lange 2017, Computerspiele als digitales Kulturgut, S. 78ff.; Wimmer 2013, Massenphänomen Computerspiele, S. 37.
329 Hierunter kann das professionelle und wettbewerbsmäßige Spielen von Computer- und Videospielen verstanden werden. Dies findet mittlerweile in großen Fußballspielen vergleichbaren Events in Stadien statt und die spielenden Teams setzen sich aus Vollzeitprofis zusammen. Mittlerweile haben auch viele Fußballclubs der Bundesliga - wie Schalke 04 oder Bayern München – eigene eSportsteams vornehmlich für das Fussballspiel „Fifa“. Vgl. Schöber 2018, Bildschirm-Athleten, S. 31 ff.
330 CDU/CSU/SPD 2018, Koalitionsvereinbarung Zeilen 2167 bis 2171.
331 Rüdiger 2016, Onlinespiele - Ein kritisches Spielfeld für Kinder und Erwachsene?, S. 3 ff.
332 Koch/Frees 2017, ARD/ZDF-Onlinestudie, S. 435 Tab. 1.
333 Müller et al. 2017, D21-Digital-Index, S. 10.
334 Müller et al. 2017, D21-Digital-Index, S. 10.
335 Roth 2017, Offizielle Facebook Nutzerzahlen für Deutschland.
336 Müller et al. 2017, D21-Digital-Index, S. 58.
337 Tippelt/Kupferschmitt 2015, ARD/ZDF-Onlinestudie, S. 443 Tab. 1.
338 Koch/Frees 2017, ARD/ZDF-Onlinestudie, S. 444 Tab. 1.
339 Koch/Frees 2017, ARD/ZDF-Onlinestudie, S. 444.
340 Koch/Frees 2017, ARD/ZDF-Onlinestudie, S. 434 ff; Statista 2014, Anteil der Nutzer von Facebook in Deutschland nach Altersgruppen im Jahr 2014.
341 Vgl. Facebook 2015, Nutzungsvereinbarung, Punkt 4.5.
342 Heintze 2017, Nutzer-Erosion – Facebook hat ein Generationen-Problem, Abbildung F4; vgl. Abb. 5.
343 Heintze 2017, Nutzer-Erosion – Facebook hat ein Generationen-Problem, Abbildung F4; vgl. Abb. 5.
344 Heintze/Dick 2018, Soziale Medien für Groß und Klein, Abbildung F4.
345 Feierabend/Plankenhorn/Rathgeb 2017, JIM Studie 2017, S. 33.
346 Feierabend/Plankenhorn/Rathgeb 2017, JIM Studie 2017, S. 33, Folie 19
347 Kempf/Holdampf-Wendel 2014, Studie Kinder und Jugend 3.0, S. 8.
348 Kempf/Holdampf-Wendel 2014, Studie Kinder und Jugend 3.0, S. 8.
349 Kempf/Holdampf-Wendel 2014, Studie Kinder und Jugend 3.0, S. 8.
350 Greif 2013, Facebook räumt erstmals schwindendes Interesse jugendlicher Nutzer ein; McGrath 2015, Facebook Still No.1 For Teens.
351 Lenhart 2015, Teens, Social Media & Technology.
352 Suter et al. 2015, Ergebnisbericht zur MIKE-Studie 2015, S. 38 Abb. 24.
353 Wassmer/Jarren 2015, Durch Governance zu einer gemeinsamen Verantwortungskultur, S. 83.
354 Schmidt 2011, Das neue Netz, S. 87.
355 Bredel/Furhop/Noack 2011, Wie Kinder lesen und schreiben lernen, S. 75 ff.
356 Feierabend/Klingler 2001, KIM 2000, S. 42.
357 Feierabend/Klingler 2002, KIM 2002, S. 38.
358 Feierabend/Rathgeb 2009, KIM 2008, S. 38.
359 Feierabend/Klingler 2001, KIM 2000, S. 42.
360 Hasebrink/Mously 2003, Mediennutzung und Konsumverhalten von 6–13Jährigen, S.44
361 Feierabend/Plankenhorn/ Rathgeb 2017, KIM 2016, S. 33.
362 Zum Begriff der Medienkompetenz in diesem Zusammenhang vgl. Kalwar/Röllecke 2013, Medienkompetenzförderung für Kinder und Jugendliche, S. 10 ff.
363 Feierabend/Plankenhorn/Rathgeb 2017, KIM 2016, S. 33.
364 Borgstedt et al. 2015, Kinder in der digitalen Welt, S. 69.
365 Livingstone et al. 2012, Risks and safety on the internet, S. 14.
366 Livingstone et al. 2012, Risks and safety on the internet, S. 14.
367 UN-Kinderrechtskonvention 1989, Konvention über die Rechte des Kindes, Art. 31 Abs. 1.
368 Feierabend/Plankenhorn/Rathgeb 2013, miniKIM 2012, S. 8.
369 Feierabend/Plankenhorn/Rathgeb 2013, miniKIM 2012, S. 8.
370 Kempf/Holdampf-Wendel 2014, Studie Kinder und Jugend 3.0, S. 17.
371 Feierabend/Plankenhorn/Rathgeb 2017, KIM 2016, S. 10.
372 Feierabend/Plankenhorn/Rathgeb 2017, KIM 2016, S. 10.
373 Feierabend/Plankenhorn/Rathgeb 2017, KIM 2016, S. 53.
374 Interessanterweise existiert natürlich auch in den meisten Onlinespielen, die Möglichkeit mit anderen Mitspielern zu chatten, da es ein Kernbereich von Onlinespielen ist mit anderen zu kommunizieren und zu interagieren.
375 DAK 2015, Internet- und Computergebrauch bei Kindern und Jugendlichen, Folie, 5.
376 DAK 2015, Internet- und Computergebrauch bei Kindern und Jugendlichen, Folie, 5.
377 DAK 2015, Internet- und Computergebrauch bei Kindern und Jugendlichen, Folie, 6.
378 Feierabend/Plankenhorn/Rathgeb 2014, JIM 2014, S. 19.
379 Feierabend/Plankenhorn/Rathgeb 2014, JIM 2014, S. 20.
380 Feierabend/Plankenhorn/Rathgeb 2014, JIM 2014, S. 19.
381 BIU 2017, Altersverteilung der Nutzer digitaler Spiele in Deutschland.
382 BIU 2017, Altersverteilung der Nutzer digitaler Spiele in Deutschland.
383 Statista 2018, Verteilung der Videogamer in Deutschland nach Alter im Jahr 2018.
384 Feierabend/Plankenhorn/Rathgeb 2014, JIM 2014, S. 41.
385 Feierabend/Plankenhorn/Rathgeb 2014, JIM 2014, S. 41.
386 Feierabend/Plankenhorn/Rathgeb 2014, JIM 2014, S. 41.
387 BIU 2017, Altersverteilung der Nutzer digitaler Spiele in Deutschland.
388 BIU 2017, Altersverteilung der Nutzer digitaler Spiele in Deutschland.
389 BIU 2017, Nutzung von Mehrspieler-Spielen 2017.
390 BIU 2017, Nutzer digitaler Spiele in Deutschland 2016 und 2017.
391 Mascheroni/Cuman 2014, Net Children Go Mobile Final Report, S. 12.
392 ESA 2017, Essential Facts about the Computer and Video Game Industry, S. 7.
393 ESA 2014, Essential Facts about the Computer and Video Game Industry, S. 2.
394 Lenhart et al. 2015, Teens, Technology & Friendships, S. 42.
395 Lenhart et al. 2015, Teens, Technology & Friendships, S. 42.
396 Lenhart et al. 2015, Teens, Technology & Friendships, S. 42.
397 Fritz weist zudem darauf hin, dass das zusammenspielen einerseits Vertrauen entstehen lässt und andererseits ein wichtiger Aspekt für die Motivation sein kann das entsprechende Spiel überhaupt zu spielen. Fritz 2009, Spielen in virtuellen Gemeinschaften, S. 137 ff.
398 Ihtiyar 2016, Affekte und Kommunikation in ausgewählten Spielen, S. 90 ff.
399 Geisler 2009, Clans, Gilden und Gamefamilies, S. 59 ff.
400 Feierabend/Plankenhorn/Rathgeb 2016, JIM 2016, S. 43.; Krause 2011, Weibliche Nutzer von Computerspielen, S. 67 ff.
401 Bos et al. 2014, ICLIS 2013, S. 1 ff.
402 Bos et al. 2014, ICLIS 2013, S. 22.
403 Lenhart et al. 2015, Teens, Technology & Friendships, S. 44.
404 Rüdiger 2013, Sexualtäter in virtuellen Welten, S. 9 ff; Rüdiger 2015, Der böse Onkel im digitalen Kinderzimmer, S. 104 ff.
405 Fisser 2016, Wie Pädo-Kriminelle Kinder in die Sexfalle locken.
406 Christiansen 2016, Was ist in der Düsseldorfer Wohnung passiert; Krebs 2016, Kinderschutz – Entführter Paul.
407 Fisser 2016, Wie Pädo-Kriminelle Kinder in die Sexfalle locken.
408 Firmin 2018, Abuse Between Young People, S. 160 ff.
409 Halliday 2015, Teenager who killed Breck Bednar in ‘sadistic’ attack jailed for life.
410 Marx/Rüdiger 2017, Romancescamming, S. 217.
411 Zöllner 2017, Kinderbilder in Social Media aus Sicht der Digitalen Ethik, S. 35 ff.
412 Reinicke 2014, Ambivalente Prozesse im digitalen Informationszeitalter, S. 42 ff.
413 Marx/Rüdiger 2017, Romancescamming, S. 217.
414 Brugger 2012, Facebook als digitale Litfasssäule, S. 19.
415 Marx 2017, Diskursphänomen Cybermobbing, S. 130.
416 Leary/Kowalski 1990, Impression managment, S. 34.
417 Marx/Rüdiger 2017, Romancescamming, S. 217.
418 Brodnig weist jedoch durchaus folgerichtig darauf hin, dass dieser Satz eher kontraproduktiv sei, da bedingt durch die Schiere Größe des Internets die Trolle so nicht bekämpft werden können, sondern eher Verdrängungseffekte eintreten. Brodnig 2016, Hass im Netz, Kapitel 2 (eBook).
419 Poland 2016, Haters: Harrassment, abuse, and violance online, S. 62.
420 Unter Hatespeech werden in dieser Arbeit nur Meinungsäußerungsdelikte die strafbar sein können – vornehmlich im Bereich §§ 86a und 130 StGB – verstanden.
421 Rost/Stahel/Frey 2016, Digital Social Norm Enforcement, S. 13.
422 BMI 2016, Polizeiliche Kriminalstatistik 2015, Grundtabelle 05, Tatschlüssel 627000.
423 vgl. Maus 2016, Wenn Opfer schneller auf Youtube landen als im OP.
424 MVD 2015, Safety Selfie.
425 Crocket 2016, The Tragic Data Behind Selfie Fatalities.
426 Rüdiger 2018, Das Broken Web, S. 275 ff.
427 Akhgar/Wells 2018, Critical Success Factors for OSINT Driven Situational Awareness, S. 2 ff; Staniforth 2016, Police Use of Open Source Intelligence Investigation, S. 27 ff,
428 Feierabend/Plankenhorn/Rathgeb 2015, JIM Studie 2016, S. 38.
429 Feierabend/Plankenhorn/Rathgeb 2015, JIM Studie 2016, S. 38.
430 Polizei NRW Hagen 2015, Hören Sie bitte auf, Fotos Ihrer Kinder für jedermann sichtbar bei Facebook und Co zu posten!
431 Dahlmann 2015, Polizei: Keine Kinderfotos auf Facebook posten.
432 AVG 2010, The AVG Digital Diaries Report, S. 4.
433 AVG 2010, The AVG Digital Diaries Report, S. 2.
434 Hienzsch 2016, Dr.-Sommer-Studie 2016.
435 Johnson 2017, Wie man seine extrem stressigen Eltern chillt, S. 11.
436 Statista 2014, Durchschnittliche Anzahl von Facebook-Freunden bei US-amerikanischen Nutzern nach Altersgruppe im Jahr 2014.
437 Smith 2014, What people like and dislike about Facebook.
438 Smith 2014, What people like and dislike about Facebook.
439 Rosen/Cheever/Carrier 2015, The Wiley handbook of psychology, technology and society, S. 254.
440 Rüdiger 2018, Broken Web, S. 274.
441 Scheel/Steinmetz 2015, Selbstmarketing im Social Web, S. 9 ff.
442 Saferinternet.at 2018, Cyber-Grooming.
443 Marx/ Rüdiger 2017, Romancescaming, S. 217.
444 Die Polizei NRW Hagen warnte beispielhaft in einem Facebook-Beitrag im Jahr 2015 davor öffentlich zu posten wenn man im Urlaub sei, da dies Einbrechern die Arbeit erleichtere. Polizei NRW Hagen 2015, Ich möchte mich bei allen bedanken, die auf Facebook posten, wann sie in Urlaub sind.
445 Pöting 2018, Musical.ly Unheimliche Parallelwelt im Kinderzimmer.
446 Pöting 2018, Musical.ly Unheimliche Parallelwelt im Kinderzimmer.
447 Spelz zeigt auf, dass gerade diese Anonymität einigen Menschen vor allem auch aus Randgruppen eine tatsächliche soziale Interaktion und Kommunikation also eine gesellschaftliche Eingebundenheit ermöglicht. Spelz 2009, Kommunikation in den neuen Medien, S. 44.
448 El Difraoui 2011, Die Rolle der neuen Medien im arabischen Frühling; Kneuer/Demmelhuber 2012, Die Bedeutung Neuer Medien für die Demokratieentwicklung, S. 30ff; Milz 2011, Die Bedeutung Sozialer Netzwerke in der arabischen Welt, S. 4.
449 Katzer beschreibt diesen Effekt bereits 2010, Tatort Internet, S. 183.
450 Baur-Ahrens/Hagendorff/Pawelec 2017, Kryptografie, S. 52 ff
451 Blankenstein 2016, Judge Forces Apple to Help Unlock San Bernardino Shooter iPhone.
452 Lerman/Day 2016, Microsoft takes Apple ´s side in iPhone dispute with FBI.
453 Matthey 2016, US-Bundesstaat will gegen Smartphone-Verschlüsselung vorgehen.
454 Zu Anonymous Struktur und Verbreitung vgl. Robertz/Rüdiger 2012, Die Hacktivisten von Anonymous, S. 79.
455 Reißmann/Stöcker/Lischka 2012, We are Anonymous, S. 10 ff.
456 Steinschaden 2012, Digitaler Frühling: Wer das Netz hat, hat die Macht?, S. 20.
457 Steinschaden 2012, Digitaler Frühling: Wer das Netz hat, hat die Macht?, S. 19 ff.
458 Steinschaden 2012, Digitaler Frühling: Wer das Netz hat, hat die Macht?, S. 19 ff.
459 Vgl. zu den Phänomenen Marx/Rüdiger 2017, Romancescaming, S. 211 ff.
460 Vgl. zur Rechtmäßigkeit der entsprechenden Vorschriften von Facebook LG Berlin Urt. v. 16.01.2018 – Az: 16 O 341/15, RN 11.
461 Zur Relevanz von Altersverifikationen im Bereich des Jugendmedienschutzes vgl. Hetmank 2016, Internetrecht, S. 178 ff.
462 Song/Jung 2015, Antecedents and Consequences of Gender Swapping in Online Games, S. 436.
463 Neverla 1998, Geschlechterordnung in der virtuellen Realität, S. 145 ff.
464 Song/Jung 2015, Antecendets and Consequences of Gender Swapping in Online Games, S.
465 Kokkinakis et al. 2017, Exploring the relationship between video game expertise and fluid intelligence, S. 608.
466 Grimm 2015, Online-Dating: Jeder Vierte macht falsche Angaben.
467 Typischerweise wird in digitalen Studien stets als Altersgrenze 13 Jahre oder 14 Jahre angesetzt. Beides soll verhindern, dass Aussagen zu Kindern gemacht werden. Argumentationsgrundlagen sind hierbei häufig, dass die Allgemeinen Geschäftsbedingungen o.Ä. keine Teilnahme von Kindern zu ließen, daher auch nicht abgefragt werden müssten.
468 Grimm 2015, Online-Dating: Jeder Vierte macht falsche Angaben.
469 Grimm 2015, Online-Dating: Jeder Vierte macht falsche Angaben.
470 Rüdiger 2013, Sexualtäter in virtuellen Welten, S. 17.