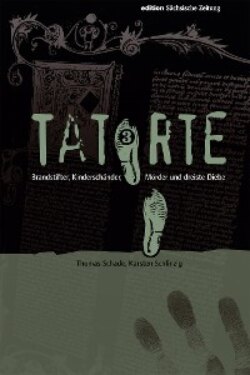Читать книгу Tatorte 3 - Thomas Schade - Страница 5
Der Kurgast mit dem Bombenkoffer von Karsten Schlinzig
ОглавлениеIm Juni 2003 steht eine Kofferbombe im Dresdner Hauptbahnhof. Zur selben Zeit wird die Deutsche Bank erpresst. Ein Kriminalist findet auf der Spur der Steine zum Täter.
Silvio Lange hatte den Koffer schon vor über einer Stunde gesehen. Anscheinend herrenlos steht das dunkelblaue Reisegepäck immer noch auf dem Bahnsteig am Gleis 14 im Dresdner Hauptbahnhof. Keiner hat ihn bisher mitgenommen. Silvio Lange, Bahnmitarbeiter und für die Reinigung von Zügen zuständig, meldet seine Beobachtung dem Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn. Es ist 19.20 Uhr, am 6. Juni, dem Freitag vor Pfingsten im Jahr 2003.
Ein Mann vom Sicherheitsdienst geht zum Bahnsteig 14, schaut sich den Koffer aus gebührender Entfernung an und informiert umgehend den Bundesgrenzschutz, denn seit den Terroranschlägen vom 9. September 2001 gibt es auch bei der Bahn Vorschriften zum Umgang mit herrenlosen Koffern und Taschen. Der Bundesgrenzschutz lässt das Gleis 14 sowie die angrenzenden Gleise sperren. Polizisten finden außerdem in 50 Meter Entfernung, außerhalb der Bahnhofhalle, eine weitere herrenlose Reisetasche. Mit einem transportablen Röntgengerät beginnen Beamte einer BGS-Spezialeinheit für Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen unter Leitung von Oliver Zieger die Tasche außerhalb der Halle zu durchleuchten. Sie finden keinen Hinweis auf einen Sprengsatz, die Tasche wird geöffnet – sie enthält Bekleidungsstücke.
Gegen 21.30 Uhr beginnt Stephan Krause (47) im Schutzanzug mit der Überprüfung des Koffers auf Bahnsteig 14 in der Halle. Der Bundespolizist ist Spezialist für das Entschärfen von Bomben. Der herrenlose Koffer steht nur einige Meter neben einem Süßwarenautomaten. Schon die ersten Röntgenbilder lassen dem Beamten den Atem stocken. Er erkennt Zünder, Kabel und vermutlich Sprengstoff. Stephan Krause entschließt sich, den Koffer mit einer Wasserkanone zu beschießen. Genau um 21.50 Uhr zerspringt der dunkelblaue Koffer, einzelne Teile der Zündvorrichtung fallen heraus. Krause tritt an den Koffer heran und sieht, dass er sich nicht geirrt hatte: Batterien, Drähte und Sprengstoff sowie einen Kochtopf, der mit Klebeband verschlossen ist. Mit einer Zange durchtrennt er die Kabel zwischen Batterie und Sprengstoff. Die Bombe ist entschärft – Krause gibt Entwarnung. Nun übernimmt die Landespolizei die weitere Arbeit am Tatort.
Der Bombenkoffer auf Bahnsteig 14 des Dresdner Hauptbahnhofes. Im Laufe der Ermittlungen rekonstruierte die Polizei die Situation am 6. Juni 2003.
Während der Bundespolizist seinen Einsatzbericht schreibt, beginnt die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Sachsen mit ihrer Arbeit auf dem Bahnsteig. Die Spurenspezialisten finden in dem Koffer Utensilien eines Sprengsatzes: Ein Kochtopf, gefüllt mit roter Sprengstoffschnur, dazu einzelne Brocken Sprengstoff; sechs zum Teil zerbrochene Schraubgläser; zwei elektrische Zündkapseln; ein Beutel, gefüllt mit Sprengstoff und Sprengschnur, einzelne Steine. In ihre Einzelteile zerschossen sind eine Pappe - die Grundplatte für die Zündvorrichtung und ein blauer Wecker. Nachdem die Tatortarbeit beendet ist, wird alles eingepackt und ins Landeskriminalamt gebracht. Parallel dazu beginnen Kriminalbeamte im Dresdner Hauptbahnhof mit der Befragung von Mitarbeitern der Deutschen Bahn. Wie zu erwarten, erhalten sie keine brauchbaren Hinweise, wer den Koffer auf dem Bahnsteig abgestellt haben könnte. Sie hoffen nun darauf, dass die Video-Überwachung des Bahnhofes ihnen etwas mehr verrät. Kann man sehen, wer den Koffer deponiert hat? Fehlanzeige – die Videoüberwachung des Dresdner Hauptbahnhofes fertigte ausgerechnet an diesem Tag keine Aufzeichnungen, sondern lieferte nur Live-Bilder in die Zentrale. Dort hätte die Speicherung manuell ausgelöst werden müssen. Aber das hatte an diesem Nachmittag niemand veranlasst – so gibt es keine Bilder vom Bahnsteig.
Der spektakuläre Fund bleibt nicht unbemerkt. Hunderte Reisende waren von den Einschränkungen im Bahnverkehr betroffen. Rundfunk und Fernsehen berichten noch am Abend von der Kofferbombe. Am nächsten Tag, dem 7. Juni, steht es in allen regionalen Zeitungen. Im Landeskriminalamt (LKA) Sachsen hat Präsident Peter Raisch die verantwortlichen Abteilungsleiter zu sich gerufen. Allen ist die Brisanz der Situation am Hauptbahnhof deutlich vor Augen. Der Fund könnte eine weitreichende Dimension erreichen, da eine politisch motivierte Tat nicht auszuschließen ist. LKA-Chef Raisch beauftragt deshalb das Dezernat für polizeilichen Staatsschutz mit den Ermittlungen und ordnet den Aufbau einer Sonderkommission an. Die Soko „Bahnhof “ wird von Kriminalbeamten der anderen Ermittlungsdezernate des LKA unterstützt. Zum Leiter der Soko wird Kriminalhauptkommissar Rüdiger Ertle ernannt, ein erfahrener Ermittler des Dezernates Staatsschutz. Der 43-Jährige stammt aus Unterfranken in Bayern, war bereits im Bundeskriminalamt tätig und wurde 1993 vom damaligen LKA-Abteilungsleiter Bernd Merbitz nach Sachsen geholt. Ertle leitet in den kommenden Monaten die Arbeit der durchschnittlich 16-köpfigen Soko. Zum „harten Kern“ gehört auch Kriminaloberkommissar Alexander Silex, ein 32-jähriger Ermittler, der aus Leipzig zum LKA gekommen ist. Die Aufgabe ist gewaltig. Die Ermittler haben nur einen zerstörten Sprengsatz und keinen einzigen Hinweis, wer ihn gebaut haben könnte.
Sieben Tage nach dem Fund stellen sich am 10. Juni Ertle und LKA-Präsident Raisch in einer Pressekonferenz den Fragen der Journalisten. Sie geben Auskunft zum Inhalt des Koffers. Die meisten Fragen der Medienvertreter können sie nicht beantworten. Aber den Kriminalisten ist klar: Der Fall ist so außergewöhnlich, dass Journalisten und Politiker immer wieder nach dem Stand der Ermittlungen fragen werden. So lastet großer Erfolgsdruck auf der Soko. Die Frage, die sich von Beginn an alle stellen und die die Ermittler noch Monate später beschäftigt, lautet: War der Sprengsatz zündfähig, hätte die Bombe tatsächlich explodieren können? Ertle kann dazu in der ersten Pressekonferenz keine Auskunft geben, er weiß es selbst nicht und muss die Journalisten auf später vertrösten. Sein Chef Peter Raisch leistet sich in dieser Frage einen groben Schnitzer, als er drei Tage später, erneut von Journalisten befragt, äußert: „Meine Kriminaltechniker werden beweisen, dass es sich um einen funktionsfähigen Sprengsatz handelte!“ – Eine Aussage, die noch große Bedeutung erhalten sollte.
Die Soko „Bahnhof “ hat derweil jede Menge zu tun. Sie muss die ersten Hinweise aus der Bevölkerung bearbeiten und gegebenenfalls Spuren verfolgen. Und es gilt zwei Fragen zu klären. Erstens: woher stammen der Koffer und sein Inhalt? Zweitens: welches Motiv hat der Täter? Handelt es sich tatsächlich um einen politisch motivierten Anschlag? Steckten islamistische Terroristen dahinter, eine links- oder rechtsextremistische Gruppierung oder handelt es sich um einen Einzeltäter?
Alles ist möglich – zunächst haben Ertle und seine Mitarbeiter keine Hinweise, in welche Richtung es gehen wird. Wenigstens die Kriminaltechnik liefert in diesen ersten Tagen positive Nachrichten. Am Inhalt des Koffers konnten einige DNA-Spuren gesichert werden. Die gilt es nun mit der zentralen DNA-Datenbank des Bundeskriminalamtes zu vergleichen. Eine besonders intensive Spur hatten die Kriminaltechniker an der Batterie der Zündvorrichtung gefunden. Der Bombenbauer hat den Ladezustand der Batterie offensichtlich durch Berührung mit der Zunge geprüft. Sein Speichel liefert eine brauchbare DNA-Spur, die Hoffnungen für die Beweisführung aufkeimen lässt. Doch bald stellt sich heraus, dass die DNA nicht im Bundeskriminalamt gespeichert ist. Es wäre wohl auch zu einfach gewesen, wenn der Bombenbauer so schnell zu ermitteln gewesen wäre. Auch eine zweite DNA-Spur im Koffer bringt die Ermittler zunächst nicht weiter.
Derweil beschäftigen sich im Polizeipräsidium Frankfurt am Main einige Kriminalbeamte mit einem Brief, der an den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank Josef Ackermann adressiert ist. Es ist ein Erpresserbrief - von der Deutschen Post am 9. Juni 2003 im Briefverteilzentrum Ottendorf-Okrilla bei Dresden gestempelt, drei Tage nach dem Bombenfund am Dresdner Hauptbahnhof. Existiert da ein Zusammenhang?
Es ist bereits der sechste Erpresserbrief, den die Deutsche Bank seit Februar 2003 erhalten hat. Ein Satz des Erpressers lässt die Kriminalisten vermuten, dass es eine Verbindung zwischen der Kofferbombe im Dresdner Hauptbahnhof und der Erpressung geben könnte. Der Verfasser hatte geschrieben: „Der Vorgang ist nicht mehr zu stoppen. Und Sie sollten daran sehen, wie die Sache eskaliert.“ Die Frankfurter Polizei informiert am 13. Juni ihre Kollegen in Dresden. Die Soko „Bahnhof “ nimmt die Sache ernst und sieht in dem Brief einen ersten Ermittlungsansatz. Denn die Frankfurter liefern weit mehr Informationen, als nur diesen einen Brief.
Der Erpresser hatte bereits am 24. Februar 2003 einen ersten Brief an die Deutsche Bank geschickt, an den damaligen Vorstandsvorsitzenden Dr. Rolf E. Breuer. Er forderte 50 Millionen Euro und wollte durch ein Gewinnspiel an sein Geld kommen, das vom Hamburger Nachrichten-Magazin „Stern“ veranstaltet werden sollte. Er kündigte an, die Details später zu präzisieren. Die Briefe sind mit Schreibmaschine geschrieben und unterzeichnet mit dem Namen „Hannnibal“. So kurios - mit drei „n“ - wird er alle Schreiben unterzeichnen. Der zweite Brief trifft am 3. März 2003 bei der Bank ein, nun an Dr. Josef Ackermann gerichtet. „Hannnibal“ nennt in diesem Brief Einzelheiten, wie das Gewinnspiel im Magazin „Stern“ ablaufen soll.
Am 17. April 2003 ereignet sich im Wiesbadener Karstadt-Kaufhaus eine Explosion. Eine Kundin wird leicht verletzt, es entsteht ein Sachschaden von 500.000 Euro. Fünf Tage später erhält die Deutsche Bank den nächsten Brief von „Hannnibal“. Er nimmt Bezug auf die Explosion im Karstadt-Kaufhaus und fordert 120 Millionen Euro. Formulierungen wie „Ich werde ohne Erbarmen bestrafen“, „Sollte der Fall eintreten, wird es furchtbar“ und „Dieses Schreiben ist ein letzter Versuch, die Sache unblutig zu erledigen.“ sollen seine Forderungen untermauern. So richtig wird den Ermittlern aber nicht klar, wie die Geldübergabe vonstatten gehen soll. Mit dem Gewinnspiel konnte es eigentlich nicht funktionieren.
Während in den Medien Experten – auch selbsternannte Experten – über einen möglichen Terroranschlag militanter Islamisten spekulieren, wissen es die Ermittler besser. Die Bombe scheint das Werk eines Einzeltäters zu sein. Das Polizeipräsidium Frankfurt am Main bittet die Fachleute des Bundeskriminalamtes, die Briefe zu analysieren. Das Ergebnis soll Hinweise auf die Persönlichkeit des Verfassers liefern, aber auch auf die verwendete Schreibmaschine.
Die Beamten der Soko „Bahnhof “ versuchen derweil zu ermitteln, woher die Gegenstände aus dem Koffer stammen. Am 14. Juni veröffentlicht das Landeskriminalamt Bilder der Bomben-Utensilien auf seiner Internetseite. Relativ leicht lässt sich die Herkunft der Sprengschnur ermitteln. Sie wird im Sprengstoffwerk Gnaschwitz bei Bautzen hergestellt und ist für gewerbliche Zwecke vorgesehen. Ihre Sprengkraft ist nicht zu unterschätzen, denn der Sorte „Detocord“ haften pro Meter 20 Gramm Sprengstoff an. In den 45 Metern Schnur steckten also 890 Gramm Sprengstoff – hochexplosiv. Weiter lässt sich diese Spur aber nicht verfolgen, denn die Herstellerfirma beliefert Abnehmer in ganz Europa. Der Koffer selbst führt auch nicht wirklich weiter. Es ist ein Trolley Board Case der Marke „Shamp“. 25.000 Stück davon waren nach dem 13. September 2000 bei Aldi-Nord verkauft worden. Nach dem 12. September 2001 wurden nochmals 25.000 Stück verkauft, davon 7.500 in Dänemark. Den Käufer des Bombenkoffers auf diesem Weg zu finden erweist sich somit als aussichtslos.
Auch der Topf, in dem die Sprengschnur lag, wird identifiziert: Es ist ein hellgrauer Schnellkochtopf der Marke BEKA, Durchmesser 18 cm, Höhe 12 cm, aus Walzstahl, hergestellt in den Jahren 1980 bis 1985 bei einer Firma in Tübingen. Im Koffer lagen auch sechs Schraubgläser, die mit einer leicht brennbaren Flüssigkeit gefüllt und mit Küchenpapier umhüllt waren. Die Kriminaltechniker können den Inhalt analysieren. Es ist eine Mischung aus Ottokraftstoff und Nitroverdünner. Da die Gläser noch mit Etiketten und Originaldeckeln versehen sind, versuchen die Ermittler die Herkunft festzustellen. Es waren Gläser für Petersilie, Rotkraut, Sauerkraut, Würstchen, Konfitüre und Tomatensauce. Fünf Gläser sind zerbrochen, ein Glas hatte den Beschuss mit der Wasserkanone unversehrt überstanden. Die Ermittler suchen in Supermärkten nach solchen Gläsern und wenden sich an die Hersteller. Es dauert einige Zeit, aber die Beamten der Soko ermitteln, dass einige der Gläser ausschließlich von ALDI Nord, andere nur von ALDI-Süd verkauft wurden. Dies lässt vermuten, dass der Käufer der Gläser in der Nähe der Grenze zwischen ALDI-Nord und ALDI-Süd wohnen könnte. Ein Hinweis, der noch wertvoll werden sollte.
Zur Zündvorrichtung der Kofferbombe gehörten ein blauer Reisewecker, Batterien und Kabel. Sie war auf einer Pappe montiert und diese Pappe zeigte ein Foto: Eine Landschaft mit einer Wiese im Vordergrund, im Hintergrund das Meer mit einer Insel. Auch diese Pappe war durch den Beschuss beschädigt, der Wecker in Stücke zerbrochen. Trotzdem lässt sich der Wecker identifizieren – ein Billigprodukt aus China, verkauft zum Beispiel bei „Kaufland“ für 1,49 Euro. Zur Pappe erhält die Soko nach der Veröffentlichung mehrere Hinweise. Es könnte sich um den Einband eines Fotosteckalbums handeln. Deshalb suchen Beamte in verschiedenen Fotoläden, um die Herkunft der Pappe zu klären. Doch dort wird man nicht fündig. Allerdings weisen Händler daraufhin, dass es sich auch um den Einband eines Kalenders handeln könnte.
Anfragen bei verschiedenen Kalenderherstellern in Deutschland führen zu einem neuen Hinweis: Es könnte sich möglicherweise um einen christlichen Kalender handeln. Nun wird bei allen Herstellern von christlichen Kalendern angefragt, und letztlich bestätigt der Verlag Christliche Schriftenverbreitung (CSV) in Hückeswagen in Nordrhein-Westfalen, dass die Umschlagpappe von einem seiner Erzeugnisse stammt. Es handelt sich um einen Buchkalender mit biblischer Botschaft für das Jahr 2001, der Titel des Kalenders: „Die gute Saat“.
In der Soko rätselt man. Wer wählt den Einband eines Kalenders mit einem täglichen Bibelvers als Grundplatte für die Zündvorrichtung einer Bombe? Fest steht nur, diese „Saat“ ist offensichtlich nicht aufgegangen. Auf der Pappe ist auch ein Aufkleber mit einer von Hand geschriebenen Acht, eine eher ungewöhnliche Preisauszeichnung. Sie deutet eher auf einen kleinen Buchladen als auf eine große Kette hin. Der Verlag gibt an, im Jahr 2000 insgesamt 120.000 Exemplare des Kalenders verkauft zu haben. In den kommenden Wochen suchen sächsische Polizisten insgesamt 83 vom Verlag CSV belieferte Buchläden und Vertriebsfirmen in Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Bayern auf. Zwei Buchhändler haben Etiketten mit einem handschriftlichen Preis verwendet. Einer von ihnen hat seinen Sitz in Hof in Bayern, der andere in Amtsberg bei Zschopau. Der Buchhändler in Amtsberg gibt an, es sei gut möglich, dass er die Acht geschrieben hat. Nach dem Hinweis auf die Grenze zwischen Aldi-Nord und Aldi-Süd deutet sich damit eine erste Richtung an, in der der Bombenbauer gefunden werden könnte – Westsachsen und Nordbayern.
Die zwei elektrischen Sprengzünder stammen von der Firma Zbrojovka Vsetin in der Tschechischen Republik. Sie dienen ebenso wie die Sprengschnüre aus Gnaschwitz gewerblichen Zwecken. Weiter lässt sich deren Weg aus Tschechien nach Deutschland nicht verfolgen. Doch die Kripo-Beamten haben eine Vermutung: Die Sprengschnur und die Sprengzünder deuten auf Kontakte zu Firmen hin, die professionell Sprengungen vornehmen. Mehr lässt sich jedoch erst einmal nicht feststellen. Es bleiben noch das Klebeband und die Steine. Auch den Hersteller des Klebebandes finden die Ermittler: Es handelt sich um ein Produkt für medizinische Zwecke von der Firma 3M, einem amerikanischen Weltkonzern, der auch eine Tochterfirma in Deutschland hat.
Im Rahmen dieser aufwendigen Herkunftsermittlungen werden die sechs Kilogramm Steine zu einer ganz besonderen Herausforderung. Doch gerade diese Arbeit eines Mitarbeiters des Kriminaltechnischen Instituts sollte sich auszahlen. Michael Münch, ein Chemiker, hat sich unter anderem auf forensische Bodenuntersuchung und Geologie spezialisiert. Mitunter sind kleinste Reste von Erde, Dreck oder Gestein als Spuren an Tatorten oder an Opfern von Verbrechen von großer Bedeutung. Dann schlägt die Stunde von Michael Münch. Im Fall der Kofferbombe vom Hauptbahnhof verfolgt der 47-Jährige über zwei Monate lang die Spur der Steine.
Vor ihm liegen exakt 6,08 Kilogramm Gestein in Form von Splitt und Schotter. Er kann sechs unterschiedliche Gesteinsarten feststellen: schwarz-grünen Splitt, hellgrünen Splitt, rosarot-olivgrünen Splitt, schwarzgrauen Schotter, grauen Schotter und hellgrüngrauen Schiefer. Sie sind zwischen 1,5 und 3 cm dick. Die Hauptmenge, genau 5,32 Kilogramm, ist Serpentinit, ein metamorphes Gestein, wie die Fachleute sagen, dessen mineralische Struktur sich im Laufe der Zeit wandelt. Münch prüft, wo es in Sachsen Serpentinit-Vorkommen gibt. Das bekannteste liegt in Zöblitz im Erzgebirge. Der Abbau des Gesteins mit besonders hohem Granatreichtum in der Nähe von Marienberg wurde im April 2002 eingestellt, weil die Vorkommen weitgehend erschöpft waren. Weitere Serpentinit-Vorkommen gibt es in Reinsdorf bei Waldheim und in mehreren Steinbrüchen in Nordbayern. Münch bleibt nichts anderes übrig, als zu den Steinbrüchen zu fahren und die Herkunft „seiner“ Steine zu ergründen. Auch im Steinbruch Galgenberg bei Reinsdorf, einem kleinen, privat betriebenen Steinbruch, sammelt er Vergleichsmaterial. Danach besucht er vier Steinbrüche im Nordosten Bayerns. Im Bereich der Münchberger Gneismasse, einem bekannten Serpentinit-Vorkommen, sind noch vier Steinbrüche in Betrieb: Wojaleithe bei Wurlitz, Thumsenreuth bei Erbendorf, Niedermurach und Winklarn. Auch hier nimmt er Proben. Das Gestein von Winklarn kann er schnell ausschließen, beim Wurlitzer Gestein stellt er eine Übereinstimmung fest. Doch bei einem Einzelstück kommt er nicht weiter. Der hellgrün-rosafarbene Stein, nur zehn Gramm schwer, könnte der Abfall einer Werksteinbearbeitung sein. Im Vergleich mit Museumsproben identifiziert Münch den Stein als Epidotgranit. Noch einmal sucht er in Wurlitz und findet auch dort diesen Epidotgranit. Nun gilt es zu ermitteln, wohin der Steinbruch Wurlitz liefert. Münch kann der Soko einen ersten Hinweis geben: Abnehmer gibt es in Nordbayern und im sächsischen Vogtland.
Münch nimmt sich einen weiteren einzelnen Stein vor: einen angeschliffenen dunkelgrauen, kleinkörnigen Stein. Er sucht im Museum für Mineralogie und Geologie in Dresden und im Deutschen Natursteinarchiv in Wunsiedel und glaubt danach, dass dieser Stein aus der Lausitz stammt. Münch sucht vier Steinbrüche in der Oberlausitz auf. Im Steinbruch Hohwald bei Neustadt in Sachsen wird er fündig. Der Stein aus dem Bombenkoffer ist ein Lamprophyr, der im Granit dieses Steinbruchs vorkommt. Vermutlich ist der Stein als Abfall bei der Werksteinbearbeitung angefallen. Weiter lässt sich die Spur nicht verfolgen.
Es bleiben noch 270 Gramm Grauwacke und ein zwanzig Gramm schweres Einzelstück. Die Grauwacke lässt sich regional nicht zuordnen, sie ist zu weit verbreitet. Den letzten einzelnen Stein kann Münch als grünlich-grauen Phylitt identifizieren, der im Erzgebirge, im Vogtland und in Oberfranken vorkommt. Nun wird es schwierig, und Münch holt sich Hilfe beim Landesamt für Umwelt und Geologie in Freiberg. Dort wird eine Gefügeuntersuchung vorgenommen. Die Geologen grenzen das Vorkommen auf das obere Vogtland und Oberfranken ein. Im Vogtland ist das Gestein fast in einer Insellage in der Nähe von Schöneck zu finden. Allerdings ist im gültigen Amtsblatt kein produzierender Steinbruch in diesem Raum für diese Gesteinsart verzeichnet. Die Geologen vom Landesamt geben Münch einen Tipp: Nach der Wende wurde solches Gestein auch in einem Steinbruch bei Schöneck zur örtlichen Belieferung abgebaut. Der Steinbruch sei aber schon wieder aufgelassen. Wieder macht sich Münch auf den Weg. Am 26. August fährt er nach Schöneck. Vorher besucht er noch die Baumärkte in Falkenstein und Auerbach und sucht dort gezielt nach einer Kombination der Steine aus dem Koffer. Er findet Bruchstücke von Werksteinen aus Lausitzer Lamprophyr. Da ist ihm klar, dass sein Stein aus Hohwald durchaus auch bis ins Vogtland kommen konnte.
Münch sucht den aufgelassenen Steinbruch „Haselmühle“ bei Schöneck, den ihm die Geologen empfohlen hatten. Zuvor fährt er noch zur örtlichen Raiffeisen-Handelsgenossenschaft in Schöneck am Bahnhof, weil auch die mit Steinen handelt. Am Bahnhof und vor dem Baumarkt waren Straße und Fußweg kürzlich neu gebaut worden. Münch traut seinen Augen nicht. Als Belag auf den Wegen und Flächen entdeckt er massenweise Wurlitzer Serpentinsplitt. Es sollte noch besser kommen: Im Außenbereich des Raiffeisenmarktes liegt der Bereich für Splitte. In abgeteilten Kammern lagern auch dort Wurlitzer Serpentin und Quarzit-Schotter direkt nebeneinander. Im Quarzit ist zudem auch noch sein grünlich-grauer Phyllit eingemischt. Bruchstücke von Werksteinen aus Lamprophyr sind auch vorhanden. Jetzt wird ihm klar, dass diese Stelle für ihn sehr interessant sein könnte.
Der Chemiker fühlt sich wie ein Lottogewinner. Er nimmt Proben und fährt anschließend zum Steinbruch „Haselmühle“. Eine lange und unbefestigte Straße durch den Wald führt dorthin. Im Steinbruch macht er die erhoffte Entdeckung: Wände aus grünlich-grauem Phylitt. Beim Abbau hatte sich der Phylitt gewissermaßen als Sonderling unter das Gestein gemischt, das hier eigentlich gewonnen worden war. Münch nimmt Proben und sucht anschließend noch zwei Abbaustellen im Raum Bad Elster und im bayerischen Regnitzlosau auf, wo es auch Phylitte gibt. Vergleichsproben von allen drei Orten übergibt er dem Landesamt für Umwelt und Geologie zur Analyse.
Auf der Spur der Steine besucht Michael Münch im Sommer 2003 gemeinsam mit einem Kollegen, der Geophysik studiert hat, aber Kriminalbeamter geworden ist, insgesamt elf Steinbrüche in Sachsen und Bayern. Nur bei der letzten Fahrt nach Schöneck ist er allein unterwegs. Die Kollegen von der Soko hält er ständig auf dem Laufenden. So übergibt er Soko-Leiter Ertle am 15. August einen Zwischenbericht, auch am 26. August informiert er Ertle sofort über seine aufschlussreichen Entdeckungen in Schöneck und Umgebung. Endgültige Gewissheit kann aber erst das Ergebnis einer so genannten Gesteinsdünnschliff-Untersuchung bringen. Dennoch ahnen die Ermittler: Die Steine haben sie auf eine Spur geführt.
Als die Ergebnisse der Laboranalysen im September vorliegen, kann Münch triumphieren. Er hat den Steinbruch des Einzelexemplars aus dem Bombenkoffer gefunden. Den Phylitt-Quarzit in dieser konkreten Ausbildung gibt es nur im Steinbruch „Haselmühle“. Münch weiß, dass eine Gesteinsart an vielen Stellen der Erde vorkommt und überall abgebaut wird. Aber die Gesteinsarten besitzen in jeder Lagerstätte ganz eigene mineralische Eigenschaften oder Gefügeausbildungen. Sogar innerhalb eines Steinbruchs lassen sich die Gesteine oft von Sohle zu Sohle unterscheiden. Münch hat den Beweis erbracht, dass ein Stein aus der Kofferbombe nur aus dem Steinbruch „Haselmühle“ stammen kann. Damit scheint das Gebiet weiter eingegrenzt, in dem Ertle und seine Leute nach dem Bombenbauer suchen sollten. Auch die Herkunft des Sprengstoffs aus dem Koffer lässt sich feststellen. Die Kriminalisten legen die einzelnen Brocken – es ist sandfarbenes, poröses TNT – dem Leiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Sachsen vor. Thomas Lange dreht und wendet die Sprengstoffbrocken und setzt sie so gut es geht zusammen. Die spezielle Form der Bruchstücke ist ihm bekannt: Der Sprengstoff stammt aus der Hohlladung einer deutschen Panzerfaust des Zweiten Weltkriegs. Er vergleicht die Stücke noch mit Hohlladungen alter deutscher Panzerfäuste aus seinem Lager und findet seine These bestätigt. Dieses Ermittlungsergebnis veröffentlichen die Ermittler nicht. Sie sprechen gegenüber der Presse nur von Sprengstoff militärischer Herkunft, denn dieses Detail können nur der Bombenbauer oder der Beschaffer des Sprengstoffs kennen. Einen weiteren Fund in dem Koffer veröffentlichen die Ermittler der Soko ebenfalls nicht: Einen Handschuh, den der Täter wahrscheinlich im Koffer vergessen hat. Insgesamt entsteht bei den Beamten der Eindruck, als wäre bei Koffer und Inhalt keine Spurenverhinderung oder Spurenentfernung betrieben worden. Der Bombenbauer ist wahrscheinlich davon ausgegangen, dass sich nach einer Explosion keine Spuren mehr finden lassen.
Am 20. Juni 2003, zwei Wochen nach dem Fund im Hauptbahnhof, geht bei der Bild-Zeitung in Hamburg ein Bekennerschreiben ein, das sich auf die Kofferbombe in Dresden bezieht. Das Schreiben ist kurz und stammt von einer Befreiungsfront „Abu Achihoba“. Den Experten des LKA Sachsen ist relativ schnell klar, dass es sich hier um Trittbrettfahrer handelt. Zum Ersten gibt es bereits die Erpresserbriefe an die Deutsche Bank, zum Zweiten ist das Bekennerschreiben für eine Befreiungsfront viel zu kurz. Solche Organisationen pflegen in ihren Bekennerschreiben in der Regel über mehrere Seiten ideologisch geprägte Begründungen für ihr Handeln anzuführen. Dieses Schreiben verhilft „Bild “ zwar zu einer Schlagzeile, eine echte Spur stellt es nicht dar.
Während Michael Münch im Juli und August von Steinbruch zu Steinbruch fährt, beschäftigt sich ein anderer Mitarbeiter des Kriminaltechnischen Instituts mit der Sprengvorrichtung. Kriminalhauptkommissar Joachim Seidel, ein Experte für unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen, soll die Kofferbombe möglichst exakt nachbauen. Der 54-jährige Seidel ist Diplomingenieur für Elektronik, hat sich jedoch bereits zu DDR-Zeiten auf Sprengvorrichtungen spezialisiert. Nach der deutschen Vereinigung hat er Lehrgänge beim Bundeskriminalamt besucht und alle Prüfungen mit Bravour bestanden. Zudem hat er die Sprengberechtigung, darf also selbst Probesprengungen vornehmen. Seidel beginnt mit einer Bestandsaufnahme des Kofferinhalts. Der Angriff mit der Wasserkanone hatte in dem Gepäckstück reichlich Unordnung angerichtet. Seidel versucht zuerst den Aufbau des Sprengsatzes zu rekonstruieren. Unbeschädigt sind nur der Schnellkochtopf, die Sprengschnur, der Sprengstoff, die Steine und die elektrischen Sprengzünder. Im Schnellkochtopf steckten 36,1 Meter Sprengschnur, 53,4 Gramm Sprengstoff und ein Sprengzünder, der mit einem Kabel mit der Zündvorrichtung verbunden war. In einem Plastikbeutel waren 8,4 Meter Sprengschnur sowie 628,3 Gramm Sprengstoff. Auch im Plastikbeutel steckte ein Sprengzünder, der wiederum mit der Zündvorrichtung auf der Pappe verbunden war. Insgesamt waren also 1,57 Kilogramm Sprengstoff im Koffer.
Die elektrischen Sprengzünder sind etwa 6 Zentimeter lang und haben einen Durchmesser von 0,7 Zentimetern. In ihrem Innern ist ein Glühdraht, der durch Stromzufuhr einen pyrotechnischen Satz zur Zündung bringt. Dieser entzündet einen Initialzündstoff, der wiederum den Sekundärsprengstoff zündet. Diese Kettenreaktion führt letztlich zur Zündung des eigentlichen Sprengstoffs, der einer hohen Zündtemperatur bedarf und nicht einfach mit elektrischem Strom oder etwa einer offenen Flamme zur Explosion gebracht werden kann. Zur Zündvorrichtung gehört der Wecker, der in seine Einzelteile zerschossen wurde, jedoch identifiziert ist. Auf dem Zifferblatt können Abdrücke eines Zeigers zwischen der 11 und der 12 erkannt werden. Offenbar war der Zeiger durch den Wasserstrahl an das Zifferblatt gepresst worden. Laboranalysen ergeben, dass der Abdruck zweifelsfrei vom Minutenzeiger der Uhr stammt. Bei der 12 ist ein Loch ins Zifferblatt gebohrt, Durchmesser ca. 1,5 mm. Der Minutenzeiger findet sich auch in den Trümmern des Weckers, an ihm befindet sich ein Litzedraht, der mit einem Faden an den Zeiger festgebunden ist. Der Faden hat Draht und Zeiger beim Beschuss geschützt, so dass sie nahezu unbeschädigt sind. Wenn der Zeiger zur 12 gekommen wäre, hätte er einen dort angebrachten Draht berührt. Dieser Auflaufkontakt hätte den Stromkreis geschlossen. Ebenfalls zur Zündvorrichtung zählen vier Batterien, zwei A 6-Zellen und zwei 9-Volt-Blockbatterien. Eine der A 6-Zellen ist deformiert, sie war im Wecker und ist ebenfalls wie dieser beim Beschuss beschädigt worden. Die zweite diente offenbar als Ersatz. Die 9-Volt-Batterien dienten der Stromzufuhr zu den Sprengzündern, um die Detonation auszulösen.
Nach der Untersuchung aller Einzelteile kennt Seidel den Aufbau der Sprengvorrichtung und macht sich an den Nachbau. Zwei Ziele verfolgen die Staatsanwaltschaft und die Ermittler damit. Sie wollen feststellen, ob der Sprengsatz überhaupt funktionsfähig war, ob er explodieren konnte, so wie er gebaut war. Seidel ärgert sich auch nach Tagen noch über die Aussage seines Präsidenten Raisch, der so vollmundig angekündigt hatte, dass „seine Kriminaltechniker nachweisen werden, dass es sich um einen funktionsfähigen Sprengsatz handelte!“ Als Raisch das sagte, war keineswegs sicher, ob die Bombe tatsächlich explodieren konnte. Seidel hatte zu diesem Zeitpunkt gerade mit seinen Untersuchungen begonnen. Noch wichtiger erscheint der Soko, mithilfe des Nachbaues festzustellen, welche Sprengwirkung das Original gehabt hätte, wenn es gezündet worden wäre.
Seidel besorgt identische Vergleichsstücke von jedem Teil aus dem Koffer. Bei der Sprengschnur, den Sprengzündern, dem Topf, den Steinen und dem Klebeband ist das kein Problem. Auch den gleichen Koffer kann Seidel auftreiben.
Den Sprengstoff aus der Panzerfaust besorgt er sich beim Kampfmittelbeseitigungsdienst. Thomas Lange hat genügend Hohlladungen von alten deutschen Panzerfäusten in seinem Lager und ist bereit auszuhelfen. Natürlich wird die eher ungewöhnliche Art der Kampfmittelvernichtung dokumentiert, Ordnung muss sein. Ende Juni findet Seidel beim Einkaufen zufällig in der Ramschtruhe des Elbecenters Meißen einen vergleichbaren Wecker für 29 Cent. Seidel kauft den Wecker, im Landeskriminalamt nimmt er ihn auseinander. Zuerst stellt er fest, dass es sich um einen baugleichen Wecker handelt. Dann erlebt er eine Überraschung: Unter dem weißen Zifferblatt ist ein zweites Zifferblatt. Es ist braun, zeigt eine Kaffeepackung und die Aufschrift „Nescafé“. Seidel informiert die SoKo, die nun beim Nescafé-Hersteller Nestlé zu den Weckern ermitteln kann. Letztlich ist nur festzustellen, dass Nestlé solche Wecker einst bei einem chinesischen Hersteller beschafft hatte und dieser nun einfach ein neutrales Zifferblatt darüber geklebt hat.
Seidel versucht zunächst die Funktionsfähigkeit der Zündvorrichtung festzustellen. Der Bombenbauer hat die Drahtverbindungen nicht gelötet, sondern die Drahtenden nur zusammengewickelt. Messungen des Widerstands ergeben, dass genügend elektrischer Strom für die Sprengzünder bereitgestellt werden konnte. Aber warum war der Zeiger bei etwa „Fünf Minuten vor Zwölf “ stehen geblieben? Seidel stellt fest, dass der Zeiger auf der Welle des Uhrwerkes einem Schlupf ausgesetzt ist und stehen bleibt, wenn er auf mechanischen Widerstand stößt. Der etwas steife, durch das Zifferblatt gezogene Litzedraht reichte als Widerstand, um den Zeiger anzuhalten. Alle diese Messungen werden Bestandteil von Seidels Gutachten zur Funktionsfähigkeit der Sprengvorrichtung.
Gemeinsam mit einem Team von Sprengstoffexperten und Kriminaltechnikern misst Seidel, welche Sprenggeschwindigkeit der im Koffer eingebaute Sprengsatz entwickeln könnte. Er nimmt einen baugleichen Topf und füllt ihn ebenso mit Sprengschnur und Sprengstoff wie im Original. Hinzu kommt ein Plastikbeutel, in dem ebenfalls die gleiche Art und Menge Sprengstoff ist. Dazu kommt die gleiche Menge Steine gleicher Beschaffenheit. Diesen Sprengsatz umgibt er mit Blechen, an denen Kontakte den Aufschlag registrieren. Am 1. September findet die Sprengung statt. Die Splittergeschwindigkeit beträgt 2666 Meter pro Sekunde. Das heißt, die Splitter des Topfes und die Steine fliegen nach der Explosion schneller als das Projektil einer Schusswaffe.
Spezialisten des Landeskriminalamtes bauten die Kofferbombe nach und brachten sie kontrolliert zur Explosion, um die Wirkung zu testen. Das Fazit danach: Es hätte Tote geben können.
Am Ende baut Seidel exakt die gleiche Bombe, wie sie auf Bahnsteig 14 im ALDI-Reisekoffer gefunden wurde. Es soll die Wirkung der Explosion festgestellt und dokumentiert werden. Das Experiment soll am 5. September auf dem Sprengplatz des Kampfmittelbeseitigungsdienstes in Jacobsthal bei Zeithain stattfinden und per Video dokumentiert werden. Drei Videokameras sollen den Versuch aus verschiedenen Richtungen festhalten – aber die Technik liefert keine Zeitlupe. Daran hatte Seidel nicht gedacht. Doch er will alle Phasen der Explosion exakt auf Video aufgezeichnet haben. Eine dafür notwendige Hochgeschwindigkeitskamera hat das sächsische Landeskriminalamt nicht. Seidel verschiebt den Versuch und bittet das Bundeskriminalamt um Hilfe, zwei Beamte aus Wiesbaden kommen mit der Superkamera nach Sachsen. Sie haben Sorge, dass ihr teures Gerät Schaden nehmen könnte. Deshalb wird eine Schutzscheibe aus Acryl davor aufgebaut. Die Kamera wird auf tausend Bilder pro Sekunde eingestellt, sie steht 50 Meter vom Ort des Geschehens entfernt. Da sie jedoch nur eine Sekunde läuft, muss die Auslösung der Sprengung mit der Kamera synchronisiert werden. Die Techniker des BKA fragen Seidel, wie viele Versuche es denn geben solle. Seidel antwortet: „Wir haben nur einen Versuch, es muss beim ersten Mal klappen.“ Der Koffer wird mit 1,5 Millimeter dicken Stahlblechen in zwei Ringen umgeben. Der erste Ring steht im Abstand von einem Meter, der zweite Ring in 2,5 Meter Abstand. An den Blechen soll die Splitterwirkung festgestellt werden.
Dann gehen alle Beteiligten in Deckung und Joachim Seidel zündet den Sprengsatz. Die Explosion entwickelt eine Druckwelle, die einige der Stahlbleche wegschleudert. Danach entwickelt sich im Abstand von Millisekunden ein Feuerball mit einem Durchmesser von etwa zehn Metern. Nachdem sich der Qualm verzogen hat, wird der Zustand der Stahlbleche dokumentiert. Sie sind deformiert, teilweise weggeschleudert. Bombensplitter haben alle Bleche durchlöchert. Die Splittergeschwindigkeit wurde mit 1090 Meter pro Sekunde gemessen. Für sein Gutachten zieht Seidel folgende Schlussfolgerung: Die Bombe hätte im Hauptbahnhof bei Menschen im Umkreis bis zu zehn Metern durch die Splitterwirkung tödliche Wirkung haben können, im größeren Abstand zumindest schwere Verletzungen verursacht.
Obwohl seine Bombe im Hauptbahnhof nicht explodiert ist, bleibt auch der Erpresser und Bombenbauer während der Sommermonate nicht untätig. Am 13. August trifft wieder ein Brief von „Hannnibal“ bei der Deutschen Bank ein. Der Erpresser fordert nun wieder 50 Millionen Euro, bleibt jedoch bei seiner Gewinnspielvariante zur Übermittlung. Diesmal droht er: „Es gibt jetzt keine Pyrotechnik und unscharfe Koffergeschichten mehr!“ Die Ermittler der Soko „Bahnhof “ fragen sich, ob er an einer weiteren Bombe baut.
Die Deutsche Bahn unterstützt die Ermittlungen so gut es geht. Sie setzt am 4. September 2003 eine Belohnung von 10.000 Euro für die Person aus, die brauchbare Hinweise auf den Bombenbauer gibt. Diese Auslobung führt schneller als gedacht zum Erfolg: Schon am 8. September trifft bei der Soko „Bahnhof “ eine Nachricht vom Bayerischen Landeskriminalamt ein. Die Kollegen in München berichten, einer ihrer V-Männer hätte Namen und Wohnort des Mannes genannt, der die Bombe gebaut und im Dresdner Hauptbahnhof deponiert habe. Es sei ein alter Bekannter von ihm und er sei sich ziemlich sicher. Der Mann heiße Ulrich Vogel und wohne in der Nähe von Auerbach.
Ertle, Silex und die anderen Ermittler fragen sich: Ist das wirklich ein brauchbarer Hinweis oder will sich hier nur jemand wichtig tun? Wird da vielleicht ein Mann angeschwärzt, um alte Rechnungen zu begleichen? Aber auch alle Spuren, die die Soko bisher hat, führen nach Westsachsen, ins Vogtland oder nach Nordbayern. Und Auerbach liegt im Vogtland. Die Beamten beschließen, sich mit diesem Ulrich Vogel näher zu beschäftigen. Wer ist dieser Mann?
Ulrich Vogel ist 62 Jahre alt, selbständiger Immobilien- und Finanzmakler und wohnt in seinem eigenen Haus in Ellefeld bei Auerbach auf der Hauptstraße 11.
Er hatte 1956 die DDR in Richtung Bundesrepublik verlassen und war Anfang der 90er Jahre ins Vogtland zurückgekehrt. Ihm und seiner Schwester wurden zwei enteignete Häuser zurück übertragen, die er in den folgenden Jahren sanieren ließ. Vogel ist gelernter Werkzeugmacher und hat einen Fachhochschulabschluss im Bereich Maschinenbau und Konstruktionstechnik. Er ist unverheiratet, soll aber eine Freundin in Hessen haben. Die Fassade des ehrbaren Geschäftsmannes bröckelt jedoch bei einer Anfrage im Bundeszentralregister. Dort erfuhr die Staatsanwaltschaft: Ulrich Vogel ist mehrfach vorbestraft. Seit 1970 ist er in neun Fällen schuldig gesprochen und verurteilt worden, unter anderem wegen Diebstahls, Steuerhinterziehung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Im Jahr 1989 verurteilte ihn das Amtsgericht Wiesbaden zu drei Monaten auf Bewährung wegen Erwerbs explosiver Stoffe. Diese Erkenntnisse lassen die Ermittler aufhorchen, sie sind an sich jedoch noch kein Beweis. Rüdiger Ertle und Alexander Silex glauben trotzdem, eine ganz heiße Spur zu haben. Dieser Ulrich Vogel aus Ellefeld könnte ihr Täter sein!
Ermittler der Soko „Bahnhof “ klappern unterdessen Geschäfte und Märkte in Westsachsen nach einem weiteren Vergleichsstück des Weckers aus dem Koffer ab. Sie werden im Kaufland Auerbach fündig. Am 12. September kaufen die Beamten für 1,49 Euro den gleichen blauen Reisewecker „Made in China“ und nehmen ihn zu den Beweisstücken.
Die Soko zieht ein Resümee ihrer Herkunftsermittlungen zum Kofferinhalt. Die Steine stammen aus Westsachsen und dem Nordosten Bayerns. Die Pappe vom Kalender ist in Amtsberg bei Zschopau oder in Hof verkauft worden. Die Schraubgläser stammen von Aldi-Nord und Aldi-Süd, deren Grenze verläuft genau zwischen Sachsen und Bayern bzw. Thüringen und Bayern. Es deutet vieles auf einen Wohnort in Westsachsen oder Nordbayern hin.
Das Landeskriminalamt Sachsen löst am 18. September 2003 eine Recherche in der Falldatei des Bundeskriminalamtes aus. Als Recherchekriterien geben die sächsischen Ermittler vor: Vorbestraft wegen illegalem Waffenbesitz, Sprengstoffdelikten, Erpressung oder Nötigung, wohnhaft in Nordbayern oder Westsachsen. Das Ergebnis der Recherche liegt am 19. September vor. Der Computer des BKA hat insgesamt 102 Personen gefunden, die diese genannten Kriterien erfüllen. Nur eine Person von den 102 lebt im Vogtland: Ulrich Vogel in Ellefeld.
Am selben Tag trifft ein neuer Brief von „Hannnibal“ bei der Deutschen Bank in Frankfurt am Main ein. Der Verfasser fordert wieder 50 Millionen Euro und droht mit Konsequenzen. Wörtlich schreibt er: „Sie wollen es also auf die harte Tour!“. Ertle und Silex fragen sich, ob der Erpresser an einer weiteren Bombe baut. Wird er wieder einen Koffer deponieren? Die Soko und die Staatsanwaltschaft sehen den Zeitpunkt für einen Zugriff bei Ulrich Vogel gekommen. Es gibt genügend Fakten, um eine Durchsuchung von Vogels Haus in Ellefeld, eine Telefonüberwachung, eine Observation und einen Haftbefehl zu beantragen. Der Haftbefehl für Vogel wird am 19. September erlassen. Ab sofort lässt die Soko den Verdächtigen rund um die Uhr von einem mobilen Einsatzkommando observieren.
Am 21. September, einem Sonntag, verlässt Ulrich Vogel kurz nach 14.00 Uhr sein Haus in Ellefeld und lädt eine Sport- oder Reisetasche in seinen Audi A 6. Er fährt in Richtung Auerbach, die Beamten des mobilen Einsatzkommandos hängen sich dran. In Auerbach fährt Vogel an eine Tankstelle an der Bundesstraße 169. Er tankt, geht in den Shop und kauft dort die „Bild am Sonntag“ und eine Flasche Mineralwasser. Was hat er vor? Wo will er hinfahren? Hat er wieder eine Bombe bei sich oder will er sich ins Ausland absetzen? Der Einsatzleiter befiehlt den Zugriff an der Tankstelle, auch um den Überraschungsmoment auszunutzen. Denn auf dem Weg zum Auto kann Vogel besser überwältigt werden. Als Vogel aus der Tür des Shops kommt, fahren zwei zivile Einsatzfahrzeuge in den Tankstellenbereich, Beamte des Kommandos stürmen heran und werfen Vogel zu Boden. Er wird durchsucht, gefesselt und es wird die Festnahme verkündet. Ute Töpfer, die Kassiererin der Tankstelle, ist baff. „Das ist ein Überfall“, denkt sie und greift zum Telefon, um die Polizei zu rufen. In diesem Augenblick kommt eine Frau in den Shop, hält einen Ausweis hoch und sagt: „LKA Sachsen, sie können das Telefon weglegen. Es hat eine Festnahme gegeben.“ Einige Zeit später informieren die Kripo-Leute noch, dass der Audi erst einmal stehen bleibt und später von der Spurensicherung untersucht wird.
Ulrich Vogel wird in das Polizeirevier Auerbach gebracht und in einer Zelle festgesetzt. Er gibt freiwillig eine Speichelprobe für den DNA-Vergleich, denn er weiß, dass es dafür ohnehin einen Gerichtsbeschluss geben wird. Die Ermittler der Soko wollen ihn nach Dresden ins Landeskriminalamt zur Vernehmung bringen, die Durchsuchung und kriminaltechnische Behandlung von Vogels Auto aber noch abwarten. Im Auto ist keine weitere Kofferbombe, sondern eine Tasche mit Utensilien für einen Saunabesuch. Später wird sich herausstellen, dass Vogel nach Auerbach in die Sauna wollte. Er hatte überhaupt nicht damit gerechnet, dass ihm die Polizei auf den Fersen sein könnte. Am späten Nachmittag fahren die Ermittler mit Vogel von Auerbach nach Dresden, die Vernehmung soll noch am Abend stattfinden. Derweil fangen andere Beamte der Soko an, gemeinsam mit Kriminaltechnikern Vogels Haus in der Hauptstraße in Ellefeld zu durchsuchen.
Die Vernehmung von Ulrich Vogel beginnt am 21. September 2003 um 19:30 Uhr. Vernehmende Beamte sind Alexander Silex und Siegfried Brosse von der Soko „Bahnhof “ sowie ein Beamter der Frankfurter Kripo zum Ermittlungskomplex „Erpresserbriefe“. Silex hat mit den Kollegen in Ellefeld vereinbart, dass er laufend telefonisch über den Stand der Durchsuchung in Vogels Haus informiert wird. Gleich zu Beginn reden die Beamten Klartext und konfrontieren den Rentner mit dem schweren Tatvorwurf. Er weist die Beschuldigungen von sich. Die Vernehmung läuft in ruhigem, ja freundlichem Ton. Allerdings macht Vogel einen etwas überheblichen Eindruck, so nach dem Prinzip: „Ihr könnt mir gar nichts beweisen!“. Silex und Brosse müssen feststellen, dass Vogel viel Erfahrung mit der Polizei, der Justiz und Gerichten hat. So einen Beschuldigten lockt man nicht so leicht aus der Reserve.
Bei der Durchsuchung in Vogel Haus in Ellefeld finden die Beamten anfangs keine Gegenstände, die in einen Zusammenhang mit der Kofferbombe oder den Erpresserbriefen gebracht werden können. Einem Kriminaltechniker fällt aber auf, dass im Treppenhaus, in dem sich eine Garderobe vor einer Holzverkleidung befindet, die räumlichen Dimensionen nicht den Gesamtmaßen des Hauses entsprechen. Der Raum ist dem Beamten vom Gefühl her einfach zu klein. Die Beamten demontieren die Garderobe und die Holzverkleidung aus Kiefern-Paneel. Dahinter finden sie einen Hohlraum. Es ist 20.30 Uhr. Schon beim erste Blick in das Versteck ruft einer der Beamten: „Aber Hallo, was haben wir denn hier!“ Die Polizei findet insgesamt vier Maschinenpistolen, darunter eine MPi Skorpion mit Schalldämpfer, fünf Pistolen, 19 gefüllte Magazine, neun Handgranaten, 10 Sprengzünder, fast drei Kilogramm Sprengstoff, darunter auch Sprengschnur, und eine Schreibmaschine.
Fast zeitgleich klingelt bei der Soko „Bahnhof “ in Dresden das Telefon. Von den Kriminaltechnikern in Ellefeld erfahren die Vernehmer von dem brisanten Fund in Vogels Haus. Alexander Silex sagt daraufhin zu Ulrich Vogel: „Unsere Leute haben in ihrem Haus hinter der Holzverkleidung das Versteck mit den Waffen und dem Sprengstoff gefunden.“ Da wird Vogel sichtlich blass und sackt in sich zusammen. Ihm ist klar, dass er damit als der Bombenbauer überführt ist.
In den kommenden Stunden gesteht der 62-Jährige, dass er die Bombe gebaut und am 6. Juni im Dresdner Hauptbahnhof deponiert hat. Er sei Anfang Juni zu einer Kur in Kreischa gewesen. Den Bombenkoffer habe er 14 Tage vorher zusammengebaut und im Kofferraum seines Audis transportiert, allerdings ohne dass die Batterien in die Zündvorrichtung eingesetzt waren. Auf dem Weg zur Reha-Klinik sei er nach Dresden zum Hauptbahnhof gefahren, mit dem Koffer auf die Toilette gegangen und habe dort die Batterien eingesetzt. Danach habe er den Koffer auf dem Bahnsteig abgestellt und sei nach Kreischa in die Reha-Klinik gefahren.
Während der Vernehmung fertigt Ulrich Vogel eine Zeichnung des Zündmechanismus und des Aufbaus der Kofferbombe an. Nicht alle Fragen der Ermittler beantwortet Ulrich Vogel. So nennt er nie weitere Beteiligte, zum Beispiel den Beschaffer des Sprengstoffes. Er stellt schon in der ersten Vernehmung klar: Die Bombe sollte nie hochgehen! Er habe sie so gebaut, dass sie zwar eine echte Sprengvorrichtung sei, aber nie funktionieren würde. Sie sollte nur als Drohpotential gegenüber der Deutschen Bank dienen. Als Motiv für die Erpressung nennt er seine hohen Schulden. Die Bank habe sich geweigert, ihm neue Kredite zu gewähren. Vogel ist jedoch gar nicht Kunde der Deutschen Bank, sondern der Sparkasse Vogtland. Die Deutsche Bank habe er erpresst, weil der „ein paar Millionen doch nichts ausmachen“. Auch die Herkunft des Kalenders „Die gute Saat“ wird geklärt. Er hat ihn 2001 von einem Mann geschenkt bekommen, der mit ihm in einem Zimmer im Krankenhaus gelegen hat. Genau 0.30 Uhr wird die Vernehmung beendet. Sie soll am nächsten Tag fortgesetzt werden. Dann soll Ulrich Vogel auch dem Haftrichter vorgeführt werden.
Während der nun dringend tatverdächtige Rentner im Landeskriminalamt vernommen wird, analysieren Biologen des Kriminaltechnischen Instituts Vogels Speichelprobe. Sie arbeiten die ganze Nacht durch, um die Auswertung des DNA-Vergleichs am Morgen vorlegen zu können. Es wird für die Soko ein weiterer Grund zur Freude: Eine der beiden DNA-Spuren im Koffer stimmt mit der von Ulrich Vogel zu hundert Prozent überein. Der Verursacher der zweiten DNA wird nie ermittelt, Vogel wird sich nie dazu äußern.
Am Vormittag des 22. September findet eine weitere Vernehmung statt. Ulrich Vogel wird von Silex und Brosse aufgefordert, die Zündvorrichtung der Bombe noch einmal zu bauen. Vogel lässt sich darauf ein und zeigt den Ermittlern, wie er das Loch in das Zifferblatt des Weckers gebohrt, den Zeiger mit Draht umwickelt und den Auflaufkontakt gebaut hat. Silex filmt den Nachbau der Zündvorrichtung mit einer Handkamera und lässt Vogel seine Handlungen kommentieren. Alle Fragen und Antworten werden aufgenommen und dienen später der Beweisführung. Vogel macht, ohne es zu ahnen, während des Nachbaus einen entscheidenden Fehler, der vor Gericht eine bedeutende Rolle spielen wird. Nachdem er den Litzedraht am Zeiger befestigt hat, schneidet Vogel ihn an der Spitze mit einer Zange so kurz ab, dass er den Auflaufkontakt nicht mehr berühren kann. Damit will er wohl ganz nebenbei dokumentieren, dass die Bombe nie hätte explodieren können. Doch Vogel hat Pech. Denn der Original-Draht ist erhalten geblieben und wurde gesichert. Und das Original am Zeiger ist 7,5 Millimeter länger und damit in jedem Fall lang genug, um den Kontakt berühren zu können. Als Joachim Seidel das Video dieser Vernehmung sieht, springt ihm dieser wichtige Punkt sofort ins Auge.
Der Untersuchungsrichter erlässt am 22. September 2003 Haftbefehl gegen Ulrich Vogel. Damit sitzt der Tatverdächtige für den versuchten Sprengstoffanschlag und die Erpressung der Deutschen Bank nach 108 Tagen mühseliger Ermittlungsarbeit in Untersuchungshaft. Gegenüber der Polizei wird sich Ulrich Vogel nicht mehr äußern.
An den in seinem Haus gefundenen Sprengstoffstücken und an der Sprengschnur stellen die Kriminaltechniker Passspuren fest. Damit lässt sich nachweisen, dass die Sprengschnur im Koffer von der Schnur im Haus abgeschnitten wurde. Außerdem stammten die Sprengstoff brocken im Koffer und aus dem Haus von derselben Hohlladung. Auf dem Farbband der Schreibmaschine finden die Kriminalisten zudem Fragmente der Erpresserschreiben. Auch die im Versteck gefundenen Sprengzünder stammen vom gleichen tschechischen Hersteller wie die im Koffer. Michael Münch stellt fest, dass die Steine im Koffer aus einem Kiesbelag an der Außenwand von Vogels Haus stammen. Sogar der seltene Phylitt aus dem Steinbruch Haselmühle ist in dem Steingemisch zu finden. Die Last der Beweise ist erdrückend. Mitte Oktober 2003 legt das Kriminaltechnische Institut das Gutachten zur Kofferbombe vor. Es umfasst 50 Seiten und ist von acht Gutachtern unterschrieben. In diesem Gutachten steht auch die Feststellung, dass es sich bei der Bombe im Koffer um eine „funktionsfähige Sprengvorrichtung“ gehandelt hat.
Für die Beamten der Sonderkommission „Bahnhof “ ist Ulrich Vogel der Erpresser und Bombenbauer, einen weiteren Tatbeteiligten können sie nicht ermitteln. Vogel äußert sich dazu nicht. Der bestreitet auch, für den Sprengstoffanschlag im Karstadt in Wiesbaden verantwortlich zu sein. Ertle und Silex sind zwar überzeugt, dass er auch diese Tat begangen hat, können es aber nicht nachweisen.
Ein Jahr nach dem Fund des Bombenkoffers wird sich der Geschäftsmann Ulrich Vogel wegen Erpressung und Herbeiführung eine Sprengstoffexplosion vor dem Landgericht Dresden verantworten.
Im Februar 2004 erhebt die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Dresden Anklage gegen Ulrich Vogel wegen Erpressung und Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. Die Ermittler der Sonderkommission „Bahnhof “ glauben, der Fall wäre für sie im Wesentlichen abgeschlossen. Sie sollten sich gründlich irren.
Vier Monate später, am 2. Juni, beginnt die Hauptverhandlung vor dem 1. Strafsenat des Landgerichtes Dresden. Vorsitz hat Richterin Birgit Wiegand, die Verteidigung von Ulrich Vogel hat der junge Rechtsanwalt Ulf Israel (32) übernommen. Der Prozess bringt einige Überraschungen für alle Beteiligten. Ulrich Vogel verweigert nicht die Aussage. In seiner Stellungnahme zur Anklage räumt er ein, die Bombe gebaut und im Hauptbahnhof deponiert zu haben, aber er bestreitet energisch, dass die Apparatur tatsächlich scharf war und explodieren konnte.
Am neunten Verhandlungstag wird Joachim Seidel als Zeuge vernommen. Er soll zu seinem Gutachten Stellung nehmen und sich zur Funktionsfähigkeit der Bombe äußern. Seidel rechnet natürlich damit, dass ihn Verteidiger Ulf Israel in die Zange nehmen wird. Die Funktionsfähigkeit der Bombe ist zur zentralen Frage des Prozesses geworden. Denn war sie scharf, könnte der Angeklagte zusätzlich zu den bisherigen Vorwürfen auch des versuchten Mordes beschuldigt werden. Dann droht Vogel lebenslängliche Haft.
Kriminalist Seidel untermauert seine Aussage mit einer Powerpoint-Präsentation und dem Video von den Probesprengungen. Seine Schlussfolgerung lautet: „Die Vorrichtung war funktionsfähig. Sie hat versagt und wir haben nur eine Erklärung dafür gefunden. Der Draht am Zeiger des Billigweckers war zu starr und hat etwa drei Minuten vor Erreichen des Auflaufkontaktes zum Stillstand geführt.“ Auf den Vorhalt des Verteidigers, sein Mandant habe das extra so gebaut, reagiert Seidel mit dem Hinweis auf das Video von der zweiten Vernehmung, in der Vogel den Draht am Zeiger zu kurz abgeschnitten hat. Ulf Israel kann daraufhin nur noch mit der Schulter zucken. Bleibt die Frage, ob dem Kriminalisten durch die vorschnelle Aussage von LKA-Präsident Peter Raisch am 13. Juni 2003 die Richtung seiner Ermittlungen vorgegeben wurde. Seidel gibt vor Gericht zu, damals „etwas frustriert“ gewesen zu sein, denn zu diesem Zeitpunkt konnte noch gar keine Aussage getroffen werden. Letztlich habe sich dieser Fauxpas des Präsidenten jedoch nicht auf sein Gutachten ausgewirkt. Alles sei akribisch dokumentiert und nachprüfbar. Die Vorsitzende Birgit Wiegand lässt dann auch keinen Zweifel am Gutachten des LKA-Experten. Für Ulrich Vogel wird es eng.
In den folgenden Wochen lässt sich Ulrich Vogel eine Menge einfallen, um sich vom Vorwurf des versuchten Mordes zu befreien. Mit einer Reihe von Beweisanträgen und Behauptungen erwirkt er beim Gericht immer wieder Nachermittlungen. Die Ermittler der Soko „Bahnhof “ haben auf einmal wieder viel Arbeit. Gericht, Staatsanwaltschaft und Kriminalbeamte wähnen sich mitunter in einer Märchenstunde.
So erhält Vogels langjährige Freundin in Ellefeld Anfang August 2004 einen Brief, der sofort bei Gericht landet. Darin steht: „Vogel, Du hältst weiter den Schnabel! Das ist besser für alle, Hannnibal.“ Es ist ein mit Computer geschriebener Text. Abgestempelt wurde der Brief in Sachsen, der Ort ist nicht zu entziffern. Das Schreiben deutet auf einen Mittäter hin, zumindest weiß der Verfasser einiges über die Dreiecksbeziehung, in der Vogel lebte. Er hatte eine langjährige Lebensgefährtin in Wiesbaden, lebte aber zuletzt mit deren Schwester in Ellefeld zusammen. Ein zweiter Brief geht im Dresdner Gefängnis ein, adressiert an Vogel selbst. Der Brief wurde bei der Postkontrolle abgefangen. Beide Schreiben werden zu den Akten genommen. Das Gericht geht davon aus, dass die Briefe von ein und demselben Verfasser stammen, einer Person, die Vogel nahesteht, und dass sie nur wegen des Prozesses geschrieben wurden. Die Soko soll das überprüfen.
Im Oktober behauptet Vogel, er habe Anfang 2003 von einem Unbekannten Briefe erhalten, der ihn zum Bau der Kofferbombe aufgefordert habe. Er sei erpresst worden, habe seine Familie schützen wollen. Der Erpresser sei sogar in sein Büro eingebrochen und habe auf seiner Schreibmaschine die Briefe an die Deutsche Bank beschrieben. Richterin Birgit Wiegand fragt Vogel: „Haben sie irgendwelche Erpresserbriefe, die Bauanleitung der Bombe oder andere Beweise aufgehoben?“ Vogel schüttelt den Kopf. Er nennt jedoch drei Männer, alte Bekannte, von denen einer der Erpresser sein könnte. Die Soko muss sie ausfindig machen.
Zwei der Männer treten am 8. Oktober 2004 vor Gericht als Zeugen auf. Herbert M. (60) aus Flösheim am Main und Robert G. (48) aus Langelsheim im Harz. Der dritte Zeuge ist Matthias L. (38), der Sohn von Vogels Lebensgefährtin. Bei Herbert M. stellt sich heraus: Er war der Informant des Bayerischen LKA, der die Ermittler schließlich auf Vogels Spur brachte. Herbert M. verweigert zunächst die Aussage, weil er sich nicht selbst belasten will. Robert G. hingegen sagt alles, was er über Ulrich Vogel weiß. Neue Erkenntnisse für den Prozess kann er allerdings nicht beisteuern. Auch die Nachermittlungen gegen Herbert M. als möglichen Mittäter bringen keine Erkenntnisse, das Verfahren gegen ihn wird eingestellt. Seine DNA stimmt auch nicht mit der zweiten biologischen Spur im Koffer überein.
Mitte Mai 2005 will das Gericht endlich ein Urteil sprechen. Die Termine für die Plädoyers von Anklage und Verteidigung sind festgelegt. Doch am 11. Mai 2005 kündigt der Angeklagte an, umfassend aussagen zu wollen. Zwei Tage später tischt Ulrich Vogel wieder nur eine neue Geschichte auf: Der alte Freund Herbert M. habe den Sprengstoff besorgt, er, Vogel, habe die Bombe so gebaut, dass sie nicht explodieren konnte. Auch habe er, Vogel, die letzten drei Erpresserbriefe an die Bank geschrieben, die ersten fünf stammten jedoch von seinem Mittäter Herbert M. Dieser sei auch der Initiator des Sprengstoffattentats und des Erpressungsversuchs gewesen. Außerdem habe sein alter Bekannter in seiner Wohnung in Hohlräumen seiner Intarsienmöbel Munition und Sprengstoff versteckt.
Noch einmal muss die Soko „Bahnhof “ zu Nachermittlungen ausrücken. Mitarbeiter durchsuchen die Wohnung von Herbert M. Mit einem Röntgengerät durchleuchten sie die Möbel des Mannes, finden aber keine Spuren von Sprengstoff. Zu den Erpresserbriefen befragt das Gericht noch einmal einen Sachverständigen des Bundeskriminalamtes. Dieser sagt, dass alle acht Erpresserbriefe mit großer Wahrscheinlichkeit von ein und derselben Person geschrieben worden seien. Es gebe viele Übereinstimmungen, so tauche die Redewendung „seien sie klug“ wiederholt auf. Zudem seien Aufbau und Stil in allen Briefen gleich.
Herbert M. wird erneut als Zeuge geladen. Nachdem er die Aussagegenehmigung des LKA in Bayern erhalten hat, sagt Herbert M., selbst wegen Waffen- und Sprengstoffdelikten vorbestraft, am 39. Verhandlungstag im Juni 2005 aus: Er kennt Vogel schon seit drei Jahrzehnten. Anfang September 2003 habe er sich mit ihm in Tschechien getroffen. Vogel soll ihm von der Erpressung der Deutschen Bank erzählt haben. Weiterhin habe er angekündigt, zwei Bomben an belebten Orten zu deponieren, falls die Bank nicht auf seine Forderungen einginge. Vogel habe ihn gebeten, ihn technisch zu unterstützen und eine Million Euro angeboten. Am 7. September habe er dann beim LKA in München angerufen und den Hinweis auf Ulrich Vogel gegeben.
Letztlich werden alle neuen Versionen des Angeklagten vom Gericht als reine Schutzbehauptungen bewertet. Am 29. Juli 2005 verkündet Richterin Birgit Wiegand nach 14 Monaten und 42 Verhandlungstagen das Urteil: Zwölf Jahre Freiheitsentzug für Ulrich Vogel wegen versuchten Mordes, Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, Herbeiführen einer schweren Sprengstoffexplosion und schwerer räuberischer Erpressung! Richterin Wiegand: „Er hat aus Habgier, Gewinnsucht und Gewinnstreben heimtückisch den Tod von Menschen in Kauf genommen.“
Im Februar 2012 befindet sich der nunmehr 72-jährige Vogel noch in der Justizvollzugsanstalt Dresden, allerdings im offenen Vollzug.