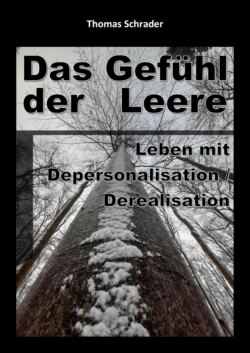Читать книгу Das Gefühl der Leere - Thomas Schrader - Страница 4
Medizinische Analyse
ОглавлениеDerealisation ist eine Veränderung in der Wahrnehmung oder Erfahrung der Außenwelt, so dass diese unwirklich erscheint. Weitere Symptome sind das Gefühl, dass es in der Umgebung an emotionaler Färbung und Tiefe mangelt. Sie ist ein dissoziatives Symptom, das in Momenten starken Stresses auftreten kann.
Derealisation ist eine subjektive Erfahrung der Unwirklichkeit der Außenwelt, während Depersonalisation ein Gefühl der Unwirklichkeit im eigenen Selbst ist, obwohl die meisten Autoren Derealisation (Umgebung) und Depersonalisation (Selbst) derzeit nicht als separate Konstrukte betrachten.
Chronische Derealisation kann durch okzipital*-temporale Dysfunktion verursacht werden.
*(Der Okzipitallappen oder Hinterhauptlappen [lat. Lobus occipitalis] ist der hinterste Anteil des Großhirns und der kleinste der vier Hirnlappen. Als Teil des visuellen Systems verarbeitet er die visuellen Impulse, weshalb er das Sehzentrum des Gehirns ist.)
Diese Symptome sind in der Bevölkerung häufig, mit einer Lebenszeitprävalenz von bis zu 26-74% und einer Prävalenz von 31–66% zum Zeitpunkt eines traumatischen Ereignisses.
Die Erfahrung der Derealisation kann als eine immaterielle Substanz beschrieben werden, die eine Person von der Außenwelt trennt, wie z. B. ein sensorischer Nebel, eine Glasscheibe oder ein Schleier. Einzelpersonen können berichten, dass dem, was sie sehen, Lebendigkeit und emotionale Färbung fehlen. Die emotionale Reaktion auf die visuelle Erkennung von Angehörigen kann erheblich reduziert sein. Gefühle von Déjà Vu oder „nie gesehen“ sind häufig. Vertraute Orte können fremd, bizarr und surreal aussehen. Man kann nicht einmal sicher sein, ob das, was man wahrnimmt, tatsächlich Realität ist oder nicht. Die Welt, wie sie vom Individuum wahrgenommen wird, kann sich so anfühlen, als würde sie einen Dolly-Zoom-Effekt* durchlaufen. Solche Wahrnehmungsstörungen können sich auch auf die Sinne von Hören, Schmecken und Riechen erstrecken.
*(Beim Dolly-Zoom fährt die Kamera typischerweise auf Schienen (Dolly) vom fokussierten Objekt (z. B. dem Schauspieler) weg oder auf ihn zu. Durch die Kamerafahrt vom Protagonisten weg würde dieser immer kleiner erscheinen. Der Dolly-Zoom-Effekt kompensiert das, indem während der Fahrt die Brennweite verändert wird (Zoom). Dadurch erscheint das Objekt immer gleich groß, aber der Raum darum herum verkrümmt sich. Der Betrachter empfindet das als unnatürlich und Sog artig. Der Hintergrund scheint ihm entgegenzukommen, wenn die Kamera sich von der Szene entfernt. Umgekehrt wird bei einem dolly out der Raum gestreckt.
Filmkenner haben diesen Effekt vielleicht schon in Filmen wie Alfred Hitchcocks „Vertigo – Aus dem Reich der Toten“ [daher wird diese Technik auch oft als Vertigo-Effekt bezeichnet], „Poltergeist“ oder „Der weiße Hai“ gesehen – stets in Szenen von Schrecken und Panik angewandt.)
Der Grad der Vertrautheit mit der Umgebung gehört zur sensorischen und psychologischen Identität, zur Gedächtnisgrundlage und zur Geschichte, wenn man einen Ort erlebt. Wenn sich Personen in einem Zustand der Derealisation befinden, blockieren sie den Rückruf dieser identifizierenden Grundlage. Dieser „Blockierungseffekt“ erzeugt eine Diskrepanz der Korrelation zwischen der Wahrnehmung der eigenen Umgebung während einer Derealisations-Episode und dem, was dieselbe Person ohne eine Derealisations-Episode wahrnehmen würde.
Häufig erfolgt die Derealisation im Zusammenhang mit ständigen besorgniserregenden oder „aufdringlichen Gedanken“, die man nur schwer abschalten kann. In solchen Fällen kann es unbemerkt zusammen mit der zugrunde liegenden Angst, die mit diesen störenden Gedanken verbunden ist, aufbauen und erst nach einer Erkenntnis der Krise, oft einer Panikattacke, erkannt werden, die anschließend schwierig oder unmöglich zu ignorieren scheint. Diese Art von Angst kann für die Betroffenen lähmend sein und zu vermeidendem Verhalten führen. Diejenigen, die dieses Phänomen erleben, sind möglicherweise besorgt über die Ursache ihrer Derealisation. Es ist oft schwierig zu akzeptieren, dass ein derart störendes Symptom einfach auf Angst zurückzuführen ist, und der Einzelne kann oft denken, dass die Ursache etwas Schwerwiegenderes sein muss. Dies kann wiederum mehr Angst verursachen und die Derealisation verschlimmern. Es wurde auch gezeigt, dass Derealisation den Lern- und Erinnerungsprozess stört, wobei kognitive Beeinträchtigungen und visuelle Defizite nachgewiesen werden. Dies kann am besten als das individuelle Gefühl verstanden werden, als ob sie die Ereignisse in der dritten Person sehen; Daher können sie Informationen nicht richtig verarbeiten, insbesondere nicht über den visuellen Weg.
Menschen, die eine Derealisation erfahren, beschreiben das Gefühl, als würden sie die Welt über einen Fernsehbildschirm betrachten. Dies kann zusammen mit Nebenerkrankungen wie Depressionen, Angstzuständen und anderen ähnlichen Gefühlen, die mit der Derealisation einhergehen, ein Gefühl der Entfremdung und Isolation zwischen der an Derealisation leidenden Person und anderen Personen in ihrer Umgebung hervorrufen.
Die Derealisation wird von Ärzten und Psychiatern leider immer noch eher selten als eigenständiges, bzw. einhergehendes Symptom erkannt, da man sich auf Faktoren wie Depressionen und Angstzustände konzentriert. Dies ist vor dem Hintergrund einer allgemeinen Bevölkerungsprävalenz von bis zu 5% und bei traumatisierten Personen sogar auf bis zu 37% sehr bedenklich und verhindert oft eine angemessene Diagnose und Therapie.
Ein oftmals miteinhergehendes weiteres Symptom ist auch die Depersonalisation, das Gefühl, ein „Beobachter“ zu sein / einen „Beobachtungseffekt“ zu haben, bzw. seinen eigenen Körper nicht mehr als solchen wahrzunehmen, gefühlstaub zu sein oder keinen Bezug mehr zum Körper zu haben.
Derealisation kann die neurologischen Zustände von Epilepsie (insbesondere Temporallappenepilepsie), Migräne und leichter Gehirnerschütterung begleiten. Es gibt eine Ähnlichkeit zwischen visueller Hypo-Emotionalität, einer reduzierten emotionalen Reaktion auf betrachtete Objekte und Derealisation. Dies deutet auf eine Störung des Prozesses hin, durch den die Wahrnehmung emotional gefärbt wird. Diese qualitative Veränderung im Wahrnehmungserleben kann dazu führen, dass Berichte darüber vorliegen, dass etwas als unwirklich oder distanziert angesehen wird.
Eine Derealisation kann sich möglicherweise als indirektes Ergebnis bestimmter vestibulärer (Die Mundhöhle betreffend) Erkrankungen wie Labyrinthitis (Entzündung des Innenohres) manifestieren. Es wird angenommen, dass dies auf Angst zurückzuführen ist, die auf Schwindel zurückzuführen ist. Eine alternative Erklärung besagt, dass ein möglicher Effekt einer vestibulären Dysfunktion Reaktionen in Form einer Modulation der noradrenergen und serotonergen Aktivität aufgrund einer falschen Zuordnung der vestibulären Symptome zum Vorhandensein einer unmittelbar bevorstehenden physischen Gefahr umfasst, die zu Angstzuständen oder Panik führt, die anschließend Gefühle der Derealisation auftreten lässt.
Kurzum auf Deutsch gesagt: Körperliche Ursachen – wie z.B. eine Entzündung oder Reizung des Gleichgewichtsorgans -, die somatisch zu Schwindel führt, wird von der betroffenen Person mit einer Angstreaktion auf den plötzlichen Schwindel fehlinterpretiert und diese Angst vor der jähen Veränderung der körperlichen Wahrnehmung erzeugt die Derealisation mit.
Ebenso ist die Derealisation ein häufiges psychosomatisches Symptom, das bei verschiedenen Angststörungen, insbesondere Hypochondrien, auftritt. Die Derealisation wird derzeit jedoch aufgrund ihres Vorhandenseins mit mehreren Pathologien oder idiopathisch als eigenständiges psychologisches Problem angesehen.
Derealisation und dissoziative Symptome wurden durch einige Studien mit verschiedenen physiologischen und psychologischen Unterschieden bei Individuen und ihrer Umgebung in Verbindung gebracht. Es wurde angemerkt, dass labile Schlaf-Wach-Zyklen (labil bedeutet leichter zu wecken) mit einigen deutlichen Veränderungen im Schlaf, wie traumähnlichen Zuständen, Halluzinationen, Nachtangst und anderen schlafbezogenen Störungen, möglicherweise bis zu einem gewissen Grad ursächlich sein können.
Derealisation kann aber auch in umgekehrtem Sinne Auslöser für Schlafstörungen sein, da man aus lauter Sorgen und Ängsten nicht mehr durchschlafen kann, was wiederum zu stärkerer Derealisation führt.
Des Weiteren kann Derealisation eine Begleiterscheinung anderer psychischer Störungen wie Borderline-Persönlichkeitsstörung, bipolare Störung, Schizophrenie, dissoziative Identitätsstörung und andere psychische Zustände sein.
Cannabis, Psychedelika, Antidepressiva, Koffein, Lachgas, Albuterol (Asthmatikum) und Nikotin können Gefühle hervorrufen, die das Gefühl der Derealisation imitieren, insbesondere wenn sie übermäßig eingenommen werden. Es kann auch aus Alkoholentzug oder Benzodiazepin-Entzug resultieren. Opiatentzug kann auch zu Derealisationsgefühlen führen, deren Symptome langwierig (chronisch), verzögert oder möglicherweise durch solche Ereignisse ausgelöst werden können.
Interozeptive Expositionsübungen wurden in Forschungsumgebungen eingesetzt, um bei Menschen, die empfindlich auf ein hohes Maß an Angst reagieren, eine Derealisation sowie das damit verbundene Phänomen der Depersonalisation zu induzieren. Übungen mit dokumentierten Erfolgen umfassen zeitgesteuerte Intervalle der Hyperventilation oder des Starrens auf einen Spiegel, einen Punkt oder eine Spirale.
Depersonalisation oder Selbstentfremdung ist das Gefühl, außerhalb der Realität zu sein. Für jemanden, der unter Depersonalisation leidet, scheint es, als ob er eine andere Rolle in der Welt spielt, vage, wie in einem Traum, unbedeutend. Der Patient erlebt eine Trennung zwischen sich und der Welt, seiner Identität oder Körperlichkeit. Menschen, die diesen Geisteszustand erlebt haben, beschreiben das Leben oft als einen Film, falsch oder verschwommen. Das Bewusstsein für die eigene Persönlichkeit nimmt ab, daher der Name. Wer die Symptome hat und in den Spiegel schaut, scheint einen Fremden zu sehen, ist sich aber gleichzeitig seiner Identität bewusst. Die Ursache der Depersonalisation ist oft ein psychisches Trauma.
Die Stimmung tritt als Teil mehrerer psychischer Erkrankungen auf, insbesondere klinischer Depressionen, bestimmter Neurosen und Angststörungen. Wenn es auch Wahnvorstellungen gibt, kann Depersonalisation ein Zeichen für Schizophrenie sein. In der DSM-IV wird die spezifische Depersonalisationsstörung als dissoziative Störung klassifiziert.
Ein etwas ähnlicher Geisteszustand ist die Derealisierung. Die Grenze zwischen den beiden ist nicht immer klar, aber bei der Depersonalisation erlebt die Person ihren eigenen Geist oder Körper als fremd und bei der Derealisation ist die Umgebung unwirklich oder fremd.
Menschen, die unter Depersonalisation leiden, empfinden diesen Zustand oft als beängstigend. Depersonalisation ist eine natürliche Reaktion des Körpers, um sich vor Bedrohungen von außen zu schützen. Depersonalisation tritt häufig nach einer langen Zeit des Stresses auf. Der Körper will sich von den negativen Reizen von außen abschotten, so dass die Person in einen unrealistischen Zustand gerät. Der Grund, warum Menschen manchmal länger in diesem Zustand bleiben, ist, dass dieser Zustand des Irrealen nicht verstanden wird, was sie ängstlicher macht, was zur Folge hat, dass die Depersonalisation intensiver wird. Die Depersonalisation wird durch zwei Elemente aufrechterhalten: Stress und Zweifel. Wenn der zugrunde liegende Stress und / oder Zweifel an der Art der Erkrankung beseitigt werden, besteht eine gute Chance, dass die Beschwerden nachlassen oder verschwinden. Das Verständnis des Zustands ist der Schlüssel, um ihn loszuwerden.
Eine Person, die unter Depersonalisation leidet, kann vom Kontakt mit anderen Betroffenen profitieren. Für einen Depersonalisationskranken ist es oft schwierig, die Erfahrungen in Worte zu fassen. Gefühle der Isolation können oft nur selbst erlebt werden und Nichtbetroffene können den Leidensdruck meist nicht nachvollziehen, was den Erkrankten dann zusätzlich frustriert und ihn sich als isoliert von anderen Menschen vorstellt. Wenn ein Betroffener von Depersonalisation mit der Tatsache konfrontiert wird, dass er nicht allein ist, kann er die Erfahrungen leichter relativieren und die Ängste und Zweifel an seiner eigenen geistigen Gesundheit mildern.