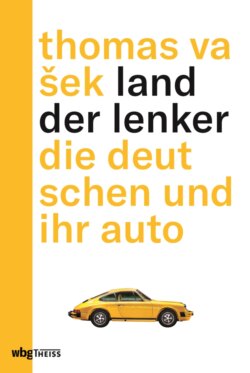Читать книгу Land der Lenker - Thomas Vasek - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 1 Tüftler und Heroen
ОглавлениеDas Automobil war eine deutsche Kopfgeburt. Es existierte zuerst auf Konstruktionszeichnungen, in der Gedankenwelt seiner Erfinder. Es war ein Erdachtes, eine Idee – ein Ideal, das seine Wirklichkeit lange nicht fand.
Carl Benz (1844 – 1929) und Gottlieb Daimler (1834 – 1900), die beiden Pioniere, waren begnadete Techniker und Tüftler. Beide kamen aus der deutschen Tradition des Maschinenbaus. Ihr Leben lang suchten sie die beste technische Lösung, die perfekte Konstruktion. Weniger verstanden sie von Unternehmensführung, von Kundenwünschen und Marktpotenzialen. Was sie wirklich antrieb, das war nicht der wirtschaftliche Erfolg, sondern eine grandiose technische Idee: das selbstlaufende Fahrzeug, genannt Automobil.
Das Automobil wurde in einem Land erfunden, in dem man es eigentlich gar nicht brauchte. In Deutschland musste man keine gigantischen Distanzen durch die Wildnis überbrücken wie in den USA. Die Attraktivität des frühen Automobils verdankte sich vor allem dem Kontrast zu zwei anderen Verkehrsmitteln, die längst die Mobilität der Deutschen prägten. Als Carl Benz 1886 den Motorwagen patentieren ließ, gab es bereits ein gut ausgebautes Eisenbahnnetz für die großen Distanzen, und das Fahrrad für den Nahbereich. Zur Zeit der Erfindung des Automobils standen also bereits zwei „demokratische“ Verkehrsmittel zur Verfügung, die es jedermann ermöglichten, sich im Land zu bewegen. Beide hatten jedoch ihre Nachteile. Der Bahnfahrer war gebunden ans Schienennetz und abhängig von Fahrplänen, der Radfahrer musste selbst in die Pedale treten.
Das Autofahren dagegen war zunächst das exklusive Sportvergnügen wohlhabender Enthusiasten, für die das Auto die Vorzüge der Kutsche mit der Schnelligkeit der Eisenbahn verband. Wer ein eigenes Auto hatte, der musste nicht länger zusammen mit dem gemeinen Volk in überfüllten Zügen sitzen, um sich wie Frachtgut transportieren zu lassen. Das Automobil versprach, die alte Freiheit und Souveränität des Reisens wiederherzustellen. Der Fahrer konnte den Reiseverlauf nach Belieben selbst bestimmen, er musste keine Fahrpläne studieren oder sich mit Schaffnern auseinandersetzen, die ihn nach der Fahrkarte fragten.
„Eine wollüstige Perspektive […] Wir werden nie von der Angst geplagt werden, daß wir einen Zug versäumen könnten. Wir werden nie nach dem Packträger schreien, nie nachzählen müssen, eins, zwei, drei, vier – hat er alles? Herrgott, die Hutschachtel; sind auch die Schirme da? Wir werden nie Gefahr laufen, mit unausstehlichen Menschen in ein Coupé gesperrt zu werden.“1
Es war das Ideal der Selbstbewegung, für das die Pioniere wie Daimler und Benz brannten. Das Automobil ersetzte nicht nur die menschliche Kraft durch die Maschine, es befreite auch von der Starrheit des Schienenstrangs. Die Fahrerperspektive – das war nicht mehr der Blick des Bahnpassagiers aus dem Fenster. Es war der Blick eines aktiven Subjekts, das mit einem Tritt aufs Gaspedal gewaltige Kräfte mobilisierte. Autofahren bedeutete Freiheit. Man wurde nicht mehr gefahren, wie im Zug oder in der Kutsche – man fuhr selbst. Das Automobil erlaubte es nicht nur, schnell von einem Ort zum andern zu kommen. Das eigentlich Moderne am Automobil war die Selbst-Bewegung, die Selbst-Bestimmung, die es versprach. Die Autopioniere hatten keine Vision vom Verkehr der Zukunft. Aber sie hatten die fixe Idee eines motorisierten „Kraftwagens“, der sich frei und mit selbstgewählter Geschwindigkeit bewegen konnte. Es war die Idee der Beherrschung von Raum und Zeit, die Idee eines „freien, richtungsbestimmenden Könnens“2, wie Carl Benz in seinen Erinnerungen schrieb.
Der entscheidende Durchbruch der Automobilentwicklung war nicht, wie viele bis heute denken, der Verbrennungsmotor. Tatsächlich wirkten mehrere technische Entwicklungen zusammen. Es ist eine der großen Ironien der Technikentwicklung, dass die Erfindung des Automobils zu wesentlichen Teilen auf dem Fahrrad basierte, auf dem „Veloziped“, wie man es nannte, das schon seit den 1870er Jahren als Hochtechnologie galt. Nicht nur die Dampfwagen griffen auf die Fahrradtechnik zurück, sondern auch die ersten Benzinautos. Der Benz-Motorwagen von 1886 war schlicht ein motorisiertes dreirädriges Veloziped, der Wagen von Paul Daimler und Wilhelm Maybach im Wesentlichen eine motorisierte Kutsche. Die bahnbrechende Leistung der deutschen Automobil-Pioniere bestand dabei weniger in den zahllosen Einzelerfindungen von kleinen, schnelllaufenden Motoren über Vergaser und Zündung bis zum Differenzialantrieb als in deren Verbindung zu einem Gesamtkonzept – einem selbstlaufenden Gefährt, das wirklich fuhr.
Das erste Automobil war keine weltumstürzende Sensation, kein Weltwunder wie die Eisenbahn oder der Heißluftballon. Verglichen mit der feierlichen Eröffnung der ersten Bahnstrecke verlief die Einführung des Autos eher unspektakulär. Als der erste Benz-Motorwagen durch München rollte, reagierten die Menschen zwar verblüfft, aber nicht geschockt. Natürlich war es bemerkenswert, dass der Wagen aus eigener Kraft fuhr. Aber ein tuckerndes Dreirad auf der Straße – das war nichts, was einem den Atem nahm, außer vielleicht durch den Gestank. Viele fragten sich ohnehin, wer eine solche „Spielerei“ brauchte, einen „Wagen ohne Pferde“, wo es doch genügend Kutschen gab. Die Frühgeschichte des Automobils erzählt von der mühseligen Durchsetzung einer Innovation, deren Sinn keineswegs so offensichtlich war, wie es aus heutiger Sicht scheint.
Abb. 1: Bertha und Carl Benz bei einer Ausfahrt im Benz-Patent-Motorwagen: Erfinder mit Startschwierigkeiten.
Die Frühzeit des Autos ist reich an Anekdoten über die Bewunderung, aber auch über die Ablehnung und den Spott, die dem Automobil entgegenschlugen. Zu den großen Legenden gehört die Autofahrt von Mannheim nach Pforzheim, die Bertha Benz im Sommer 1888 mit ihren beiden Söhnen Richard und Eugen unternahm, angeblich hinter dem Rücken ihres Mannes – die erste Fernfahrt der Automobilgeschichte. Wie es heißt, musste die Benz-Familie unterwegs immer wieder mal schieben, Bertha Benz für eine Reparatur sogar ein Strumpfband opfern, und als einmal der Sprit ausging, soll ein Apotheker mit Kraftstoff ausgeholfen haben. Die Ausfahrt war wohl, wenn die Geschichte überhaupt so stimmt, ein tolles Familienerlebnis. Doch die Käufer für das neue Gefährt blieben zunächst aus. Bezeichnenderweise war der erste Kunde ein offenbar psychisch kranker Mann, der seinen Wagen nach dem Kauf wieder zurückgab.
Beinahe wäre das Automobil in Deutschland ein Flopp geworden. Viel größer war das Interesse in Frankreich, wo man das Marktpotenzial der Erfindung von Anfang an begriff. Die französischen Hersteller entwickelten die deutschen Prototypen weiter; auf Basis der deutschen Erfindung, so stellte es Benz später dar, stürzten sie sich „auf den deutschen Gedanken wie die Bienen auf aufblühende Blumen, holten den Nektar heraus, machten Honig daraus und verkauften ihn an die ganze Welt, nicht zuletzt auch an Deutschland.“3 Dagegen ärgerte sich Benz über die mangelnde Akzeptanz in Deutschland, die „abwägende Geringschätzung“ und „kühle Verneinung“, die ihm entgegenschlug:
„Der Mann mit der rückständigen Zipfelmütze über den Ohren ignorierte von jeher gerne, was deutsch und deutschen Ursprungs ist – selbst wenn es dem Volk zum größten Schaden wurde. Wie schwärmerisch streckte er dagegen die Hände aus nach allem, was von außen kam, vor allem aus Paris.“4
Aus der Sicht von Benz fehlte den Deutschen die Aufgeschlossenheit für die Innovation:
„Selbst die deutsche Fachwelt erkannte – zum Unterschied von der französischen – lange Zeit nicht das fundamental Bedeutsame, Umgestaltende meiner Erfindung für das Verkehrs- und Wirtschaftsleben.“5
So hieß es zum Beispiel im Herder’schen Jahrbuch der Naturwissenschaften, wie Benz mit Ingrimm erwähnt:
„Diese Anwendung der Benzinmaschine dürfte ebenso wenig zukunftsreich sein wie die des Dampfes auf die Fortbewegung von Straßenfuhrwerken.“6
Aber es war wohl nicht nur die Skepsis der Deutschen gegenüber dem Neuen und auch nur teilweise die „schwerfällige Zurückhaltung des deutschen Großkapitals“, wie Benz meinte, die den Durchbruch des Autos in Deutschland zunächst verhinderten. Die Franzosen waren einfach professioneller darin, das Automobil zu kommerzialisieren. Die deutschen Erfinder verstanden zwar die Technik, aber nicht die Kundenbedürfnisse, wie der Automobilhistoriker Kurt Möser meint, für sie war ihre Erfindung lediglich „eine konstruktive Weiterentwicklung des technischen Standes.“7 Benz, Daimler und andere dachten, das Auto würde sich mehr oder minder von selbst durchsetzen, einfach, weil es technisch so gut war. In den Erinnerungen von Carl Benz geht es um technische Konstruktionen, aber nicht darum, was potenzielle Kunden wollen könnten. Die französischen Hersteller hingegen orientierten sich an den Wünschen und Fähigkeiten der Fahrer. Vor allem aber verstanden sie es, ihr Produkt zu vermarkten. Man machte Werbung für die Autos, richtete Schauräume ein und veranstaltete Ausstellungen für die breitere Öffentlichkeit. Internationale Autorennen rückten die französischen Erzeugnisse in den Blickpunkt der Weltöffentlichkeit. Bald überholte die französische Autoindustrie die deutsche, was Carl Benz zu der resignativen Feststellung veranlasste, dass Paris den Automobilmarkt mittlerweile so beherrsche wie die Kleidermode. Noch 1904 war Frankreich der weltgrößte Autoproduzent – und nicht das Land, in dem das Automobil einst erfunden worden war. Die Dominanz ging erst in den Jahren danach zu Ende, als die Konkurrenten anderer Länder begannen, das französische Erfolgsmodell zu kopieren. Die Frühzeit des Automobils ist nicht nur ein Lehrstück der Innovationsgeschichte. Sie lehrt auch etwas über den Idealismus der Deutschen, ihren Hang zum weltfremden Tüfteln, zur Perfektion als Selbstzweck. Die Deutschen haben das Automobil erfunden. Aber sie erfanden es an den Menschen und ihren Bedürfnissen vorbei.
Das zeigt auch die besonders tragische Geschichte von Rudolf Diesel (1858 – 1913), dem Erfinder des Dieselmotors, welchem die deutsche Automobilindustrie den größten Erfolg der letzten Jahrzehnte verdankt – und der untrennbar verbunden ist mit ihrem bislang größten Skandal. Der in Augsburg geborene Ingenieur Diesel kam eigentlich aus der Eisherstellung bei Linde, sein erstes Patent betraf ein Verfahren zur Herstellung von Klareis in Flaschen. 1892 meldete er ein Patent auf eine „Neue rationelle Wärmekraftmaschine“ an mit dem Begriff „Arbeitsverfahren und Ausführungsart für Verbrennungskraftmaschinen“. Das Patent beschrieb die Ausgangsidee einer neuartigen Kraftmaschine, die sich vom herkömmlichen Verbrennungsmotor in einem wesentlichen Punkt unterschied. Im Benzinmotor wird ein Treibstoff-Luftgemisch in den Zylinder gesaugt und entzündet. Im Dieselmotor hingegen wird nur Luft in den Zylinder gesaugt und stark verdichtet, was höhere Temperaturen ermöglicht. Erst dann wird der Treibstoff eingespritzt, wobei er sich spontan entzündet. Die hohen Drücke und Temperaturen galten anfangs als unbeherrschbar, doch wieder einmal fand ein deutscher Ingenieur die Lösung. Ab 1893 entwickelte Diesel den ersten Motor, der schließlich seinen Namen trug; fünf Jahre später gründete er die Dieselmotorenfabrik Augsburg. Als Unternehmer war Diesel allerdings wenig erfolgreich, zudem litt er offenbar unter psychischen Problemen. Nach jahrelangen Patentprozessen musste die Dieselmotorenfabrik Augsburg 1911 ihren Betrieb einstellen. Im September 1913 ging Diesel in Antwerpen an Bord eines Fährschiffs, um nach England überzusetzen, wo er sich in einem englischen Diesel-Unternehmen der Kritik von Aktionären stellen sollte. Nach dem Abendessen wurde er nicht mehr gesehen, später sah die Besatzung eines Lotsenbootes die Leiche eines Mannes im Wasser treiben. Die Umstände von Diesels Tod konnten nie restlos geklärt werden.
Der Dieselmotor wurde zuerst für Schiffe eingesetzt, später auch für Lokomotiven und ab den 1920er Jahren für Lastkraftwagen. Die ersten beiden Serien-PKWs mit Dieselmotor, der Mercedes-Benz 260 D und der Hanomag Rekord, wurden 1936 auf der Internationalen Automobil- und Motorrad-Ausstellung präsentiert. Den späteren durchschlagenden Erfolg seines Motors, jedenfalls in Deutschland, konnte Rudolf Diesel vermutlich ebenso wenig vorausahnen wie den heutigen Dieselskandal.
Noch zur Jahrhundertwende war es keineswegs ausgemacht, dass sich der Verbrennungsmotor durchsetzen würde. Das Benzinauto konkurrierte nicht bloß mit Dampfwagen, sondern auch mit den ersten Elektrofahrzeugen. Gegen den Motorenlärm des Benzinautos stand die mühelose Eleganz des Dampfantriebs, der allerdings in den Augen vieler Techniker als hoffnungslos altmodisch galt. Auch die frühen Elektroautos waren angenehm und ruckelfrei zu fahren; sie machten weder Lärm noch Gestank und erreichten beachtliche Geschwindigkeiten. Noch 1895 gewann ein Elektroauto bei einem Rennen gegen Benziner; die 100-Stundenkilometer-Marke wurde erstmals von einem Elektroauto überboten. Allerdings zeigten sich schon damals die Probleme, die der Elektromobilität bis heute anhaften. Das Elektroauto hatte nur eine geringe Reichweite, und für die Stromversorgung benötigte es eine Infrastruktur.
Trotz allem waren Dampfwagen und Elektroautos eigentlich die kultivierteren Alternativen zum lauten, stinkenden Benziner. Doch die Käufer sahen es anders. Am Ende wollten sie nicht das elegante Dahingleiten, sondern das wilde Abenteuer, das der Benzinwagen versprach. Der lärmende Explosionsmotor, die hohen Geschwindigkeiten, die Pannenanfälligkeit: All das galt keineswegs als Nachteil, sondern als besonderer Reiz, der die Faszination des Autofahrens ausmachte.