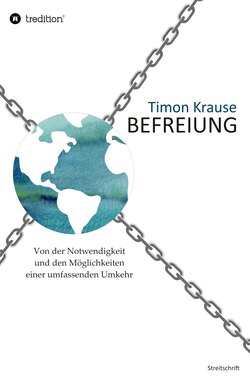Читать книгу Befreiung - Von der Notwendigkeit und den Möglichkeiten einer umfassenden Umkehr - Timon Krause - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2. Schlaglichter und blinde Flecken
„Ich würde bis ans Ende der Erde gehen, wenn ich könnte, um immer wieder zu sagen, dass ich in die junge Generation Vertrauen habe.“
- Frère Roger Schutz
„Wenn wir nicht unsere volle Verantwortung für die Welt, in der wir leben, anerkennen, haben wir kein Recht, darin zu leben.“
- Mahatma Gandhi
Am 25. November 2018 ließ Alexander Gerst, der damalige Kommandant der internationalen Raumstation ISS, eine Videobotschaft ausstrahlen, mit der er sich an seine Enkelkinder und die kommenden Generationen wandte: „Wenn ich so auf den Planeten runterschaue, dann denke ich, dass ich mich bei euch entschuldigen muss. Im Moment sieht es so aus, als ob wir, meine Generation, euch den Planeten nicht gerade im besten Zustand hinterlassen werden. Im Nachhinein sagen natürlich viele Leute, sie hätten davon nichts gewusst. Aber in Wirklichkeit ist es uns Menschen schon klar, dass wir den Planeten mit Kohlendioxyd verpesten, dass wir das Klima zum Kippen bringen, dass wir Wälder roden, dass wir die Meere mit Müll verschmutzen, dass wir die limitierten Ressourcen viel zu schnell verbrauchen und dass wir zum Großteil sinnlose Kriege führen. Und jeder von uns muss sich an die eigene Nase fassen und überlegen, wohin das gerade führt. Ich hoffe sehr für euch, dass wir noch die Kurve kriegen und ein paar Dinge verbessern können. Und ich würde mir wünschen, dass wir nicht bei euch als die Generation in Erinnerung bleiben, die eure Lebensgrundlage egoistisch und rücksichtlos zerstört hat.“[1]
Unterlegt mit beeindruckenden Bildern der Erde aus vierhundert Kilometern Höhe, gab Gerst mit einfachen Worten ein klares, ehrliches Statement ab, zu dem sich die führenden Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik bislang nicht durchringen konnten. Ein Schuldeingeständnis. Aufrichtiges Bedauern ob der kollektiven Unfähigkeit unserer Gesellschaft, den fatalen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte entgegenzuwirken und die immer schwerer umkehrbare Zerstörung unseres Lebensraumes zu beenden. Ratloses Bedauern darüber, dass bis zum heutigen Tage erbarmungslose, blutige Konflikte das Leben zahlloser Menschen zur Hölle machen, anstatt dass die Einflussreichen sich gemeinsam den wirklich drängenden Problemen unserer Zeit widmen würden.
Alexander Gersts Statement ist berührend und stimmt nachdenklich, doch neu sind seine Einsichten selbstverständlich nicht. Stammten sie nicht von einer Art wissenschaftlichem Popstar, hätten sie mit Sicherheit nicht dieselbe Aufmerksamkeit erregt. Doch selbst ein spektakulärer Appell aus dem Weltall lässt unseren Politikbetrieb nicht aus der Alltagsroutine aufschrecken, geschweige denn uns vielbeschäftigte Berufstätige in unserem täglichen Umfeld. Schöne Worte zu schönen Bildern, vorübergehende Nachdenklichkeit, und dann geht es weiter wie gehabt.
Wie wäre es denn, Alexander Gersts Botschaft wörtlich zu nehmen? Haben wir uns schon einmal mit der Frage beschäftigt, was wir unseren Kindern und Enkelkindern antworten würden, wenn sie uns fragten: „Was ist schief gegangen damals? Wo ist das Grün der Wälder und Wiesen hin, das auf euren Fotos zu sehen ist? Wo sind die weißen Gletscher der Alpen?“ Wie würden wir uns fühlen, wenn die folgende Generation uns eindringlich auf den Zahn fühlte: „Wieso gibt es so viele furchtbare Kriege um Wasser und Lebensraum? Habt ihr nichts gelernt aus den Weltkriegen vor 100 Jahren? Wieso habt ihr Öl und Kohle verheizt, obwohl zu eurer Zeit allen klar war, dass damit der Planet aufgeheizt und viele Gegenden der Erde zerstört und verseucht werden? Seid ihr denn vollkommen übergeschnappt gewesen, zu glauben, Wohlstand, Reichtum, Luxus könnten einfach immer noch weiter gesteigert werden? Seid ihr völlig von Sinnen gewesen, auf ewiges Wirtschaftswachstum zu vertrauen und die dabei auftretenden Probleme einfach zu ignorieren? Wo wart ihr seinerzeit, womit habt ihr euch stattdessen beschäftigt, welche Politikerinnen und Politiker habt ihr gewählt, worin euer Geld investiert? Wer hätte eurer Meinung nach die Probleme angehen sollen? Was habt ihr euch nur dabei gedacht? Ging es euch nur um euren Vorteil, habt ihr nur für den Moment gelebt, nach mir die Sintflut, carpe diem, komme was wolle, sündige kräftig?“ Was würden wir antworten? Verärgert abwimmeln? „Ihr macht es euch zu leicht, es ist doch alles viel komplizierter als ihr denkt.“ Beschämt zu Boden blicken, Ausflüchte stammelnd? Es sei ja leichter gesagt als getan, sich den Herrschenden und Einflussreichen entgegen zu stellen, anders zu leben und wirklich etwas zu verändern, im großen Rahmen. Ideen gab es viele, aber kaum jemand ist vorangegangen und konnte sie durchsetzen. Alle haben doch mitgemacht! Hier und da haben wir uns ja bemüht, daneben mussten wir aber doch den Alltag absolvieren, Geld verdienen, in Urlaub fahren… Sollte es tatsächlich soweit kommen, bleibt uns wohl nichts anderes, als uns wie Alexander Gerst bei ihnen zu entschuldigen und einzugestehen: „Seht ihr, wir haben versagt. Und ihr, ihr müsst nun mit den Folgen leben und das Beste daraus machen.“
Doch um Pessimismus und Schwarzmalerei soll es hier nicht gehen.
Drei Monate zuvor, am 20. August 2018, stellte sich eine unscheinbare 15-jährige Schülerin mit einem Plakat vor den schwedischen Reichstag in Stockholm. Auf dem Plakat war zu lesen: „Schulstreik fürs Klima.“ Bis zum 9. September, den Tag der Parlamentswahlen in Schweden, begab sich Greta Thunberg jeden Tag aufs Neue vor das Abgeordnetenhaus, ganz allein, ohne die Unterstützung ihrer Mitschüler oder Schulleitung, geschweige denn mit irgendeiner mächtigen Organisation im Rücken. Der Kontrast zwischen dem übermächtigen globalen Bedrohungskomplex des Klimawandels und einem einsamen Teenagermädchen hätte größer und entmutigender nicht sein können. Und doch wurde Greta Thunberg zu einem David, der es mit einem schier übermächtigen Goliat aufnehmen konnte. Einem Goliat, gleich einer Hydra, deren Köpfe Profitgier, Egoismus, Hochmut und Gleichgültigkeit heißen. Zunächst berichteten nur einige schwedische Tagesmedien von Gretas stillem Protest, bevor es im Oktober einen ersten internationalen Zündfunken gab, bei einem Treffen von Thunberg mit Vertretern der britischen Bewegung „Extinction Rebellion“. Ab November bildeten sich größere Protestgruppen in zahlreichen schwedischen Kommunen. Kurz darauf griff die Bewegung, die sich unter dem Hashtag #fridaysforfuture formiert, auf andere Länder über. Seit Anfang 2019 bestreiken auch in Deutschland regelmäßig Schülerinnen und Schüler freitags den Unterricht, um für ihr Anliegen auf die Straße zu gehen: Die Gesellschaft soll ihre Sorge hören, die Politik soll endlich Maßnahmen ergreifen, um den vom Menschen mit verursachten Klimawandel abzuwehren oder zumindest abzumildern. Bisheriger Höhepunkt der von Thunberg initiierten Bewegung war der weltweite „Klimastreik“ am 20. September 2019, an dem sich weltweit, selbst in armen und kriegsgeplagten Ländern wie Afghanistan oder den Philippinen, Millionen Menschen beteiligten und ein beeindruckendes Zeichen gegen die allgemein verbreitete Gleichgültigkeit setzten.
Über die Person Greta Thunberg, über ihre Gesundheit, ihre Herkunft, über ihre Vereinnahmung durch ein aktiennotiertes Social-Media-Startup, angebliche familiäre Verstrickungen in Geheimgesellschaften wie die Freimaurer und andere vermeintliche Seilschaften wurde seither viel berichtet und diskutiert, ebenso wie über die Frage, ob die Kinder und Jugendlichen nicht besser in ihrer Freizeit demonstrieren gehen sollten, anstatt die Schule zu schwänzen. Die üblichen Abwehrmechanismen des Komplexes aus Medien, Wirtschaft und Politik: das eigentliche Anliegen der nächsten Generation besser unter den Teppich kehren, denn zu viele Interessen finanzieller Art könnten von einer breiten gesellschaftlichen Debatte über Klimaschutz und eine nachhaltige Wirtschaftsweise beeinträchtigt werden. Doch entgegen all der feindseligen und spöttischen Reaktionen haben die Proteste ein wesentliches Ziel erreicht: Ihre Themen sind fester Bestandteil der öffentlichen Debatte geworden. Alle größeren Parteien in Deutschland haben sich im Europawahlkampf 2019 in irgendeiner Form zum Thema Umwelt- und Klimaschutz positioniert. Auf die großspurige Bemerkung des FDP-Vorsitzenden Christian Lindner, die Jugend soll Klimapolitik doch besser „den Profis“ überlassen, meldeten sich über 12.000 „Scientists For Future“, darunter Tausende Professoren und zwei Nobelpreisträger, um mit ihrem Fachwissen den Schülerprotesten zusätzliches Gewicht zu verleihen. Was nützt es schließlich, bei einer irrsinnig rasanten Fahrt auf einen Abgrund zu einfach nur ein wenig die Geschwindigkeit zu verringern, wie es der Finanz- und Wirtschaftselite offenkundig am liebsten wäre? Die Jugend, weitgehend gefeit gegen lobbyistische Einflussnahme und daher kaum korrumpierbar, hält den trägen, egoistischen Größen aus Wirtschaft, Politik und Medien den Spiegel vor. Kann sie den breiten Protest aufrechterhalten, wenn die Teilnehmerzahlen nachlassen? Wie soll sie reagieren angesichts der Ignoranz und der Politik des Aussitzens in den Machtzirkeln unserer Staatsgebilde?
Ein großer, schwerer Stein ist endlich ins Rollen geraten.
Anfang Mai 2019 verkündete ein Gericht in der südargentinischen Provinzhauptstadt Neuquén in einem von der Weltöffentlichkeit unbemerkten Verfahren sein Urteil: Sechs wegen Hausfriedensbruchs und widerrechtlicher Aneignung angeklagte Angehörige der Mapuche-Minderheit wurden in allen Anklagepunkten freigesprochen. Hintergrund des Rechtsstreits war der Widerstand gegen das Megaprojekt „Vaca Muerte“, bei dem mittels Fracking Öl- und Gasvorkommen aus dem Boden des Gemeindegebietes der Angeklagten abgebaut werden sollte. Wegen der unkontrollierbaren Umweltschäden sowie mehrerer tödlicher Unfälle in den Förderstätten ist das Projekt hochumstritten. Doch vor allem sehen sich die Nachkommen der Ureinwohner seit Jahrzehnten wiederkehrenden Anläufen von Staat und Privatwirtschaft ausgesetzt, das Land der Mapuche für umfassende Rohstoffausbeutung in Beschlag zu nehmen. So erwarb die Unternehmerfamilie Vela Ende der 1970er Jahre, unter der letzten argentinischen Militärdiktatur, Land im Territorium der Mapuche-Gemeinde, und versucht seither immer wieder, die Ureinwohner von ihrem angestammten Gebiet zu vertreiben. Das Gebiet der Gemeinde Lof Campo Maribe wurde schließlich 2014 in Absprache zwischen dem staatlichen Ölkonzern YPF und dem US-amerikanischen Energieriesen Chevron für die Förderung von Öl und Gas ausgewählt. Die Zustimmung hierfür gab ausschließlich die Familie Vela, während die dort lebenden Indigenen nicht konsultiert wurden. Das Projekt wurde vorangetrieben, obwohl die argentinische Verfassung und internationale Konventionen den Mapuche das Recht auf ihr Territorium zweifelsfrei zusprechen. Das Gericht in Neuquén schuf nun einen Präzedenzfall, der den Mapuche in einem seit über einhundert Jahren schwelenden Konflikt um Landbesitzrechte in Südargentinien und Chile erstmals ihr Recht auf ihren ureigenen Landbesitz zuspricht.
Dieses von Menschenrechtsorganisationen zu Recht als „historisch“ gefeierte Urteil ist bislang allerdings kaum mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die Urvölker Amerikas sehen sich nach Jahrhunderten kolonialer Unterdrückung auch nach der formalen Unabhängigkeit ihrer Nationen fortlaufender Ausbeutung und Diskriminierung ausgesetzt. Wer sich in diesen Ländern für die Rechte von Indigenen einsetzt, wer sich den rücksichtslosen Interessen von Großkonzernen mit offenem Engagement für Umweltschutz in den Weg stellt, aber auch wer offen für Arbeitnehmerrechte eintritt, muss um sein Leben fürchten. Fast täglich werden in Südamerika Aktivistinnen und Aktivisten für ihren Einsatz umgebracht. Auch kritische Medienschaffende leben südlich des wohlhabenden amerikanischen Nordens gefährlich. Es ist eine Liste des Grauens ohne Anfang und Ende. Die Weltöffentlichkeit bekommt davon nichts mit; für unsere Medien sind diese traurigen Alltagsereignisse, diese Kollateralschäden der Globalisierung scheinbar ohne Relevanz. Hier nur exemplarisch einige Zahlen: Allein in Brasilien gab es 2016 und 2017 (noch vor Jair Bolsonaros Präsidentschaft) weit mehr als tausend gewaltsame Angriffe auf Umwelt- und Menschenrechtsaktivisten, bei denen mindestens 375 Menschen zumeist gezielt getötet wurden. Paramilitärische Gruppierungen morden gezielt und möglichst grausam in ländlichen Gegenden Kolumbiens; seit der Unterzeichnung des Friedensabkommens zwischen Regierung und FARC im Jahr 2016 wurden dort bis heute über 700 soziale Aktivisten ermordet – mehr als 200 davon waren Mitglieder des landesweiten gemeinnützigen Bündnisses für Entwicklung und Frieden. Aber auch in Südostasien, beispielsweise auf den Philippinen, leben Sozial- und Umweltaktivisten gefährlich: Das gesellschaftliche Klima hat sich seit der Wahl von Präsident Duterte gegenüber Menschenrechtlern, Journalisten und anderen Vertretern benachteiligter Gruppen massiv verschlechtert. 2017 wurden in dem Inselstaat allein 30 Landrechtsaktivisten umgebracht.
Willkürlich lassen sich aus dieser Liste der aus unserer Sicht Namen- und Gesichtslosen zahllose Fälle herauspicken:
Am 2. März 2016 wird die honduranische Menschenrechtsaktivistin Berta Cáceres Opfer eines Attentats. Am 14. März 2018 werden die brasilianische Stadträtin Marielle Franco und ihr Fahrer in ihrem Auto erschossen; Franco war Mitglied der sozialistischen Partei sowie des Frauenausschusses des Stadtparlamentes in Rio de Janeiro. Am 3. Oktober 2018 wird der Präsident einer Fischergewerkschaft aus Chile ermordet aufgefunden, nachdem er tags zuvor an einer Demonstration anlässlich der Umweltkatastrophe von Quintero-Puchuncavi und der andauernden Passivität der Behörden teilnahm. Anfang November 2018 werden Luis Fajardo und Javier Aldana, Mitglieder der kommunistischen Partei Venezuelas und Aktivisten zur Verteidigung von Bauernrechten, auf dem Heimweg von einer Veranstaltung ihrer Partei erschossen. In den indigenen Gebieten Kolumbiens nimmt die Zahl an Morden an Lehrkräften stark zu, unter anderem wird Javier Fernandez, Lehrer und Mitglied einer Lehrergewerkschaft, am helllichten Tage ermordet. Mitte November 2018 schießen Spezialkräfte der Militärpolizei dem Enkel eines Anführers der chilenischen Mapuche-Gemeinde Temucuicu von hinten in den Kopf. Anfang Dezember desselben Jahres werden die unabhängigen mexikanischen Journalisten Alejandro Márquez und Diego Corona ermordet aufgefunden. Kurz vor Weihnachten wird Gilson Tampone, Präsident des brasilianischen Bauernverbandes und Mitglied der Landlosenbewegung, an seiner Haustüre erschossen. Seit dem Jahreswechsel 2018/19 wurden folgende Politiker der linken mexikanischen Regierungspartei Morena Opfer von Attentaten: der frisch vereidigte Bürgermeister Tlaxiacos, Alejandro Aparicio, der Friedensrichter Hernández Gutiérrez und der schwer sehbehinderte Morena-Aktivist Pedro Lucero. In den ersten Tagen des Jahres 2019 wurde in Kolumbien alle 48 Stunden ein Sozialaktivist getötet, so die Kommunalratsmitglieder Gilberto Valencia, Jesús Perafán, José González und Miguel Gutiérrez sowie die Gewerkschaftsmitglieder Wilmer Miranda und Wilson Pérez, außerdem die Sprecherin des Opferverbandes Santa Marta, Marizta Quiroz. Im März 2019 wird in Costa Rica Sergio Rojas umgebracht, der sich in seiner Gemeinde für die Durchsetzung indigener Rechte einsetzte. Am 2. Mai wird im südmexikanischen Oaxaca Telésforo Enríquez, Grundschullehrer und Betreiber eines lokalen Radiosenders, erschossen – Enríquez war ein Förderer indigener Sprachen und informierte in seiner Sendung über die zapotekische Gemeinde vor Ort (der zapatistische Widerstand kommt in einem späteren Kapitel noch ausführlich zur Sprache).6
Diese Liste lässt sich endlos fortsetzen. Sie dokumentiert die massive Bedrohungslage für Vertreter und Unterstützerinnen von Minderheiten und Marginalisierten: In den meisten südamerikanischen Staaten ist der Einsatz für Recht, Gerechtigkeit und Umweltschutz lebensgefährlich. Die über Jahrzehnte gewachsenen Strukturen der Rechtlosigkeit, mafiöse Verbindungen von Politik und Großkapital und die de facto historische Machtlosigkeit der diskriminierten Bevölkerungsgruppen haben dazu geführt, dass die Täter mit Straffreiheit rechnen können, da die Rechtssysteme im Zweifelsfall auf der Seite der Mächtigen stehen. Rechtsaußenregierungen wie aktuell in Chile, Brasilien oder Kolumbien setzen den diskriminierten Arbeitnehmervertretern, Landlosen und Indigenen außerdem beharrlich zu und sagen ihnen als „wirtschaftsfeindlichen Elementen“ offen den Kampf an – im Hintergrund verbandelt mit den Interessen übermächtiger, zumeist ausländischer Großkonzerne, die ohne Rücksicht auf Menschenrechte die rohstoffreichen Länder des Südens auszubeuten versuchen.
Doch es regt sich Hoffnung! Nicht nur die Mapuche-Gemeinde in Südargentinien hat erstmals vor Gericht Recht zugesprochen bekommen. Gelegentlich widersetzt sich die Justiz dem verbreiteten politischen Klima und verkündet Urteile, in denen die Verantwortung von Politikern und Großkonzernen hervorgehoben wird und diese zu Strafen und Reparationen verurteilt werden, und welche die Lokalbevölkerungen vor den Folgen rücksichtloser Investments schützen: Seit Mitte April 2019 wird im Fall des Wasserkraftwerkes „Agua Zarca“ in Honduras 16 Angeklagten wegen betrügerischer Machenschaften der Prozess gemacht; einer der Angeklagten sitzt bereits wegen Mordvorwürfen im Fall Berta Cáceres in U-Haft. Die Ermittlungen um Dokumentenfälschung bei der Konzessionierung und Genehmigung des Kraftwerksprojektes gehen auf über 30 Anzeigen zurück, die Berta Cacéres zu Lebzeiten als Generalkoordinatorin der Indigenenorganisation Copinh gestellt hatte. Im März gibt ein US-Berufungsgericht der Klage der peruanischen Kleinbäuerin Máxima Axuna und ihrer Familie gegen die Newmont Mining Company statt; der US-Konzern betreibt in Peru das Goldbergwerk Yanacocha, das vor Ort für massive Umweltzerstörung und Gesundheitsschäden der Lokalbevölkerung verantwortlich gemacht wird. Am 4. März entscheidet ein Gericht in Tocoa, Honduras, auf Freispruch für zwölf Umweltaktivistinnen und -aktivisten, die sich seit langem mit zivilem Widerstand gegen den unkontrollierten, zerstörerischen Bergbau in ihrer Region eingesetzt hatten. Im Dezember 2018 verurteilt ein Gericht in Brasilien den Schweizer Konzern Syngenta wegen Mordes und versuchten Mordes an Landlosenaktivisten. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass Syngenta als Auftraggeber für einen tödlichen Überfall durch seinen damaligen Sicherheitsdienst verantwortlich war. Im Jahr 2017 sorgt die Klage des peruanischen Landwirtes Saúl Luciano Lliuya gegen den Energieriesen RWE in Deutschland für Aufsehen: Das Oberlandesgericht Hamm stellt klar, dass große CO2-Emittenten wie RWE grundsätzlich verpflichtet sind, Betroffene von Klimaschäden in anderen Ländern zu unterstützen. Das abschließende Urteil steht noch aus, dennoch sprechen Menschenrechtsorganisationen bereits jetzt von einem entscheidenden Stück Rechtsgeschichte, das in Hamm geschrieben worden sei.
David gegen Goliath, Arm gegen Reich. Die verzweifelte Auflehnung dieser Menschen an der Peripherie der Weltgeschichte erscheint uns weit weg. Mit unserer Realität und unseren gegenwärtigen Problemen scheint sie nichts zu tun zu haben. Oder etwa doch?
6 Die genannten Mordfälle wurden von der unabhängigen Nachrichtenplattform www.amerika21.de recherchiert und veröffentlicht.