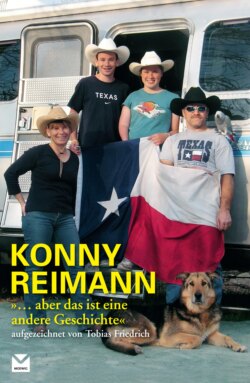Читать книгу Konny Reimann - Tobias Friedrich - Страница 5
1. DIE ERSTEN JAHRE
Оглавлениеellblechbaracken. Das erste Bild meiner Kindheit, an das ich mich erinnern kann, sind Wellblechbaracken. In Hamburg-Harburg standen damals kurz nach dem Krieg diese eilig errichteten Lager für Amerikaner und Engländer, in denen nun, in den fünfziger Jahren, deutsche Familien wohnten, bis ihnen irgendwann Neubauten zugewiesen werden sollten. Ich war ungefähr vier Jahre alt, als sich mir das Bild dieser Kolonie ins Gedächtnis brannte – zweihundert Baracken, Wellblech, so weit das Auge reichte.
Ich wurde geboren, als meine Mutter sechzehn war, der erste männliche „Nachkomme“ seit Generationen, eine kleine Reimann’sche Sensation. Meine Eltern trennten sich, als ich drei war, und ich wohnte fortan bei meiner Mutter. Ein Stiefvater, der vorher zur See gefahren war und dann seiner neuen Familie wegen, uns zuliebe also, dieses Leben aufgab und bei uns blieb, folgte kurz danach. Ich kann nicht sagen, dass wir wohlhabend waren. Ich erinnere mich, dass meine Mutter einmal an Weihnachten einen sehr kleinen Weihnachtsbaum besorgte, ein kleines grünes Kerlchen, das den Namen „Baum in viel zu kleinen Klamotten“ trug. Eines Nachmittags – keine Ahnung mehr, wie es passierte – fiel der Baum von seinem Podest auf den Boden, und einige von seinen spärlichen Zweigen brachen ab. Es war undenkbar, dass meine Mutter einen neuen Baum besorgte, also nahm sie die Zweige und nähte sie mit Nadel und Faden wieder an den ramponierten Rest des Baumes. Wen wundert es da, dass ich schon im zarten Alter von etwa fünf Jahren anfing, Eisenschrott zu sammeln, um ihn für ein bisschen Klingelgeld zum Eisenhändler zu bringen?
Trotzdem war es keine schlechte Zeit. Ich versuchte früh, mein Glück in meine eigenen Hände zu nehmen, mich in der Gegend auszutoben. Ich mochte unsere Umgebung, eine Vergleichsmöglichkeit hatte ich ja nicht. Nach und nach wurden den Familien in unserer Nachbarschaft neue Wohnungen zugewiesen, man konnte das Ausdünnen der Siedlung langsam verfolgen, und ich wartete darauf, dass auch wir umziehen würden. Tatsächlich waren wir aber am Ende die Letzten, die das Barackenfeld verlassen durften.
Wie man unschwer erkennen kann, bin ich ein Original-Hamburger, aufgewachsen in Harburg, mit vier Jahren umgezogen nach Bramfeld, wo ich auch eingeschult wurde. Später wohnten wir in der Nähe vom U-Bahnhof Uhlandstraße, Hamburg-Hohenfelde, direkt um die Ecke vom Kuhmühlenteich. Als Kind, ungefähr sieben oder acht Jahre alt, lief ich oft mit meinem jüngeren Bruder und manchmal auch mit meiner noch jüngeren Schwester an der Alster entlang zur Elbe. Ich liebte das Wasser, ich liebte die Flüsse und das Meer. Die täglichen zwanzig Kilometer waren für uns schnell ein normales Pensum. Oft stand ich schon um vier Uhr früh auf und lief zum Fischmarkt, wollte gucken, wo man Enten und Hühner kaufen konnte. Nicht, dass ich jemals selbst etwas erstanden hätte, aber das Gefühl, dabei zu sein, dort zu sein, wo das Federvieh den Besitzer wechselte, wo die Schiffe vorbeifuhren, wo etwas los war, das alles brachte täglich kleine Abenteuer, die durch nichts zu ersetzen waren. In den Sommerferien waren wir Kinder praktisch sechs Wochen ununterbrochen im Wasser. Schlauchboottouren, schwimmen gehen, am Wasser entlanglaufen und spielen, reinspringen: unsere ganz persönliche kleine Welt aus Wellen und Wind. Hier wehte immerhin ein wenig vom Geruch der großen Welt, von der wir natürlich noch nicht sehr viel ahnten, die man hier aber schon förmlich schmecken konnte.
Mein „Zimmer“ zu Hause war das komplette Gegenteil von diesem Freiluftabenteuer ohne Grenzen. Ich lebte in einer Art Speisekammer, in der gerade eben ein Bett ganz hineinpasste und damit ebenso knapp der, der darin zu liegen hatte. Das Zimmer war etwa 2,20 Meter lang und 80 cm breit. Aber es war meins. Das war alles, was für mich zählte. Erstaunlich, dass außer dem Bett noch irgendwo ein 80-Liter-Aquarium hineinpasste. Obwohl ich schon nicht der Größte war, musste ich, wenn ich seitlich auf meinem Bett saß, also mit den Füßen auf dem Boden, immer etwas die Beine anziehen, ausstrecken war nicht möglich. Die Wand beendete jedes Minimum an Gemütlichkeit. Hier kam mir mein Körper etwas entgegen, denn wäre ich ein angehender Basketballer gewesen, hätte ich auf meinem Bett gesessen wie ein Harlem Globetrotter in einem Trabbi. Aber ich war klein (und bin es noch). Doch schon in jungen Jahren kompensierte ich das durch Kraft.
Ich war so klein und so kräftig, dass ich einmal in der Schule sogar hochspringen musste, um einem älteren Mitschüler, der mich traktiert hatte, einen Kinnhaken zu geben. An eine weitere derartige Begebenheit kann ich mich aber nicht erinnern, denn es sprach sich schnell herum, dass ich der falsche Ansprechpartner für Schlägereien jeglicher Art war. Die Chancen, gegen mich einen glorreichen Sieg davonzutragen, standen nicht besonders gut, ganz egal, wer antrat.
Ganz abgesehen davon, war schon damals Prügeln nichts für mich. Meine Gegner haben mir immer viel zu leid getan, wie überhaupt die Verlierer solcher Kämpfe. Ich sah keinen Sinn darin, jemanden körperlich zu demütigen, viel lieber hatte ich Spaß mit anderen Kindern. Ernste Kämpfe waren nicht meine Sache.
Dennoch habe ich früh gelernt, dass man Rückgrat zeigen muss, sich „gerademachen“ muss, wenn es notwendig ist. Allerdings weniger, um jemanden zu Boden zu schicken, als vielmehr, um Haltung zu zeigen, dem Gegenüber zu verstehen zu geben, was die eigene Meinung ist. Vor einigen Jahren wurde mein Sohn Jason in Schenefeld in der Schule von einem notorischen Schlägertyp verprügelt, der auch schon viele andere Kinder angegangen war und belästigt hatte. Der Junge trieb eine Weile sein Unwesen, und niemand schien sich darum zu kümmern oder auch nur das Geringste dagegen zu unternehmen. Ich war bei all den vielen Eltern der Einzige, der bei einem Elternabend aufstand und sagte: „So geht es nicht, wir müssen auf dieses Kind aufpassen.“ Andere Eltern schlossen sich meiner Meinung an, und so machten wir das dann – wir kamen selbst zur Schule und behielten den Störenfried im Auge. Mehr war gar nicht nötig, und nach einer Weile hatte sich das Problem erledigt. Man muss für seine Prinzipien einstehen und auch den Mund aufmachen können. Wenn mir etwas nicht passt, sage ich das. Es nützt nichts, sich aus Angst, Scham oder um des lieben Friedens willen zurückzuhalten. Meinung auf den Tisch, basta, aus. Auch wenn das manchmal unangenehme Konsequenzen nach sich zieht. Ich stand damals an jenem Abend auf und zeigte mit dem Finger auf die Lehrerin und sagte ihr auf die Nase zu, dass sie mit der Situation nicht klarkäme. Sie hatte ihre Klasse nicht im Griff, und jeder wusste das. Zunächst versuchte sie, die Situation mit dem Schlägerkind herunterzuspielen. Außer mir traute sich niemand, der Lehrerin die Wahrheit zu sagen. Sie war überfordert und hilflos. Kurz nachdem ich der Lehrerin erklärt hatte, sie habe pädagogisch versagt und die Situation nicht im Griff, bekam ich Schulverbot. Ich hatte mir erlaubt, die Lehrerin zu maßregeln, und derlei Kritik war nicht erwünscht. Mir war’s egal. Die Situation war geklärt, und ich hatte mich nicht versteckt.
Neben meiner Mutter kümmerte sich vor allem meine Oma viel um mich. Ich habe kaum eine Erinnerung an sie, aber meine Mutter sagte mir einmal, dass meine Großmutter mich im Grunde etwas verzogen hätte. Ich bekam, was ich wollte. Während meine Mutter und auch später mein Stiefvater zu Hause eine – nennen wir es mal vorsichtig „recht robuste“ Gangart an den Tag legten, versuchte sie, es mir immer recht zu machen. Dementsprechend gut kamen wir miteinander aus. Es war allerdings kein Wunder, dass die alte Dame auf Harmonie aus war: Meine Oma war im Krieg mehr als ein Mal ausgebombt worden. Das erste Mal, als Bomben auf ihr Haus fielen, war sie im Keller, wie man es den Menschen damals beigebracht hatte. Die oberen Etagen wurden schwer getroffen, das Fundament knickte ein, als wäre es aus Salzstangen gebaut, und im Keller stürzten Balken und die Decke auf die Schutzsuchenden ein. Ein paar Meter neben meiner Oma wurde ein Mann derart schwer von einem Eisenträger getroffen, dass er wenig mehr als das angsterfüllte Jammern eines Sterbenden herausbrachte. Er starb vor ihren Augen, sie selbst konnte ihm nicht helfen, war sie doch ebenfalls derart verschüttet und lädiert, dass es ihr unmöglich war, Hilfe zu leisten. Es war schlimm, einen Menschen auf diese Art und Weise sterben zu sehen, viel schlimmer jedoch war die Tatsache, dass meine Oma mit ansehen musste, wie der Mann langsam neben ihr verfaulte. Unfähig, sich selbst aus den Trümmern zu befreien, musste sie neben dem Getroffenen ausharren, bis – viel später erst – Hilfe kam. Immer wenn später Bombenalarm war, blieb sie stoisch im oberen Teil des Hauses und wartete, bis der dröhnende Spuk vorbei war.
Die einzige bildhafte Erinnerung, die ich an meine Großmutter habe, ist die, wie wir sie im Krankenhaus besuchten. Am Ende ihrer Tage war sie durchgedreht. Die Vergangenheit hatte sie eingeholt und überfahren wie ein schwerer Laster, und Körper und Geist waren schließlich zu schwach, um noch eine vernünftige Gegenwehr zu leisten.
Mein Stiefvater war im Gegensatz zu meiner Großmutter kein Mann, der ein Übermaß an Empathie verströmte. Ich weiß nicht, ob das raue Leben auf See ihn zu dem grobklotzigen Typen gemacht hatte, der sich mir oft genug in den Weg stellte, oder ob es das Leben an anderer Stelle nicht gut mit ihm gemeint hatte. Er trank und kanalisierte seine stets darauf folgende Übellaunigkeit handfest in meine Richtung. Vermutlich ist bereits in jungen Jahren daher eine Abneigung gegen übermäßig viel Alkohol in mir gewachsen. Selbst wenn ich später mal ein Bier trank, so tat ich das lange Zeit nicht vor meinen eigenen Kindern.
Obwohl ich nie wirklich adoptiert wurde, trug ich trotz allem bis zu meinem 16. Lebensjahr doch den Nachnamen meines Stiefvaters: Nothmann. Damals war es noch üblich, dass man als Kind mit einem von den Eltern ausgestellten Krankenschein zum Arzt ging. Immer wenn ich mich auf den Weg zu einem Arzt machte, hatte ich genau so einen Krankenschein bei mir, allerdings gaben meine Mutter und mein Stiefvater mir diesen immer in einem Kuvert mit. Ich kam zu den Ärzten, händigte ihnen den Umschlag aus und machte mir nie viele Gedanken darüber. Irgendwann, ich muss ungefähr fünfzehn Jahre alt gewesen sein, überkam mich aber auf einmal die Neugier. Auf dem Weg zu einem meiner Arztbesuche öffnete ich den Umschlag und sah mir den darin befindlichen Zettel zum ersten Mal an. Ich war mehr als überrascht, auf diese Art zu erfahren, dass ich mehrere Jahre den Krankenschein eines anderen mit mir getragen hatte. Konrad Reimann wurde auf diesem Wisch zum Arzt geschickt, nicht ich. Zu Hause erzählten sie mir dann, dass ich eigentlich Reimann hieße und einen anderen Vater hätte. Ich weiß noch, dass ich das damals relativ gelassen aufnahm. Die Neugier, den Mann, der mein Vater sein sollte, dennoch zu treffen, wuchs aber stündlich und wurde bald so groß, dass ich sie nicht mehr ignorieren konnte.
Ein Treffen wurde arrangiert, um mir die Chance zu geben, meinen richtigen Vater kennenzulernen. Dazu gab es dann aber nicht wirklich Gelegenheit, denn meine Mutter und der erstmals für mich auftauchende Herr Reimann hatten sich schneller in den Haaren, als ich „Papa“ sagen konnte. Erst ein Jahr später verabredete ich mich alleine mit meinem leiblichen Vater. Zu dem Zeitpunkt lebte ich schon nicht mehr zu Hause.
Ich beendete die Volksschule mit sechzehn und fing sofort eine Lehre an. Im zweiten Lehrjahr schmiss mich meine Mutter dann raus. Es war 1972, und ich war erst siebzehn Jahre alt. Ich zog um ins Arbeiterwohnheim und war ehrlich gesagt froh, von zu Hause weg zu sein.
Als ich meinen richtigen Vater traf, war ich erstaunlicherweise nicht sauer auf ihn. Die Frage, warum er uns verlassen und vor allem all die Jahre keinen Kontakt gesucht hatte, ergab sich nicht – die Antwort hatte das erste, von meiner Mutter arrangierte Treffen gegeben. Hätte sich mein Vater in unser Leben eingemischt, wäre nur Mord und Totschlag dabei herausgekommen. Ich hätte zwar zwei Väter gehabt, aber auch viel Verwirrung und weit mehr Streit mitbekommen. Es war sicher nicht einfach für meinen Vater, die Füße stillzuhalten und zu wissen, dass er an unserer Entwicklung keinen Anteil haben konnte. Aber vielleicht war es trotzdem die beste Entscheidung seines Lebens. Ich empfand auf jeden Fall tiefen Respekt vor seinem Entschluss und hegte nicht den geringsten Groll ihm gegenüber. Ich merkte zudem sehr schnell, dass Blut dicker ist als das Tränenwasser, das mich dürftig mit meinem Stiefvater verband.
In den kommenden Jahren traf ich mich immer wieder mit meinem Vater, und aus einer puren Verwandtschaft wurde irgendwann eine Freundschaft. Während der Draht zu meinem Stiefvater sich auflöste wie ein Kondensstreifen, steht die Verbindung zu meinem wirklichen Vater heute fester denn je. Ob das auch meine Mutter und ihr Freund so im Sinn gehabt hatten, als sie mich alleine großzogen? Irgendwie finden sich die Personen, die zueinander gehören, dann scheinbar doch. Is’ so. Mein Vater wird uns bald besuchen kommen hier in Amerika. Das erste Mal. Ich freue mich drauf.
Als ich im Frühjahr ’72 meine Berufsausbildung bei der Werft Blohm & Voss begann, war eine gewisse Manu gerade mal vier Jahre alt. Während sie sich vermutlich noch mit Puppen und Ponys beschäftigte, bekam ich es mit Schiffsmaschinenbau zu tun. Blohm & Voss war damals die größte Werft in Hamburg, und man konnte dort mehr lernen als anderswo. Hier bekam ich den Grundstock dessen an die Hand, was man benötigt, um in der Welt Fuß zu fassen. Ich durchlief alle Abteilungen, die notwendig sind, um ein Schiff zu bauen, und wurde so zu einem Schweißer, Blechschlosser, Maschinen- und Rohrschlosser, Schiffsmaschinenbauer, Turbinenbauer, Schmied und Dreher. Ich lernte metallverarbeitende Verfahren und Gewerke kennen, wurde zum Fräser und technischen Zeichner ausgebildet, absolvierte die Abteilungen der Arbeitsvorbereitung, erfuhr etwas über Arbeits- und Sicherheitsschutz, und selbst die Holzverarbeitung kam irgendwann dran. Nichts Handwerkliches blieb mir verborgen.
Ich blieb dreieinhalb Jahre bei Blohm & Voss. Die Ausbildung war mit das Wertvollste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Es gab danach kaum
eine bautechnische Aufgabe, die mich vor große Rätsel stellte. Ich hatte das Rüstzeug, und wo ich auch ging und stand, fiel der Name Blohm & Voss, und schon war alles klar. Meine Lehre dauerte bis 1975, und direkt im Anschluss arbeitete ich ein halbes Jahr, bevor ich mich entschloss, zur Bundeswehr zu gehen. Dort blieb ich zwei Jahre, also länger als üblich. Das hatte einen einfachen Grund: Die Ausbildung und auch die anschließende Arbeit hatten meine Taschen nicht eben zum Bersten gefüllt, und wenn man sich damals für eine längere Zeit als vorgeschrieben beim Bund verpflichtete, gab es weitaus mehr Geld. So konnte ich mir auf einmal locker eine Wohnung und ein Auto finanzieren. Ein neues Stück von der heißersehnten Freiheit. Die Aufgaben, die bei der Bundeswehr auf mich warteten, stellten für mich, im Gegensatz zu einigen anderen, kein Problem dar. Im Gegenteil, ich mochte selbst die langen Märsche, war ich es doch von Kindesbeinen an gewohnt, lange und viel zu laufen und mich auch sonst fit zu halten.
Seit ich sieben Jahre alt war, ging ich zum Kunstturnen. Ich liebte den Sport. In der Schule bekam ich stets erste Preise, und auch überregional machte ich auf mich aufmerksam. Mit siebzehn fing ich zudem mit Karate an und gelangte auch dort schnell auf ein hohes Niveau. Der Sport bestimmte also schon früh in meinem Leben einen guten Teil meiner Freizeit, und auch während der Zeit beim Bund war dies nicht anders. Man kann also sagen, dass mein Körper jegliche noch so schwierige Betätigung dort als reine Fortsetzung des Bisherigen ansah.
Den Ideologien meiner Vorgesetzten konnte ich nicht immer folgen, aber zu diesem Zeitpunkt interessierte mich das auch noch nicht so. Das Sportliche und auch die Kameradschaft waren mir wichtiger. Ich entsinne mich, dass wir dort viel Spaß gehabt haben, erinnere mich zum Beispiel an Gewaltmärsche, bei denen ich am Ende nicht nur mein eigenes, sondern stattdessen gleich vier Gewehre auf dem Rücken hatte. Es waren die Waffen von anderen Soldaten, denen die Last nach einiger Zeit zu viel geworden war. Natürlich ging auch mir das Autoritätsgehabe mancher Leute gegen den Strich. Bereits zu diesem Zeitpunkt lehnte ich mich gegen jegliche Art der Bevormundung auf, zumal wenn es sich um kodierten Schwachsinn handelte, den kein Mensch nachvollziehen konnte. Ich wusste, dass man bei der Bundeswehr logischerweise Befehle befolgen musste, und wenn diese von gescheiten Personen kamen, die einen respektierten – kein Problem. Brenzliger wurde es bei ein, zwei Vorgesetzten, die auf den ersten Blick keine allzu großen Leuchten waren. Da fragte ich mich schon das ein oder andere Mal, wieso ich jetzt ausgerechnet von solchen Pfeifen Anweisungen entgegennehmen musste. Aber auch das habe ich überstanden.
Eine wichtige Sache, die ich in dieser Zeit lernte: Wenn es mal Ärger gibt, schlaf eine Nacht drüber! Ich weiß, das ist kein allzu neuer Grundsatz, aber einer, den die wenigsten beherzigen. Und er ist absolut wahr, denn egal, was für eine Wut du im Bauch hast, egal, was für einen Streit du mit jemandem ausfichtst – am nächsten Tag hat sich die Welt oft von einem lodernden Rot in ein mildes Hellblau verwandelt, und der Rauch vom Vortag hängt nur noch am Rand deiner Nasenlöcher. Diese fast schon buddhistische Maxime hat sich seit dieser Zeit in mir festgesetzt und ist mir seitdem mehr als einmal in schwierigen Situationen noch rechtzeitig in den Sinn gekommen.
So verging auch die Zeit in Lübeck-Blankensee, wo ich stationiert war, und das Jahr 1977 war noch nicht vorüber, als eine neue Zeitrechnung für mich begann. In den kommenden Jahren galt es, die eigene Freiheit auszukosten und weitere Teile der Welt kennenzulernen. Außerdem wollte ich testen, was es im Spaßsektor noch alles zu erleben und zu entdecken gab.
ine Sache, die mich mein Leben lang begleitet hat wie meine Schultern und mein Kopf, ist der Sport. Schon in der Kindheit fing ich damit an und habe bis heute nicht damit aufgehört. Ich werde in diesem Buch immer mal wieder darauf zurückkommen. Denn die Sportarten, die ich ausprobiert habe, ergaben nicht nur zu der Zeit einen Sinn, in der ich mit ihnen begann. Sie ermöglichten mir auch und vor allem Tonnen von Spaß und gaben mir die Kraft, die ich später beim Ausprobieren von Unmöglichkeiten hatte und brauchte. Ohne sie wären die Dinge, die ich mit meinen Freunden im Laufe der Jahre durchzog, nicht möglich gewesen. Fast all der Unsinn, den wir im Kopf hatten, involvierte körperliche Höchstleistungen, und ihr dürft dreimal raten, wer am Ende immer derjenige war, der als Proband herhalten musste und, seien wir ehrlich, das auch wollte ...
Nach der Bundeswehr arbeitete ich als Kältemechaniker. Diesen Beruf gab es damals erst seit kurzer Zeit, noch wenige Jahre vorher hatte man das gar nicht gekannt. Für mich war die Arbeit, Blohm & Voss sei Dank, kein Problem. Im Gegenteil, es machte Spaß, und ich genoss die erste Zeit, in der ich mein eigenes Geld mit eigener Leistung verdiente.
Wie viel Geld das letztlich war, habe ich immer an der Aufgabe festgemacht. Ich habe mir das nie bewusst vorgenommen, aber ich habe mich zu keiner Zeit darum geschert, was andere in ähnlichen Positionen verdient haben. Ob ein Kollege einen besseren Vertrag hatte als ich, störte mich nicht. Ich wusste, was ich wert war und wie viel ich für meine Arbeit haben wollte. Wenn ich das nicht bekam, machte ich die Arbeit im Zweifel eher nicht. Es ist schon komisch: Als ob mich jemand daraufhin erzogen oder trainiert hätte, ein sicheres Auftreten zu haben, wenn ich solche Sachen verhandele, stand ich stets schon früh in meinem beruflichen Leben vor meinen Auftraggebern und sagte ihnen, was ich unter einer gerechten Gleichung von Arbeit und Lohn verstehe. Doch von einer derartigen Vorbereitung hatte in meiner Kindheit und Erziehung nicht die Rede sein können. Mir ging es bei den Gesprächen mit meinen Arbeitgebern weniger um eine besonders gewiefte Taktik als vielmehr um ein korrektes Gefühl. Ich wollte mich einfach nicht unter Wert verkaufen, ansonsten hätte mir die Arbeit keinen Spaß gemacht. Wenn jemand nur wenig zu geben hatte, aber fair mit seinen Arbeitern umging, gab ich mich auch mit weniger zufrieden. Die Verhältnisse mussten einfach stimmen.
Zunächst verdiente ich mein Geld in Hamburg, später fuhr ich dann zur See und reparierte unterwegs Klimaanlagen. In jener Zeit arbeitete ich für verschiedene Firmen, mit Unterbrechungen war ich immer wieder unterwegs an entlegene Orte, für die man, wollte man sie auf dem Globus suchen, eine halbe Umdrehung benötigte.
Ich genoss diese Reisen damals sehr. Alles, was ich zu der Zeit tat, hatte mit Freiheit zu tun und stillte meine Sehnsucht nach Abenteuer. Ich kam unter anderem auch nach Südamerika und wäre um ein Haar sehr früh schon dort hängengeblieben. Ein Hotel in Santos hatte mir ein Angebot gemacht, dort zu arbeiten, und die Option gefiel mir sehr gut. Zwei Gründe hielten mich davon ab, dort zu bleiben: Zum einen hatte ich in Hamburg zu der Zeit eine Freundin. Zum anderen hatte eben diese Freundin in meiner Abwesenheit einen Unfall mit meinem Chevy Caprice Kombi. Sie erzählte mir davon am Telefon, genau in den Tagen, als ich in Südamerika war. Ich hatte ein schlechtes Gefühl, sie (und den kaputten Wagen) dort so alleinzulassen. Ich liebte meine Freundin, und ich liebte den Wagen. Die Vorstellung, meinen „Ami“ einfach kaputt zurückzulassen, bereitete mir Magenschmerzen. Ich war ziemlich entnervt von der Sache. Ihr war nichts passiert, und später erfuhr ich auch, wieso. Als ich wieder in Hamburg angekommen war, entpuppte sich der Unfall als Lappalie: Meine Freundin hatte gar keinen Schaden davontragen können, weil sie an dem Station Wagon (so nannte man das Modell) lediglich das Gummi an der Zierleiste etwas ramponiert hatte. Eine Macke, die ich mit einem Handgriff wieder beheben konnte. So hielten ein kleines Stück Gummi und meine ausufernde Vorstellungskraft mich davon ab, mein Leben in Südamerika fortzusetzen. War vielleicht besser so.
Auch nach England und Frankreich bin ich gekommen und habe gelernt, dass der alte Spruch tatsächlich stimmt: Reisen bildet. Ich fand es großartig, auf See zu sein und diese unterschiedlichen Länder kennenzulernen. Auch durch den Sport bin ich später noch viel gereist, bin viel herumgekommen, und habe ebenso wissbegierig alles in mich aufgesogen. Noch ein Grund, warum ohne Sport mein Leben definitiv anders verlaufen wäre.
In den letzten Jahren in Hamburg arbeitete ich sogar des Öfteren ohne Arbeitsvertrag. Ich war Subunternehmer, hatte ein gewisses Risiko, konnte das aber immer besser taxieren. Ich wusste schon nach ein paar Jahren, wem ich trauen konnte und wem nicht. Sobald es ernste Schwierigkeiten gab oder Abmachungen nicht eingehalten wurden, ging ich. Bald wussten die Firmen, was sie von mir erwarten konnten und dass sie mich nicht hinters Licht führen konnten. Mit dieser offenen Art und Weise bin ich sehr gut gefahren. Am Ende hatte ich einen guten Kundenstamm mit Firmen, bei denen ich immer wieder mit Aufträgen rechnen konnte.
s muss 1979 oder 1980 gewesen sein, als ich mein erstes amerikanisches Auto, oder „einen Ami“, wie wir es nannten, fuhr. Es war ein Chevy Caprice, an den ich durch Zufall gekommen war. Ich selbst hatte zu diesem Zeitpunkt noch einen Audi 100 mit Automatik. Dann lernte ich das Mädchen kennen, das diesen Chevy fuhr. Ich war wie hypnotisiert. Die junge Frau war in Ordnung, aber der Wagen war eine Wucht. Der Zufall wollte es, dass sie das Ding verkaufen wollte, und ich schlug sofort zu. Weder hatte ich vorher irgendeine Verbindung zu Amerika gehabt noch das Verlangen, dahin zu kommen, aber die Autos von dort waren für mich schon früh etwas Besonderes. Die Größe dieser Gesamtkunstwerke allein hat es mir schon angetan. Auch die Maschine – der 5,7-Liter-V8-Motor –, der Sound, all der Platz unter der Haube und im Wagen ... Diese Autos waren wie für mich erfunden. Vielleicht war dieser amerikanische Duft von Freiheit und Größe aus späterer Sicht der Wegbereiter für die euphorischen Gefühle, die ich hatte, als wir das erste Mal nach Texas einsegelten. Bei dem Chevy konnte man die Sitzbank herunterklappen, und schon hatte man eine wunderbare Ladefläche. Oder man setzte hinter die letzte Sitzreihe noch eine Bank mit zwei Sitzplätzen, von der aus man nach hinten auf die Straße hinaussah. Auch für die Wochenendfahrten war die Kiste wie geschaffen. Nahm man die Sitze wieder weg, hatte man automatisch eine Liegefläche von 2,60 Metern. Das Ding war sehr komfortabel, es hatte einen Tempomat und eine sich selbstständig regelnde Klimaanlage, so dass man selbst nach langen Fahrten topfit war.
Seit diesem Chevy hatte ich immer wieder US-Karossen. Bei einem der späteren Amis, die ich aus den USA bezog, einem schwarzen Pick-up Crew Cab (im Prinzip ein großer PKW mit Ladefläche), fand ich kurz nach dem Kauf ein paar leere McDonald’s-Ketchup- und Pfeffertüten im Innenraum. Ich weiß noch genau, dass mir komisch zumute wurde. Wenige Tage zuvor hatte noch jemand am anderen Ende der Welt versucht, seinen in irgendeinem Fast-Food-Restaurant gekauften Hamburger mit Pommes zu würzen, und jetzt stand die Kiste mit diesem stummen und seltsam beiläufigen Gruß einer Hinterlassenschaft vor mir. Aber damit noch nicht genug: Ich fand auch noch Bohnenspuren und einen feinen, farbigen Rand am Tacho. Wenn man sich etwas mit derlei Fahrzeugen und ihrer Nutzung beschäftigt, weiß man, dass der Vorbesitzer seinen Wagen nicht geschont hatte und in einer Gegend unterwegs gewesen war, die vom Verlauf des Weges so manche Überraschung parat hatte. Man musste kein Sherlock Holmes sein, um zu erkennen, dass dem Mann das Auto sehr wahrscheinlich wenigstens einmal abgesoffen war, im wörtlichen Sinne – das Auto also untergegangen war oder zumindest bis unter die Halskrause im Feuchten gesteckt hatte. Der Verkäufer hatte es vor dem Verkauf gereinigt und am Ende, nach dem Trocknen, blieb schließlich nur der feine Rest am Tacho übrig. Neben dem Staub und den Essensresten fand ich noch roten Sand.
Es war meine erste, noch sehr lose Verbindung zu Amerika, einem Land, das mir zu jenem Zeitpunkt außer seinen Autos nicht viel zu sagen hatte. Während jeder Amerikaner sich in seinem Leben ein deutsches, möglichst schnelles Auto wünscht, ging meine Sehnsucht schlicht in Richtung Größe. Heute überfluten die Japaner sowohl Europa als auch Amerika mit Fahrzeugen, die sich eher an der asiatischen Körpergröße orientieren. Nichts für mich. Man stelle sich nur mal vor, wie ich in einem kleinen Mazda aussehen würde!
Als wir bereits in Amerika wohnten, waren wir einmal beim Red River im Norden von Texas. Ich sah den flach und breit vor mir liegenden rostig-roten Boden und musste urplötzlich wieder an den roten Sand aus dem schwarzen Pick-up denken. Vielleicht hatte ich, ohne es zu wissen oder auch nur zu ahnen, bereits lange bevor wir nach Amerika übersiedelten, ein Auto gefahren, das kurz zuvor durch die Straßen von Texarkana, Clarksville, Dallas, Plano und Wim Wenders’ Paris, Texas gescheucht worden war. Wer weiß, vielleicht sogar durch Gainesville und am Moss Lake vorbei? Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber es könnte so gewesen sein.
Vor dem Pick-up war ich einen Suburban gefahren, dessen Hinterteil ich kurzerhand abflexte, so dass aus ihm ebenfalls eine Art Pick-up wurde. Einfach so lassen, wie sie waren, konnte ich Autos generell eher schlecht. Mir fiel immer etwas ein, was man mit ihnen machen konnte, was sie noch geiler machte, noch brauchbarer für meine Zwecke.
Den Chevy hatte ich mir damals wegen seines großen Heckfensters gekauft. Ich war ungefähr seit dem Jahr 1979 leidenschaftlicher Surfer, und mit diesem Auto konnte ich an die Garage heranfahren und alles direkt ausladen, was ich in die großen Backentaschen am Ende des Autos gepackt hatte. Herrlich! Für mich fühlte sich das an, als könne ich auch noch drei Elefanten hinten im Auto verstauen und mit zum Surfen nehmen.
Ansonsten gab es im Grunde für mich vor der Auswanderung fast keinen Bezug zu den USA. Ich hörte kaum Musik, und wenn, hatte mich nie interessiert, woher sie kam. Meine Reiseziele waren lange Zeit klar umrissen: Sie mussten nicht allzu weit weg sein, und man musste dort ungestört seine Spleens ausleben können. Man musste mit dem Auto hinkommen und günstig übernachten können. Es schadete auch nichts, wenn ich mich etwas auskannte, um gleich die besten Stellen für unsere improvisierten Stunts und das Surfen zu finden. Die USA meiner frühen Jahre waren entweder Südfrankreich oder Dänemark, Letzteres noch etwas öfter.
Ich bin mir sicher, dass ich der Erste war, der mit einem Geländewagen auf Stränden herumgefahren ist. Ich hatte diese großen Schlitten, also musste ich auch ausprobieren, was damit alles zu machen war. Heutzutage gibt es sogar im Fernsehen allerlei Sendungen, die anarchistische Mutproben zum Inhalt haben und den Kids quasi Anleitungen zur Hobbyrebellion geben. Früher waren die Leute, selbst junge, noch weitaus vorsichtiger, was spektakuläre Aktionen anging. Meine Freunde und ich schienen allerdings mehr Albernheiten im Kopf zu haben als Otto Normalverbraucher, und wir zündeten diese Ideen, sobald wir losfuhren – zu irgendeinem Strand, der uns einlud, ihn als Kulisse für unsere Spektakel zu nutzen.
Nicht selten befestigten wir zum Beispiel mit einem Seil eine Holzpalette am Auto, auf der wir anschließend am Strand „surften“; das Auto war das Motorboot, und wir waren die Johnny Knoxvilles der späten Siebziger und frühen Achtziger, die ausprobierten, ob wirklich nicht geht, was eigentlich nicht gehen kann. Meist ging es dann doch irgendwie, wenn auch nicht immer ohne Zwischen- oder gar Unfälle.
Oder wir banden ein Tau ans Auto, an dessen Ende sich eine Schlaufe befand. Diese Schlaufe hielten wir in der Hand, standen auf einem Surfbrett, und der Fahrer gab Gas. Damit surften wir dann im flachen Wasser am Ufer entlang. Es war wie eine skurrile Form von Wasserski an der Grenze von Meer und Land. Nicht Wellen sollten den Surfer tragen, sondern nur eine Tischdecke aus Wasser, damit man gleiten konnte, wenn der Fahrer losfuhr. Wir erreichten damals auf diese Weise Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h. Es war ein Traum. Wir hatten nur Blödsinn im Kopf, nichts konnte skurril genug sein. Hatten wir eine Sache überlebt, musste eine neue gefunden werden, die der Vorherigen mindestens ebenbürtig war.
Es hatte sich bald herumgesprochen, dass wir zum Äußersten bereit waren und im Prinzip sogar die Erdanziehungskraft in Frage stellten. Einmal war ein Fotograf einer großen Surfzeitung dabei, der uns fotografieren wollte, wie wir den Wellen trotzten. Wie so oft kam es dann aber gar nicht zu einem normalen Surf-Nachmittag. Vielmehr probierten wir mal wieder unser „Ufer-Surfen“, also das Gleiten auf den ausrollenden Wellen am Strand mit einem Surfbrett, gezogen von unserem Auto. Einer meiner Freunde fuhr den Wagen, und ich stellte mich hinten auf das Brett. Alles klappte hervorragend, das Auto und somit auch das Surfbrett und ich gewannen an Fahrt, und ich schlidderte über den Strand mit einer Geschwindigkeit, die Pferde neidisch gemacht hätte. Mit Unebenheiten muss man natürlich immer rechnen, und wenn man nicht mit ihnen rechnet, muss man sich wenigstens spontan mit ihnen anfreunden. Ich war voll in Fahrt, als plötzlich vor mir eine Sandbank auftauchte. Das Brett stoppte, wie es ihm die Sandbank befahl, doch ich hatte noch das Seil in Hand, verbunden mit einem Auto, das Sandbänke überhaupt nicht kannte. Allein aufgrund des immensen Tempos und einer recht guten inneren Steuerung fiel ich jedoch nicht einfach hin, sondern rannte, wenn man das so nennen will, auf dem Sand weiter, was dann ausgesehen haben muss wie eine Art Dreisprung. Als Erstes ließ ich das Seil fallen. Dann machte ich einen Satz und kam mit einem Fuß wieder auf, ein paar Meter weiter mit dem anderen, dann wieder mehrere Meter dahinter mit dem ersten. So ging das ein paar „Schritte“, bis ich krachend und einen rasanten Salto schlagend ins Wasser katapultiert wurde. Der Fotograf hielt während der ganzen, in wenigen Sekunden stattfindenden Szene drauf, und ich schätze, man konnte ein gutes Daumenkino aus seinen Bildern machen. Er schaute am Ende verdutzt hinter seiner Kamera hervor, unsicher, ob ich würde aufstehen können und überhaupt noch bei Bewusstsein oder gar am Leben wäre. Ich war! Ich lachte schon beim Aufrappeln und fand das Ende dieser legendären Surffahrt noch besser, als wenn es einfach weitergegangen wäre. Sicherlich hat mir auch hier meine jahrlange Kunstturnerfahrung geholfen, mich instinktiv halbwegs geschickt ins Wasser fallen zu lassen. Die Fotos und auch die Stunden, die der Fotograf mit uns verbrachte, manifestierten auf jeden Fall unseren Ruf als die wasserdichtesten Spinner, die dänische und südfranzösische Strände je gesehen hatten, mit den undichtesten Ideen, die man besser nicht zu Ende denkt und schon gar nicht umsetzen sollte. Oder wie die Amis sagen: Don’t try this at home, kids!
Mein Gott, wir wussten damals nicht mal, wie viel Benzin wir verfuhren; es war eine aberwitzige Menge. Nach über zwanzig Jahren habe ich mir mit einem Kumpel einmal die Mühe gemacht und ausgerechnet, wie viel Geld bei diesen Trips für Sprit draufgegangen ist. Allein die daraus resultierende Zahl sprach Bände – wir waren schon etwas herumgekommen, wie man so schön sagt. 1.000.000,– DM hatten wir für das schmierige Nass ausgegeben, das uns an die ganzen Strände trug und oft genug ermöglichte, diese irrwitzigen Dinge auszuprobieren. Keine einzige Mark war falsch investiert! Wochenenden waren für uns keine Zeit zum Ausruhen von etwaigen Strapazen des Alltags, nein, sie waren Einladungen zum Austoben. Unsichtbare Tickets ins Abenteuer. Wir waren fast jedes Wochenende in Rømø, Dänemark. Die Geografie bot uns Strände an, und wir wollten nicht so unhöflich sein, sie abzulehnen. Alle paar Tage kalkulierten wir, wie wir diese „Kurzurlaube“ finanzieren könnten. Wir brauchten Benzin, etwas zum Grillen und gegebenenfalls einen Campingplatz, oft genug stellten wir uns aber auch einfach irgendwo auf. Die simple Gleichung zum Glück lautete beispielsweise: 2.000,– DM Benzin und 1.000,– DM Camping; Portemonnaies auf, zusammenlegen, los geht’s. Wir sind gefahren, egal, was war. Rømø hätte schon von feindlichen Außerirdischen besiedelt sein müssen oder Ziel eines Atomangriffs, andere Ausreden gab es nicht. Es war kalt draußen? Umso besser, dann wird’s ja erst richtig interessant. Es stürmt, es regnet, es ist ungemütlich? Solange das Meer bereit ist und uns nicht rauswirft, wird es uns und das Surfbrett tragen.
Trotz all der Menge Geld, die dabei an Tankstellen und Supermärkten verschwand, gingen wir keinesfalls unüberlegt oder zügellos mit den Finanzen um. Im Gegenteil, wir wussten sehr genau, was wir uns leisten konnten oder wollten und wo wir vorsichtig sein mussten. Meist war die Devise jedoch: Wir verdienen gutes Geld, also wollen wir es auch ausgeben. Wofür aufheben, jetzt muss die Schwarte krachen, jetzt haben wir Lust darauf, der Welt zu zeigen, wo der Hammer hängt. Wir waren jung und kräftig und bis obenhin voller Energie. Was soll man da sparen auf ein Leben, das man am Ende eh nicht haben und leben will? So verfahre ich auch jetzt noch. Ich kalkuliere, was ich mir leisten kann und will, und setze es dann um. Lebensqualität, Spaß und inzwischen auch der Sinn für Familie passen alle wunderbar unter einen Hut und sind durch die Fitness und Frische im Kopf ganz nebenbei sogar auf wundervolle Weise eine gewisse Absicherung für das Alter. Es gibt keinen Grund, alle Kohle in tote Zahlen auf den Innenseiten eines Sparbuches zu verwandeln. Da bringt das Geld keine Freude. Mir jedenfalls nicht. Arbeiten und Spaß haben muss beides in den Tag passen. Auch in Zukunft, denn surfen kann man auch mit achtzig noch. Jedenfalls werde ich euch das dann zeigen. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ein weiterer Unterschied zu heute war, dass Rømøs Strände damals noch weitgehend leer waren. Das Urlaubsland Dänemark wurde nur zaghaft entdeckt. Viele Strände lagen fast jungfräulich für uns da und bettelten um ein wenig Aufmerksamkeit. Sie schienen förmlich nach uns zu rufen.
Anfangs gab es dort noch kleine Holzbuden, es war, als hätte Astrid Lindgren unsere Wochenendtrips und die langen Urlaube geplant. Idyllisch, liebenswert und individuell konnten wir die Dänen und ihr goldenes Eigentum genießen. Später kamen immer mehr kommerzielle Steinhäuser an die Strände, immer mehr Läden eröffneten, schließlich mündete das Ganze in Massentourismus. Man kann es den Dänen nicht verübeln – sie wollten natürlich ihre Ufer in klingende Münze verwandeln. Die zumeist deutschen Urlauber entdeckten nach und nach, was wir Jahre vorher noch fast alleine staunend begrüßt hatten.
Zum Teil waren wir, speziell ich, an dieser touristischen Entwicklung sogar selbst beteiligt und nicht ganz schuldlos. Ich warb damals so sehr in meinem Umfeld für diese Länder und Orte, pries Dänemark und auch das Surfen an wie Sauerbier. Ich erzählte von dem wilden Wochenend- und Urlaubsleben in Rømø und Frankreich, schwärmte überall, wo ich ging und stand. Schließlich brach wenige Jahre später in meinem Umfeld und darüber hinaus fast schon eine Art Surfeuphorie aus. Die Surfbretthersteller hätten meinen Kumpels und mir eigentlich eine kleine Prämie ausloben können.
Irgendwann war an „unseren“ dänischen Stränden alles ziemlich überlaufen, sie wurden sogar teilweise gesperrt, weil der Andrang zu groß war. Aber auch meine Bedürfnisse hatten sich geändert. Nicht dass ich mit steigendem Alter ein Luxushotel und gemütliche Kissen am Ende eines Tages erwartet hätte; die Unternehmungen, meine Spaß-Expeditionen, wurden nur immer größer. War ich anfangs noch mit einem Ein-Mann-Zelt unterwegs gewesen, wuchs dieses zunächst zu einem Zelt für mehrere Personen, bis ich am Ende mit einem Wohnwagen herumfuhr, der von Jahr zu Jahr mit immer neuen Gimmicks ausgerüstet wurde.
Aus dieser Zeit habe ich heute noch zwei, drei gute Freundschaften, die, wie ich schätze, auch noch eine Weile länger halten werden. Denn auch wenn es zwischendurch mal Streit gab, haben wir doch immer alles offen angesprochen. Selbst über Wochen und Monate andauernden Zwist konnten wir am Ende immer bereinigen und uns wieder in die Augen schauen. Es gibt nicht viele Menschen im Leben, mit denen so etwas gelingt. Leute, die auch Kritik annehmen, selbst wenn sie schonungslos ist. Im gleichen Atemzug muss man aber auch selbst offen für Kritik sein und es einstecken können, wenn andere einem den Spiegel vorhalten. Ich hoffe sehr, dass meine Familie und Freunde das in den kommenden Jahren genauso weiterhin beherzigen werden, wie ich es tun werde.