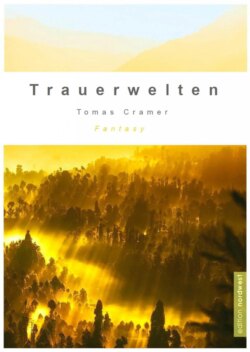Читать книгу TrauerWelten - Tomas Cramer - Страница 6
ОглавлениеII
Ein lärmender Schwarm Krähen lässt Theo aus ihrer Ohnmacht erwachen. Sie hält die Augen noch geschlossen, aus Furcht und Erwartung darüber, was geschehen sein könnte. Ein kühler Windhauch streift ihre Nase, in der Luft liegt Brandgeruch. Theo fühlt sich matt, ausgelaugt und kraftlos, dennoch öffnet sie ihre felsenschweren Augenlider, dann holt sie tief Luft und spürt, wie der kalte Hauch in ihre Lungen dringt.
Theo richtet sich langsam auf und lässt sich sofort wieder ins Gras fallen, weil sie nicht glauben kann, was sie gerade gesehen hat.
»Was ist passiert? Wo bin ich? Wo ist unser Haus, mein Lesezimmer, einfach alles?«, sagt Theo mit erstickter, leiser Stimme zu sich selbst.
Ihr Mund ist trocken und das Schlucken fällt ihr schwer. Die Zunge liegt wie ausgedörrt in ihrem Rachen. Sie schließt die Augen wieder, aber nur für einen kurzen Moment. Theo liegt auf einer mit Steinen und kleinen Felsbrocken übersäten Wiese, die Teil eines steilen Abhanges ist. Als sie ihren Oberkörper erneut leicht aufrichtet, muss sie Acht geben, nicht die Balance zu verlieren und hinunterzurollen. Gespannt wendet sie den Kopf nach rechts und schaut den Abhang hinunter.
Die meisten Büsche und Sträucher um sie herum scheinen mit gelbgrauer und brauner Farbe getränkt zu sein, als hätten sie eine giftige Substanz aus der Erde gesogen. Das trockene Gras, auf dem ein gelblicher Schleier liegt, hat auch schon bessere Tage gesehen, denkt Theo.
Langsam dreht sie den Kopf nach vorn und peilt mit zusammengekniffenen Augen die entferntere Umgebung der unwirtlichen Gegend an. Es kann sich doch nur um einen schlechten Scherz handeln, um eine Inszenierung oder um eine … Bewusstseinsstörung?! Ist es nun so weit? Bin ich jetzt wirklich total übergeschnappt, durchgetillt, abgenippelt, hirnexplodiert, wirr, dement oder einfach nur durchgeknallt? Theos laute Gedanken sind plötzlich ruhig, zu beängstigend sind die Gefühle, die sie auf dieser kargen Wiese zu bewältigen hat.
Abermals versucht sie sich aufzurichten und spürt sofort einen stechenden Schmerz im rechten Bein. Ihren verletzten Zeh hatte sie in der Aufregung ganz vergessen. Fast beiläufig wirft sie einen kurzen Blick auf ihren Fuß und erkennt, dass der Fuß in einen Verband gewickelt ist. Verband? Wo ist die Orthese? Theo reckt sich nach vorn und betastet vorsichtig ihren Fuß. Tatsächlich! Der Orthese ist weg, einfach verschwunden! Stattdessen sieht sie, dass der Fuß mit einem einfachen, aber festen Stoffverband umwickelt ist.
»Wie lange bin ich ohnmächtig gewesen und wo ist die Fußschale geblieben? Sie kann sich doch nicht einfach in Luft auflösen«, entfährt es ihr. Theos Augen verweilen einen Moment auf ihrer Kleidung. Dem kühlen Wetter angemessen gekleidet ist sie wenigstens. Sie trägt ihre blaue Jeans, deren rechtes Hosenbein wohl vom Arzt ein paar Zentimeter aufgeschnitten worden war und die schwarze Winterjacke, über ihren blauen, wollenen Lieblingspullover, den sie heute Morgen bereits in der Schule an hatte.
Ein weiterer Gedanke versetzt sie in Panik: »Die Kerzen! Ich habe die Kerzen brennen lassen. Paps bringt mich um, wenn er das sieht. Er müsste ja gleich nach Hause kommen. Hoffentlich richten sie bis dahin keine Katastrophe an!« Schon oft hat Theo Kerzen einfach abbrennen lassen, weil sie zwei Zentimeter über dem Kerzenhalter von selbst erlöschen, aber gilt das für alle Arten? Theo ist sich nicht sicher. Was hätte sie auch tun sollen, sie hatte ja nicht einmal eine winzige Chance sie zu löschen …
Allmählich bekommt sie es mit der Angst zu tun. Nein, Angst ist es nicht, versucht sie sich über ihre Gefühle im Klaren zu sein. Angst ist dieses grässliche Gefühl, das einen überfällt, wenn man ahnt, dass etwas Schreckliches passieren wird. Angst hatte sie damals verspürt, als Mama ihr von der Krankheit erzählte und sie nicht wusste, ob die Ärzte den Krebs in den Griff bekommen würden.
So schlimm wie damals kann es gar nicht mehr werden. Nein, jetzt ist sie angespannt, aufgeregt oder besorgt darüber, was das alles hier zu bedeuten hat.
Sonst sind ihre Gefühle immer so geradlinig und normalerweise leicht zu erklären, aber nun beschleicht sie ein mulmiges Empfinden. Etwas Ungeheuerliches muss geschehen sein und sie hat nicht den blassesten Schimmer, was es ist, geschweige denn, was sie daran ändern könnte. Zum ersten Mal in ihrem Leben, fühlt sie sich allein auf sich gestellt.
Als sie ihren Blick noch einmal über die Umgebung streifen lässt, erkennt sie in einiger Entfernung einen schmalen Pfad.
»Wo ein Weg ist, da ist Hoffnung«, spricht Theo sich selbst Mut zu. Es kostet sie unendliche Mühe, sich zu erheben und ihre Beine zu bewegen, die sich ungelenk anfühlen. Behutsam humpelt sie die unebene Wiese hinunter, indem sie ihr Gewicht vornehmlich auf den gesunden Fuß verlagert.
Theo hofft, auf dem Weg jemandem zu begegnen, der ihr aus dieser seltsamen Situation heraushelfen kann. Dennoch hat sie das unbestimmte Gefühl, als sprächen gewisse Umstände dagegen. Dazu gehört die Tatsache, dass sie mit einem einfachen Verband nicht weit kommen wird, aber auch, dass ihr die Gegend absolut fremd ist. Beim Anblick der kargen Hügel fühlt Theo sich an Schottland erinnert. Erst vor wenigen Monaten hatte sie einen Reisebericht über das schottische Hochland im Fernsehen gesehen.
Ihr Blick schweift über die weiten, zerklüfteten Abhänge und sie sieht nun auf einmal eine schmale, dunkelgraue Rauchfahne, die in der Nähe eines kleinen Laubwäldchens in den Himmel emporsteigt. Theos Herz macht einen Freudensprung, dort gibt es sicher Menschen, die ihr weiterhelfen können, hofft sie.
Nach etwa zwei Kilometern erkennt Theo, dass der Weg geradewegs in das Wäldchen hineinführt. Das Rauchfähnchen ist nun zu einer ausgeprägten Rauchfahne angewachsen. Der Qualm verteilt sich in den Baumwipfeln, deren Spitzen an manchen Stellen schon nicht mehr auszumachen sind. Theo glaubt, den Geruch von gebratenem Fleisch wahrzunehmen.
Eine weitere Viertelstunde später hat sie den Rand des Waldes erreicht – aus dem Wäldchen ist ein stattlicher Wald geworden. Sie schaut zum steilen Abhang zurück.
»Von da oben sieht alles viel kleiner aus«, sagt sie flüsternd und beugt sich hinab, um die Festigkeit des Verbandes noch einmal zu überprüfen.
Die Sonne versinkt langsam hinter den zerrissenen Hügeln und auf der gegenüberliegenden Seite walzt sich, unterstützt durch tiefschwarze Regenwolken, die Dunkelheit aus.
Vorsichtig folgt Theo dem Weg durch die Bäume, deren hohe Zweige ausgebreitet sind wie Baldachine. Etwas unscharf erkennt sie endlich den flackernden Feuerschein, ungefähr in der Mitte des Waldes. Die jetzt schon nachtschwarzen Bäume geben Theo das sichere Gefühl nicht sofort entdeckt zu werden, falls ihr irgendwer begegnen oder in ihre Richtung schauen sollte.
Theos Füße beginnen vor Anstrengung zu schmerzen, der weiche Waldboden schafft leider kaum Erleichterung. Der Schmerz des gebrochenen Zehs hält sich zu ihrer großen Überraschung in Grenzen, aber die Kräfte beginnen zu schwinden.
Ab hier geht sie nur noch in geduckter Haltung vorwärts, während sie sich vorsichtig der Feuerstelle nähert. Baum für Baum pirscht sie voran, sehr bemüht sich nicht durch Schleifgeräusche zu verraten oder versehentlich auf einen vertrockneten Ast zu treten.
Aus sicherer Entfernung beobachtet sie mehrere Gestalten, die um das Feuer herumlungern. Es sind vielleicht fünf oder sechs Erwachsene mit vier Kindern alle unterschiedlichen Alters. Auch zwei Babys kann Theo in den Armen ihrer Mütter ausmachen. Sie glaubt, dass es sich bei dieser Gruppe um eine Großfamilie, mit Großeltern, Eltern und Kindern handelt. Auf der linken Seite erspäht Theo eine graue Holzhütte, deren Fundament, das aus kleinen Findlingen besteht, ein Stückweit aus dem Boden ragt. Rechts neben der Hütte sind in separaten Verschlägen ein paar Ziegen, Schweine und Hühner untergebracht. Das Vieh mampft zufrieden aus den Futtertrögen, Theo vernimmt lautes Geschmatze und Gegrunze.
Die um das Feuer versammelte Sippe brät derweil grob zerteilte Fleischstücke über lodernden Flammen. Das Fett trieft spritzend ins Feuer, dessen Flammen sich immer höher recken, als wollten sie selbst das Fleisch verschlingen.
Theos Magen meldet sich mit einem geräuschvollen Knurren, reflexartig legt sie die Hand auf ihren Bauch, so, als könne sie auf diese Weise das Grummeln unterbinden. Nach dem anstrengenden Marsch ist sie fast versucht, aufrechten Ganges in die traute Runde zu platzen und dreist um eine Malzeit zu bitten. Schlimmer als Elfis Portionen kann das Essen hier gar nicht sein, das steht für sie fest. Theo kann nicht recht erklären, was sie von dieser Idee abhält – aber, sie traut dem Braten nicht …
Noch bevor sie ihre Gedanken weiter sortieren kann, hört Theo ein verdächtiges Knacken direkt hinter ihrem Rücken. Bei dem Versuch, sich umzudrehen bleibt es. Ein unheimlicher Koloss packt sie fest um den Hals und dreht gleichzeitig ihren Arm auf den Rücken, der durch die Drehung fast auszukugeln droht. Ein brennender Schmerz durchfährt die Armmuskeln, als sei ihr Arm an eine 1000-Volt-Leitung geraten. Ein ekelhafter Gestank dringt in ihre empfindliche Nase, eine Mischung aus gebratenem Fleisch, Rauch, Erde und Urin.
Der Muskelprotz schleift Theo mit brachialer Gewalt zur Feuerstelle, fast hätte sie dabei ihre Brille verloren. Die Hitze der Flammen kommt ihr bedrohlich nahe. Sie fürchtet schon, ins Feuer geworfen zu werden, aber das hat der Herkules-Typ offenbar nicht vor. Theo wird brutal auf den Boden gedrückt, sie bekommt keine Luft. Sie hat das Gefühl, gleich ersticken zu müssen. Mit ganzer Kraft versucht sie sich dagegen zu stemmen, um wenigstens atmen zu können und den Zeh vor einer erneuten Verletzung zu bewahren. Zwei stahlharte Hände greifen nach ihrem Kopf und halten ihn fest wie eine Schraubzwinge. Nur unter größtem Widerstand ist es den Stahlpranken möglich, ihr Gesicht zum hellen Feuerschein zu drehen, von dem sie sich vorher abgewendet hatte.
Die übrigen erstarrten Grillfestteilnehmer streifen Theos Antlitz mit einem kurzen Blick, lediglich um festzustellen, dass das Mädchen für sie unbekannt und somit uninteressant ist.
Theo spürt am gesamten zitternden Leib, dass ihr Alptraum unvermindert anhalten wird, als sie in die Gesichter der Waldbewohner schaut. Deren Augen sind durch und durch tiefschwarz! Sie glänzen wie ausrangiertes Motoröl. Die Gesichter wirken alt und verschlissen, als bestünden sie aus gegerbtem Leder, das mindestens fünfhundert Jahre lang von der Sonne ausgedörrt wurde. Vollkommen verschrumpelt sehen sogar die Gesichter der Kinder aus, deren Alter Theo vielleicht nur anhand der Körpergröße einschätzen kann. Eine eiskalte Fessel des Entsetzens umschlingt Theos Herz, trotz der heißen Flammen in der Nähe.
Der Hüne löst endlich seine harten Griffel, sodass sie ihr Gesicht wieder in die kühlere Dunkelheit drehen kann. All die vorherigen Gefühle von Angespanntheit, Aufgeregtsein und Besorgnis sind aus ihrem Kopf verbannt, die blanke Angst ist zurückgekehrt! Sie fühlt nichts anderes als Demütigung, Entsetzen und wünscht, die Erde würde sich unter ihr auftun um sie zu verschlingen. Diese erschreckenden Eindrücke muss sie erst verarbeiten. Für einige Sekunden schließt sie die Augen, bis sie plötzlich aufschreckt, weil zwei Männer sich anbrüllen, als sei urplötzlich ein Krieg zwischen ihnen ausgebrochen. Noch nie hatte sie solche Laute gehört.
»Uaaarrk!«, worauf Theos Peiniger mit »Karraaka tormana!«, antwortet. Theo versteht jetzt gar nichts mehr. Mit dieser Ansammlung von Urlauten kann sie absolut nichts anfangen. Unwillkürlich muss sie bei dieser Unterhaltung an ihren Chemie-Lehrer Herrn Stadlober denken. Wenn der sein Urbayrisch vom Stapel lässt, klingt das ganz ähnlich …
Seltsamerweise steht Theo nach einer Weile nicht mehr unter Beobachtung, vielleicht hängt das mit der jähzornigen Brüllerei zusammen? Sie zieht ihren verletzten Fuß näher zu sich heran. Auch die Aufmerksamkeit der verschreckten Kinder lässt nach. Sie rennen ausgelassen um das Feuer herum, während die Mütter ihre schreienden Babys beruhigen. Etwas stiller reden nun die Männer miteinander, aber sie achten nicht im Geringsten auf ihren Gast. Hatten die etwa jemand anderen erwartet oder vielleicht sogar befürchtet? Oder hielten die mich für einen Spion, versucht sie einen Sinn für die ganze Aufregung zu finden. Theos Gedanken überschlagen sich, während sie versucht, sich einigermaßen gerade hinzusetzen, ohne die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Dann schaut sie zu den Baumwipfeln hinauf, der Himmel hat inzwischen eine tintenblaue Färbung angenommen. Mittlerweile ist die Hitze erträglich und das Knistern leiser geworden, die Holzscheite sind fast verzehrt.
Die schwarzen Augen machen ihr Angst und die alten, zerfurchten Gesichter der Kinder ebenfalls. Beim Anblick der ganz alten Borkengesichter muss Theo an Roll-Mops denken. Wie gern wäre sie jetzt lieber im verhassten Sportunterricht (im Geräteraum), als hier in der unwirklichen Dunkelheit! Theo verharrt etwa eine Stunde regungslos auf dem Boden, ihr Magen knurrt inzwischen wie ein hungriger Wolf. Sie harrt der Dinge, die da kommen und wartet insgeheim auf einen Robin Hood, der sie aus diesem Grauen befreit, aber es tut sich nichts.
Als sich nach weiteren zehn Minuten noch niemand um sie bemüht, nimmt sie all ihren Mut zusammen, sie krabbelt vorsichtig auf allen Vieren zu einer großen Holzschale, in der sich Reste gebratenen Fleisches und beinahe abgenagte Knochen befinden. Ganz langsam hebt Theo den Arm und beobachtet dabei aufmerksam die alten Schorfgesichter. Nur kurz würdigen sie Theo eines Blickes und wenden sich dann wieder ihren Beschäftigungen zu. Theo führt ihre Hand in die Schale und zieht eine gebratene Rippe heraus. Dann kann sie sich nicht mehr beherrschen, Theo nagt das Restfleisch von diesem und weiteren Rippenknochen ab, dabei stopft sie den Mund so voll, dass sich der Unterkiefer kaum noch auf- und abbewegen lässt.
Plötzlich verharrt sie in dieser Bewegung und hockt da wie versteinert. Aus den Augenwinkeln beobachtet Theo, wie ein Mann mit wirren Haaren und kantigem Narbengesicht einen glühenden Ast aus dem Feuer zieht und wütend einem der Jungen nachwirft, der die ganze Zeit laut schreiend um das Feuer herumgesprungen war. Die Glut trifft ihn am Wadenbein. Er stürzt fürchterlich und schreit auf, sogleich beginnt er wie ein geprügelter Hund zu winseln, dass es Theo das Herz zerreist.
Das geht ihr jetzt aber eindeutig über die Hutschnur. Sie richtet sich mutig und erhobenen Hauptes auf und wendet sich mitleidig dem erbärmlich heulenden Jungen zu. Mit beiden Händen ergreift sie sein Bein und dreht es vorsichtig zum Schein des Feuers, damit sie sich die Verletzung genauer ansehen kann. Schlagartig beendet der Junge sein Geheule, schaut Theo kurz in die Augen und zieht blitzschnell sein Bein zurück. Dann verschwindet er in der Dunkelheit wie ein junger Fuchs, der sich aus einer Falle befreien konnte. ›Merkwürdig‹, denkt Theo, ›ist der es nicht gewohnt, dass man sich um ihn kümmert oder fürchtet er sich vor Fremden?‹
Sie kommt nicht dazu, diesen Gedanken weiterzuführen, weil der Mann mit den Eisenfingern (der ähnlich schäbig gekleidet ist wie der Flammenwerfer), zu einem fürchterlichen Gebrüll anhebt, das auch ein Neandertaler nicht grauenvoller hätte anstimmen können. Die Haarpracht dieses spitzgesichtigen, ziegenbärtigen Mannes besteht lediglich aus einer Halbglatze. Die wenigen kreisförmig angelegten Drahthaare stehen vom Kopf ab, als sei ein Zwergen-Ufo darauf gelandet.
Die Kinder, die Frauen und die Alten raffen sich auf, suchen gemächlich ihre Sachen zusammen und begeben sich schleppend in die Waldhütte, die Theo nur noch schemenhaft im Schein des fast abgebrannten Feuers wahrnehmen kann. Niemand schaut sich nach ihr um, niemand kümmert sich um sie. Zufrieden grunzend erhebt sich als Letzter das vernarbte Kantengesicht und schlendert in gebeugtem Gang der Tür der Hütte entgegen.
Nachdem ihn die Hütte verschluckt hat, packt Ufo-Kopf einen dicken Holzbalken, der neben der Tür steht und verschließt diesen damit von innen, sofort kehrt Ruhe ein. Theo fühlt sich einerseits erleichtert, weil ihr keine weitere Gewalt angetan wurde, andererseits beginnt sie zu begreifen, welche Abgründe sich hier auftun. Ist das Ganze Realität oder nur ein böser Traum? Es kann kein Traum sein, dafür spürt sie ihren zerschundenen Körper zu deutlich …
Die Schale mit dem Fleisch und eine andere kleinere Holzschale, in der sich ein paar Kartoffeln befinden, hatten die Frauen vergessen mit ins Haus zu nehmen. Theo nimmt die Schalen an sich und beginnt schnell, die Reste zu essen, bevor wieder etwas dazwischen kommt. Die Nahrung tut ihr gut. Sie spürt mit jeder Sekunde, wie ihr Körper jene Kraft bekommt, die sie dringend braucht. ›Mit leerem Magen schläft es sich nicht gut‹, hatte Mama immer gesagt.
Auf einmal ist sie wieder da, die Erinnerung an den Klang ihrer Stimme! Auch Mamas lächelndes Gesicht erscheint vor Theos geistigem Auge. Eine Erinnerung, die nicht von den üblichen Fotos herrührt, sondern die aus den tiefsten Tiefen ihres Unterbewusstseins emporsteigt. Wie kann das sein? Warum muss erst etwas Schlimmes passieren, bevor die Erinnerungen zurückkehren, fragt sie sich.
Das Feuer erlischt, die Holzscheite glühen nur noch. Aus dem Dunkel kriecht die Kälte immer näher. Sie schleicht, gleich einem schwarzen Panther, der geduldig darauf wartet, sein Opfer jeden Augenblick anspringen zu können. Theo fühlt sich verloren, die Angst umschlingt ihren Magen und windet sich über die Wirbelsäule hinauf bis ins Gehirn.
All ihre Sinne sind von der Sehnsucht gedrängt, wieder zu Paps zu kommen. Zurück, einfach nur zurück! Sie verspürt nichts, als diesen brennenden Wunsch, aber das macht keinen Sinn. Sich in dieser Dunkelheit auf den Rückweg zu machen, wäre glatter Selbstmord!
Obwohl, sie braucht nur den Waldweg in die entgegengesetzte Richtung zu gehen, dann käme sie zum Ausgangspunkt ihrer Reise zurück … aber was dann? Wo ist das verflixte Tor in ihre eigene Welt und wie kann man es öffnen? Muss sie nur darauf warten, bis sie wieder das Bewusstsein verliert, das könnte Jahre dauern!
Und was ist mit den Gefahren, die unterwegs auf sie lauern? Wilde Tiere, die im Dickicht hungrig darauf warten, bis sie falsche Entscheidungen trifft …
Nein, solcher Gefahr will sie sich nicht aussetzen. Sie muss diese Nacht irgendwie hier im Wald überstehen, am besten in der Nähe des Hauses. Theo nimmt sich vor, erst morgen über einen Ausweg aus dieser verfahrenen Lage nachzudenken. Manchmal sieht die Welt am nächsten Tag ganz anders aus, wenn es wieder hell geworden ist, manchmal aber auch nicht …
Der Zeh beginnt wieder stärker zu schmerzen, außerdem juckt es unter dem Verband. Theo traut sich nicht, diesen zu lösen, aus Angst, eine eiternde Wunde oder ein anderer grausiger Zustand könnte sie darunter erwarten. »Und dann bekomme ich den Verband nicht mehr richtig fest«, sagt Theo zu sich selbst, erschreckt, ihre eigene Stimme zu hören.
Kühler Wind kommt auf und lässt die Bäume rauschen. Theo umschlingt ihren Oberkörper mit den Armen, als könne sie sich unverwundbar machen oder einfach nur vor der Kälte schützen. Es ist sinnlos.
Sie schleicht näher an die Feuerstelle, um nach übriggebliebenem Brennholz zu suchen und damit die Flammen neu entfachen zu können. Aber es ist zu dunkel, in der näheren Umgebung kann sie jedenfalls nichts auftreiben.
›Bei den Tieren ist es bestimmt etwas wärmer und die Hütte schützt ein wenig vor dem kalten Wind, der von oben in die Lichtung weht‹, überlegt sie. Leise nähert sie sich dem umzäunten Gehege und versucht im schwachen Mondlicht eine Decke, einen Sack oder etwas Ähnliches auszumachen. Theo muss dabei ihre Hände zu Hilfe nehmen, um das fehlende Sehvermögen auszugleichen, sie tastet sich am Zaun entlang.
Sie hat Glück, dort, wo der Zaun direkt an das Waldhaus stößt, liegt auf dem sandigen Boden ein rauer Teppich aufgerollt wie eine Wurst und gleich dahinter noch ein zweiter. Zudem entdeckt sie etwas weiter einen Mauervorsprung auf der Rückseite des Hauses, der Theo etwas Schutz vor den kühlen Fingern des Windes bietet. Hier breitet sie den staubigeren der beiden Teppiche aus, in den anderen rollt sie sich vollständig ein, nur ihr Gesicht schaut ein Stückweit heraus.
Zu ihrer großen Freude spürt sie, dass etwas Wärme durch den Teppich kriecht. Sie stammt aus dem Mauervorsprung, der, wie Theo glaubt, die Rückseite eines Kamins ist. »Ein Paradies in der kalten, dunklen Hölle …«, flüstert Theo in die Nacht hinein, schließt die Augen und ist der Welt augenblicklich für einige Stunden entschwunden.
Paps wäscht ihr mit einem Waschlappen durchs Gesicht, dann wieder und wieder und nochmal. Das Wasser ist angenehm warm, aber der Lappen mufft grottenfies.
»Paps, jetzt reicht es! Ich bin kein kleines Kind mehr, wie oft soll ich das eigentlich noch sagen? Lass mich das selbst machen …« Eine blitzsaubere Theo öffnet die Augenlider und sieht in die schwarzen, blutunterlaufenen Augen eines unglaublich hässlichen Hundes. Sie erschrickt fürchterlich. Nach längerer Betrachtung ist sie geneigt, ihn unter diesen Umständen als Höllenhund anzusehen. Er ist kohlrabenschwarz, klapprig dünn und stinkt wie die Pest. Der Gestank hat sich unmittelbar auf Theos Gesicht übertragen, weil der Höllenköter sein Schlabberorgan nicht bei sich behalten konnte. Sie verzieht angewidert das Gesicht und rollt sich steif aus dem Teppich. Mister Schwarzauge verliert das Interesse am neuen Camping-Gast. Er trabt zur dampfenden Feuerstelle und schleckt die restlichen Fleischkrümel aus den verwaisten Holzschalen. ›Waren die letzten Fleischbrocken etwa für ihn bestimmt?‹
Plötzlich öffnet sich die Hüttentür. Die beiden Frauen, die gestern Abend am Feuer saßen, kommen heraus und gehen wenige Meter zwischen den Bäumen hindurch, heben ihre Röcke an, hocken sich hin und verrichten die morgendliche Notdurft. Dabei schauen sie Theo so unverblümt an, als träfen sie sich seit fünfzehn Jahren allmorgendlich zu diesem Ereignis.
Theo schaut verlegen weg. Die Gesichter der beiden haben sich in ihr Gedächtnis eingeprägt.
Die Frau rechts hat eine lange hässliche Narbe über der linken Wange. Die wilde Haarpracht der Frauen ist schmucklos zu einem Zopf zusammengebunden, was die braun gegerbten Gesichter runder erscheinen lässt, als sie es tatsächlich sind.
Nach wenigen Minuten ist die Morgentoilette beendet, die Frauen ziehen sich rasch in die Waldhütte zurück.
Durchdringendes Männergebrüll lässt plötzlich die Hauswände erbeben. Die massive Holztür fliegt wieder auf und sogleich poltern zwei Jungen auf den Waldweg. Einen der beiden erkennt Theo als denjenigen wieder, der sich gestern verletzt hatte, sich aber nicht untersuchen lassen wollte. Sie nehmen sich einen großen Tonkrug von der dampfenden Feuerstelle und verschwinden gehetzt in den Wald. Nach wenigen Minuten eilen sie zurück. In dem Krug befindet sich Wasser. Der Junge, der den Krug trägt, balanciert ihn vorsichtig über die Türschwelle. Nachdem die Tür zugezogen worden ist, versucht Theo durch ein kleines offenes Fenster zu spähen, das sich links vom Mauervorsprung befindet. Die Düfte von frischem Brot, geräuchertem Schinken, Kümmel, Getreidekaffee und Alkohol dringen ihr in die Nase.
Der Junge mit der Brandwunde am Bein sieht Theo am Fenster, kommt herausgelaufen und zerrt sie an ihrer Jacke zum Eingang. Nur widerwillig geht sie mit hinein. Ein kleines Mädchen schließt hinter ihnen die Tür. In der rechten Ecke entflieht gerade eine Maus durch ein kleines Loch in der Holzwand. Die ganze Sippschaft sitzt versammelt um einen Tisch und verschlingt gierig und schmatzend das rustikale Frühstück. Auf der eckigen Tischplatte stehen Schinken, Käse, Eier und Brot, dazu eine hellbraune Paste, ein Krug mit Getreidekaffee sowie ein Krug mit Bier. Theos Blick schweift durch den schlicht eingerichteten Raum, der die gesamte Waldhütte ausfüllt. Alles, was die Großfamilie zum Leben benötigt, ist hier untergebracht. Der Tisch, Stühle, Regale, ein Spülbecken aus Stein und Schlafkojen, die wie Regale an drei Wänden übereinander angeordnet sind. Theo nimmt an, dass sich vier Kinder ein Bett teilen müssen oder zum Teil in den Betten der Eltern schlafen. An der rückwärtigen Wand befindet sich der breite Kamin, in dem gerade frische Brotfladen gebacken werden. Links davon steht der schwere Spülstein für den Abwasch, bestehend aus über- und nebeneinander gestapelten Holz- und Tongefäßen.
Nirgends kann Theoe Farben, Bilder oder bunte Stoffe sehen. Selbst die Kleidung der Bewohner ist schlicht dunkelbraun oder grau, die Möbel sind nicht im Geringsten durch Schnitzereien oder Einlegearbeiten verziert. Nur dort, wo man sich stoßen konnte, wurden die Ecken und Kanten des Tisches, der Regale und Betten abgehobelt, abgeschliffen oder sie sind einfach abgenutzt.
Die gewebten Teppiche, die in Dreier- oder Viererschichten übereinander liegen, sind dick und grau. Sie erfüllen lediglich einen Zweck, nämlich die Hütte vor der aus dem Erdreich kriechenden Kälte zu schützen, nicht mehr und nicht weniger.
Der Jüngling, der Theo vorhin ins Haus zog, blickt sie mit seinen schwarzen Augen herausfordernd an, greift nach einem Stück Brot, das mit der hellbraunen Paste bestrichen ist und legt es ihr mit ernster Miene in die Hand. »Danke!«, sagt Theo erstaunt und amüsiert sich im Stillen über seine struppigen Haare. Sie setzt sich auf eine Bettkante und beginnt das trockene Brot zu essen.
Der Aufstrich schmeckt nach einer Mischung aus Kümmel und Nüssen. Das Brot ist so trocken, dass es ohne Aufstrich sicher wieder zu Mehl zerfallen wäre. ›Schade, dass das Brot im Ofen noch nicht fertiggebacken ist‹, denkt Theo.
Sie schaut in die Gesichter der Schmatzenden, die Theo fast gar nicht beachten. Während die Großfamilie sich grunzend und schnaubend an der Mahlzeit labt, blicken die Erwachsenen stur auf die Tischplatte.
Tischmanieren sind hier so unbekannt, wie ein Schuljahr ohne Hausaufgaben. Theo fasst nach einem henkellosen Becher und gießt sich etwas von dem ›Kaffee‹ ein. Die warme Brühe erscheint ihr etwas zu grün für Getreidekaffee, vielleicht war es noch gar nicht reif, als das Getreide geerntet wurde …
Mutig nimmt Theo einen Schluck und verzieht sogleich angewidert das Gesicht. Das Zeug schmeckt wie eingeschlafene Füße am Wandertag. Sie blickt in die Gesichter der älteren Herrschaften und fühlt sich beim Anblick der Großmutter an einen grauen, verdorrten Baum erinnert. Das Gesicht des Alten dagegen ist braungebrannt, aber zerfurcht wie weiches, gebogenes Knäckebrot.
Plötzlich schreit der Großvater laut auf: »Taogara urka!« Alles ist still, niemand rührt sich. Theo hält vor Schreck den Atem an, sie lässt ihren Kaumechanismus einfrieren. Nicht weit entfernt hört man dumpfe Trommelschläge, deren Schallwellen unheilvoll und ausdauernd durch den Wald dröhnen.
Ufo-Kopf und Kantengesicht stürzen nach draußen, um die Herkunft des immer wiederkehrenden Donnerns auszumachen. Die ganze Szenerie wirkt auf Theo sehr beängstigend. Wild gestikulierend stapfen die Männer wieder herein und blaffen ihre Frauen an. Diese schrecken zusammen und wenden sich ihren Säuglingen zu. Die Alten beginnen die kleineren Kinder und sich selbst warm anzuziehen, alles läuft wie ein Film vor Theos Augen ab, als wäre die Familie seit langem auf diesen Moment vorbereitet gewesen.
Dann geht alles relativ schnell. Von einer Weide, außerhalb des Waldes, treibt das vernarbte Kantengesicht zwei Ochsen zur Waldhütte, die der Ufo-Kopf sogleich vor einen Karren spannt. Die Alten setzen sich auf desen Karren, die Mütter legen die dick und warm eingepackten Säuglinge zu ihren Füßen und decken sie mit einer rauen Wolldecke zu. Anschließend laufen sie zurück ins Haus, um gleich darauf vor Anstrengung keuchend wieder zu erscheinen, in den Händen halten sie die frisch gebackenen Fladenbrote.
Ufo-Schädel treibt brüllend und mit einem Stock wild umherfuchtelnd die Ochsen an, ihm kann es gar nicht schnell genug gehen, während Kantenkopf die Frauen und Kinder anschreit – vermutlich sollen sie sich beeilen.
Theo begreift die ganze Hektik nicht. Sind sie in akuter Gefahr und sind die Trommeln Vorboten einer unausweichlichen Katastrophe? Egal, eine Antwort erhält sie sowieso nicht. Theo fasst den Entschluss, sich an der Flucht zu beteiligen, vielleicht ist das die einzige Möglichkeit, um wieder nach Hause zu gelangen.
Der Höllenhund bleibt wie angewurzelt neben der Hütte stehen, er hat wohl den Auftrag Haus und Hof zu bewachen. ›Was gibt es da eigentlich zu bewachen‹, fragt Theo sich.
Die Frauen haben alle Mühe, ihre Kinder beieinander und mit der Geschwindigkeit des Karrens Schritt zu halten. Auch Theo humpelt derart langsam hinterher, dass sie kaum mithalten kann.
»So ein Mist! So komme ich nie nach Hause!«, schimpft sie. Theo beißt die Zähne zusammen, stapft etwas schneller und wagt es, sich am Karren hochzuziehen, um neben der Großmutter Platz zu nehmen. Niemand beschwert sich, kein Mann schreit, die Großmutter schaut nicht einmal auf, auch die Kinder protestieren nicht – es interessiert niemanden.
»Ich bin sonst gar nicht so, aber ich muss eben alles versuchen, um nicht unter die Räder zu kommen. Mit Höflichkeit komme ich bei euch ja leider nicht weiter …«, sagt Theo an die Großmutter gerichtet, deren Gesicht aber nichts als Teilnahmslosigkeit erkennen lässt. Theo findet es sehr ungewöhnlich, dass niemand auch nur das geringste Interesse an ihr zeigt, mit Ausnahme eines Jungen.
Während sie so in die zerfurchten Baumgesichter blickt, fällt Theo noch etwas auf. Die Erfindung des Lächelns scheint sich in diesem Landstrich wohl noch nicht herumgesprochen zu haben.
Die beschwerliche Reise geht über Hügel und Täler, über Brücken und durch schlammige Furten, in denen die Räder immer wieder stecken bleiben. Sie kommen oft an Bächen vorbei, halten einige Male an, um daraus zu trinken und die Ochsen zu tränken.
Verstohlen schaut Theo auf ihre Armbanduhr. Seit fast zwei Stunden ist die Großfamilie mit ihrem Fahrgast unterwegs.
Das dumpfe Dröhnen der Trommeln ist zwar beträchtlich leiser geworden, aber weiterhin deutlich hörbar. Wenn Theo die Gesichtszüge der Männer und Frauen richtig deutet, dann sind es die Trommelsignale, die der Familie den Tag gründlich vermiest haben. Die Fahrt auf dem Ochsenkarren ist für alle Beteiligten eine ungeheure Anstrengung. Theos Wirbelsäule spürt inzwischen jede kleine Unebenheit auf dem steinigen Weg und meldet unentwegt die gleiche Botschaft an ihr Gehirn: SCHMERZ.
Gleich hinter einer Hügelkuppe, die links und rechts des Weges von verwelkten Blüten und braunen Samenständen umsäumt ist, taucht auf der linken Seite eine kleine Ortschaft auf, die bei näherer Betrachtung Unheil verheißt.
Der Anblick, der sich den Reisenden schon während der Anfahrt bietet, ist grauenvoll. Das Dorf muss erst vor kurzem fluchtartig verlassen worden sein. Viele Häuser waren niedergebrannt worden. Die Ruinen recken wie warnende Fingerzeige in den grauschwarzen Himmel, der Gestank von verkohltem Holz und verendeten Kadavern erfüllt die Luft. Die Gegend liegt unter einer Dunstglocke, der hohe Luftdruck ermöglicht dem Rauch kaum Abzug. Aus einer schwarzen Ruine, die sehr weit im Hintergrund liegt, qualmt es noch beträchtlich, dieses Haus muss als Letztes angezündet worden sein. Ein paar Katzen streunen orientierungslos über die Trümmer, sie suchen vergeblich nach vertrauten Gesichtern.
Das Knäckebrotgesicht des Großvaters gibt irgendwelche Laute von sich, die wohl niemand wiederholen kann. Der Karren stoppt mit einem Ächzen und Stöhnen der Achsen und Räder, die Großeltern steigen ebenso geräuschvoll von der Sitzbank. Eilig stärken sich die Frauen und Kinder mit Brot, während die Männer die Ochsen mit frischem Heu und Wasser versorgen. Großvater und Großmutter teilen sich ein kleines Stück geräucherten Schinken.
Während alle beschäftigt sind, humpelt Theo eine kleine Böschung hinauf, um das verlassene Dorf besser überblicken zu können. Sie nutzt die Gelegenheit, um sich auch die Kätzchen näher anzuschauen – es sind Theos Lieblingstiere. Ein kleines, weißes Kätzchen mit grauen Tigerstreifen und runden, schwarzen Knopfaugen nähert sich ihrer Hand, es lässt sich bereitwillig streicheln.
»Hallo, kleines süßes Ding. Bist du aber flauschig. Gefällt dir das? Du siehst ja so süß aus …« Das Kätzchen reckt sich und streift ganz dicht an Theos Hosenbeinen entlang. »Du bist das warmherzigste Wesen, das mir weit und breit begegnet ist. Vielleicht weißt du, dass die Menschen hier laut und brutal miteinander umgehen, aber bitte glaube nicht, dass alle so sind. Schau dir meine Augen an, sie sind anders, und ich bin es auch.« Ein leises »Miau«, dringt an ihre Ohren. Theo ist plötzlich den Tränen nahe, als sie das kleine Stimmchen hört. Das ständige Gekeife der Erwachsenen ist ihr unerträglich geworden. Sie sehnt sich sehr nach den ruhigen und sachlichen Gesprächen mit Paps.
Theo hockt sich hin und nimmt das weiche Kätzchen auf den Arm, dann streicht sie mit ihrer Wange über das warme Fell.
»Tut mir leid, aber leider kann ich dich nicht mitnehmen.« Theo setzt das kleine, weißgraue Bündel wieder ins feuchte Gras zurück. Etwas ungläubig schauen die dunklen Knopfaugen zu ihr hinauf, als erwarteten sie noch etwas.
Vom Weg erschallt Großvaters Gebrüll, das die Familienmitglieder eiligst zusammentreibt. Sie finden sich beim Karren zusammen und bereiten sich zum Aufbruch vor. Theo bewegt sich ebenfalls in die Richtung, wirft dann aber einen wehmütigen Blick zurück. Das Kätzchen läuft ihr nach und umspringt Theos Füße, als sie wieder stehen bleibt.
Schwerfällig setzen sich die Ochsen in Bewegung. Das Gequietsche der Achsen fährt Theo durch Mark und Bein. Die breiten Räder haben große Mühe dem lehmartigen Schlamm zu entkommen, in den sie während der Rast noch tiefer eingesunken waren.
Was soll Theo mit dem schutzbedürftigen Kätzchen machen, wie soll sie sich entscheiden? Kurzentschlossen legt sie das kleine weißgraue Wollknäuel in ihre leicht geöffnete Jacke und humpelt angestrengt dem Karren hinterher, der sich ächzend aus der lehmigen Pampe befreien konnte. Einige Lehmbrocken hindern den Karren allerdings daran, zügig vorwärts zu kommen.
Theo ist glücklich, wieder neben der Großmutter zu sitzen. Das süße Kätzchen bleibt ganz still auf ihrem Schoß liegen, während Theo es hinter den Ohren krault. Vielleicht hat es unter den Trümmern des Dorfes jemanden verloren, der sich bislang um das süße Wollknäuel gekümmert hatte, befürchtet Theo.
Der holprige Weg führt die Reisenden bergan und bergab, mehr durch bewaldete Gebiete. Die Bäume stehen immer dichter, und die Wälder zu beiden Seiten des Weges kommen Theo düster und geheimnisvoll vor.
Sämtliche Gestalten, die ihnen auf dem Weg nach Irgendwo begegnen, starren sie aus ungnädigen schwarzen Augen an, als wollten sie sagen: Verschwinde von hier, du gehörst nicht zu uns. Hüte dich, hier bleiben zu wollen! Trotzig starrt sie in die Borkengesichter, als stünde ihre Antwort gut lesbar auf der Stirn: Ich will nur nach Hause, also lasst mich einfach ziehen. Der Anblick dieser ausdruckslosen Gesichter lässt Theo über diese Menschen nachgrübeln. Sind es die harten Lebensbedingungen, die ihre Spuren in die Haut gegraben haben oder nur der ungeschminkte Ausdruck ihrer Denk- und Lebensweise? Theo schaut bei diesen Überlegungen auf ihre neue Freundin, die zusammengerollt auf ihren Beinen liegt.
»Ich werde dich Susa nennen«, fällt Theo spontan ein und flüstert dem Kätzchen fragend ins spitze Ohr, »gefällt dir der Name?« Aber Susa lässt lediglich ein wohliges Schnurren vernehmen, während Theo sie weiter sanft am Hals streichelt.
»Nun, das werte ich mal als Zustimmung...«
Nach weiteren drei Stunden der mühsamen Reise, erreichen sie eine weite Ebene, die den Blick auf eine mächtige und düstere Stadt freigibt. Der mittelalterlich wirkende Ort ist umgeben von einer hohen Mauer, bestehend aus unzähligen, quaderförmigen Felsbrocken, deren oberer Rand von brusthohen Zinnen gekrönt ist, wie eine Festung. An strategisch wichtigen Stellen sind Wachen postiert, die von einer erhöhten Position nach verdächtigen Vorkommnissen Ausschau halten. Schwere, unbehauene Findlinge bilden das Fundament des wehrhaften Schutzwalls, die der Mauer den Anschein ewiger Standhaftigkeit und Unverwundbarkeit verleihen.
Schwere Wolken künden von ausdauerndem Regen, der in wenigen Stunden auf die Stadt niederprasseln wird. Auf tieferliegende Hügel, die sich hinter der Stadt befinden, fällt bereits ein grauer Vorhang, der die Sicht auf die höher gelegenen Ebenen versperrt. Hin und wieder ist ein dumpfes Grollen zu vernehmen, als hätten Riesen eine überdimensionale Bowlingkugel ins Rollen gebracht. Der Wind wird kälter und trägt den Reisenden den Geruch von Gebratenem und Gedünstetem entgegen, aber es liegt auch eine Spur von Verwesung in der Luft.
Theo lassen all diese Eindrücke verhältnismäßig kalt. Sie hat nur ein Ziel fest vor Augen, nämlich einen Ausweg zu finden, um dieser Stätte so schnell wie möglich den Rücken zu kehren. Zurück zu Paps, Elfi, Paula, Jenny, Frau Roll (gestern noch undenkbar) und all den anderen.
Die silbergrauen Dächer der alten Stadt reihen sich aneinander, als wäre ein riesiges Kettenhemd über die Häuser ausgebreitet worden. Theo lässt den Blick zum Stadttor wandern. Bewaffnete Wachen stehen davor und kreuzen ihre Speere. In diesem Moment ertönt der durchdringende Ton eines Signalhorns, dessen Signalgeber in einem ummauerten Vorbau der Stadtmauer steckt. Mit einer zackigen Bewegung ziehen die Wachen ihre Speere an ihre Stiefelschäfte, dann wird eine der beiden großen Flügeltüren von innen geöffnet. Das schwarzäugige Volk, das sich bereits in großen Mengen vor dem Stadttor eingefunden hatte, drängt jetzt mit großem Geschrei hindurch. Theo sieht mit Entsetzen, dass jeder danach trachtet als Erster hindurch zu gelangen, ohne Rücksicht auf Kranke, Kinder, Alte und Gebrechliche zu nehmen. Wer fällt oder eingequetscht wird, hat kaum Chancen ohne Blessuren durch das Tor zu gelangen.
Fast fröhlich verabschiedet sich Theo von der unsympathischen Mitfahrgelegenheit, auch wenn die Familie kein Wort ihrer Sprache versteht, am Ende der Reise ist Theo das ziemlich egal:
»Danke fürs Mitnehmen! Auf ein Wiedersehen lege ich aber keinen besonderen Wert, müsst ihr wissen.«
Aber niemand, außer dem aufgeweckten Jungen, würdigt sie auch nur eines Blickes. Freimütig lächelt Theo den Burschen an, dennoch ist er nicht fähig, ihr Lächeln zu erwidern. Er schaut sie unschlüssig an, als erahne er eine ihm bislang unbekannte Dimension des Menschseins – die Nächstenliebe.
Sie löst sich von seinem Blick, nimmt Susa hoch und öffnet wieder den Reißverschluss ihrer Jacke. Hier, in der warmen Winterjacke bekommt Susa vorübergehend ein neues Zuhause, damit sie im Gedränge nicht verloren geht.
Theo hält sich nun sehr weit am äußeren Rand der Menschenmenge und es gelingt ihr, in das Innere der Stadt zu kommen, ohne blaue Flecken davonzutragen. Mit jedem Schritt stellt sie erleichtert fest, dass wenigstens die stechenden Schmerzen in der Wirbelsäule langsam nachlassen, wenngleich sich der Zeh heftig gegen diesen Marsch zu wehren scheint.
Von den laut schimpfenden und drängelnden Massen lässt sie sich ins Zentrum ziehen. Auffällig vielen Menschen fehlen einzelne Gliedmaßen oder Sinnesorgane. Dem Einen fehlt die Hand, dem Anderen ein oder zwei Finger oder gar ein Bein. Manche tragen Ohren- oder Augenklappen, wie in einem schlechten Piratenfilm.
Vielleicht sind das Mitbringsel aus einem oder mehreren Kriegen, mutmaßt Theo.
Die Menge strömt weiter einem Ziel zu, dem Marktplatz. Immer mehr Baldachine und Stände stehen bereits auf den breiten Zugangsstraßen, doch die Vielfalt der Gerüche und Geräusche lässt vermuten, dass der Marktplatz nicht mehr weit entfernt sein kann. Theo humpelt orientierungslos die Straße entlang und zwängt sich durch Gemüsekisten und Hühnerkäfige, die planlos auf dem Pflaster abgestellt worden waren. Die vielen Marktstände bieten Waren zum Kauf an, die fast ausnahmslos die Bedürfnisse des täglichen Bedarfs stillen sollen: Fleisch, Fisch, Käse, Milch, Obst, Gemüse, lebendes und totes Vieh, jede Menge Alkohol, grau und braun gewebte Stoffe und Filz, aber auch Werkzeug und Waffen. Sie entdeckt keinerlei Schmuck, kein Kunsthandwerk oder gar Handel mit feinen Tüchern oder Färbemitteln, die das Leben etwas bunter gestalten könnten. Die Stadt ist trist und farblos, ohne Blumenschmuck oder verzierendem Schnitzwerk an den Häusern. Einige Mauersimse und Dachstürze weisen erhebliche Schäden auf. Ganz offensichtlich haben Wind und Wetter schon zu lange an manchem Mauerwerk genagt. Aus eingestürzten Gauben, Erkern und dunklen Fensterhöhlen wachsen dünne Äste hervor, die sich verzweifelt nach der trüben Sonne recken.
An Toreingängen und Häuserecken lungern düstere Gestalten herum, denen Theo lieber nicht zu nahe kommen möchte. Mit versteinerten Mienen zwängen sich die Menschen durch das schlichte Warenangebot. Der Duft von Maronen, Met, Apfelwein, gebratenem Fleisch, aber auch der Gestank von Schlachtabfällen und faulen Eiern zieht quer über den gesamten Marktplatz, den Theo nun endlich erreicht hat. Sie hört das Klappern von Hufen, das Schnauben und Wiehern von Pferden, das Grunzen von Schweinen, das Meckern und Gackern von Ziegen und Hühnern, das klangliche und duftende Spektrum eines Bauernhofs auf einem Platz versammelt. Sie sieht das emsige Treiben der vielen Menschen, das Theo an einen riesigen Ameisenhaufen erinnert.
Plötzlich erhebt sich in Theos unmittelbarer Nähe Geschrei und das Geräusch von berstendem Holz. Rücksichtslos galoppiert eine Horde betrunkener Männer auf Pferden durch die Stadt, ohne sich um die Verwüstungen zu kümmern, welche die stampfenden Hufe der Reittiere anrichten. Die Menschen sprengen auseinander und flüchten in die nahegelegenen Gassen.
Eine Wolke aufgescheuchter Tauben erfüllt für kurze Zeit den Himmel. Der linke, vordere Teil des Marktplatzes verwandelt sich in wenigen Sekunden in ein Trümmerfeld. Dann herrscht wieder Ruhe, die murrenden Marktleute richten ihre Stände wieder her.
Nach und nach kehrt das Leben auch in diesen Teil des Marktes zurück.
Als Theo weitergeht, macht sie eine grausige Entdeckung: Am Baldachin eines kleinen Standes baumeln bunte Fellchen. Sie erkennt sofort, dass es sich dabei um Kater- und Katzenfelle handelt. Eine Gänsehaut kriecht ihr den Rücken bis zu den Nackenhaaren hinauf, als sie sieht, dass rechts daneben das gedörrte Fleisch der Tiere ebenfalls zum Kauf angeboten wird. Theo hält den Reißverschluss ihrer Jacke ganz fest zu, wendet sich scharf nach links und sucht verstört das Weite.
Sie bahnt sich ihren Weg durch das Gedränge und hält verzweifelt Ausschau nach einem Rathaus oder einem anderen Gebäude, das dem eines öffentlichen Amtes oder eines Polizeigebäudes auch nur im Entferntesten ähnelt. Ganz sicher würde sie dort jemanden finden, der ihre Sprache spricht, oder sonst wie weiterhelfen kann. Ein milchgesichtiger Mann hält Theo unvermittelt einen übelriechenden Trank unter die Nase, den sie angewidert beiseite schiebt. Sie verlässt den Marktplatz und hastet humpelnd die Gassen weiter, so schnell es eben geht. Mehr und mehr bekommt ihre Wanderung durch das Getümmel den Charakter einer albtraumhaften Odyssee, ohne zu wissen wo sie enden wird.
Vor Theos Augen beginnt sich alles zu drehen. Ein dicker Mann mit Schweinsohren tritt ihr auf den verletzten Zeh.
»Autsch, auaaa...!«, schreit Theo, während der rücksichtslose Mann sogleich von der Menge verschluckt wird, er bekommt von ihrem Klagegeschrei nicht einmal etwas mit. Tränen schießen ihr über die Wangen.
Sie weiß langsam nicht mehr, was sie machen soll und spürt instinktiv, dass hier keine Hilfe zu erwarten ist. Theo kann die Blicke der Schwarzaugen nicht mehr ertragen. Es scheint, als habe sich die Welt der Baumrindengesichter gegen sie verschworen, so feindselig wird sie begafft.
Auf einmal spürt Theo eine ungewöhnliche Wärme, die allmählich ihren Fuß umschließt. Der vordere Teil des Verbandstoffes färbt sich dunkelrot.
»Oh, nein … das bitte nicht auch noch! Was mache ich jetzt?«, krächzt sie in ihrer Verzweiflung und zieht damit die Aufmerksamkeit einer Frau auf sich, deren Aussehen Theo auf den ersten Blick sogar sympathisch erscheint. Ihr rotes Haar flattert über die schmalen Schultern wie züngelndes Feuer. Dieser Anblick erinnert Theo an ihre Vertrauenslehrerin Paula. Theo zeigt verzweifelt auf ihren Fuß und erklärt:
»Bitte helfen Sie mir! Gibt es hier einen Arzt, oder ein Krankenhaus? Ich brauche einen Doktor, Doktor! Verstehen Sie?« Die Frau nickt mit versteinertem Gesicht und zieht Theo am langen Arm in eine Seitengasse, dann links weiter durch eine andere Marktstraße. An einem heruntergekommenen Haus, mit graugrünen Flecken auf Wänden und Tür, baumelt ein Schild, dessen Aufschrift in fremden Schriftzeichen Theo überhaupt nichts sagt. Die Frau klopft energisch mit der ganzen Faust gegen die Tür, die sich unmittelbar darauf öffnet.
Ein kleiner, untersetzter Mann, mit spärlichem und ungepflegtem Haarwuchs, fingerlosen Handschuhen und abgewetztem Mantel schaut zunächst fragend zur Frau und dann hinüber zu Theo.
»Labrelko urbatik?«, zischt er angewidert, worauf die Frau ihn bösartig ankeift:
»Krawkisch, diu monerk«, anschließend weist sie mit ihrem verknöcherten Finger auf Theos roten Fußverband, um dann umgehend in der Menge zu verschwinden, ohne sich nochmals umzusehen.
Theo kann gerade noch: »Dankeschön!« hinterherrufen, als der Mann sie ins Haus winkt und in einen Raum führt, der sich gleich hinter der ersten dunklen Tür auf der linken Seite des Flures befindet. Der Alte weist ihr einen Stuhl zu, auf den sie sich sogleich vor Erschöpfung fallen lässt. Neugierig schaut sie sich um. Das Zimmer ist eingerichtet wie der Behandlungsraum eines Tierarztes im 18. Jahrhundert, schätzt Theo – spärlich und schmucklos.
Schwere Schneidewerkzeuge an den Wänden, unterm Fenster steht ein Holzkübel mit Wasser, ein schwarzes Tuch liegt ausgebreitet auf dem Stuhl, auf dem sie sitzt und ein fleckiger, massiver Holztisch mit einer kopfgroßen Einkerbung an der zur Tür gewandten Seite, steht in der Mitte des Raumes. Theo fühlt sich bei diesem Anblick an eine Schlachtbank erinnert.
Das Fenster zur Marktstraße steht weit offen. Theo kann im Sitzen nur die Köpfe der Menschen hin- und herwandern sehen. Der Anblick erinnert sie an ein skurriles Puppentheater mit echten Köpfen, aber ohne Körper.
Mittlerweile glaubt Theo ernsthaft, dass sie schlecht träumt und kneift sich in den Arm – leider schmerzt es … dies ist kein Traum, sondern brutale Wirklichkeit!
Die traurige Realität verwandelt sich in blanke Furcht, als Theo beobachtet, wie der ›Doktor‹ zielstrebig ein bestimmtes Sägemesser von der Wand nimmt und sich emotionslos ihrem verletzten Fuß nähert. Theos Blut stockt in den Adern, erschreckt zieht sie den Fuß zurück. Sie muss an die Menschen mit den fehlenden Gliedmaßen denken. Vor Angst spannt sich ihr Körper und entsetzt weiten sich ihre Augen, bevor sie losschreit:
»Behandeln Sie so etwa Verletzte? Wollen Sie mir gleich den ganzen Fuß absägen oder was?« Sie beginnt bitterlich zu weinen.
Der ›Doktor‹ bleibt irritiert stehen, stammelt mit dumpfer Stimme irgendwelche Silben mit zu vielen Konsonanten, dann versucht er Theos Bein gewaltsam zu packen. Das Entsetzen, das ihr den Atem raubt, durchbricht die Stimmbänder und äußert sich in einem fürchterlichen Schrei. In ihrer Verzweiflung schreit sie nach Paps, der sie nicht hören kann:
»Papa, hilf mir, hilf mir doch!« Theo stößt den Knochensäger mit ihrem gesunden Bein gegen das geöffnete Fenster, durch das in diesem Augenblick ein weißhaariger Mann von der Straße in den Raum blickt.
Der Fremde spricht zum ›Doktor‹ ein paar ermahnende Worte, die Theo nur dem strengen Klang nach als solche identifizieren kann. Der ›Medizinmann‹ lässt endlich sein Sägemesser sinken, während Theos Augen vom Anblick des weißbärtigen Mannes geradezu magisch angezogen werden. Durch den Schleier ihrer Tränen schaut sie ihm in die blauen Augen.
Sie trifft fast der Schlag …