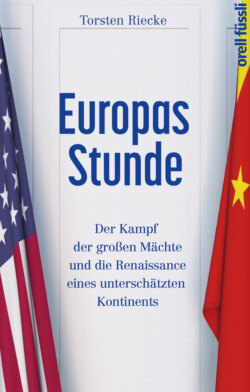Читать книгу Europas Stunde - Torsten Riecke - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der andere Kalte Krieg
ОглавлениеFür Kai-Fu Lee ist der neue »Rüstungswettlauf« bereits entschieden. Der 57-jährige Chinese gibt Europa keine Chance mehr. Und das macht er mit einer Selbstverständlichkeit, die kaum Zweifel am Urteil des Technologie-Gurus zulässt. Die Europäer, so Lees Kassandra-Ruf, könnten im globalen Wettrennen um die Zukunftstechnologien am Ende sogar »leer ausgehen«. Es ist Ende Januar 2019 und die Mächtigen und Möchtegern-Mächtigen der Welt gönnen sich beim »World Economic Forum« (WEF) im tiefverschneiten Davos ihre alljährliche Denkpause. Grund dafür gibt es mehr als genug: Handelskriege, Bürgerkriege, Währungskriege und jetzt auch noch ein »Tech War«. Die Welt ist ziemlich in Unordnung geraten. Und der technologische Wandel spielt dabei eine zentrale, womöglich sogar die entscheidende Rolle. Lee gehört auf dem Davoser Jahrmarkt der Eitelkeiten zu den gefragtesten Hellsehern der Welt von Morgen. Dass ausgerechnet er ein vernichtendes Urteil über Europa fällt, hat durchaus symbolische Bedeutung: Lee ist in Taiwan geboren, hat für die US-Giganten Apple, Microsoft und Google Pionierarbeit bei der Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) im Silicon Valley geleistet und sucht heute mit seinem Risikokapitalfonds »Sinovation Ventures« in China nach »the next big thing« – also nach der nächsten bahnbrechenden Erfindung. In Person und Biografie verkörpert der Chinese mit dem amerikanischen Pass damit die beiden Machtzentren der Tech-Welt: China und die USA. Im Titel seines 2018 erschienenen Bestsellers »AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order« kommt Europa schon gar nicht mehr vor.
Für europäische Ängste vor einem »Big Brother«, sei es im Gewand von Facebook oder der Kommunistischen Partei (KP) Chinas, hat Lee wenig Verständnis. »Die Debatte über mögliche Gefahren Künstlicher Intelligenz hat paranoide Züge angenommen«, moniert er in Davos in kleiner Runde und meint damit vor allem europäische Bedenkenträger. In seinem dunkelgrauen Anzug und seiner weinroten Krawatte ähnelt Lee eher einem Investmentbanker denn einem Computer-Nerd. Kühl und ohne Mitleid fällt er sein Urteil über Europas technologische Schwäche. Dass einer der renommiertesten Technologie-Experten der Welt mit weltweit über 50 Millionen Fans in den sozialen Netzwerken ausgerechnet jenen Kontinent abschreibt, dem die Welt die Aufklärung und moderne Wissenschaft verdankt, ist zwar noch kein Todesurteil, aber eine letzte Warnung für Europa ist es schon. »Wir kämpfen um unsere Souveränität. Wenn wir nicht in allen Gebieten, den digitalen wie der Künstlichen Intelligenz, unsere eigenen Champions aufbauen, dann werden unsere Entscheidungen von anderen diktiert«, redet wenig später der französische Präsident Emmanuel Macron den »Movern & Shakern« aus Europa ins Gewissen.
Die Warnung kommt zur rechten Zeit. Wandelt sich unsere Welt doch gerade dramatisch. Der Aufstieg Chinas hat zu einer nachhaltigen Machtverschiebung von West nach Ost geführt und damit einen Machtkampf auf globaler Ebene ausgelöst. Das aufstrebende Reich der Mitte mit seinen 1,4 Milliarden Einwohnern ist, gemessen an internationalen Kaufkraftparitäten, bereits heute die größte Volkswirtschaft der Welt und hat damit die USA überholt. Ein Drittel des globalen Wachstums kommt heute aus China – das ist mehr als die USA, Europa und Japan zusammen erarbeiten. Deutschland verkauft, gemessen an der eigenen Wirtschaftsleistung, heute fast so viel Waren nach China wie in die USA. Für Südkorea, Australien und Japan ist China bereits jetzt der wichtigste Exportmarkt. Unter den zehn wertvollsten Technologieunternehmen der Welt befinden sich immer noch sechs amerikanische, aber bereits zwei chinesische Konzerne. Weit abgeschlagen auf Platz zwölf folgt mit dem deutschen Softwareanbieter SAP das erste europäische Unternehmen. Der chinesische Telekomausrüster Huawei ist zum Weltmarktführer aufgestiegen und spielt für den Aufbau des neuen, für Wohlstand und technologischen Fortschritt so wichtigen Mobilfunkstandards 5G eine ebenso zentrale wie umstrittene Rolle. Smart Cities, autonomes Fahren, Smart Grids – all das geht nicht ohne 5G. Huaweis Konkurrenten Ericsson aus Schweden und Nokia aus Finnland sind immerhin noch im Rennen, doch die Nordamerikaner haben nach dem Untergang ihrer Telekomausrüster, Nortel aus Kanada und Lucent aus den USA, ihre Kompetenz in dieser Schlüsseltechnologie weitgehend verloren.
Machtwechsel zwischen Großmächten verlaufen nie friedlich. Auch diesmal nicht. Mit einer Mischung aus Protektionismus und Nationalismus stemmen sich die USA unter ihrem Präsidenten Donald Trump gegen den immer stärker spürbaren Machtverfall. Es ist durchaus noch nicht ausgemacht, dass die Pax Americana, die seit dem Zweiten Weltkrieg den Lauf der Welt bestimmt hat, im 21. Jahrhundert durch eine Pax Sinica abgelöst wird. Die USA sind nach wie vor die größte Militärmacht der Welt und in vielen Technologien immer noch führend. Amerika und China ringen weltweit um die modernen Insignien der Macht: um wirtschaftliche Stärke, militärische Überlegenheit, politischen Einfluss, vor allem aber um technologische Dominanz. Denn sie ist der Schlüssel zu wirtschaftlichem Wohlstand und militärischer Überlegenheit in einer digitalisierten Welt. Der Titel von Lees Buch macht deutlich, dass es dabei um mehr geht, als um die Kinder und Enkel von Alexa und Siri, den intelligenten Sprachassistenten von Amazon und Google. Um viel mehr. Es geht um eine neue Weltordnung, also um die Frage, wer künftig die Welt beherrscht und ihre Standards, Werte und Regeln bestimmt. Dass Lee dabei China und die großen amerikanischen Technologie-Konzerne aus dem Silicon Valley als die eigentlichen Kontrahenten sieht, ist durchaus kein Zufall. »Entweder China oder wir«, stellte Facebook-Chef Mark Zuckerberg amerikanische Kongressabgeordnete bei einer Anhörung im Herbst 2019 vor die Wahl, wem sie in Zukunft vertrauen wollten. Und der Politikberater Ian Bremmer von der »Eurasia Group« in New York ergänzt: »Der Kalte Krieg mit China wird sehr wenig mit militärischer Macht zu tun haben. Es geht um wirtschaftliche Stärke und technologische Überlegenheit. Und um die Stärke und Effektivität zweier radikal unterschiedlicher politischer Systeme.«
Was für die Großmächte früher ihre Nuklearwaffen waren, sind heute Zukunftstechnologien wie der neue Mobilfunkstandard 5G, die Daten-Cloud, Künstliche Intelligenz oder das Quanten-Computing. »Wer die Künstliche Intelligenz beherrscht, regiert die Welt.« Nicht zufällig hat ausgerechnet Wladimir Putin diese neue Formel der Macht im 21. Jahrhundert formuliert. Der russische Präsident gilt als der Staatschef mit den größten Machtinstinkten, sein Land hat allerdings nur Außenseiterchancen, im Wettrennen der großen Mächte ganz vorne mitzumischen. Wirtschaftliche Stärke, vor allem aber technologische Überlegenheit sind heute Voraussetzungen für nationale Sicherheit. Früher galt »Wandel durch Handel« als Friedensformel, heute ist der Handel eine wichtige »Waffe« im Ringen mächtiger Nationalstaaten um globale Dominanz. Aus der liberalen, regelbasierten, vom Westen geprägten Nachkriegsordnung ist eine »Arena« geworden, in der jeder gegen jeden um den eigenen Vorteil ringt, und dabei gilt nur ein Recht: das des Stärkeren. »Ich zuerst«, ruft der neue Zeitgeist. Europa hat darauf noch keine Antwort gefunden. Zwar hat sich die neue EU-Kommission unter der deutschen CDU-Politikerin Ursula von der Leyen selbst das Prädikat »geopolitische Kommission« gegeben und die Europäer aufgefordert, die »Sprache der Macht zu lernen«. Darin steckt zwar der richtige Wunsch, dass Europa sich im Powerplay der Großmächte behaupten muss. Wie die Europäische Union (EU), die in wesentlichen Fragen oft uneins und vom Populismus innerlich und dem Brexit Großbritanniens äußerlich geschwächt ist, ihre wirtschaftliche und politische Macht wirksam einsetzen will, darauf gibt es weder in Brüssel noch in den europäischen Hauptstädten bislang eine Antwort.
Was von der Leyen anmahnt, dürfte vielen Europäern und insbesondere vielen Deutschen gegen den Strich gehen. Für sie ist die EU ein Gegenentwurf zur Machtpolitik des frühen 20. Jahrhunderts, die den Kontinent verwüstet hat. Das Friedensprojekt Europa ist von der Rückkehr nationalistischer Machtpolitik denn auch überrascht worden. Mehr als dreißig Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer und des Eisernen Vorhang zwischen Ost und West ist die Geschichte mit voller Wucht zurückgekehrt. Ob im Mittleren Osten, Afghanistan oder im Südchinesischen Meer. Ob auf der koreanischen Halbinsel, in Hongkong oder der Ukraine: So viele Krisen wie heute gab es zuletzt vor hundert Jahren. Kapitalismus und Marktwirtschaft gelten seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr als natürliche Sieger der Geschichte, die Verlierer der Globalisierung gehen auf die Barrikaden und erhoffen sich die Rettung ihrer Jobs und ihrer abendländischen Leitkultur von populistischen »Scheinriesen« und Scharlatanen wie Donald Trump, Viktor Orbán und Boris Johnson. Der Klimaschutz wird zum Kultur- und Überlebenskampf, Millionen Menschen fliehen vor Klimakatastrophen und Bürgerkrieg, der technologische Wandel verschlingt mit immer intelligenterer Software die alte, vertraute Welt und mit ihr die Geschäftsmodelle, Betriebe und Jobs des industriellen Zeitalters. Ein Beispiel: 1955 war der US-Autokonzern General Motors (GM) das größte und wertvollste US-Unternehmen und beschäftigte damals rund 577000 Mitarbeiter. Im Oktober 2019 übernahm Apple die Krone der Wirtschaft, der Tech-Gigant beschäftigt aber »nur« 137000 Menschen. »Software is eating the world«, hat Marc Andreessen, Mitbegründer des ersten Internet-Browsers »Netscape«, schon 2011 gewarnt. Europa scheint dabei das Hauptgericht zu sein. Findet sich doch unter den zehn wertvollsten Unternehmen der Welt kein einziges mehr vom europäischen Kontinent.
Dabei sollte nach dem Ende des Kalten Krieges 1989 doch eigentlich alles ganz anders kommen. Stellvertretend für den damaligen Zeitgeist feierte der amerikanische Politologe Francis Fukuyama mit seinem weltberühmten Buch »The End of History and the Last Man« den Sieg der westlichen Demokratien über ihre ideologischen Gegner. 30 Jahre und viele Rückschläge später musste Fukuyama zum Jubiläum des Berliner Mauerfalls im November 2019 einräumen, dass der Westen sowohl von innen wie von außen bedroht ist und sich die Welt keineswegs auf einem unwiderruflichen Weg zu Demokratie und Marktwirtschaft befindet. Schuld daran ist seiner Meinung nach auch der technologische Wandel. Ist der technische Fortschritt doch nicht immer ein Schritt in die richtige Richtung. »Die neuen Technologien haben zwei Gesichter: Sie erhöhen unsere Freiheit, sie sind aber auch ein Werkzeug der Unterdrückung«, warnt Fukuyama bei seinem Besuch in Berlin und denkt dabei vor allem an die immer größer werdende Macht intelligenter Maschinen. Eurasia-Chef Ian Bremmer geht sogar noch einen Schritt weiter: »Die neuen digitalen Technologien begünstigen autokratische Regime«, warnt er mit Blick auf den Überwachungsstaat China, der schon jetzt digitale Gesichtserkennung zur politischen und sozialen Kontrolle einsetzt.
»Der Krieg um die Künstliche Intelligenz hat gerade erst begonnen«, sagt der Wirtschaftshistoriker Niall Ferguson. Ich treffe den gebürtigen Schotten ebenfalls in Davos. Der an der »Hoover Institution« in Stanford lehrende Historiker ist so etwas wie der »Rockstar« seiner Zunft, seitdem er frühzeitig vor der weltweiten Finanzkrise 2008 gewarnt hatte. Vor allem aber ist der 55-Jährige ein Querdenker, der seinen historisch geschulten Blick nicht nur nach hinten in den Rückspiegel der Geschichte wirft, sondern auch nach vorne schaut. Ferguson war es auch, der 2006 zusammen mit dem deutschen Ökonomen Moritz Schularick den Begriff »Chimerica« prägte, um die symbiotischen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den USA und China zu beschreiben. Die USA importieren jedes Jahr Waren im Wert von mehr als 500 Milliarden Dollar aus China. Mit den Einnahmen daraus kauft China in großer Zahl amerikanische Staatsanleihen und besitzt heute Schuldscheine der USA im Volumen von deutlich mehr als einer Billion Dollar. »Heute ist Chimerica tot«, konstatiert Ferguson mit der Gewissheit eines Pathologen, »Trump hat den Handelskrieg mit China auf den Technologiesektor und den Währungsbereich ausgeweitet. Wir befinden uns in einem neuen Kalten Krieg.«
Tatsächlich gibt es einige Parallelen zum ersten Kalten Krieg zwischen dem Westen und der Sowjetunion in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wieder stehen sich zwei Großmächte mit konkurrierenden politischen und gesellschaftlichen Systemen gegenüber. Wiederum wird der Konflikt durch Stellvertreterkriege rund um den Globus ausgetragen. Wiederum spielen Schlüsseltechnologien darin die entscheidende Rolle. Und doch ist es ein anderer Kalter Krieg, den wir jetzt erleben. Es gibt bislang noch keine eindeutige Blockbildung zwischen dem von Amerika geführten Westen und einer von China dominierten Einflusssphäre. Dass es dazu noch nicht gekommen ist, liegt vor allem daran, dass die Welt wirtschaftlich viel zu stark miteinander verflochten ist, als dass man sie durch einen neuen Eisernen Vorhang so einfach spalten könnte. Unmöglich ist es aber nicht, und wir werden noch sehen, wie die USA unter ihrem Präsidenten an einer Abkoppelung von China arbeiten. »Wir könnten die gesamte Beziehung abbrechen und würden 500 Milliarden Dollar sparen«, drohte Trump Mitte Mai 2020 in seinem amerikanischen Lieblingssender Fox.
Seit der düsteren Prophezeiung von Kai-Fu Lee ist ein Jahr vergangen. Ein Jahr, in dem US-Präsident Donald Trump fast die gesamten chinesischen Exporte nach Amerika mit Strafzöllen von bis zu 25 Prozent überzog, chinesische Tech-Firmen wie Huawei geächtet und damit internationale Lieferketten großer Konzerne gekappt hat. Die Chinesen haben mit ihren begrenzten Mitteln zurückgeschlagen. Im Moment herrscht zwischen der alten und der neuen Supermacht ein brüchiger Waffenstillstand im globalen Handelskrieg. Der Anti-Globalist Trump hat die Globalisierung zur wichtigsten Waffe für seine »America First«-Politik verkehrt. Die beiden US-Wissenschaftler Henry Farrell und Abraham L. Newman nennen das »Weaponized Interdependence«. Die Erdkugel ist heute von einem engmaschigen Geflecht aus Güter-, Kapital- und Datenströmen überzogen, den eigentlichen Lebensadern der Weltwirtschaft. Apples iPhone wird von 300 Firmen aus fast 30 Ländern gebaut. Die Smartphones von Huawei liefen bis vor Kurzem mit dem Android-Betriebssystem von Google und den Chips der US-Anbieter Intel und Qualcomm. Das schafft gegenseitige Abhängigkeiten – und macht Unternehmen und ganze Nationen verwundbar. Mit Strafzöllen und Technologieembargos hat Trump viel Sand in das Getriebe der Globalisierung gestreut und damit die auf Kooperation und Freihandel aufgebaute Weltwirtschaftsordnung zu einer Arena der Konfrontation gemacht. Als der US-Präsident 2019 kurzzeitig ein Technologieembargo gegen den chinesischen Smartphone-Hersteller ZTE verhängte, stand die Firma kurz vor der Pleite. Huawei muss ein eigenes Betriebssystem für seine Smartphones entwickeln, seitdem Google auf Druck von Trump die Chinesen nicht mehr mit seiner Android-Software beliefern darf.
Die immer noch anhaltende »Schlacht um Huawei«, dem führenden Anbieter des neuen Mobilfunkstandards 5G, sei Beispiel für die kommende Spaltung der Welt in unterschiedliche Technosphären, prophezeit Ferguson. »Huawei ist zum Symbol des globalen kalten Technologie-Krieges geworden.« »Decoupling« heißt dafür das Schreckenswort, das die technologische Entkopplung der beiden größten Volkswirtschaften beschreibt. Die USA haben den chinesischen Telekomausrüster aus Angst vor Spionage und Cyberattacken aus ihrer Technosphäre verbannt und drängen auch ihre westlichen Verbündeten, die Verbindungen zu Huawei zu kappen. »Leider sehen die USA die 5G-Technik als eine strategische Waffe. Für sie ist es eine Art Atombombe«, klagte Huawei-Gründer Ren Zhengfei in einem Interview mit dem »Handelsblatt«. In Davos gibt er sich nach außen dennoch gelassen: »Wir sind für die nächste Attacke gerüstet«, versichert der 75-Jährige. Da wusste er noch nicht, dass die US-Regierung wenig später versuchen würde, Huawei auch von lebenswichtigen Chiplieferungen aus dem Ausland abzuschneiden. »Überleben ist für uns das Schlüsselwort«, gestand Huawei-Manager Guo Ping im Mai 2020 nach der neuerlichen Attacke aus den USA und bestätigte damit die düstere Prophezeiung von Yuval Noah Harari. Der israelische Historiker und Autor des Weltbestsellers »Eine kurze Geschichte der Menschheit« hatte in Davos ein weltweites technologisches Wettrüsten vorausgesagt. »Um ein Land zu erobern, braucht es heute keine Waffen mehr«, sagte Harari, Imperialismus und Kolonisierung fänden jetzt mithilfe von Daten statt.
Europa ist Frontstaat und Schlachtfeld zugleich im neuen Kalten Krieg. »Die Europäer werden von den beiden Supermächten Amerika und China in die Zange genommen und glauben immer noch, sie könnten ihre eigenen Wege gehen. Das ist jedoch reines Wunschdenken«, warnt Ferguson. Europa habe den großen Tech-Konzernen aus dem Silicon Valley und China nichts entgegenzusetzen. Apple sei heute mehr wert als alle deutschen Dax-Konzerne zusammen. »Europa muss sich zwischen den beiden Technosphären der Supermächte entscheiden«, sagt der Historiker. Eine Meinung, die zum Beispiel auch von Mathias Döpfner, Chef des Axel-Springer-Verlages geteilt wird. »Nach der (Corona-)Krise müssen wir uns festlegen: Wollen wir weiter an der Seite Amerikas stehen oder an der Seite Chinas? Beides geht nicht«, schreibt der ehemalige Journalist in einem Essay. Dass es zu einem wirtschaftlichen und technologischen Decoupling kommen wird, hält Ferguson für unausweichlich – trotz der immer noch engen ökonomischen Verflechtungen zwischen dem Westen und China. Ist das überhaupt möglich in einer so stark vernetzten Welt? Vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges glaubten auch viele Experten, dass ein militärischer Konflikt zwischen Deutschland und England wegen der engen wirtschaftlichen Bande beider Länder unvorstellbar sei. »Nach Kriegsbeginn haben Deutschland und England innerhalb von Tagen alle Bande gekappt«, erinnert der Historiker Ferguson. Wie ähnlich die Rivalität zwischen den USA und China heute dem Machtkampf zwischen dem Vereinigten Königreich und Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg ist, haben der Ökonom Markus Brunnermeier und der Wirtschaftshistoriker Harold James von der Princeton University zusammen mit dem China-Experten Rush Doshi vom »Brookings Institute« dokumentiert. »Die Rivalität zwischen China und den Vereinigten Staaten im 21. Jahrhundert hat eine unheimliche Ähnlichkeit mit der Rivalität zwischen Deutschland und Großbritannien im neunzehnten Jahrhundert«, schreiben die drei Wissenschaftler in ihrem Aufsatz aus dem Herbst 2018. Wie schnell auch heute noch Grenzen geschlossen, Lieferketten gekappt und Forderungen nach »strategischer Autonomie« laut werden, hat auch die Corona-Pandemie gezeigt. Die Folgen einer Spaltung der Weltwirtschaft wären insbesondere für Europa und Deutschland dramatisch. Noch mehr als die USA und China, die beide über riesige Binnenmärkte verfügen, wäre Deutschland als offenste Volkswirtschaft der Welt davon betroffen, wenn sich Globalisierung und Freihandel von Wohlfahrtsgaranten zu Achillesfersen verwandeln sollten. Zwar bietet der europäische Binnenmarkt mit seinen 450 Millionen Verbrauchern einen gewissen Schutz und fast 60 Prozent der deutschen Ex- und Importe gehen bzw. kommen aus den EU-Ländern. Schlüsselbranchen wie die deutsche Automobilindustrie sind jedoch stark von China und den USA abhängig. Etwa jedes dritte Auto von Volkswagen, BMW und Daimler wird von Chinesen gekauft. Allein BMW verkaufte 2019 doppelt so viele Fahrzeuge in China wie in den Vereinigten Staaten. Aber auch die USA bleiben für deutsche Firmen ein enorm wichtiger Absatzmarkt: 16 der 25 im Deutschen Aktienindex (DAX) zusammengefassten Konzerne machen in den USA höhere Umsätze als in Deutschland, hat das Handelsblatt ausgerechnet.
Kriege um Macht, Wohlstand und Territorien werden seit Menschengedenken geführt. Dass politische Macht und wirtschaftliche Stärke dabei Hand in Hand gehen, ist ebenso wenig neu wie der Einsatz wirtschaftlicher »Waffen«, um geopolitische Ziele zu erreichen. Schon in den Peloponnesischen Kriegen zwischen Athen und Sparta spielten Seeblockaden für Lebensmittel- und Nachschublieferungen eine wichtige Rolle. Der amerikanische Politologe Graham Allison von der »Kennedy School« an der Harvard University sieht die USA und China bereits in der Falle des Thukydides und befürchtet, dass die beiden Großmächte, ähnlich wie die griechischen Stadtstaaten Athen und Troja in ihrem vorchristlichen Duell, auf einen militärischen Konflikt zusteuern. Das nach dem Historiker Thukydides der griechischen Antike benannte Dilemma besagt, dass die Rivalität zwischen einer aufsteigenden und einer etablierten Macht meist zu einem militärischen Konflikt führt. In den vergangenen 500 Jahren habe es sechzehn Versuche einer aufstrebenden Nation gegeben, eine etablierte Großmacht zu verdrängen. »Zwölf davon endeten in einem Krieg«, schreibt Allison in seinem Buch »Destined For War«. Die Gefahr einer militärischen Eskalation zwischen den USA und China sieht auch Henry Kissinger: »Ich bin sehr besorgt. Die gegenseitigen Beziehungen haben sich in den vergangenen Monaten derart verschlechtert, dass auf beiden Seiten ein Feindbild entstanden ist«, warnte der Doyen der amerikanischen Außenpolitik und Strippenzieher für die historische Chinareise des früheren US-Präsidenten Richard Nixon im Januar 2020 im US-Magazin »The New Yorker«.
Die Wirtschaft ist dabei wie schon zu früheren Zeiten wieder zum Schlachtfeld der Großmächte geworden. Bereits im Siebenjährigen Krieg in Nordamerika rangen die beiden Kolonialmächte England und Frankreich um Handelswege und wirtschaftliche Vorherrschaft. Napoleon versuchte mit seiner Kontinentalsperre den Engländern die wirtschaftliche Luft abzuschnüren. Im Ersten Weltkrieg stürzte die englische Seeblockade Deutschland in die Hungerkatastrophe des »Steckrübenwinters«. In der Zwischenkriegszeit verschärften die USA mit ihren berüchtigten »Smoot-Hawley«-Schutzzöllen die Weltwirtschaftskrise 1930. Mit der Atlantikschlacht des Zweiten Weltkriegs versuchten England und Deutschland sich gegenseitig nicht nur militärisch, sondern auch wirtschaftlich niederzuringen. Die USA nutzten nach ihrem Kriegseintritt das gesamte Waffenarsenal des Wirtschaftskrieges: vom Ölembargo gegen Japan über Exportkontrollen und dem Einfrieren von Finanzmitteln bis hin zum Aufkauf strategischer Rohstoffe. Vollends zum Schlachtfeld wurde die Wirtschaft während des ersten Kalten Kriegs. Mit Exportverboten, die von strategisch wichtigen Rohstoffen wie Öl bis hin zu Computertechnologien reichten, versuchte der Westen das Sowjet-Imperium zum Einsturz zu bringen. Vor allem Kuba und Nordkorea bekamen die volle Härte wirtschaftlicher Sanktionen zu spüren. Umgekehrt gewährten die USA ihren Verbündeten in Westeuropa mithilfe des Marshall-Plans eine enorme wirtschaftliche und finanzielle Wiederaufbauhilfe – auch, um sie zu einem Bollwerk gegen den Kommunismus zu machen. Als George Marshall 1947 in seiner berühmten Rede vor Studenten der Harvard University warnte, ohne eine wirtschaftliche Gesundung Westeuropas könne es keinen dauerhaften Frieden geben, machte er damit zugleich die enge Verbindung von Wirtschafts- und Geopolitik deutlich. Marshalls Botschaft: Wirtschaftliche Instrumente sind ein formidables Mittel, um geopolitische Interessen durchzusetzen. Im Guten wie im Schlechten. Es gehört zur Ironie der Geschichte von Wirtschaftskriegen, dass die wirksamsten Sanktionen der USA nicht etwa gegen den ideologischen Feind in Moskau, sondern gegen die Verbündeten Großbritannien, Frankreich und Israel eingesetzt wurden. Während der Suez-Krise 1956 zwang US-Präsident Dwight Eisenhower die drei befreundeten Länder mit massiven Devisenverkäufen des britischen Pfunds und einem Ölembargo dazu, ihre Invasionspläne gegen Ägypten abzublasen und sich vom Suezkanal zurückzuziehen. Eisenhower war es auch, der schon 1953 die »Commission on Foreign Economic Policy« (auch bekannt unter dem Namen »Randall Commission«) ins Leben rief, um untersuchen zu lassen, wie Amerika seine wirtschaftlichen Stärken zum Beispiel im Handel besser für die außen- und sicherheitspolitischen Ziele des Landes einsetzen könnte.
Die weitaus wirkungsvollste geoökonomische Waffe des ersten Kalten Krieges war jedoch das sogenannte »Bretton Woods«-System. Amerikaner und Briten nutzten die Konferenz im Juli 1944 im »Mount Washington Hotel« in Bretton Woods (New Hampshire) dazu, mithilfe von neuen Institutionen wie dem »Internationalen Währungsfonds« (IWF) und der Weltbank eine regelbasierte, liberale Weltwirtschaftsordnung mit offenen Märkten und marktwirtschaftlichen Prinzipien durchzusetzen. Vornehmlich ging es den Siegermächten nach den Worten des amerikanischen Finanzministers Henry Morgenthau darum, »die ökonomischen Übel« zu beseitigen, die dem Zweiten Weltkrieg vorausgegangen waren. Das Kalkül der westlichen Siegermächte war es jedoch, durch eine liberale Weltwirtschaftsordnung die westliche Demokratie und Marktwirtschaft weltweit zu befördern und den Kommunismus als Systemkonkurrenten zurückzudrängen. Dies drückte sich später im sogenannten »Washington Konsens« aus, einem Zehn-Punkte-Programm, das jahrzehntelang die wirtschaftsliberale Politik des von den USA kontrollierten IWF und der Weltbank bestimmte. Freier Handel und globale Bündnisse, das waren die beiden wichtigsten Säulen, auf denen die USA nach dem Zweiten Weltkrieg ihre »Pax Americana« stützten. Trump hat beide Säulen mit seiner nationalistischen »America First«-Politik zerstört. Ein ungewollter Nebeneffekt der herrschenden Lehre des Laissezfaire-Liberalismus war freilich, dass der Einsatz der Wirtschaft für politische Zwecke zum Beispiel durch eine staatliche Industriepolitik oder Handelsbarrieren erheblich erschwert wurde. Das war so lange kein Problem, solange sich die meisten Länder an die Spielregeln einer globalen Marktwirtschaft hielten. Wehe aber, wenn einige Nationen aus nationalem Egoismus foul spielen oder gar das ganze Regelbuch der liberalen Weltordnung infrage stellen, wie es Trumps Amerika heute offen und China seit Langem heimlich macht. Zum Wirtschaftsnationalismus beider Länder gehört der gezielte Einsatz ökonomischer und vor allem technologischer Waffen. Sei es, dass die USA den Iran durch Wirtschaftssanktionen ökonomisch in die Knie zwingen. Sei es, dass China die Basketballspiele der »Houston Rockets« aus seinen Medien verbannt, weil deren Manager Daryl Morey es gewagt hatte, die Freiheitsbewegung in Hongkong auf Twitter zu unterstützen. Für die amerikanische »National Basketball Association« (NBA) stehen in China Milliardeneinnahmen aus Übertragungsrechten und Merchandising auf dem Spiel. Auch die Kritik Australiens am Krisenmanagement Chinas während der Corona-Pandemie beantwortete Peking mit Drohungen und knallharten Wirtschaftssanktionen.
Die wichtigste Munition im neuen Kalten Krieg sind neue Technologien. Der erste Kalte Krieg ist uns heute vor allem als Ära des Wettrüstens in Erinnerung. Bis an die Zähne mit Atombomben bewaffnet standen sich West und Ost zwischen 1945 und 1989 gegenüber. Die geopolitische Rivalität drückte sich vor allem darin aus, wer die schrecklichsten Vernichtungswaffen bauen konnte. Die Amerikaner glaubten, durch das »Manhattan Project« zum Bau der ersten Atombombe am Ende des Zweiten Weltkriegs einen technologischen Vorsprung zu haben. Das änderte sich mit dem Sputnik-Schock. Ein Schock war der Start des ersten künstlichen Erdsatelliten am 4. Oktober 1957 durch die Sowjets deshalb, weil der Westen bis dahin überzeugt war, dass die liberalen Demokratien quasi per Naturgesetz dem Kommunismus technologisch überlegen seien. »Sputnik« erschütterte diesen Glauben und war der Startschuss für ein technologisches Wettrennen ins All. Die Amerikaner konterten die Herausforderung Moskaus mit dem Projekt »Moonshot«, gründeten die NASA und starteten den Wettlauf zum Mond.
Technologische Überlegenheit ging auch schon in früheren Jahrhunderten mit Macht einher. China war bis zum späten Mittelalter auch dank seines Erfindungsreichtums die am weitesten fortgeschrittene Zivilisation. Die vier großen Erfindungen – das Papier, die Druckkunst, das Schwarzpulver und der magnetische Kompass – gehen auf das Konto des alten China. Viele weitere Innovationen machten das Reich der Mitte während der Song-Dynastie (960 bis 1279) zum Silicon Valley des Mittelalters.
Warum China nach 1500 seine globale Spitzenstellung an Europa verlor, darüber streiten sich die Historiker bis heute. Sicher ist, dass die Renaissance der Naturwissenschaften und der aufklärerische Glaube an die Vernunft des Menschen ganz wesentlich dazu beigetragen haben, dass Europa zum neuen Machtzentrum der Welt wurde. Die industrielle Revolution ebnete Europa und später Amerika auch wirtschaftlich den Weg zur globalen Dominanz. Heute ist es die digitale Revolution, die eine neue Zeitenwende einläutet. Die Innovationsfähigkeit eines Landes wird im digitalen Zeitalter zum entscheidenden Hebel für geopolitische, militärische und wirtschaftliche Macht. Der technologische Wandel ist zudem eine wesentliche Ursache dafür, dass sich die alte internationale Nachkriegsordnung auflöst und Populismus und Wirtschaftsnationalismus sich in vielen Ländern ausbreiten.
Die Welt ist eine Arena, in der rivalisierende Nationen um die Vorherrschaft ringen. So haben die früheren Trump-Berater Gary Cohn und H. R. McMaster das Hobbessche Weltbild des amerikanischen Präsidenten beschrieben und dessen »America First«-Politik gerechtfertigt. Chinas starker Mann Xi Jinping hatte schon 2015 seine Version einer »China First«-Politik vorgelegt: Xis Initiative »Made in China 2025« ist sein Masterplan, um die globale Technologieführerschaft zu erringen. Was wie ein unscheinbares Produktlabel aussieht, birgt den Anspruch, das Reich der Mitte wieder zum Mittelpunkt der Welt zu machen. So ist das von China verfolgte Jahrhundertprojekt einer »Neuen Seidenstraße« (»Belt and Road Initiative«, BRI) von Fernost nach Europa, Afrika und Lateinamerika weit mehr als nur die Wiederbelebung früherer Handelswege durch Straßen, Eisenbahnschienen, Schifffahrts- und Flugrouten. Versucht China doch gleichzeitig, seine Technologien und die autoritäre Kontrolle darüber auf einer digitalen Seidenstraße weltweit zu exportieren. Das afrikanische Land Tansania hat zum Beispiel das chinesische Überwachungsmodell übernommen und ähnlich die »Great Firewall« in China eine staatliche Kontrolle des Internets aus Gründen der nationalen Sicherheit angeordnet. Auch siebzehn osteuropäische Länder, Griechenland und sogar das EU-Gründungsmitglied Italien konnten die Chinesen in den Bann ihrer Großmachtträume ziehen. Und auch Trump, der den Handelskrieg anfänglich wegen billiger Industrieimporte aus China vom Zaun brach, hat inzwischen die geopolitische Bedeutung der neuen Technologien erkannt. In seiner »National Security Strategy« und »National Defense Strategy« wird China als »strategischer Rivale« und Pekings Hightech-Offensive als Gefahr für die nationale Sicherheit und Amerikas Führungsanspruch in der Welt gebrandmarkt. Nirgendwo wird die Machtformel für das 21. Jahrhundert deutlicher beschrieben als hier. »Wir befinden uns in einer Ära, in der die Großmächte im Wettbewerb stehen. Und China ist unser größter Herausforderer«, zitierte US-Verteidigungsminister Mark Esper auf der »Munich Security Conference« im Februar 2020 aus seinem Strategie-Kursbuch. Wirtschaftliche Entscheidungen seien im 21. Jahrhundert auch eine Frage der nationalen Sicherheit, betonte der Amerikaner mit Blick auf den transatlantischen Streit um Huawei. Umgekehrt sind wirtschaftliche Stärke und Innovationsführerschaft bei neuen Technologien für die USA die Voraussetzung dafür, dass sie ihre globale Vormachtstellung verteidigen können. Dass das Duell um die Zukunftstechnologien bislang vor allem mit Strafzöllen auf klassische Industrie- und Agrargüter der »Old Economy« ausgetragen wird, ist insofern eine Ironie des neuen Kalten Wirtschafts- und Techno-Krieges.
Es ist nicht nur der technologische Rückstand, der Europa zum machtlosen Zuschauer des globalen Ringens zwischen China und den USA degradiert. Europa fehle nicht die Macht, sondern der politische Wille, seine gemeinsame Stärke auch für seine Interessen einzusetzen, konstatiert EU-Außenbeauftragter Josep Borrell. Insbesondere Deutschland ist nach dem Zweiten Weltkrieg das strategische Denken abhandengekommen. Geopolitik und Strategie haben hierzulande stets den Ruch von Großmachtpolitik und wurden deshalb der Schutzmacht USA überlassen. Der Begriff Geoökonomie – also der strategische Einsatz wirtschaftlicher Instrumente zur Durchsetzungen geopolitischer Interessen – war in den politischen Zirkeln Berlins lange Zeit ein Fremdwort. Und auch die Erkenntnis, dass neue Technologien eine entscheidende Rolle für das Machtgefüge im 21. Jahrhundert spielen, sickert erst langsam ins Bewusstsein der deutschen Politik. Im Auswärtigen Amt befasst sich inzwischen immerhin eine kleine Projektgruppe mit der strategischen Frage, welchen Einfluss die Entwicklung Künstlicher Intelligenz auf die außenpolitischen Interessen Deutschlands haben bzw. wie man die neuen Technologien für eigene Ziele nutzen könnte. Europas Wirtschaftspolitiker versuchen nach dem »Huawei-Schock« dagegen mit einem Griff in die industriepolitische Mottenkiste, »National Champions« wie einen »digitalen Airbus« aus dem Boden zu stampfen, um so den technologischen Rückstand wettzumachen.
Dass der Einsatz wirtschaftlicher und technologischer Instrumente für geopolitische Ziele in Deutschland und Europa fast in Vergessenheit geraten konnte, ist nicht nur wegen der Bedeutung des Marshall-Plans für die europäische Nachkriegsordnung überraschend. Die Entwicklung der Europäischen Union – von der Montanunion bis zum Euro – ist im Grunde die weltweit größte geoökonomische Erfolgsgeschichte. Liegt der europäischen Einigung doch die Idee zugrunde, dass eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit der Europäer die beste Garantie für einen dauerhaften Frieden auf dem Kontinent ist. Dass die Wirtschaft ein »Friedensstifter« sein kann, zeigte sich auch in der Ostpolitik: Der Handel trug wesentlich zum politischen Wandel der Länder hinter dem Eisernen Vorhang bei. Damit verbunden ist auch ein alter, aber immer noch aktueller Gedanke der Abschreckung: Je enger verfeindete Länder wirtschaftlich miteinander vernetzt sind, desto kostspieliger ist es, diese Bande aus ideologischem oder machtpolitischem Kalkül zu kappen. Der amerikanische Politikwissenschaftler und ehemalige Diplomat Joseph Nye sieht in der gegenseitigen Abhängigkeit (»entanglement«) deshalb auch einen stabilisierenden Faktor für das geopolitische Gleichgewicht im 21. Jahrhundert.
Das wiedervereinigte Deutschland hat nach 1989 versucht, diese Lehre mit in die Zukunft zu nehmen und den Ausbau wirtschaftlicher Beziehungen zu autoritären Ländern wie Russland, China und dem Iran als Hebel zum Beispiel für die Verbesserung der Menschenrechte zu nutzen. Die Erfolgsbilanz ist bestenfalls als gemischt zu bezeichnen, was auch daran liegt, dass die kommerziellen Interessen der deutschen Wirtschaft oft die Oberhand über die politischen Ziele behielten. Die China-Politik und das Schweigen Berlins zur chinesischen Machtpolitik gegenüber der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong ist dafür das jüngste Beispiel. Anders war es, als der russische Präsident Wladimir Putin 2014 die Krim annektierte und seinen Zermürbungskrieg gegen die Ukraine begann. Erstmals seit langer Zeit setzte Europa gezielt Wirtschaftssanktionen ein, um der geopolitischen Aggression Moskaus Einhalt zu gebieten. Eine strategische Debatte darüber, wie Europa seine geoökonomische Stärke im globalen Machtkampf auch anderswo nutzen kann, ist daraus aber noch nicht entstanden. Eine nationale oder europäische Sicherheitsstrategie wie sie die USA regelmäßig entwerfen, gibt es nicht. Im Gegenteil: Die europäische Außen- und Sicherheitspolitik ist bis heute ein Papiertiger. Was auch daran liegt, dass Deutschland als wirtschaftlich mächtigste Nation Europas sich wegduckt. Sechs Jahre ist es her, dass der damalige Bundespräsident Joachim Gauck auf der Sicherheitskonferenz in München die Deutschen aufforderte, mehr Verantwortung in der Welt zu übernehmen. Seitdem rätselt die politische Elite in Berlin, wie sie deutsche Interessen stärker vertreten soll, ohne dabei in die Großmachtattitüde der dunklen Vergangenheit zurückzufallen oder die pazifistisch gestimmte Mehrheit in der Bevölkerung gegen sich aufzubringen. Wirtschaftlich ein Riese, politisch ein Zwerg – so hat der Rest der Welt die Bundesrepublik lange Zeit wahrgenommen. Und den Deutschen war dieses Selbstbildnis einer großen Schweiz ganz recht, konnte man doch die unangenehmen Pflichten der nationalen und europäischen Sicherheit weitgehend den Amerikanern, Franzosen und Briten überlassen – und seinen Geschäften nachgehen.
Seit sich der Kampf der Nationen um Macht und Einfluss im 21. Jahrhundert mehr und mehr auf das wirtschaftliche Schlachtfeld und in die globalen Technosphären verlagert, ist Wegducken jedoch keine Option mehr für Deutschland. Die eigene Sicherheit lässt sich nicht mehr outsourcen, seit Trump von Berlin eine massive Erhöhung der Verteidigungsausgaben fordert. Auch wirtschaftlich könnte Deutschland abgehängt werden, sollte es den technologischen Anschluss an die USA und China verlieren.
Noch aber ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt ein wirtschaftlicher Koloss und könnte ihre ökonomischen Muskeln viel stärker spielen lassen, um ihre geopolitischen Interessen durchzusetzen. Voraussetzung dafür wäre allerdings, dass man sich der eigenen Stärken überhaupt bewusst und gewillt ist, sie zusammen mit den europäischen Partnern gezielt einzusetzen. Europa hat seine wirtschaftliche Macht bislang vor allem beim Schutz des Wettbewerbs, in der Handelspolitik und neuerdings im Datenschutz aufblitzen lassen. Über den gemeinsamen europäischen Binnenmarkt mit rund 450 Millionen Verbrauchern können auch die USA und China nicht so einfach hinwegsehen. Europa hat dieses Faustpfand jedoch viel zu selten genutzt, um seine geopolitischen Ziele zu befördern. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat deshalb in Anlehnung an den »National Security Council« der USA einen »Europäischen Sicherheitsrat« vorgeschlagen. Der Vorschlag ist vage geblieben, vor allem, weil die Kanzlerin die Details eines solchen Gremiums bis heute nicht nachgeliefert hat. Dennoch geht Merkels Idee in die richtige Richtung. Ein europäischer Sicherheitsrat bräuchte eine europäische Sicherheitsstrategie und müsste, um diese umzusetzen, gerade auch auf ein geoökonomisches Droh- und Waffenrepertoire zurückgreifen können.
Zentraler Bestandteil einer europäischen Sicherheitsstrategie müsste die technologische Aufholjagd sein, um wieder Anschluss an Amerika und China zu finden. Die Ausgangslage ist jedoch alles andere als gut: Der digitale Binnenmarkt ist längst nicht vollendet, in der Grundlagenforschung herrscht egoistische Kleinstaaterei, von einer gemeinsamen europäischen Strategie für den Einsatz neuer Technologien wie der Künstlichen Intelligenz ist man meilenweit entfernt. Dabei zeigt doch gerade die europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), dass die Europäer auch die Tech-Giganten aus den USA und China bändigen können, wenn sie an einem Strang ziehen. Europa scheint sich noch gar nicht bewusst zu sein, dass es dank seines riesigen Binnenmarktes ein gewichtiges Wort darüber mitsprechen könnte, welche Regeln und Standards in der digitalen Welt gelten sollen.
Wir stehen heute am Beginn eines neuen Kalten Krieges globalen Ausmaßes, der Politik, Wirtschaft und Technologien gleichermaßen umfasst. Wiederum ist es ein Wettbewerb zwischen politischen Systemen: Auf der einen Seite die USA und die liberalen Demokratien des Westens, die nach dem Fall der Berliner Mauer lange das Ende der Geschichte feierten, bevor die Wahl Donald Trumps 2016 zum US-Präsidenten dann für Katerstimmung, Verunsicherung und Uneinigkeit sorgte. Und auf der anderen Seite China mit seiner leninistischen Marktwirtschaft, in der das wirtschaftliche Leben bis zu einem gewissen Grade den Gesetzen des Marktes folgt, das politische Leben aber den Befehlen der Kommunistischen Partei gehorcht. Dass Trump mit seiner nationalistischen »Amerika First«-Politik auch noch einen Keil in das westliche Bündnis getrieben hat, macht die Sache insbesondere für die Europäer nicht leichter. Sollte der Republikaner im November 2020 wiedergewählt werden, würde das den Druck auf Europa weiter erhöhen, sich gegenüber beiden Supermächten als eigene, dritte Kraft zu behaupten. Eine politische Annäherung an die Parteidiktatur in China wäre jedoch kein Zeichen europäischer Selbstbehauptung gegenüber einem wiedergewähltem Trump. Europa ist neben dem gemeinsamen Wirtschafts- und Währungsraum eben auch eine Gemeinschaft politisch Gleichgesinnter. Amerika bleibt deshalb Freund und Partner – auch unter Trump. Auf dieser alten Wertegemeinschaft des Westens kann sich Europa jedoch nicht mehr ausruhen. »Die Welt braucht den Westen«, hat der Transatlantiker Thomas Kleine-Brockhoff in einem klugen Buch geschrieben und einen »robusten Liberalismus« eingefordert. Wolfgang Ischinger, Chef der »Munich Security Conference« und ehemaliger Botschafter in den USA, bescheinigt der Welt hingegen eine zunehmende »Westlessness«, also einen Niedergang des Westens im Inneren wie Äußeren. Es ist nun an Europa, das Gegenteil zu beweisen und das politische Vakuum in der Weltpolitik mit Leben, Ideen und Macht zu füllen und damit die eigene Renaissance einzuleiten. »Für Europa ist die Stunde der Wahrheit gekommen«, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron auf der Sicherheitskonferenz in München. Es ist Europas Stunde – im Guten wie im Schlechten. Entweder gelingt es den Europäern, sich im Kampf der großen Mächte zu behaupten und seine Ideale zu verteidigen. Oder Europas letzte Stunde als prägende Macht der Welt hat geschlagen.