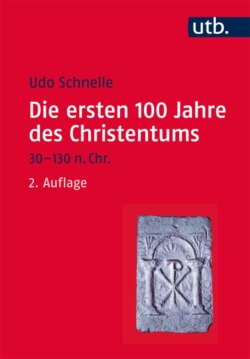Читать книгу Die ersten 100 Jahre des Christentums 30-130 n. Chr. - Udo Schnelle - Страница 6
Оглавление1. Vom Schreiben einer Ursprungsgeschichte
Jesus von Nazareth ist eine Gestalt der Geschichte und die Bewegung der Christen ein Zeugnis der Wirkungsgeschichte dieser Person. Wenn auf einer solchen Basis mit 2000 Jahren Abstand eine Geschichte des frühen Christentums geschrieben wird, zeigen sich unausweichlich die Grundprobleme historischen Fragens und Erkennens. Wie entsteht Geschichte? Was passiert, wenn in der Gegenwart ein Dokument der Vergangenheit mit einem Zukunftsanspruch interpretiert wird? Wie verhalten sich historische Nachrichten und ihre Einordnung in den gegenwärtigen Verstehenszusammenhang des Historikers/Exegeten zueinander?
1.1 Geschichte als Gegenwerts- und Vergangenheitsdeutung
Johann Gustav Droysen, Historik, hg. v. Peter Leyh, Stuttgart/Bad Cannstatt 1977 (= Nachdruck 1857/1882). – Jörn Rüsen, Historische Vernunft, Göttingen 1983. – Ders., Rekonstruktion der Vergangenheit, Göttingen 1986. – Ders., Lebendige Geschichte, Göttingen 1989. – Christoph Conrad/Martina Kessel (Hg.), Geschichte schreiben in der Postmoderne. Beiträge zur aktuellen Diskussion, Stuttgart 1994. – Hans-Jürgen Goertz, Umgang mit Geschichte, Reinbek 1995. – Chris Lorenz, Konstruktion der Vergangenheit. Eine Einführung in die Geschichtstheorie, Köln 1997. – Hans-Jürgen Goertz, Unsichere Geschichte, Stuttgart 2001.
Interesse und Erkenntnis
Vergangenheit gibt es immer nur im Modus der Gegenwart des Interpreten
Das klassische Ideal des Historismus, nur zu „zeigen, wie es eigentlich gewesen“1 ist, erwies sich in mehrfacher Hinsicht als ideologisches Postulat. Die Gegenwart verliert mit ihrem Übergang in die Vergangenheit unwiderruflich ihren Realitätscharakter. Schon deshalb ist es nicht möglich, das Vergangene ungebrochen gegenwärtig zu machen. Der Zeitabstand bedeutet Abständigkeit in jeder Hinsicht, er verwehrt historisches Erkennen im Sinne einer umfassenden Wiederherstellung dessen, was geschehen ist. Vielmehr kann man nur seine eigene Auffassung von der Vergangenheit in der Gegenwart kundtun. Vergangenheit begegnet uns ausschließlich im Modus der Gegenwart, hier wiederum in interpretierter und selektierter Form. Relevant aus der Vergangenheit ist nur das, was nicht mehr Vergangenheit ist, sondern in die gegenwärtige Weltgestaltung und Weltdeutung einfließt2. Die Sozialisation des Historikers/Exegeten, seine Traditionen, sein geographischer Lebensort, seine politischen und religiösen Werteinstellungen prägen notwendig das, was er in der Gegenwart über die Vergangenheit sagt3. Geschichtsschreibung ist deshalb nie ein pures Abbild des Gewesenen, weil sie selbst immer eine Geschichte hat, nämlich die Geschichte des Schreibenden. Das Subjekt steht nicht über der Geschichte, sondern ist ganz und gar in sie verwickelt. Deshalb ist ‚Objektivität‘ als Gegenbegriff zu ‚Subjektivität‘ völlig ungeeignet, um historisches Verstehen zu beschreiben4. Vielmehr sollte von ‚Angemessenheit‘ oder ‚Plausibilität‘ historischer Argumente gesprochen werden5. Nicht das wirklich vollzogene Geschehen ist uns zugänglich, sondern nur die je nach Standort der Interpreten verschiedenen Deutungen vergangener Ereignisse liegen vor uns. Erst durch unsere Zuschreibung werden die Dinge zu dem, was sie für uns sind. Geschichte wird nicht rekonstruiert, sie wird unausweichlich und notwendigerweise konstruiert. Es gilt: „es wird Geschichte, aber es ist nicht Geschichte“6. Geschichtsschreibung geht somit über ein bloßes Vergangenheitsverhältnis weit hinaus; sie ist eine Form von Sinndeutung und Sinnstiftung, ohne die individuelles und kollektives Leben gar nicht möglich wären.
Fakten und Fiktion
Fakten und Fiktion fließen stets ineinander
Geschichte erweist sich somit immer als ein selektives System, mit dem die Interpretierenden nicht einfach Vergangenes, sondern vor allem ihre eigene Welt ordnen und deuten7. Sprachliche Konstruktion von Geschichte vollzieht sich deshalb stets auch als ein sinnstiftender Vorgang, der sowohl dem Vergangenen als auch dem Gegenwärtigen Sinn verleihen soll. Historische Interpretation heißt, einen kohärenten Sinnzusammenhang zu schaffen; mit der Herstellung historischer Erzählzusammenhänge erlangen die Fakten den Status, der ihre Bedeutsamkeit für uns ausmacht. Dabei müssen historische Nachrichten in der Gegenwart erschlossen und zur Sprache gebracht werden, so dass sich in der Darstellung/Erzählung von Geschichte notwendigerweise ‚Fakten‘ und ‚Fiktion‘8, Vorgegebenes und schriftstellerisch-fiktive Arbeit miteinander verbinden. Indem historische Nachrichten kombiniert, historische Leerstellen ausgefüllt werden müssen, fließen Nachrichten aus der Vergangenheit und ihre Interpretation in der Gegenwart zu etwas Neuem zusammen9. Durch die Interpretation wird dem Geschehen eine neue Struktur eingezogen, die es zuvor nicht hatte. Fakten muss eine Bedeutung beigemessen werden und die Struktur dieses Interpretationsprozesses konstituiert das Verständnis der Fakten. Erst das fiktionale Element eröffnet einen Zugang zur Vergangenheit, ermöglicht die unumgängliche Neuschreibung der vorausgesetzten Ereignisse.
Das Vorgegebene
Konstruktion bezieht sich immer auf Vorgegebenes
Zugleich sind Aussagen immer eingebunden in vorgegebene allgemeine Wirklichkeits- und Zeitvorstellungen, ohne die Konstruktion und Kommunikation nicht möglich sind. Es gibt zweifellos eine Realität, die vor, neben und nach, vor allem aber unabhängig von unserer Wahrnehmung und Beschreibung existiert. Jeder Mensch ist zudem genetisch vor-konstruiert und ständig sozial-kulturell ko-konstruiert. Reflexion und Konstruktion sind immer nachfolgende Akte, die sich auf etwas Vorgegebenes beziehen, so dass jede Form von Selbstgewissheit nicht in sich selbst ruht, sondern jeweils den Bezug auf etwas Vorausliegendes benötigt, das es begründet und ermöglicht. Schon die Tatsache, dass die Frage nach Sinn möglich ist und Sinn gewonnen werden kann, verweist auf eine „unvordenkliche Wirklichkeit“10, die allem Sein vorausgeht und ihm den Wirklichkeitsstatus verleiht. Grundsätzlich gilt: Geschichte entsteht erst, nachdem das ihr zugrunde liegende Geschehen erfolgt ist und in den Status gegenwartsrelevanter Vergangenheit erhoben wurde, so dass notwendigerweise Geschichte nicht denselben Realitätsanspruch erheben kann wie die ihr zugrunde liegenden Ereignisse. Nicht die Welt und das Leben sind eine Konstruktion, wohl aber unsere Anschauungen über sie; für uns ist beides aber faktisch nicht auseinanderzuhalten.
1.2 Geschichte und Methode
Gerade das unausweichliche fiktional-kreative Element jeder Geschichtsschreibung erfordert eine umfassend Einbeziehung aller relevanten Quellen, eine Berücksichtigung der zentralen kulturellen Voraussetzungen und Kontexte und eine Kombination verschiedener Fragestellungen, um so das natürliche subjektive Element vor subjektivistischen Engführungen zu bewahren11.
Quellen
Quellenvielfalt
Die Hauptquelle sind natürlich alle Schriften des Neuen Testaments; insbesondere die Paulusbriefe, die Apostelgeschichte und die Evangelien. Zudem sind das griechische Alte Testament (Septuaginta/LXX) und die gesamte jüdische Literatur von ca. 200 v.Chr.-100 n.Chr. zu berücksichtigen, sofern sie für das frühe Christentum von Bedeutung sind (s.u. 3.3.1). Hinzu kommen die Schriften des jüdischen Historikers Flavius Josephus (ca. 37/38 n.Chr. – ca. 100 n.Chr.), dessen Hauptwerke ‚Bellum Judaicum‘ (= ‚Der jüdische Krieg‘; geschr. ~ 78/79 n.Chr.) und ‚Antiquitates Judaicae‘ (= Jüdische Altertümer‘; ~ 94 n.Chr.) für das Verständnis des antiken Judentums von größter Bedeutung sind. Aus dem griechisch-römischen Bereich sind vor allem die römischen Historiker Tacitus (ca. 60–120 n.Chr./Hauptwerke: Historiae = ‚Historien‘; ~ 105 n.Chr.; Annales = ‚Annalen‘; ~ 115 n.Chr.), Sueton (ca. 70–140/150 n.Chr./Hauptwerk: De vita Caesarum = Kaiser-Viten; ~ 120 n.Chr.) und Dio Cassius (ca. 160–235 n.Chr./Hauptwerk: = /Historia romana = ‚Römische Geschichte‘, ~ 230 n.Chr.) zu nennen12. Sie hatten Zugang zu zahlreichen (heute verlorenen) Quellen und überliefern auch wertvolle Informationen über das Verhältnis des römischen Staates zum Judentum und zum entstehenden frühen Christentum. Zu beachten sind ferner einzelne außerbiblische Zeugnisse zu Jesus und dem frühen Christentum, die zeigen, wie man diese Person/Bewegung wahrgenommen hat. Eine einzigartige Quelle für die Wahrnehmung der Christen durch die Römer finden wir im Briefwechsel zwischen dem Statthalter Plinius und dem Kaiser Trajan (um 110 n.Chr.), der über die Rechtsfragen hinaus Einblick in das Denken der imperialen Führungsschicht gewährt (s.u. 12.4). Zu berücksichtigen sind auch die großen philosophischen Strömungen um die Zeitenwende herum (s.u. 3.2.1), denn im Gegensatz zu heute bestimmten philosophisch-religiöse Gedanken weite Kreise der Bevölkerung. Schließlich sind auch Inschriften, Münzen und architektonische Zeugnisse (z.B. der Titusbogen in Rom) zu berücksichtigen, wenn sie auch für das frühe Christentum aussagekräftig sind.
Chronologischer Ansatz
Grundsätzlich sollte bei jeder historischen Darstellung ein chronologischer Aufbau der erste Zugriff sein. Die mittel- und unmittelbaren Voraussetzungen müssen dabei ebenso zur Sprache kommen wie die zentralen Entwicklungslinien und wirkmächtigen Einzelereignisse. Mit der Chronologie verbinden sich die Orte des Geschehens und die dort agierenden Personen. Geographisch/lokalgeschichtliche sowie kulturell-religiöse Aspekte ergänzen sich, denn es ist in der Regel kein Zufall, dass sich relevante Entwicklungen nur oder vor allem an bestimmten Orten vollziehen.
Kulturelle Kontexte und Handlungsträger
Das frühe Christentum kann weder isoliert betrachtet noch monokausal erklärt werden, sondern seine Einbettung in die vielfältige Welt des Hellenismus ist zum Ausgangspunkt der Darstellung zu machen. Auch das Judentum als erster Bezugspunkt des frühen Christentums ist ein Teil des Hellenismus, so dass ein bewusst weiter methodischer Horizont gewählt werden muss, bei dem sich Religions- und Gesellschaftsgeschichte unter Einbeziehung von Politik, Wirtschaft und Kultur ergänzen (s.u. 3). Ebenso schließen sich individuelle und kollektive Handlungsträger bei geschichtlichen Entwicklungen nicht aus. So ist Paulus zweifellos die wirkmächtigste individuelle Gestalt innerhalb des frühen Christentums, zugleich sind aber die vielen unbekannten Gemeinden und namenlosen Missionare der Anfangszeit für die Herausbildung der neuen reichsweiten Bewegung der ‚Christianer‘ (vgl. Apg 11,26) von allergrößter Bedeutung. Ebenso kann historischen Prozessen eine plausible, folgerichtige Intentionalität innewohnen, zugleich vermögen aber auch zufällige Nebeneffekte Entwicklungen anzustoßen oder zu unterstützen.
Die Perspektive der Anderen
Das Ineinander von Einzelakteuren und Gesamtentwicklungen muss dabei um den Aspekt der Andersdenkenden (‚Gegner‘) in bestimmten Gemeinden bzw. an bestimmten Orten ergänzt werden. Sie spielten in der Geschichte des frühen Christentums eine bedeutende, zugleich aber nur schwer fassbare Rolle, denn sie lassen sich nur indirekt aus der Perspektive der später erhaltenen Literatur erschließen (s.u. 11.3). Für das Verständnis der Gesamtentwicklung des frühen Christentums sind sie dennoch unerlässlich. Theologisch aufschlussreiche und historisch notwendige Kontroversen werden nur verständlich, wenn die Positionen der jeweils Andersdenkenden in die Darstellung miteingebracht werden13.
Ideen- und Sozialgeschichte
Ideen- und sozialgeschichtliche Fragestellungen ergänzen sich
Eine rein materialistische Grundlegung der Geschichte, wonach allein die genetische Ausstattung und die soziale Realität das Denken und Handeln der Menschen bestimmt, ist ebenfalls eine Verkürzung wie das idealistische Konzept der historischen Persönlichkeit oder wirkungsmächtigen Idee/Ideologie, die den Gang der Geschichte bestimmen. Die Welt der Ideen ist ebenso ein prägendes Element der Geschichte wie die realen Verhältnisse. Deshalb sollten Ideen- und Sozialgeschichte nicht als Gegensätze begriffen werden, sondern Ideen/theologische Konzepte und ihre konkreten sozialen und literarischen Umsetzungen gehen bei einer positiven Entwicklung in der Regel ineinander. Bei den frühen Christen ist dieser Zusammenhang unübersehbar, denn der Glaube an Jesus Christus wurde in einer neuen Sozialform, der christlichen Hausgemeinde gelebt, in der Fundamentalunterscheidungen der antiken Welt aufgehoben waren (vgl. Gal 3,26–28). Das frühe Christentum war zudem gerade auf der ideengeschichtlichen Ebene eine höchst kreative Erscheinung (s.u. 13), denn es entwickelte zukunftsweisende Gottes- und Weltdeutungen, eine einzigartige Sprache des Glaubens, eigene Literaturformen und neue Lebensformen, die offenbar als attraktiv empfunden wurden, selber Geschichte machten, den Erfolg der neuen Bewegung maßgeblich begründeten und insofern in die Darstellung dieser Geschichte hineingehören.
Mikrogeschichte
Die Geschichte des frühen Christentums ist eine Form von Mikrogeschichte, die sich zunächst fast ausschließlich in ihrer eigenen Literatur widerspiegelte, in der Anfangszeit nur kleine Anhängergruppen hatte (Hausgemeinden mit ca. 30–40 Personen) und erst sehr zögerlich von außen wahrgenommen wurde. Deshalb liegen aus der Anfangszeit nur jene Zeugnisse vor, die von einer späteren Zeit im Prozess der Kanonbildung als sachgemäß angesehen wurden. Zudem gingen Schriften der Anfangszeit einfach verloren, so nach 1Kor 5,9 ein Paulusbrief und nach Lk 1,1–4 frühe (Vor-)Formen der Evangelienliteratur. Zugleich muss aber festgehalten werden, dass die Anzahl und die Qualität der erhaltenen Zeugnisse in dreifacher Weise auch religionsgeschichtlich einzigartig sind: 1) Im Vergleich mit der Ursprungsphase anderer Weltreligionen (z.B. Judentum und Islam) sind die Anzahl, das Alter und die unterschiedlichen Autoren der Schriften aus der Anfangszeit bemerkenswert. Nach einer Phase der mündlichen Überlieferung und erster Verschriftlichungen (s.u. 6.7) liegt schon 20 Jahre nach dem Tod Jesu um 50 n.Chr. mit dem 1Thesssalonicherbrief das erste eigenständige schriftliche Zeugnis der neuen Bewegung vor. Mit der Logienquelle folgt die erste Lebensund Verkündigungsgeschichte Jesu Christi um 50–60 n.Chr.14 .2) Es gibt mehr als 5000 ntl. Handschriften15, d.h. die Textproduktion und -überlieferung des frühen Christentums ist innerhalb der Antike einzigartig und bildet eine zuverlässige Grundlage für historisches Fragen. 3) Von allen wichtigen Strömungen innerhalb des frühen Christentums wurden Texte überliefert, so dass man nicht von einer Geschichte der Sieger sprechen kann.
Makrogeschichte
Schließlich zeigt die Geschichte des frühen Christentums sehr deutlich, dass jede Mikrogeschichte Teil einer Makrogeschichte ist, und das sogar in mehrfacher Hinsicht: 1) In seiner frühen Entstehungsphase ist die Bewegung der Christusgläubigen ein Teil der jüdischen Gruppengeschichte (s.u. 5). 2) Das bindet sie zugleich in das spannungsreiche Verhältnis zwischen den Juden und den Römern und somit in eine Parallelgeschichte ein. 3) Mit der erfolgreichen paulinischen Mission in Kleinasien und Griechenland bleibt das sich formierende Christentum Teil der jüdischen (Diaspora-) Geschichte und wird anfangs von den Römern auch so wahrgenommen (Claudius-Edikt; Paulus vor Gallio), zugleich entwickelt die neue Bewegung aber auch eine Eigendynamik in der genuin römischen Geschichte (Brand Roms unter Nero). 4) Der Untergang Jerusalems 70 n.Chr. hat zwar auch für das frühe Christentum eine große Bedeutung (s.u. 9), tangiert es aber weit weniger als das Judentum. 5) Je größer das frühe Christentum wurde, desto mehr nahm es an der genuin römischen Geschichte teil und wurde zugleich in eine lang anhaltende Konfrontation mit den Römern hineingezogen. Die Sonderregelungen für das Judentum als in der Regel geduldeter Religion16 galten nun nicht mehr und vor allem der Kaiserkult machte Konflikte unausweichlich (s.u. 12).
Was generell gilt, trifft auch für die Geschichtsschreibung zu: Der Mensch ist ein deutendes Wesen; er ist auf Selbst- und Weltdeutung angewiesen, um seine Geschichte, sein Erleben, sich selbst und die anderen verstehen zu können. Dieser Deutungsprozess muss bewusst gestaltet und reflektiert werden, wobei die historischen Quellen ebenso im Blick zu behalten sind wie ihre Auslegungsgeschichte und die heutigen Konstruktionsbedingungen von Geschichte. Ein weiter Blick, Multiperspektivität und ein eigener Standort schließen sich dabei nicht aus, sondern ergänzen sich. Genese und Geltung eines historischen Phänomens müssen unterschieden, können aber nie wirklich getrennt werden.
1Leopold von Ranke, Geschichten der romanischen und germanischen Völker von 1494–1514, Leipzig 2 1874, in: L. v. Ranke’s Sämtliche Werke. Zweite Gesamtausgabe Bd. 33/34, Leipzig 1877, VII: „Man hat der Historie das Amt, die Vergangenheit zu richten, die Mitwelt zum Nutzen zukünftiger Jahre zu belehren, beigemessen; so hoher Aemter unterwindet sich gegenwärtiger Versuch nicht: er will blos zeigen, wie es eigentlich gewesen.“
2Vgl. Johann Gustav Droysen, Historik, 422: „Das Gegebene für die historische Forschung sind nicht die Vergangenheiten, denn diese sind vergangen, sondern das von ihnen in dem Jetzt und Hier noch Unvergangene, mögen es Erinnerungen von dem, was war und geschah, oder Überreste des Gewesenen und Geschehenen sein.“
3Vgl. Jürgen Straub, Über das Bilden von Vergangenheit, in: Jörn Rüsen (Hg.), Geschichtsbewusstsein, Köln/Weimar 2001, 45–113.
4Vgl. dazu Hans-Jürgen Goertz, Umgang mit Geschichte, 130–146.
5Vgl. dazu Jürgen Kocka, Angemessenheitskriterien historischer Argumente, in: Wolfgang J. Mommsen/Jörn Rüsen (Hg.), Objektivität und Parteilichkeit, München 1977, 469–475.
6Johann Gustav Droysen, Historik, 69. Über geschichtliche Sachverhalte urteilt Droysen, ebd., zutreffend: „Sie sind nur historisch, weil wir sie historisch auffassen, nicht an sich und objektiv, sondern in unserer Betrachtung und durch sie. Wir müssen sie sozusagen transponieren.“
7Vgl. Ernst Cassirer, Versuch über den Menschen, Hamburg 1996 (= 1944), 291: „Geschichtswissenschaft ist nicht Erkenntnis äußerer Fakten oder Ereignisse; sie ist eine Form der Selbsterkenntnis.“
8‚Fiktion‘ bezeichnet nicht einfach im umgangssprachlichen Sinn die Negation der Wirklichkeit, sondern ist in einem funktional-kommunikativen Sinn gemeint und kommt damit der ursprünglichen Bedeutung von ‚fictio‘ nahe: Bildung, Gestaltung. Vgl. Wolfgang Iser, Der Akt des Lesens, München 31990, 88.
9Cicero, Orator 2,54 (der Historiker Antipater wird lobend herausgestellt, „die anderen erwiesen sich als Leute, die Geschichte nicht wirkungsvoll gestalten, sondern nur erzählen konnten“); Lk 1,1–4; Plutarch, Alexander 1,1 ( = „denn ich schreibe nicht Geschichte, sondern zeichne Lebensbilder“) zeigen deutlich, dass auch antike Autoren ein klares Bewusstsein von diesen Zusammenhängen hatten (vgl. ferner Thucydides, Historiae I 22,1; Lukian, Historia 51; Quintilian, Institutio Oratoria VIII 3,70).
10Vgl. Jörn Rüsen, Faktizität und Fiktionalität der Geschichte – Was ist Wirklichkeit im historischen Denken?, in: Konstruktion von Wirklichkeit, hg. v. Jens Schröter/Antje Eddelbüttel, Berlin 2004, (19–32) 31.
11Zur Welt der Geschichtswissenschaften vgl. Stefan Jordan, Theorien und Methoden der Geschichtswissenschaft, Paderborn 2009; zu den Methoden, Ansätzen und Fragestellungen vgl. Michael Maurer (Hg.), Aufriss der Historischen Wissenschaften I–VI, Stuttgart 2001–2005.
12Vgl. dazu Dieter Flach, Römische Geschichtsschreibung, Darmstadt 42013.
13Hilfreich zur Erfassung dieser Positionen ist die Diskursanalyse; sie ist eine Methode/Fragestellung, um die Formierung und Etablierung von Diskursen in der Geschichte zu erfassen und die damit verbundenen sprachlichen Äußerungen/Anschauungen/Argumente/Intentionen/Interessen/Machtansprüche zu erfassen und aufzuzeigen. Vgl. dazu: Reiner Keller, Diskursforschung, Wiesbaden 22004; Achim Landwehr, Historische Diskursanalyse, Frankfurt 2008.
14Zur Begründung der Datierungen vgl. Udo Schnelle, Einleitung in das Neue Testament, 65.250f.
15Vgl. dazu Kurt Aland/Barbara Aland, Der Text des Neuen Testaments, Stuttgart 21989; David C. Parker, New Testament Manuscripts and their Texts, Cambridge 2008.
16Der häufig verwendete Begriff der ‚religio licita‘ für das Judentum ist irreführend, weil es nie ‚offiziell‘ von römischer Seite anerkannt wurde; vgl. Dietrich-Alex Koch, Geschichte des Urchristentums, 548–550. Die Römer akzeptierten lediglich in der Regel ‚alte‘ Kulte und Religionen und statteten zeitweise, sowie von Kaiser zu Kaiser unterschiedlich, das Judentum mit Sonderrechten aus.