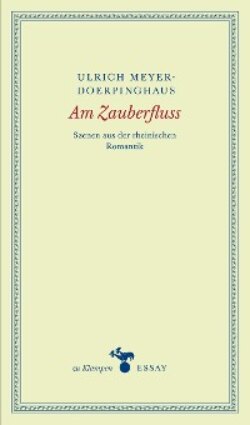Читать книгу Am Zauberfluss - Ulrich Meyer-Doerpinghaus - Страница 7
Einleitung
ОглавлениеIM Frühjahr 1790 brach der deutsche Naturforscher und Publizist Georg Forster auf zu einer Reise, die ihn durch das Rheintal zwischen Bingen und Koblenz führen sollte. Als sein Schiff zuvor die sanften Hänge des Rheingaus passierte, griff er nach einem Buch und las darin. Es trug den Titel »Reise nach Borneo« und stammte aus der Feder des holländischen Seefahrers Jacob Janson de Roy. Forster wollte sich mit der Lektüre in frühere Tage zurückversetzen: Zwischen 1772 und 1775 hatte er den britischen Seefahrer James Cook auf dessen zweiter Weltumseglung begleitet. Die kostbarsten Bilder, die Forster sich von jener Reise bewahrt hatte, wurden von dem Buch, in dem er jetzt las, hervorgelockt: das Licht des Südens, die angenehme Wärme, die exotischen Gerüche und die Faszination fremdartiger Menschen. Mit der Lektüre hatte es aber noch eine andere Bewandtnis: Forster wollte mit Hilfe der »Reise nach Borneo« die Eindrücke vertreiben, denen er hier, am Rheingau, ausgesetzt war. Er habe nämlich, so heißt es in seinem Tagebuch, seine »Phantasie an jenen glühenden Farben und jenem gewaltigen Pflanzenwuchs des heißen Erdstrichs, wovon die winterliche Gegend hier nichts hatte, gewärmt und gelabt«.
Als das Schiff am Binger Loch in das Rheintal einbog, sollte es für den Naturforscher noch schlimmer kommen: »Für die Nacktheit des verengten Rheinufers unterhalb Bingen erhält der Landschaftskenner keine Entschädigung. Die Hügel zu beiden Seiten haben nicht jene stolze, imposante Höhe, die den Beobachter mit einem mächtigen Eindruck verstummen heißt; ihre Einförmigkeit ermüdet endlich, und wenn gleich die Spuren von künstlichem Anbau an ihrem jähen Gehänge zuweilen einen verwegenen Fleiß verraten, so erwecken sie doch immer auch die Vorstellung kindischer Kleinfügigkeit.« Als Forster dann zu den Ritterburgen hinaufsah, geriet sein Urteil nicht milder: »Das Gemäuer verfallener Ritterfesten ist eine prachtvolle Verzierung dieser Szene; allein es liegt im Geschmack ihrer Bauart eine gewisse Ähnlichkeit mit den verwitterten Felsspitzen, wobei man den so unentbehrlichen Kontrast der Formen sehr vermißt.« Die Ruinen dort oben erschienen ihm »ängstlich«, die Städtchen unten am Fluss »melancholisch und schauderhaft«.1
Forster stand mit seiner Sichtweise in Deutschland nicht allein. Während die Engländer bereits Jahrzehnte vorher den Rhein zu ihrem Sehnsuchtsort erklärt hatten, betrachteten die Deutschen die Landschaft noch mit einiger Reserve. Das zerklüftete, geschichtsbeladene Rheintal passte nicht recht zum Geschmack der Aufklärung, die den klaren Formen, geraden Linien und einem vernunftgesättigten Glauben an die Gegenwart den Vorzug gab. Die steilen Hänge am Ufer des Rheins bereiteten den Deutschen dagegen einiges Unbehagen: Das alles war ihnen zu wirr und unübersichtlich, manchen erschien es sogar bedrohlich.
Diese Ressentiments hielten jedoch bekanntlich nicht lange vor. Mit Beginn des 19. Jahrhunderts erklärten die Deutschen den Rhein zum Inbegriff der Romantik: Der Philosoph Friedrich Schlegel entwarf kurz nach 1800 das neue Bild vom Rhein und erfand damit die deutsche Spielart der Rheinromantik. Fast zur gleichen Zeit fuhren die Freunde Clemens Brentano und Achim von Arnim auf dem Schiff durch das Rheintal und ließen sich zu vielen der Texte inspirieren, die in die Liedersammlung »Des Knaben Wunderhorn« eingegangen sind. Brentano erfand auch die Figur der Loreley, vor der später Heinrich Heine mit seinen Versen »Ich weiß nicht, was soll es bedeuten« eindrücklich warnen sollte. Spätestens als der Koblenzer Verleger Karl Baedeker im Jahr 1828 die »Rheinreise von Mainz bis Cöln. Handbuch für Schnellreisende« publizierte und damit die Reihe seiner Reiseführer eröffnete, war Forster widerlegt. Deutsche reisten von überall her an den Strom und ließen sich von der Landschaft begeistern. Die rheinromantischen Gedichte Kinkels, Freiligraths, Müllers von Königswinter, Simrocks und der Adelheid von Stolterfoht waren bald in aller Munde. Nicht weniger festigten die Gemälde Bleulers, Dietzlers oder Schirmers den Ruf der Landschaft. Um 1840 schien die Zeit der Rheinromantik eigentlich vorüber zu sein, doch da hatten es die Franzosen auf das linke Ufer des Flusses abgesehen, und der Rhein wurde zum Symbol der deutschen Nation erklärt. Heine mochte in »Deutschland. Ein Wintermärchen« den »armen Vater Rhein«, der »politisch kompromittiret« werde,2 noch so bemitleiden – lieber erinnerte man sich an Ernst Moritz Arndts alte, aus der Zeit der Freiheitskriege stammende Parole vom »Rhein, Teutschlands Strom, nicht Teutschlands Grenze«, und es wurde mit Vorliebe Nikolaus Beckers »Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein« oder Max Schneckenburgers »Wacht vom Rhein« gesungen.
Den Worten folgten indes bald Steine: Burgen und Schlösser bewehrten bald das Rheintal. Immer mehr Gäste strömten heran, der Rummel kannte keine Grenzen. Der Dichter Karl Simrock bemerkte in der Einleitung zu seinem »Malerischen und Romantischen Rheinland«: »Reisebücher, Karten, Panoramen, malerische und plastische Darstellungen einzelner Gegenden wie grösserer Strecken, Sagensammlungen in Versen und Prosa, und tausend andere Reisebehelfe sind in allen Kunst- und Buchläden in solcher Fülle zu Kauf, dass zwischen Mainz und Köln kaum ein Haus, kaum ein Baum gefunden wird, der nicht schon eine Feder oder einen Grabstichel in Bewegung gesetzt hätte. Diese Gegend ist so vielfältig beschrieben, abgebildet und dargestellt, dass man zuletzt das Postgeld schonen und sie mit gleichem Genuss in seinen vier Wänden bereisen kann.«3
Wie ist es heute um die Rheinromantik bestellt? Sie ist en vogue, keine Frage: Viele Ausstellungen, immer neue Bücher und zahlreiche Gäste, die an den Rhein kommen, belegen es. Und dennoch, die Rheinromantik scheint inzwischen etwas von ihrem Kern verloren zu haben. Es ist, als sei sie zu einer kulturellen Ikone geronnen, zum Opfer des Klischees geworden, das sie selbst erschaffen hat: efeubewachsene Gemäuer, weinselige Geselligkeit und Wehmut – die Bilder und Vorstellungen, die sich heute mit der Rheinromantik verbinden, sind unbestritten schön und pittoresk, aber eben nur das. Macht die Rheinromantik noch betroffen? Wollte heute noch einer an den Rhein ziehen, um sich vom Fluss berücken zu lassen und dabei die eigenen Schaffenskräfte entfesselt zu sehen? Gern genießt man die Landschaft bei Rotwein und Kerzenlicht – damit soll es dann aber sein Bewenden haben.
Dieses Missverständnis gilt für die Romantik überhaupt. Man hält die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts gerne für eine Zeit, die vor allem von Melancholie geprägt war. Der Schein trügt jedoch: Nie wurde mehr gesucht und gesehnt, mehr gespielt und gewagt als in der Romantik. Thomas Mann, der von seinen Kindern »der Zauberer« genannt wurde, schrieb über die romantische Seele, dass sie sich den »irrationalen und dämonischen Kräften des Lebens, das will sagen: den eigentlichen Quellen des Lebens nahe fühlt und einer nur vernünftigen Weltbetrachtung und Weltbehandlung die Widersetzlichkeit tieferen Wissens, tieferer Verbundenheit mit dem Heiligen bietet«.4
Oder vor einigen Jahren Rüdiger Safranski: »Der romantische Geist ist vielgestaltig, musikalisch, versuchend und verführerisch, er liebt die Ferne der Zukunft und der Vergangenheit, die Überraschungen im Alltäglichen, die Extreme, das Unbewußte, den Traum, den Wahnsinn, die Labyrinthe der Reflexion. Der romantische Geist bleibt sich nicht gleich, ist verwandelnd und widersprüchlich, sehnsüchtig und zynisch, ins Unverständliche vernarrt und volkstümlich, ironisch und schwärmerisch, selbstverliebt und gesellig, formbewußt und formauflösend.«5
Alles das kann man auch von den Rheinromantikern sagen. Sie haben das Rheintal zu ihrer Landschaft gemacht, weil es ihnen so unübersichtlich, widersprüchlich und zerklüftet erschien wie die menschliche Seele. Wo hätte man besser auf Erweckung und Glück spekulieren können als hier! Der Rhein: ein Zauberfluss! Ihm dürften die Rheinromantiker wohl ähnliche Wirkungen zugeschrieben haben wie Eichendorff dem berühmten »Zauberwort«:
»Schläft ein Lied in allen Dingen,
Die da träumen fort und fort,
Und die Welt hebt an zu singen,
triffst du nur das Zauberwort.« 6