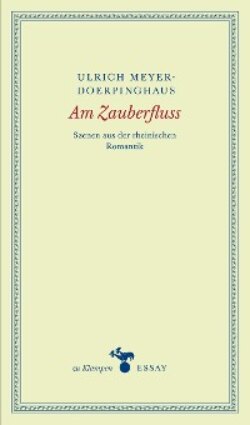Читать книгу Am Zauberfluss - Ulrich Meyer-Doerpinghaus - Страница 8
Ich wähle dich!
ОглавлениеFriedrich Schlegel und die Erfindung der Rheinromantik
PARIS, im Herbst 1803. Die Luft steht still, ein spätes Licht liegt über der Stadt. Die ersten Kastanienblätter fallen auf die Kieswege des Jardin des Tuileries. Sie sind bereits so welk geworden wie die Ideale, die nur ein Jahrzehnt zuvor hier, im Herzen Frankreichs, das Blut der Menschen erhitzt hatten. Noch stehen die Parolen der Revolution in schwarzen Lettern auf den Hauswänden: »Liberté, Égalité ou la Mort!«7 Der Sturm auf die Bastille ist aber längst Geschichte. Was ihm folgte, lässt sich in der Erinnerung kaum noch voneinander trennen: die Hinrichtung des Königspaares, die Errichtung der Republik, die Schreckensherrschaft der Jakobiner, die Greueltaten der Sansculotten. Dass man seit kurzem wieder im Krieg mit England liegt, interessiert kaum jemanden. Alltag zieht ins kriegsmüde Paris ein. Napoleon Bonaparte, der Erste Konsul, hat mit dem Staatsstreich vom 18. Brumaire 1799 die Alleinherrschaft an sich gerissen. Er schickt sich an, die Monarchie zu restaurieren. Argwöhnisch lässt er die eigene Bevölkerung bespitzeln, drückt Presse und Theater in die Zensur. Die Schriftstellerin Germaine de Staël, die den gesellschaftlichen Rückschritt in ihrem Roman »Delphine« kritisierte, wird des Landes verwiesen und muss ihren literarischen Salon aufgeben. Den Bürgern von Paris ist es einerlei. Sie wollen nur Ruhe – und die gibt Napoleon ihnen.
Wer jedoch die Stadt in Richtung Norden verließ, der konnte in einem stattlichen Haus an den Hängen des Montmartre eine kleine Wohngemeinschaft antreffen, die entschlossen schien, der Stimmung in der Stadt zu trotzen. Wo die Pariser Aristokraten die Sommerfrische in ihren Landhäusern zu verbringen pflegten, stand an der langen, schnurgerade aufsteigenden Rue de Clichy ein Haus mit Innenhof und einem großem Garten, der von hohen, alten Bäumen überragt wurde. Ein halbes Jahrhundert zuvor hatte hier der damalige Hausherr, der Baron d’Holbach, zusammen mit Rousseau und Diderot die »Encyclopédie«, das größte literarische Vorhaben der französischen Aufklärung, in Angriff genommen. Jetzt wohnte in dem Haus der deutsche Philosoph und Schriftsteller Friedrich Schlegel. Er strebte danach, in Paris das Ideal der romantischen Geselligkeit ins Werk zu setzen. Dazu sammelte er einen Kreis Gleichgesinnter um sich. Man las gemeinsam Texte, diskutierte oder trieb – wie es der Hausherr nannte – »Symphilosophie«.8
Der 1772 in Hannover als Sohn eines Pfarrers geborene Schlegel machte auf den ersten Blick den Eindruck eines eher ruhigen Zeitgenossen: Er war klein und untersetzt, hatte ein rundes, wie mit dem Zirkel gezogenes Gesicht, sein Kopf ruhte halslos auf dem Rumpf. Der zweite Blick belehrte den Beobachter jedoch eines Besseren: Schlegels wachen Augen entging nichts. Sein heller Verstand griff stets aus nach Neuem. Er war ein Frühaufsteher und Tausendsassa, ein funkensprühender Feuerkopf. Seit der frühen Kindheit hatte er unzählige Bücher gelesen. Die Zeitgenossen staunten über seine stupende Gelehrsamkeit. Ein jeder in Deutschland wusste es: Schlegel war Vordenker und Stichwortgeber der romantischen Bewegung. Drei Jahre zuvor, im Sommer 1799, hatte er in seiner Wohngemeinschaft in der Jenaer Leutragasse an heißen Tagen und in kurzen Nächten das Projekt der Romantik ersonnen, zusammen mit seiner acht Jahre älteren Lebensgefährtin Dorothea Veit, seinem Bruder August Wilhelm und dessen Frau Caroline, mit dem Philosophen Friedrich Schelling, dem Schriftsteller Ludwig Tieck und seinem engsten Freund Friedrich von Hardenberg, der sich Novalis nannte. Friedrich Schlegel besaß zwar nicht die poetischen Fähigkeiten der anderen, wusste aber am besten auf den Begriff zu bringen, worauf es der Romantik ankam: Skepsis gegenüber dem gleißenden Licht der Vernunft und Suche nach der – wie er es nannte – »schönen Verwirrung der Fantasie, […] dem ursprünglichen Chaos der menschlichen Natur«,9 ein nahezu grenzenloses Vertrauen in das schöpferisch tätige Subjekt, unbändige Neugierde für alles Unverständliche und Unendliche. Für Schlegel war all dies keine graue Theorie, sondern bot ihm einen praktischen Schlüssel zum menschlichen Glück, denn, so schrieb er, »die innere Zufriedenheit« hänge »irgendwo zuletzt an einem solchen Punkte, der im Dunkeln gelassen werden muß, dafür aber auch das Ganze trägt und hält, und diese Kraft in demselben Augenblicke verlieren würde, wo man ihn in Verstand auflösen wollte«.10
Berühmt wurde Schlegel, als er sich mit einem der größten Vernunftsoptimisten seiner Zeit öffentlich anlegte: mit Friedrich Schiller. Die gelehrten Beiträge, die dieser in den »Horen« und im »Musenalmanach« veröffentlicht hatte, verriss Schlegel mit zähem Fleiß. Als in der Jenaer Wohngemeinschaft aus Schillers »Glocke« vorgelesen wurde, fiel man vor Lachen fast vom Stuhl, belustigt von den Versen über die tugendhafte Hausfrau. Die Sache mit den Frauen sah Schlegel ganz anders als Schiller: Er zog es vor, ihnen eine starke Rolle zuzuschreiben. In dem Romanfragment »Lucinde« verbreitete Schlegel die für seine Zeit ungewöhnliche Erkenntnis, dass eine Ehe nur dann sinnvoll sei, wenn sie auf gegenseitiger Liebe beruhe. Mehr noch, er beeilte sich hinzuzufügen, die Befriedigung der körperlichen Lust sei in einer solchen Ehe durchaus möglich, sowohl für den Mann und – das war eine Provokation – auch für die Frau. Diese Feststellung versuchte er mit intimen Details aus der eigenen Verbindung mit Dorothea Veit zu belegen. So schrieb er vom »Blitz der Liebe«, der »in ihrem zarten Schoß gezündet«.11 Das war zu viel – nicht nur für Dorothea, sondern auch für ein Publikum, das sich zwar aufklärerisch, nicht aber aufgeklärt gab: Das Buch wurde zum Skandal.
Schlegel war, nachdem sich die Jenaer Wohngemeinschaft wegen verschiedener Spannungen und Eifersüchteleien aufgelöst hatte, mit Dorothea und Philipp, ihrem neunjährigen Sohn aus erster Ehe, nach Paris gezogen, um sich hier eine berufliche Existenz aufzubauen. In dem Haus an der Rue de Clichy wollte man den Geist von Jena zu neuem Leben erwecken. Die beiden gründeten eine Pension, in der bald zwei Sanskritexperten zur Miete wohnten, von denen einer, der Schotte Alexander Hamilton, seinem Pensionsvorsteher jeden Nachmittag von zwei bis fünf Uhr Unterricht in der altindischen Sprache erteilte. Zahlreiche Männer und Frauen fanden sich jeden Sonntag bei einem literarischen Tee-Abend in der Schlegel’schen Wohnung zusammen, gleich im Anschluss an eine öffentliche Vorlesung, die der Philosoph am »Athenée des étrangers« vor einer großen Menge Zuhörer gab, um, wie er es fasste, »das Evangelium auf meine Weise zu verkünden«.12 Bei den sonntäglichen Geselligkeiten verwandelte sich das Haus in einen Salon: Man las einander vor, diskutierte, musizierte gemeinsam, lachte, aß und trank viel. Die Gäste kamen aus vielen Ländern: Es waren Deutsche, Franzosen, Schweizer, Portugiesen, Dänen, Niederländer und Italiener darunter. So ließ sich zum Beispiel Dorothea von Rodde blicken, die erste promovierte Geisteswissenschaftlerin Deutschlands. Der Schriftsteller Achim von Arnim kam hinzu und stritt mit Schlegel über das, was Romantik im Kern bedeute. Der später berühmte italienische Bildhauer Lorenzo Bartolini bereicherte die Zusammenkünfte ebenso wie Vivant Denon, der Direktor des Musée Napoléon.
In diesem Getriebe wusste besonders eine zwanzigjährige Frau aufzufallen, nicht nur wegen ihrer großen mandelförmigen Augen und der langen schwarzen Haare, die sie zu einem Dutt hochgesteckt hatte. Mehr noch tat sie sich durch ihr Temperament, ihre Neugierde für Menschen und ihre ausgeprägte Gesprächsfreudigkeit hervor. Ihr koketter Charme war in Paris in aller Munde. Helmina von Halfter, so ihr Name, stammte aus Berlin und war die Enkelin der damals berühmten Schriftstellerin Anna Louisa Karsch. Diese Herkunft bereitete ihr ein vorzügliches Entree in die gehobenen Kreise von Paris. Helmina hatte es nach einer gescheiterten Ehe an die Seine verschlagen, wo sie als Korrespondentin für verschiedene deutsche Zeitungen tätig war. Bald übernahm sie auch die Redaktion einer Zeitschrift, der »Französischen Miscellen«, in denen sie Klatsch und Tratsch vom Hofe Napoleons zum Besten gab. Das deutsche Publikum las die Reportagen aus der Herzkammer des Feindes mit lebhaftem Interesse.
Helmina fühlte sich in der Hausgemeinschaft bestens aufgehoben, sie arbeitete am liebsten draußen in der Orangerie und liebte den Blick, der sich ihr von dort aus über ganz Paris bot. Den Gastgebern Friedrich Schlegel und Dorothea Veit war sie nah verbunden. Als das Paar im Sommer des vorangegangenen Jahres fast mittellos nach Paris gezogen war, hatte Helmina ihnen mit finanzieller Unterstützung über die schwierige Anfangszeit hinweggeholfen. Das vergalt ihr das Paar später mit dem Angebot, in das Holbach’sche Palais zu ziehen. Die junge Deutsche ließ sich nicht zwei Mal bitten. Besonders zu Dorothea fasste sie Vertrauen und Zuneigung. Jene war ihr wie eine zweite Mutter, mit ihr teilte sie ihre Geheimnisse, Ängste und Vorlieben. Die Tochter des berühmten Aufklärungsphilosophen Moses Mendelssohn verfügte wie Helmina über eine profunde Bildung, hatte ein ausgeprägtes Interesse an Literatur und betätigte sich als Schriftstellerin. Beide Frauen waren bereits ein Mal geschieden, was der einen genauso wenig ausmachte wie der anderen. Helmina sprach hingebungsvoll über ihre neue Ersatzmutter: »Sie war freudig und stark, großartig und mild, duftend wie eine Blume, saftig wie eine Frucht, feurig wie ein Mann, zartfühlend wie ein Weib.« Zu Friedrich Schlegel hatte Helmina dagegen ein eher kompliziertes Verhältnis. Sie betrachtete ihn mit einer Mischung aus Bewunderung und Skepsis. Nicht ohne Furcht nahm sie seine »kolossale überströmende Natur« zur Kenntnis. Sie schrieb, er sei »einklanglos und in seinem Wesen die entschiedensten Gegensätze offenbarend: weich wie ein Kind und schroff wie ein Gigant, hinwogend im Aether wie ein Adler und wühlend im Boden nach Vergnügungen, die ganz irdischer Natur waren«. Sie nahm wahr, wie der Mann von seinen gegensätzlichen inneren Impulsen hin- und hergezogen wurde: »Er wußte und erstrebte zu vielerlei.« Schlegel bemühte sich zwar nach Kräften, Helmina in ihrem Bildungsstreben zu unterstützen, doch fühlte sie sich von ihm zugleich oft zurückgestoßen. Das »Eckige und Schroffe, das öfters bei ihm hervortrat«, machte ihr oftmals großen Kummer.13
Die schwankenden Stimmungen Schlegels mögen ihren Grund darin gehabt haben, dass er in Paris nicht die Erfüllung fand, die er sich gewünscht hatte. Der Dreißigjährige verfolgte hier das Ziel, seine frei schwebende Existenz als privater Gelehrter aufzugeben und eine feste berufliche Stellung zu erlangen, um sich erstmals in seinem Leben auf verlässliche Einkünfte stützen zu können. Er setzte sich in Paris für die Gründung einer deutsch-französischen Gelehrtenakademie ein, an der er selbst zu lehren gedachte. Bei den Pariser Behörden stieß Schlegel aber auf taube Ohren, was ihn vollends ernüchterte. Bekleidet mit einem schwarzen Paletot, stromerte er durch die Stadt, während ihm sein durchlöcherter Hut das Aussehen einer, wie ein Augenzeuge formulierte, »Sperlingsscheuche«14 verlieh. Dabei wälzte er in seinem Kopf grollende Phantasien. Sein Unmut spießte alles auf, was französisch war oder nur so aussah. Schlegel fühlte sich als ein Exot. An seinen Bruder August Wilhelm schrieb er: »Auch die Ménagerie [der zoologische Garten im Jardin des Plantes] hier ist sehr schön; besonders der Elefant hat mir viel Achtung und Teilnahme eingeflößt. Er ist unstreitig nächst mir derjenige welcher am wenigsten hier zu Hause ist.«15 Schlegel war ratlos, er sehnte sich nach einem äußeren Ereignis, das ihn von seiner Unzufriedenheit erlösen würde.
Im September 1803 klopften drei junge Männer an das schwere Tor des Holbach’schen Palais, und es war Helmina, die als erste zur Stelle war und öffnete. Beim Anblick der Herrschaften konnte sie ein Schmunzeln kaum unterdrücken. Die Männer standen da »ganz weiß gepudert, mit Taubenflügeln und Zöpfen, in Fracks, seidenen Strümpfen und Schuhen mit goldenen Schnallen« – solche Toiletten trug man in Paris schon lange nicht mehr. Helmina trieb mit den dreien sogleich ihren Schabernack. Deren Frage, ob sie es wohl mit Frau Schlegel zu tun hätten, bejahte sie, woraufhin sie ein wohlklingendes Kompliment zu hören bekam: »Das Gerücht hat Sie uns nicht ganz schön beschrieben, Frau Schlegel!«16
Die Neuankömmlinge hatten den Weg von Köln, ihrer Heimatstadt, nach Paris in einer Postkutsche zurückgelegt. Es waren allesamt wohlbegüterte Kaufmannssöhne, von denen einer, offenbar der Älteste, sogleich die Rolle des Wortführers übernahm. Er stellte sich als Johann Baptist Bertram vor. Die beiden anderen waren offensichtlich jünger und, wie unschwer zu erkennen war, Brüder: Sie führten sich als Sulpiz und Melchior Boisserée ein. Während Bertram bereits ein Studium der Jurisprudenz und der Philosophie absolviert hatte, lag die Schulzeit für die beiden anderen noch nicht weit zurück.
Die Boisserée waren Sprösslinge einer Familie, die ursprünglich in der Gegend von Lüttich ansässig gewesen war. Der Vater war von dort nach Köln gezogen, um die Leitung des Handelshauses zu übernehmen, das ihm sein kinderloser Onkel vererbt hatte. Der tüchtige Boisserée hatte dann eine Kölner Kaufmannstochter geheiratet und mit ihr eine zwölfköpfige Familie gegründet, die »am Blaubach« wohnte, mitten in den verwinkelten Gassen der Stadt und nur einen Steinwurf von Neumarkt und Heumarkt entfernt. Der zwanzigjährige Sulpiz, im Verhältnis zu seinem jüngeren Bruder Melchior der zweifellos Aufgewecktere und Temperamentvollere, absolvierte eine Kaufmannslehre in Hamburg. Die Entwicklung des weltläufigen jungen Mannes nährte die Erwartung, dass er, wie von seiner Familie erhofft, in die Fußstapfen des Vaters treten und eine Karriere als Kaufmann einschlagen werde. Das wäre auch so gekommen, wenn er nicht durch Zufall bei einem Kölner Buchbinder »einem jungen Manne mit krausem Haar und lebhaften Augen« begegnet wäre, eben dem um sieben Jahre älteren Johann Baptist Bertram. Sulpiz Boisserée erinnert sich: »Das Gespräch führte gleich auf die Brüder Schlegel, besonders auf Friedrich; die unbedingte Begeisterung, welche der junge Mann für diese beiden genialen, aber etwas gar zu stürmisch auftretenden Männer aussprach, wollte mir nicht einleuchten.«17 Von den Vorbehalten des Sulpiz Boisserée aber ließ sich Bertram nicht entmutigen. In den kommenden Tagen und Wochen suchte er Sulpiz immer wieder auf und schrieb ihm mehrere Briefe, um ihn für Schlegels Ideen und Schriften zu begeistern. So gelang es Bertram, Sulpiz Boisserée mit dem Virus der Schlegel-Begeisterung zu infizieren. Jener beschloss, nun von den schönen Wissenschaften fasziniert, von der Kaufmannslaufbahn zu lassen, um statt dessen ein Studium zu beginnen. Er fasste den Plan, sich im Herbst 1803 an der Universität Jena zu immatrikulieren, wo die idealistische Philosophie durch Lehrer wie Friedrich Schelling oder Georg Wilhelm Friedrich Hegel in Blüte stand. Um die verbleibende Wartezeit zu überbrücken, schlug Bertram seinem neuen Freund einen Plan vor: Warum sollte man nicht nach Paris reisen, bei Schlegel anklopfen und für eine Weile bei ihm in die Lehre gehen? Sulpiz stimmte zu und überzeugte auch seinen jüngeren Bruder Melchior, sich den Reisenden anzuschließen.
In der Rue de Clichy angekommen, zögerten die drei nicht, Schlegel eine Bitte vorzutragen: Sie hätten den Wunsch, einige Wochen in seiner Pension zu wohnen und für das Gold, das sie ihm gäben, nicht nur Kost und Logis, sondern auch Privatvorlesungen zu erhalten. Diesen Wunsch erfüllte ihnen der Hausherr gern. Im »Cabinet«, dem Arbeitszimmer, erging er sich, zwischen Bücherstapeln und Haufen von Manuskripten stehend, vor seinen Zuhörern in gelehrten Ausführungen über Literatur, Kunstgeschichte und Philosophie. Der Parisaufenthalt der Kölner sollte sich wegen eines Hautleidens von Sulpiz indes verlängern, und so kamen sie ein halbes Jahr lang in jenen Genuss. Auch Helmina durfte mitlauschen. Sie äußerte sich hernach begeistert: »Unsere Stunden waren sehr belebt, der Geist durchwehte sie wie eine angenehme Zugluft.«18 Sulpiz war nicht weniger angetan: Schlegels »Urteile … fesselten uns, trotz der Paradoxien, worin er sich dann und wann verstieg«.19
Was bewegte die Kölner Gäste, ihre Pläne für Ausbildung und Beruf über Monate hintanzustellen, um sich von den Ideen eines Philosophen bereichern zu lassen? War es allein dessen schillernde Intellektualität, die den Ausschlag gegeben hatte? Gewiss, Bertram und die Boisserée gaben einem ausgeprägten Streben nach Bildung nach, das für die höheren Familien Kölns durchaus charakteristisch war. Doch spielte noch ein weiteres Motiv eine Rolle, und das waren die Zustände, in denen sich die Heimatstadt der drei Parisbesucher in jener Zeit befand. Seitdem die Franzosen die linksrheinischen Gebiete im Jahr 1794 besetzt hatten, war es mit Köln bergab gegangen. Die neuen Herren beraubten die Stadt nicht nur ihrer wirtschaftlichen Substanz, sondern sie hatten es auch auf den Lebensnerv abgesehen, der der Stadt seit jeher Stolz und Selbstbewusstsein gegeben hatte. Das waren die anscheinend zahllosen Kirchen, Klöster und Stifte und der unermessliche Reichtum, der in jenen Einrichtungen aufbewahrt wurde: mittelalterliche Tafelbilder, kostbares Schnitzwerk, liturgische Geräte aus wertvollen Materialien. Seit Beginn der Besetzung schafften die Franzosen das Kölner Kirchengut in großen Mengen nach Paris, wo im Jahr 1793 der Louvre zu dem Zweck eröffnet worden war, das Gut, das dem König und dem Adel Frankreichs sowie den eroberten Ländern geraubt worden war, aufzubewahren und öffentlich auszustellen. Die Situation sollte sich für Köln im Jahr 1802 weiter verschärfen. Im Juni dieses Jahres wurde im Rheinland das sogenannte Supressionsgesetz erlassen, ein Vorläufer des »Reichsdeputationshauptschlusses«, der ein Jahr darauf die Säkularisation für ganz Deutschland verbindlich machen sollte. Zwischen August und Oktober 1802 wurden in Köln fast alle geistlichen Institutionen aufgelöst. Man riss Kirchen und Klöster ab oder führte sie einem neuen, weltlichen Zweck zu. Priester und Ordensleute mussten binnen zehn Tagen die geistliche Kleidung ablegen und sich eine neue Bleibe suchen. Der gesamte Kirchenbesitz wurde kurzerhand zu französischem Nationalgut erklärt. Ein Teil davon übergab man einer Reihe deutscher Fürsten östlich des Rheins, die Napoleon sich als künftige Bündnispartner gegen Preußen und Österreich gewogen machen wollte. Der andere Teil ging vom Staat zurück in private Hände: Kunstgegenstände wurden von Sammlern angeboten und auf den Jahrmärkten verhökert.
Diese Geschehnisse warfen für die Zeitgenossen eine Frage auf: Welchen Wert hatte eigentlich die Kunst des Mittelalters? Der aufgeklärte Zeitgeist sprach ein klares Urteil: Die Kunst der Antike und der Renaissance war wertvoll, die des »finsteren« Mittelalters dagegen nicht. Bevor sich der Markt diesem Geschmacksurteil anpassen sollte, ergriffen die vornehmen Familien Kölns die Initiative. Sie wollten das kulturelle Erbe der Stadt retten, indem sie der Kunst des Mittelalters einen neuen, höheren Wert verliehen. Das war, so wurde es in den höheren Kreisen der Stadt einhellig begriffen, zur entscheidenden Existenzfrage Kölns geworden.
Hier dürfte wohl der entscheidende Grund zu suchen sein, warum Bertram und die Boisserée nach Paris reisten. Schlegel war für sie der ideale Mann, um die Kölner Ambitionen zu unterstützen. In der Zeitschrift »Europa«, die er seit dem Frühjahr 1803 herausgab, unternahm er den Versuch, die mittelalterliche Kunst neu zu entdecken und sie zu diesem Zwecke genauestens zu beschreiben. Das Musée Napoléon, wie der Louvre inzwischen hieß, bot ihm dafür einen breiten Fundus an. Weil der neue Blick, den Schlegel auf die mittelalterliche Kunst warf, die Kölner Gäste zu ihm gelockt hat, erscheint an dieser Stelle ein Exkurs über die sogenannten Gemäldebeschreibungen des Philosophen lohnenswert.
Schlegel macht bei seinem Rundgang durch das Musée Napoléon gleich zu Anfang eine Entdeckung, die ihn erschüttert. In einer weit entlegenen, schwach beleuchteten Kammer stößt er auf Gemälde, die nach seiner Meinung eine bessere Behandlung verdient hätten: »Hier liegen übereinandergelehnt an der Wand die göttlichen Meisterwerke Perugins und des leiblichen Johann Bellin, ungesehen, und unbewundert!« Dagegen findet Schlegel in den öffentlichen Ausstellungsräumen des Museums Werke jüngeren Datums, die ihm viel weniger gefallen. Die alten Werke zu entdecken, das sieht er als seine Aufgabe. Denn: »Ich habe durchaus nur Sinn für die alte Malerei, nur diese verstehe ich und begreife ich, und nur über diese kann ich reden.« Was aber ist für ihn »alte Malerei«? Es sind solche Gemälde, die während des Spätmittelalters und der frühen Renaissance (also bis etwa 1550) in Deutschland, in den Niederlanden und Italien geschaffen wurden. Jan von Eyck, Albrecht Dürer, Hans Holbein der Jüngere, Leonardo und Raffael, so heißen seine Helden. Maler, die erst in der Hoch-, der Spätrenaissance und im Barock lebten, markieren dagegen für ihn eine Art neutralen Zwischenzustand, nicht schön genug, um sie zu schätzen, aber auch nicht schlecht genug, um sie rundheraus abzulehnen. So urteilt Schlegel, »daß die kalte Grazie des Guido [Reni] nicht viel Anziehendes für mich hat, und daß mich das Rosen- und Milch-glänzende Fleisch des Dominichino mit nichten bezaubert«. Was jedoch noch später gemalt wurde, trifft vollends der Bannstrahl seiner vernichtenden Kritik: »Ich habe über diese Maler kein Urteil, wenn man nicht etwa das für eines wollte gelten lassen, daß damals schon die Malerei nicht mehr vorhanden war.« Schlegel steht wie frierend vor diesen Gemälden, da »der Künstler, wo er nun für den Gegenstand nicht mehr fühlte, doch den Zwang der Aufgabe und der gegebenen Bedingung desto drückender empfand, und sein Produkt dadurch nicht selten in Affektation oder Spielerei geriet, oder doch kalt blieb«. Was aber haben die alten den neuen Meistern voraus? Schlegel: »Keine verworrene Haufen von Menschen, sondern wenige und einzelne Figuren, aber mit dem Fleiß vollendet, der dem Gefühl von der Würde und Heiligkeit der höchsten aller Hieroglyphen, des menschlichen Leibes, natürlich ist; strenge, ja magre Formen in scharfen Umrissen, die bestimmt heraustreten, keine Malerei aus Helldunkel und Schmutz in Nacht und Schlagschatten, sondern reine Verhältnisse und Massen von Farben, wie in deutlichen Accorden; Gewänder und Costume, die mit zu dem Menschen zu gehören scheinen, so schlicht und naiv als diese; in den Gesichtern (der Stelle, wo das Licht des göttlichen Malergeistes am hellsten durchscheint) aber, bei aller Mannichfaltigkeit des Ausdrucks oder Individualität der Züge durchaus und überall jene kindliche, gutmütige Einfalt und Beschränktheit, die ich geneigt bin, für den ursprünglichen Charakter des Menschen zu halten; das ist der Styl der alten Malerei, der Styl, der mir, ich bekenne hierin meine Einseitigkeit, ausschließend gefällt.«
In der alten Malerei findet Schlegel »wilden Enthusiasmus«; dieser »ergreift das innere Herz«. Dort meint er »wirkliches Leben vor sich zu sehen«, »Genauigkeit und objektive Bestimmtheit«, mithin den »unergründlichsten und verwickelsten Tiefsinn«.20
Schlegel bezog mit diesen Überlegungen Position in der zeitgenössischen Diskussion über Ästhetik und Kunst. Dabei wandte er sich vor allem gegen Goethes ästhetische Anschauung. Dieser hatte in seiner zwischen 1798 und 1800 erschienenen Zeitschrift »Propyläen« den klassizistischen Kunstgeschmack geprägt. Demnach sollte die junge Künstlergeneration allein an den Kunstwerken der klassischen Antike Maß nehmen und geschult werden. Der Dichterfürst vertrat die Ansicht, dass »kein neues Kunstwerk […] gegen die Muster der Alten [der Antiken] gestellt völlig bestehen« könne.21 Und da Goethes Wort in seiner Zeit Gewicht hatte, erschöpften sich die Bemühungen der Kunststudenten an den Akademien weitgehend darin, die antiken Vorbilder möglichst genau nachzuahmen: Wem dies am besten gelang, der galt als der beste Künstler. Genau das aber erregte Schlegels Einspruch: Der gegenwärtige Künstler – so formuliert er – »bewegt sich nur mit fort in dem verworrnen Strudel und Traume eines bloß äußerlichen, innerlich ganz wesenlosen und eigentlich nichtigen Daseins; statt daß uns die Kunst grade aus diesem herausrücken und in die höhere, geistige Welt emporheben sollte«.22 Dagegen vermöge doch die Malerei viel mehr. Sie sei »eins der wirksamsten Mittel, […] sich mit dem Göttlichen zu verbinden, und sich der Gottheit zu nähern«.23 Deshalb empfahl Schlegel den Kunststudenten, an der schlichtweg ergreifenden Kunst des Mittelalters Maß zu nehmen, statt sich an antiken Vorbildern zu orientieren.
Goethe war nicht amüsiert. Er nannte seinen Herausforderer kurzum eine »rechte Brennessel«.24
Die mittelalterliche Malerei als höchster Ausdruck der Kunst – das war es, was die Kölner Gäste zu hören bekommen wollten. Sie empfingen aber nicht nur von Schlegel, sondern gaben ihm auch zurück. Der Philosoph erhielt von ihnen neue Denkanstöße, die sein Blickfeld erweiterten. So interessierte sich Schlegel zunächst nur für die Malerei des Mittelalters – für die Baukunst derselben Zeit aber hatte er keinen Blick: An der Notre-Dame ging er achtlos vorüber. Das sollte sich ändern, nachdem die drei Kölner ein solches Interesse in ihm geweckt hatten. Aber nicht nur das, sie begeisterten ihn auch für die alte katholische Kultur im Allgemeinen, wie sie in Köln beispielhaft verkörpert war. Sie fanden in Schlegel einen aufmerksamen Zuhörer, als sie ihm von den zahlreichen Kirchen und Klöstern wie auch von der rheinischen Lebensart erzählten. Das faszinierte Schlegel. Sulpiz schrieb: »Alles dieses erweckte bei unserm Freund den Wunsch, diese wegen ihren veralteten Volkssitten und Zuständen zu jener Zeit sehr verkannten Landstriche kennen zu lernen.«25 Die drei Kölner aber gingen in Gedanken noch einen Schritt weiter. Sie wollten Schlegel und Dorothea davon überzeugen, nach Köln umzuziehen. Und sie wussten, womit sie den Wissenschaftler Schlegel locken konnten: In Köln gab es zwar seit 1798 keine Universität mehr, aber maßgebliche Teile der Bürgerschaft arbeiteten daran, die höhere Lehranstalt wieder zu errichten. Sollte es da nicht möglich sein, Schlegel mit der von ihm seit langem erstrebten beruflichen Festanstellung auszustatten?
Im Frühjahr 1804 entschieden sich Friedrich Schlegel und Dorothea Veit tatsächlich, ihren Wohnsitz nach Köln zu verlegen. Zuvor heiratete man noch in Paris, nachdem Dorothea sich hatte evangelisch taufen lassen. Dann wurde der Schlegel’sche Hausrat mit einer Kutsche nach Köln gebracht, und das Paar reiste mit Dorotheas Sohn und den neuen Freunden über Brüssel, Löwen, Lüttich, Aachen und Düsseldorf nach Köln – zu Fuß, denn das war für Romantiker eine Selbstverständlichkeit.
Wenn es zu jener Zeit eine deutsche Stadt gab, die für Altehrwürdigkeit und Tradition stand, dann war es Köln. Die Monumente aus römischer Zeit, die zahlreichen Kirchen und die verwinkelten Gassen flößten dem Besucher Respekt ein. Doch konnte ihm zugleich nicht entgehen, dass die würdevolle Oberfläche bereits Patina angesetzt hatte. Georg Forster, der Köln im Jahr 1791 besuchte, notierte in seinem Tagebuch, keine andere Stadt am Rhein liege »so üppig hingegossen da«. Beim näheren Hinsehen fand er die Stadt jedoch »finster« und »traurig«. Forster sah in den Gassen »Scharen von zerlumpten Bettlern herumschleichen«. Geradezu angewidert zeigte sich der aufgeklärte Naturforscher angesichts der Reliquienfrömmigkeit, die ihm in der Stadt überall entgegenschlug. Als er in der Ursulakirche einen großen Knochenhaufen bemerkte, der angeblich von den elftausend Jungfrauen stammte, rief er aus: »Allein, daß man die Stirne hat, dieses zusammengeraffte Gemisch von Menschen- und Pferdeknochen, welches vermutlich einmal ein Schlachtfeld deckte, für ein Heiligtum auszugeben […], das zeugt von der dicken Finsternis, welche hier in Religionssachen herrscht.«26
Auch Schlegel konnte, als er nach Köln gezogen war, an solchen Missständen nicht vorübersehen: »Die Straßen, besonders die nach dem Rheine zu, sind meistens eng, weil alles sich des Verkehrs und des Gewerbes wegen nach dieser Gegend drängt; sehr breite Gassen würden hier auch wegen der Strenge der Rheinluft im Frühling und Herbst nicht eben wohnlich sein.« Dann aber brach sich bei ihm doch die Begeisterung Bahn: »Die herrliche amphitheatralische Lage der Stadt am Rhein, längs dessen Ufer sie einen halben Mond in der Ausdehnung einer kleinen Stunde bildet, die Menge der Gärten in der Stadt selbst, die Schönheit des innern und äußern Spaziergangs um den Wall, die beträchtliche Erhöhung einiger Teile der Stadt, gewährt einen hinlänglichen Ersatz für den Mangel an umgebenden Spaziergängen, und für die im Ganzen flache Gegend, die nur in der Ferne durch das Siebengebirge begrenzt wird.« Am meisten aber sagte ihm der kulturelle Reichtum der Stadt zu: »Für den Freund der Kunst und der Altertümer ist es eine der wichtigsten und lehrreichsten Städte Deutschlands.«27
Der alte Glanz konnte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Köln damals eine tiefe historische Zäsur erlebte. Die Franzosen, seit 1794 Besatzungsmacht, hatten der Metropole den Titel der »freien Reichsstadt« genommen und sie zum Provinzhauptsitz degradiert. Aber nicht nur das, die neuen Herren schickten Köln binnen weniger Jahre in die Moderne. Sie führten die Gewerbefreiheit ein und schafften die Gaffeln und Zünfte ab. Die Juden wurden mit den übrigen Bürgern gleichgestellt und der Code Civil eingeführt. Fortan maß man nicht mehr an Elle, Fuß oder Hand, sondern in Metern – die Waagen zeigten Kilogramm statt »Mark«. Die Häuser wurden numeriert, zunächst durchgängig, später nach Straßen, so dass das Haus des Parfümherstellers Wilhelm Mühlens zunächst die »4711« trug und dann die Adresse »Glockenstraße 12« erhielt. Die Kölner mussten zugleich zahlreiche Neuerungen hinnehmen, die gerade für eine katholische Stadt gewöhnungsbedürftig waren: Man rechnete die Zeit nicht mehr ab Christi Geburt, sondern ab 1792, dem Jahr der Abschaffung der französischen Monarchie. Die Monate trugen Namen, die am Naturkalender orientiert waren, zum Beispiel Ventôse für die stürmischen Frühjahrswochen oder Floréal für die Zeit der ersten Blüte. Statt des Sonntags gab es nur alle zehn Tage einen Feiertag, den sogenannten Dekadi.
Das symbolträchtigste Bild für den Niedergang der Stadt war indes der Anblick des Domes: Halb fertig stand er da, ein mächtiger Torso, an dem seit 1560 nicht mehr weitergebaut worden war. Vollendet war allein der massive Westbau, den die Franzosen jedoch zu einem Getreidespeicher umfunktioniert hatten. Während dort, wo das Kirchenschiff zu erwarten war, eine große Lücke klaffte, ragte an der Ostseite nur einer der beiden ursprünglich vorgesehenen Türme in die Luft, jedoch auf halber Höhe flach abgeschnitten. Auf der Plattform reckte sich ein großer, unbenutzter Baukran wie ein klagender Zinken schräg in die Luft; Herman Melville sollte diesen später in seinem Roman »Moby Dick« als das Symbol des Unfertigen schlechthin bezeichnen.
Dass in Köln die Verhältnisse auf dem Kopf standen, konnten die Schlegels außerdem bemerken, als sie in ihre Wohnung an der Kirche Sankt Maria im Kapitol einzogen. In dem großen Haus wohnten sie gemeinsam mit einer über siebzigjährigen Dame, die hier noch vor kurzer Zeit einer geistlichen Frauengemeinschaft als Äbtissin vorgestanden hatte. Nach Aufhebung des Klosters hatte ihr ehemaliger Kutscher das Gebäude erworben und ihr gnädigerweise erlaubt, darin mietfrei ihren Lebensabend zu verbringen.
Als Schlegel, Bertram und die Brüder Boisserée in Köln ankommen, wissen sie gleich, was zu tun ist. Es gilt, der Stadt die eigene Geschichte und die kulturelle Grundlage wiederzugeben. Wie Sulpiz schreibt, sei es die Zeit des »Unglücks, wo man in allem Trost suchte, was einer bessern Vergangenheit angehörte«.28 Folglich sei »zu retten, was noch zu retten war«.29 So beginnen die vier, die Bildwerke, die seit dem Jahr 1802 aus den Kirchen verschwunden waren, zu suchen und zu sammeln. Sie sprechen zu diesem Zweck nicht nur private Kunstsammler an, die hier neuerdings in großer Zahl vorhanden sind, sondern gehen auch auf Trödelmärkte, wo Tafelbilder zu Spottpreisen verramscht werden. In zäher Anstrengung gelingt es ihnen, einen Bestand zusammenzustellen, der die Werke der bekanntesten mittelalterlichen Maler von Stefan Lochner über Albrecht Dürer, Lucas Cranach den Älteren, Hans Holbein den Jüngeren, Jan von Eyck und Rogier van der Weyden bis zu Dierick Bouts und Hans Memling zusammenführt. Den Restauratoren über die Schulter zu blicken, ist für Sulpiz ein atemraubendes Vergnügen: »Und wie freuten wir uns, wenn wir dann unter der reinigenden Hand des Restaurators irgend einen Kopf oder ein Stück eines schönen, blauen, roten oder grünen Gewandes, wenn wir einen Kräuterboden mit Erdbeerblüten und -früchten, mit Veilchen und andern Frühlingsblumen aus dem dunklen Überzug von Kerzendampf und anderm Dunst klar hervortreten sahen.«30
Die vier bilden nicht nur eine enge Arbeitsgemeinschaft, sondern sie leben auch zusammen, wie Sulpiz bezeugt: »Wir lebten zu jener Zeit eigentlich nur mit Schlegel und seiner Frau, wir sahen sie alle Tage und oft mehr als einmal.«31 Während Bertram und die Brüder Boisserée rastlos den Erwerb der Bilder vorantreiben, arbeitet Schlegel am Konzept der Sammlung. Er besucht die wichtigsten privaten Kunstsammler der Stadt, wie den früheren Rektor der Universität, Ferdinand Franz Wallraf, oder den Wein- und Tabakhändler Jakob Johann Nepomuk Lyversberg und vertieft im Gespräch sein kunstgeschichtliches Wissen. Seine Erkenntnisse vermittelt er anschließend seinen drei Freunden, denen er, wie schon in Paris, auch hier Privatvorlesungen erteilt. Dabei ermahnt er sie, die Bilder nicht einfach zu horten, sondern der Sammlungstätigkeit wissenschaftliche Prinzipien zugrunde zu legen.
Die Schlegels wohnten schon einige Monate am Rhein, als sich Friedrich erneut auf Reisen begab. Er wollte seinen älteren Bruder August Wilhelm besuchen, der mit der Schriftstellerin Germaine de Staël auf Schloss Coppet am Genfer See lebte. Schlegels Wanderung führte ihn dabei auch durch das Rheintal zwischen Koblenz und Bingen. Die Eindrücke, die er hier empfing, inspirierten ihn zu einem Text über das Rheintal, dessen Wirkung nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Man kann diesen als eine Art Ursprungsmanifest der Rheinromantik lesen, auch wenn der Begriff selbst darin noch nicht vorkommt. Deshalb erscheint es lohnenswert, Schlegels Gedanken an dieser Stelle genauer zu folgen: »Bei dem freundlichen Bonn fängt die eigentlich schöne Rheingegend an; eine reich geschmückte Flur, die sich wie eine große Schlucht zwischen Hügeln und Bergen eine Tagereise lang hinaufzieht bis an den Einfluß der Mosel bei Koblenz; von da bis St. Goar und Bingen wird das Tal immer enger, die Felsen schroffer, und die Gegend wilder.«
In Kenntnis der Ressentiments, die Georg Forster und andere Deutsche dem Rheintal bis dahin entgegengebracht hatten, setzt Schlegel, der die Provokation liebt, einen deutlichen Kontrapunkt: »Und hier ist der Rhein am schönsten.« Mit dem Begriff des »Schönen« steht Schlegel bereits mitten in der ästhetischen Debatte seiner Zeit, der gelehrten Diskussion darüber, was eigentlich schön sei. Entsprechend schärft er seine Position: »Für mich sind nur die Gegenden schön, welche man gewöhnlich rauh und wild nennt; denn nur diese sind erhaben, nur erhabene Gegenden können schön sein, nur diese erregen den Gedanken der Natur.«32 Warum ist das so? Schlegel antwortet: weil aus einer solchen Landschaft etwas spreche, das über ihren äußeren Schein hinausweise, nämlich »das Eine und Unbegreifliche« oder, wenn man so will, »das Göttliche in der Natur«.33 Noch mehr aber vermag die Natur den Menschen zu ergreifen, wenn die Kultur hinzutritt. Und das ist beim Rheintal der Fall: »Nichts aber vermag den Eindruck so zu verschönern und zu verstärken, als die Spuren menschlicher Kühnheit an den Ruinen der Natur, kühne Burgen auf wilden Felsen.« Beides zusammen, die Natur und die Kultur, machen das Rheintal in Schlegels Wahrnehmung zu einem Kunstwerk: »Überall belebt durch die geschäftigen Ufer, immer neu durch die Windungen des Stroms, und bedeutend verziert durch die kühnen, am Abhange hervorragenden Bruchstücke alter Burgen, scheint diese Gegend mehr ein in sich geschlossenes Gemälde und überlegtes Kunstwerk eines bildenden Geistes.«
Im Angesicht der Natur hält der Wanderer am Rhein ähnlich inne wie der Betrachter eines mittelalterlichen Gemäldes im Musée Napoléon. Und kaum hat er das getan, da verwandelt sich das Gemälde schon in ein Gedicht: »Der alte vaterländische Strom erscheint uns nun wie ein mächtiger Strom naturverkündender Dichtkunst.«34 Hier spielt Schlegel an auf sein romantisches Ideal der »progressiven Universalpoesie«, die »Kunstpoesie und Naturpoesie bald mischen, bald verschmelzen« kann.35
Dieses Ideal sieht Schlegel sich direkt vor seinen Augen entfalten: Das Rheintal changiert von der Natur zur Kunst, vom Gemälde zum Gedicht – das romantische Ideal entfaltet sich als Wirklichkeit vor den Sinnen des Wanderers. Das berührt ihn so sehr, dass er angesichts dieser »Quelle der Begeisterung« ausruft: »Ich wähle dich, o Rhein!« Diese Worte stehen zu Beginn der Verse, mit denen Schlegel seine Rheinbegeisterung auf den Punkt bringt: »Ich wähle dich, o Rhein, der du mit Sausen / Hinwogst durch enger Felsen hohe Schranken / Wo Burgen hoch am Abhang auf sich ranken / Ans Herz den Wandrer greift ein ahnend Grausen.«36
Was begründet das »ahnend Grausen«? Es ist die Ahnung vom Verlust einer besseren, größeren Vergangenheit. An dieser Stelle schlägt Schlegel als erster den Ton einer patriotischen Sichtweise des Rheins an – ein Topos, der später von seinen Landsleuten noch oft aufgegriffen und variiert werden sollte. Schlegel begegnet am Rhein einer großen deutschen Vergangenheit, was ihm die Gegenwart um so geringer erscheinen lässt. Diese hat für ihn nur noch den »Charakter der Nullität«, er konstatiert eine »gänzliche Unfähigkeit zur Religion, […] die absolute Erstorbenheit der höhern Organe. Tiefer kann der Mensch nun nicht sinken; das ist nicht möglich.«37 Das von den Franzosen besetzte Rheinland aber erinnert Schlegel an das Mittelalter: »Nirgends werden die Erinnerungen an das, was die Deutschen einst waren, und was sie sein könnten, so wach, als am Rheine.«38
Der Philosoph vermochte aber auch in Köln nicht Wurzeln zu schlagen. Es fehlte ihm an geistiger Anregung. Da es in der Stadt keine Gelehrtenzirkel und Salons gab, lernte Schlegel nur wenige anregende Gesprächspartner kennen. Dorothea konnte die Situation ihres Mannes nicht mit ansehen. Sie klagte über »die ängstliche Ungewißheit seiner Lage, die Einsamkeit und die große Abgestorbenheit zu Kölln«, die »seinem Geiste und seinem Gemüthe drückend, und seinen Werken schädlich werden müßen«.39 Es kam hinzu, dass auch hier Schlegels berufliche Entwicklung zu einem holprigen Unterfangen geriet. Anstelle der Universität, die die Franzosen im Jahr 1798 geschlossen hatten, wurde eine »Zentralschule« eingerichtet, an der Schlegel Literaturgeschichte lehrte. Die Schule fiel aber bald weiteren Reformen zum Opfer. Schlegel überbrückte die Zeit bis zur Einrichtung einer neuen höheren Schule mit Privatvorlesungen. Als ihm aber an dieser Einrichtung ein Gehalt angeboten wurde, das er als unangemessen empfand, schlug er die bereits erfolgte Ernennung zum Lehrer wieder aus, um sich nur noch den Privatvorlesungen zu widmen. Fortan sahen sich die Schlegels nach einem neuen Wohnsitz um. Es war der Bruder August Wilhelm, der ihnen behilflich wurde: Er vermittelte seinem Bruder eine Stelle als Sekretär am kaiserlichen Hof in Wien. Damit war Friedrich endlich im Besitz der lang ersehnten festen Anstellung. Nachdem die Schlegels in Köln noch zum katholischen Glauben konvertiert waren, zogen sie im Jahr 1808 nach Wien.
Bertram und die Brüder Boisserée bedauerten den Weggang der Schlegels zutiefst. Die Gemeinschaft hatte ihren Mittelpunkt verloren, die schöpferische Atmosphäre, die den Freundeskreis verbunden hatte, war unwiederbringlich. Es kam hinzu, dass die drei Kaufmannssöhne zur Kenntnis nehmen mussten, dass es im fremd besetzten Köln an einem öffentlichen Publikum fehlte, das ihrer Sammlung die gewünschte Beachtung geschenkt hätte. So zogen sie im Jahr 1810 mit ihren inzwischen über 200 Gemälden nach Heidelberg weiter, einem der wichtigsten romantischen Zentren jener Zeit. Bertram und den Boisserée gelang es hier, die Gemälde, die zuvor stets in Privatwohnungen aufbewahrt worden waren, erstmals öffentlich auszustellen. Dies war, wenn man die Gründung entsprechender Häuser in Berlin und München mit bedenkt, die Geburt des öffentlichen Museums in Deutschland. Im Jahr 1827, nach einem Stuttgarter Intermezzo, verkauften Bertram und die Boisserées die Sammlung an den bayerischen König Ludwig I., der sie in den Kernbestand der »Alten Pinakothek« einbrachte.
In dieser Zeit verfiel Sulpiz Boisserée noch auf ein weiteres Vorhaben: den Weiterbau und die Vollendung des Kölner Doms. Damit wagte er sich zweifellos an eine Herkulesaufgabe. Es war kein Geringerer als Goethe, der von der »Unausführbarkeit eines so ungeheuren Unternehmens« sprach und wie eine Kassandra warnte, man sehe »das Mährchen vom Thurm zu Babel an den Ufern des Rheins verwirklicht«.40 Davon ließ sich Boisserée aber nicht schrecken. Inspiration für seine Bemühungen lieh er sich von seinem Lehrmeister Schlegel, der den Weiterbau des Kölner Doms nachdrücklich gefordert hatte. Und so arbeitete Boisserée unermüdlich an dem Projekt, seitdem Schlegel aus Köln fortgezogen war. Er spürte alte Baupläne in Archiven und Bibliotheken auf und beschäftigte mehrere Zeichner, Restauratoren und Kupferstecher, mit denen er die Planungen zum Weiterbau des Doms vorantrieb. Zugleich bemühte sich Boisserée, die preußischen Behörden von seinem Vorhaben zu überzeugen und Mittel von privaten Geldgebern einzuwerben. Ein wichtiger Fortschritt war erreicht, als es ihm gelang, den preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm von der Notwendigkeit des Weiterbaus zu überzeugen – der junge Mann soll daraufhin drei Nächte nicht geschlafen haben. Als dieser im Jahr 1840 als Friedrich Wilhelm IV. das königliche Amt antrat, erklärte der »Romantiker auf dem Thron« den Weiterbau des Kölner Doms sogleich zu einem zentralen nationalen Projekt. Zwei Jahre später erfolgte die feierliche Grundsteinlegung. Den Abschluss der Arbeiten sollte Boisserée, der 1854 in Bonn starb, allerdings nicht mehr miterleben: Erst 1880 konnte die Fertigstellung des Doms gefeiert werden.
Friedrich Schlegel indes blieb auch in Wien ein rastloser Intellektueller. In Deutschland mokierte man sich gern darüber, dass der einstige Raufbold nun auf »konziliatorischem Filzschuhe« herumlaufe.41 Schließlich sei der Gelehrte in die Arme der katholischen Kirche geflohen und habe dann auch noch beim österreichischen Kaiser, dem Inbegriff ultrakonservativen Denkens, Unterschlupf gefunden. Schlegel konnte über solche Einschätzungen nur lächeln. Er blieb bis zu seinem Tod im Jahr 1829 der Überzeugung, sich selbst stets treu geblieben zu sein. Dorothea zog danach zu ihrem Sohn Philipp Veit, der inzwischen ein bekannter Maler geworden war, nach Frankfurt am Main, wo sie im Jahr 1839 starb. Zu der Zeit waren schon zahllose Menschen dem Ruf der Rheinromantik gefolgt, die Schlegel einst erfunden hatte.