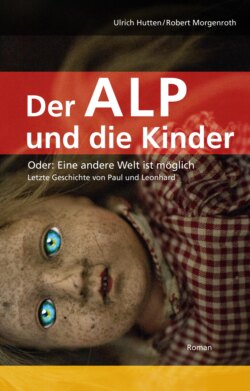Читать книгу Der Alp und die Kinder - Ulrich Von Hutten - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 1 – Fehlfarben
ОглавлениеVieles stimmt in dieser Geschichte, manches ganz bestimmt. Das meiste ist natürlich erfunden. Aber alles ist wahr. Dass jede Ähnlichkeit mit lebenden Personen purer Zufall sein muss, versteht sich von selbst. Falls sich jemand erkennen sollte, kann es nur an ihm liegen. Von mancher historischen Gegebenheit sind wir in dichterischer Freiheit abgewichen, von den meisten nicht. Erneut haben wir uns daran erfreut, Fantasie und Realität, Fakten und Fiktion ineinander zu verweben. Das würden seriöse Journalisten wie Dr. Leonhard Ross und Paul Wiesensee nie tun.
Robert Morgenroth und Ulrich Hutten
„Die Tradition aller toten Geschlechter lastet wie ein Alp auf dem Gehirne der Lebenden. Und wenn sie eben damit beschäftigt scheinen, sich und die Dinge umzuwälzen, noch nicht Dagewesenes zu schaffen, gerade in solchen Epochen revolutionärer Krise beschwören sie ängstlich die Geister der Vergangenheit zu ihrem Dienste herauf, entlehnen ihnen Namen, Schlachtparole, Kostüm, um in dieser altehrwürdigen Verkleidung und mit dieser erborgten Sprache die neue Weltgeschichtsszene aufzuführen.“ – Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, 1852, MEW 8, S. 115
„Der Kommunismus ist für uns nicht ein Zustand, der hergestellt werden soll, ein Ideal, wonach die Wirklichkeit sich zu richten haben [wird]. Wir nennen Kommunismus die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt.“ – Marx/Engels, Die deutsche Ideologie, 1846, MEW 3, S. 35
Karl Marx (geboren 1818, gestorben 1883)
Berlin, Hauptstadt der DDR, im November 1986
Zum ersten Mal spürt er die Stille. Eigenartig, dass sie ihm nie aufgefallen ist. Eine bedrückende Stille, trotz der vielen Menschen. Wie ein schwarzes Loch. Sie verschluckt das Schlüsselklappern des Mannes vor ihm und das Geräusch seiner eigenen Schritte. Sie gehen die immerbraunen Wände der Gänge entlang, kommen an der Stehzelle vorbei. Hier sitzt keiner, hier wird gestanden, bis einer umfällt. Die Tür zum Verhörraum öffnet sich, drinnen warten sie auf ihn.
„Willkommen, Genosse Brause“, hört er einen der beiden Kollegen, unter dem Tisch ordentlich zusammengestellte Beine in Bügelfaltenhosen, über dem Gesicht dicke Brillengläser, ein schmaler Typ. Er kennt ihn nicht. „Setzen Sie sich. Das hier alles ist Ihnen ja nicht unbekannt.“
Es ist absurd, denkt Werner, völlig absurd. Er ist es, der sonst hinter diesem Tisch sitzt. Er sollte es sein, der hier die Fragen stellt.
Er war wieder die ganze Nacht unterwegs gewesen, im Einsatz. Als sie ihn heute Morgen gegen fünf aus dem Bett geklingelt hatten, war er gerade erst richtig eingeschlafen. Von der Straße herauf Motorengeräusch. ,Es muss etwas Besonderes vorgefallen sein, wenn sie mir ein Auto schicken.’ Eigentlich hatte er einen freien Tag. Seine Frau schlief grummelnd weiter. Als er unten vor der Tür den fensterlosen Barkas der Abteilung XIV gesehen hatte, wusste er, die Männer hatten einen anderen Auftrag als ihn zu seiner Sonderdienststelle zu bringen. Mit ihnen zu reden war sinnlos. Sie sagten ihm nur, es gehe darum, einen Sachverhalt aufzuklären. Und dann schafften sie ihn ausgerechnet in das Stasi-Gefängnis, in dem er selbst schon so oft Gefangene vernommen hatte.
Kontrolle zur Hofeinfahrt, vertraute Gesichter. Aber heute Morgen schien es plötzlich, als würden sie ihn nicht mehr kennen, als hätte er irgendetwas an sich, das ansteckend sein könnte. Sie behandelten ihn vollkommen korrekt, aber sie ersparten ihm nichts. Man nahm ihm zuerst seine Makarow ab, verschloss sie sorgfältig im Waffenschrank, dann seine Effekten, seine Uhr, sein Portemonnaie und die Halskette aus Messingplättchen, die ihm seine Frau in besseren Ehezeiten zu irgendeinem Hochzeitstag geschenkt hatte. Gegen Quittung natürlich. Sie hinterlegten alles säuberlich im Regal mit der Nummer 98. Er musste sich nackt machen, völlig, und den Geruch seines Geschlechts, seiner Haut und seines Hinterns auf dem Tuch hinterlassen, das sie ihm mit einem Schemel unterschoben und dann sorgfältig in einer Glaskonserve verschlossen. Selbst die erkennungsdienstliche Behandlung in der Fotozelle ließen sie nicht aus: Klick um Klick machten sie aus ihm, dem Genossen und Kollegen Werner Brause, einen aktenkundigen Untersuchungshäftling, eine Nummer in grauer Anstaltsunterwäsche und einheitsblauem NVA-Trainingsanzug.
„Na klar, klar kenne ich das alles hier. Aber Sie nicht, Sie kenne ich nicht“. Werner raunzt den Kollegen auf der anderen Seite des Tisches sofort an und schaut ihm mitten ins Gesicht, direkt in die ausweichenden Augen hinein. Ein Agent agiert, auch in der Defensive.
Werner setzt sich aufrecht, schiebt sein Kinn nach vorn und wendet sich dem anderen Mann zu, offenbar der Ältere und Ranghöhere. Bauchansatz, teigig belanglose Gesichtszüge und schütteres Haupthaar sprechen dafür, dass er sich als lang gedienter Angehöriger der bewaffneten Organe lieber einem ungestörten Rentnerdasein in seiner Datsche nähern würde als diesem Verhör. Ihm kommt Werner ganz freundlich, fast familiär: „Hören Sie, auch wenn wir uns nicht persönlich kennen, wir sind ja Kollegen. Oder hat man Sie nicht informiert? Ich wüsste nun wirklich gerne, was das hier soll.“
Es ist nicht gelogen. Werner hat keine Ahnung. Oder vielmehr, er hat tausend. Er weiß, dass diese Stasi-Kollegen irgendetwas wissen, aber er weiß nicht was.
Die Vernehmung beginnt nicht wie sonst üblich: Der Schlaksige tritt nicht von hinten an ihn heran, fasst ihn nicht an die Schulter, um zu demonstrieren, dass man die totale Kontrolle über ihn hat. Nein, sie lassen es ganz höflich und förmlich angehen. Name? Werner Brause. Geboren? 1942. Wo? In Berlin. Vater? Rudolf Brause, Schlosser, geboren 1905, in Berlin. Mutter? Gertrud Brause, gebürtige Perlitz, Arbeiterin, geboren 1914, ebenfalls in Berlin. Und so fort. Bis hin zu Bruder, Frau und Tochter. Dann geht es los. Belangloses zunächst, wie bei einer Unterhaltung in der Kantine. Es geht um den letzten Urlaub an der Ostsee mit seiner Frau, um die Gespräche dort, um Urlaubsbekanntschaften. Durch Werners Kopf schießen Erinnerungen an typische Sommerferienerlebnisse, Ausflüge, Strandleben, abendliche Geselligkeit, Besäufnisse. Eigentlich nichts Besonderes. Er antwortet brav auf ihre Fragen, erzählt alles, was sie wissen wollen. Alles völlig harmlos.
„Haben Sie immer noch keine Ahnung, warum Sie hier sind?“ Der Schüttere pirscht sich heran. Werner schweigt. „Weil wir jeden Verdacht gegen Sie ausräumen wollen“, fährt der Schüttere schließlich fort. „Sie wissen doch selbst, wie es ist, gerade jetzt wird so viel subversiv herumgeredet. Vor allem über unsereins. Kürzlich haben wir aus Ihrem Wohnblock von einem Gespräch gehört. Da hat eine Nachbarin Ihre Frau gefragt, warum Sie nachts am Kfz-Kennzeichen Ihres Autos herumschrauben. Ihre Frau hat geantwortet, das habe sie noch gar nicht bemerkt. Sie wisse nichts davon.“
Er unterbricht sich und hebt die Augenbrauen. „Aber was soll so etwas Dämliches denn? Ihre Frau weiß doch Bescheid, warum Sie wo herumschrauben. Sie hätte einfach sagen können: War wohl was kaputt am Auto.“
Werner wittert die Falle: Von wegen, seine Frau weiß Bescheid. Er würde nicht hineintappen: „Entschuldigen Sie bitte, warum sollte meine Frau lügen? Sie ist schließlich keine Geheimnisträgerin. Sie arbeitet den ganzen Tag in der Bibliothek des ZK. Sie weiß nichts. Überhaupt nichts. Das ist doch hoffentlich bei Ihnen zuhause nicht anders.“
Der Schüttere geht nicht darauf ein, lehnt sich zurück, blättert eine Weile hinter einem Aktendeckel in Unterlagen und scheint dort die Antworten zu finden, die Werner ihm vorenthält. „Na gut, Sie haben also überhaupt keine Idee, was uns veranlasst haben könnte, Sie zu befragen. Sie möchten uns nichts sagen?“
„Nein, ich wüsste keinerlei Grund dafür und ich würde mich freuen, wir könnten das Ganze hiermit beenden. Kann ja nur ein Missverständnis sein.“
„Schade“, sagt der Kopfschüttere und steht auf. „Dann würde ich Sie bitten, in den Nebenraum mitzukommen. Wir würden gerne ausnahmsweise einen Polygrafen einsetzen. Sie kennen auch das vermutlich?“ Seine Mundwinkel verziehen sich leicht und verleihen seinem leeren Gesicht so etwas wie eine persönliche Note. „Wie Sie wissen, halten wir alle nicht viel davon. Die Dinger funktionieren ungefähr so gut wie unsere Allgemeinen Dienstanweisungen. Aber wir wollen alle Möglichkeiten ausschöpfen, wenn es um einen eigenen Mann geht.“ Er zuckt mit den Schultern: „Anweisung von oben, einfach als zusätzliche Sicherheit. Sie sind doch sicher einverstanden?“
Werner akzeptiert sofort. Er weiß, was kommt. Er wird reden und der Lügendetektor wird ruhig bleiben. Er hat in seinen Spezial-Lehrgängen für die HV A gelernt, nicht nur Menschen, sondern auch Polygrafen zu täuschen. Simpel die Grundregeln: einfach entspannen, einfach nicht lügen. Du musst sie nur weglocken von den gefährlichen Gefilden, in denen du lügen müsstest. Das haben sie ihm beigebracht und er war sehr gut darin, es hat immer funktioniert. Er wird sie an der Nase herumführen, so gut können sie mit ihren Fragen gar nicht auf ihn vorbereitet sein.
Sie schließen ihn an. Sehr häufig scheinen diese Kollegen nicht mit dem Gerät zu arbeiten. Ihre Unbeholfenheit amüsiert ihn. Es macht ihnen sichtlich Mühe, ihn mit Tatwissen-Fragen und Vergleichsfragen auch nur ansatzweise zu überlisten, zumal sie ihn mit dem Tatvorwurf noch gar nicht konfrontiert haben. Ihre angestrengten Versuche, die Fragen so zu formulieren, dass er sie möglichst nur mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten könnte, oder sie ihm in unerwartet neuer Reihenfolge noch einmal aufzutischen, alles ist so durchsichtig wie dünner Muckefuck. Besonderes Vergnügen bereiten ihm ihre verzweifelten Blicke, wenn die Schreibarme des Polygrafen plötzlich unerklärliche Linienmuster auf das Papier zu zeichnen beginnen. Weil er sie seinerseits verwirrt, indem er bei völlig belanglosen Fragen den Arsch zusammenkneift oder die Zähne aufeinanderbeißt, bis sein Körper reagiert und Impulse sendet.
Sie fragen und fragen, abwechselnd, drei Stunden oder vier, nach diesem Urlaub mit seiner Frau, aber dann unvermittelt auch nach den häufigen Einsätzen während seiner HV A-Zeit, als er oft in West-Berlin zugange war. Sie fragen penibel nach Einzelheiten, die sie sich aus Akten angelesen haben mussten, und speziell nach verschiedenen Leuten, mit denen er auf der anderen Seite der Stadt zu tun hatte und auch sonst im Westen. Er bleibt bei seiner Linie, lügt einfach nicht, erzählt alles genau so, wie es war. Wort und Tat sind eins bei Brause. Und lockt sie immer weiter weg, weg von den Gefahrenstellen. Er hat alles unter Kontrolle, Blutdruck, Puls und Atemmuster, Schweiß, sein ganzes vegetatives Nervensystem. Es wird keinen Ausschlag auf dem Gerät geben, es sei denn, er selbst wird ihn hervorrufen. Werner fühlt sich ihnen meilenweit überlegen. Nichts von alledem, was sie wissen wollen, kann mit Christine zu tun haben oder gar mit dem Staatsgeheimnis, das er unter allen Umständen zu schützen hat. Sonst wären andere Leute hier, ganz sicher der Oberst. Die Männer, die ihm hier gegenübersitzen, sind nicht eingeweiht.
Irgendwann geben sie auf. Er hört die Resignation in der Stimme des Schütteren, der sich räuspert und plötzlich anfängt, ihn zu duzen: „Genosse, du weißt doch, wer bei uns Fehler einsieht, dem wird nicht gleich der Kopf abgerissen. Nicht einem Kollegen wie dir. Schon so viele Jahre dabei. Immer bereit, immer zuverlässig, zigfach bewährt. Willst du nicht lieber reinen Tisch machen? Wir hauen doch keinen in die Pfanne, der auf unserer Seite steht …“
„Ich habe immer noch keine Ahnung, was Sie von mir wissen wollen.“ Werner bleibt beim Sie, diese Runde ist an ihn gegangen.
Schließlich sperren sie ihn weg.
In der Zelle wieder die Stille. Er fühlt sich ausgelaugt wie nach zig Kilometer Querfeldeinlauf durch vermintes Gelände. Extrem anstrengend, selbst für einen trainierten Mann, stundenlang auf der Hut und trotzdem entspannt zu bleiben. Und der fehlende Schlaf, er zehrt, übermannt ihn. Er fällt auf die Pritsche, lässt sich gehen. Verdammte Scheiße, was machen sie mit ihm? Die eigenen Leute. Wütend hämmert er mit der Faust an die Wand. Stopp. Sein Hirn schaltet den Kontrollmodus ein. Was können sie wollen?
Es geht zu viel durcheinander in diesen Zeiten. Kaum jemand mit offenen Augen und Ohren weiß noch, wie der Hase läuft und wohin, ob die Linien noch gelten, auf denen es längs geht. Vor allem, ob es noch rote Linien sind, die halten, wenn es ernst wird. Seit der große Bruder aus Moskau, der allmächtige Generalsekretär der großen Bruderpartei, mit seinem Glasnostgerede alle verunsichert, seither ist das so. Selbstkritik verlangt er. Sogar hier in der DDR. Aber wer sorgt denn für gefestigte Verhältnisse an der Front zum Feind? Wer verhindert denn, dass alles auseinanderfällt? Glasnost, Perestroika. Was soll das bringen außer Zersetzung und Reaktion?
So richtig kann er nur mit Christine über solche Sachen reden, auch wenn sie sich dann in die Haare geraten, weil sie selten einer Meinung sind. Aber in ihre Haare gerät er am liebsten. Und bei ihr muss er sich wenigstens nicht verstellen. Was dieser Gorbatschow verbreitet, ist in Wahrheit so unheimlich und bedrohlich wie die unsichtbare, angeblich gefährliche Atomwolke aus Tschernobyl, wegen der jetzt alle fast in Panik geraten. Niemand kann richtig fassen, was passiert. Inzwischen weiß er von Genossen, die selbst schon alles in Zweifel ziehen, was bisher in Ordnung war. Sogar in seiner Dienststelle. Ist da was falsch gelaufen? Hat doch einer etwas mitbekommen von ihm und Christine, ihn vielleicht denunziert?
Unsinn. Dann hätten diese Trottel das Verhör ganz anders geführt, führen müssen. Was sollte bloß die ganze Fragerei nach dem Sommerurlaub mit seiner Frau im Ferienheim? Ihm fällt nichts ein.
Die aufgestaute Müdigkeit senkt sich auf ihn wie eine schwere Bettdecke und er versinkt halbschlafen in eine andere Welt. Unscharfe Bilder. Wasser. Seine Frau schwimmt, wedelt mit dem Arm und ruft, er versteht sie nicht, seine Tochter gräbt sich in den Sand und ist plötzlich weg, er rennt hin, wieder ruft es, jetzt ist es plötzlich Fritz, der etwas über das Feld brüllt, sein Kumpel in der Fußball-Jugend, Werner bekommt den Ball, läuft auf das Tor zu, ,schieß doch’, schreit Fritz, er schießt, verstolpert und im Fallen reißt sein Trikot. Er zerrt es sich vom Leib, es hat ein Loch, genau in der Mitte, genau da, wo das Abzeichen aufgenäht war, auf das er so stolz war, Berliner Fußballclub Dynamo, das BFC D mit den beiden goldenen Ähren. Es ist verschwunden.
Werner wälzt sich herum. Dieses Gefühl, von Kindesbeinen an allen voran dabei zu sein, aber immer Angst davor, ausgeschlossen zu werden. Für Momente, gefühlte Ewigkeiten, ist er wieder wach. Sein Blick fällt auf den roten Kübel in der Ecke.
Sein Vater saß oft in solchen Zellen. Nein, in unvergleichlich schlimmeren. Und ließ sich nie unterkriegen. Er hätte ihn so gerne kennengelernt. Und nicht nur die spärlichen Geschichten, die seine Mutter viel zu selten erzählte, bevor sie wieder bedeutungsvoll schwieg.
Die Mutterworte, sie handelten kaum vom Vater, den er liebte, vom aufopferungsvollen Kampf des Gewerkschafters und Kommunisten. Mehr über ihn erfuhr er erst durch seine Erzieher und späteren Genossen: Von seiner revolutionären Hingabe als Agitator in den Kampfzeiten der Zwanziger Jahre, seiner Verhaftung durch die Nazi-Verbrecher, seinen Jahren im Zuchthaus und im KZ. 1936 hat man ihn endlich wieder entlassen, das hat ihm seine Mutter erzählt, und als ungelernten Arbeiter bei der Deutschen Fernkabel Gesellschaft knüppeln lassen.
„Das war die Zeit, mein Junge, in der zwischen deinem Vater und mir überhaupt erst Liebe möglich war. Aber das verstehst du nicht.“ Dann legte Mutter erneut eine ihrer gedehnten Pausen ein, vielleicht weil sie selbst einmal mehr gründlich über alles nachdenken musste, ehe sie murmelte: „So kam dein Bruder Hans zu uns.“
Werner hatte diesen Satz lange nicht verstanden. Aber was ihm die Mutter von seiner eigenen Zeugung erzählte, verstand er schon. „Du warst die Zugabe unserer letzten Liebe.“ 1942 wurde sein Vater zum Strafbataillon 999 eingezogen. Im Jahr darauf trat er in Afrika auf eine Mine. Ein einjähriger Bengel war das Letzte, was von ihm blieb. Soviel verstand Werner schon.
Er hätte wahnsinnig gern mit ihm geredet. Und manchmal, in Kinderzeiten, hatte er es auch getan, abends, wenn er nicht einschlafen konnte und die Mutter noch auf Schicht bei Bako war. Dann hatte er sich vorgestellt, der Vater säße an seinem Bett und er erzählte ihm etwas, zum Beispiel wie sie heute in der Schule über ihn gesprochen hatten. Dass der Lehrer die Stimme wieder so komisch angehoben und gesagt hatte, Werner, du kannst stolz sein auf deinen Vater. Wir alle sind es. Er war ein Genosse, wie er sein soll, ein Vorbild. Sein Leben und sein Tod sind uns Verpflichtung. Er war ein echter Kommunist: aufrecht, solidarisch und opferbereit der Zukunft entgegen. Ohne Angst, weil er wusste, dass die Geschichte auf unserer Seite steht. Und dass unser sowjetisches Brudervolk den Faschismus am Ende ein für alle Mal besiegen wird, damit wir auf seinen Trümmern die neue Gesellschaft aufbauen können, eine Gesellschaft, die keine Ausbeutung mehr kennt und keine Ungerechtigkeit.
Wenn der Lehrer wieder einmal so über seinen Vater redete, war es Werner, als drücke ihn etwas auf die Brust, dass ihm beinahe die Luft wegblieb. Doch machte es ihn mächtig stolz und er erzählte seinem Vater abends im Bett davon. Das freut ihn, dachte er.
Manchmal erzählte er ihm auch ganz andere Geschichten, zum Beispiel, dass Hans ihn wieder einmal bei der Mutter verpetzt hatte oder dass im Treppenhaus jetzt eine schwarze Katze mit weißen Tatzen wohnt. Aber leider konnte er ihn nie etwas fragen und seine Antworten hören, zum Beispiel ob das jetzt alles so geworden ist in der neuen sozialistischen Gesellschaft, wie er sich das erträumt und wofür er gekämpft und ihn die Faschisten in den Tod geschickt hatten. Und ob Werner es auch einmal schaffen könnte, ein solcher Held zu werden. Manchmal schlief er darüber ein und stellte sich vor, wie er mit der roten Fahne dem Klassenfeind entgegenzog und der sich feige in die Büsche schlug. Und dann kam manchmal im Traum, ganz, ganz selten, sein Vater zu ihm und nahm ihn in die Arme. Dann waren sie beide keine Helden mehr, nur noch eine schlecht rasierte, kratzende Männerwange und die pflaumenfrische Backe eines Berliner Bengels, die sich zärtlich aneinanderrieben.
Seine Mutter hatte einmal gesagt: „Dein Vater hatte seinen eigenen Kopf. Das hat ihn letztlich das Leben gekostet. Wer weiß, ob es später mit ihm gut gegangen wäre, wenn er den Faschismus überlebt hätte. Als du noch klein warst, nach dem Krieg, mussten wir uns alle schwer am Riemen reißen in unserem neuen Staat. Da wäre womöglich auch kein Platz gewesen für einen solchen Querkopf. Beim Aufbau des Sozialismus mussten die führenden Genossen alles abschneiden und beiseiteschaffen, was nicht ganz geradeaus wuchs, anders ging es eben nicht. Das hat sogar die eigenen Kader erwischt. Und wie ich deinen Vater kannte, hätte er garantiert angefangen zu mosern. Und dann …“ Ja, und dann setzte wieder ihr Schweigen ein, das keine neugierigen Kinderfragen mehr zuließ.
Aber das hätte sein Vater doch sicher gerne erlebt, dass er nach der Schule eine Schlosserlehre machte, wie er. Und dass er, wie er, ein vorbildlicher Aktivist in den gewerkschaftlichen und kommunistischen Jugendorganisationen wurde, ihm nacheiferte in der FDJ, in der DSF, in der GST, im FDGB und beim Fußball sowieso, beim BFC Dynamo. Seinen Vater hätte die Auszeichnung der Mutter als „Heldin der Arbeit“ ganz sicher gefreut: Frau eines verdienten Kommunisten und Opfers des Nazi-Regimes, Genossin der ersten Stunde und vorbildliche Werktätige.
Werner erinnert sich noch genau an die feierliche Ordensverleihung. Er musste gerade 17 geworden sein, jedenfalls war er noch nicht beim MfS, und saß mit seinem Bruder Hans in der ersten Reihe, als seiner Mutter der Orden an die stolz geschwellte Brust geheftet wurde. Er konnte sich so gut an diesen Tag erinnern, weil Hans ihm direkt nach der Feier ein Versprechen der Mutter unter die Nase gerieben hatte: Einen eigenen Motorroller dürfe er sich davon kaufen, eine Schwalbe. Wovon? Von den 5000 Mark, die es zusammen mit dem Orden gab. Hans konnte schon immer besser mit Mutter. Und überhaupt mit den Frauen.
Er hört die Schlüssel in der Zellentür und das Zurückschnappen der Riegel. Sie holen ihn, führen ihn hinunter in den Hof und schieben ihn dort in eine der eingebauten Freigangzellen, rundum zugemauerte, aber nach oben offene Abteile. Er bleibt stehen, zieht die frische Luft tief in sich hinein, dehnt die Brust, reckt den Hals und den Kopf hoch zum Himmel. Der Herbst hat seinem fahlen Blau einen goldenen Sonnenhauch beigemengt. Und der Maschendraht, der die Zelle überspannt, teilt ihn säuberlich in kleine Vierecke auf. Aber der Himmel bleibt nicht. Mal zieht ein weißer Wolkenstreifen von einem Quadrat zum andern um, mal zwängt sich unbotmäßig ein heller Sonnenfleck durch die Maschen, um sich für einen kurzen Lichtblick auf den tristgrauen Spritzputz der Zellenwand zu setzen. Sonst sieht er nichts, nur über seinem Kopf den Laufgang des Wachpersonals, das auf ihn herunterschaut.
Hier war er noch nie. Bewegung immerhin. Und frische Luft. Werner geht von Wand zu Wand, sechs Schritte hin, sechs Schritte zurück, zwölf Schritte hin und zurück, in der Diagonale acht, im Kreis zählt er die Schritte nicht, seine Gedanken wandern von selbst.
Es muss um 1968 gewesen sein. Unsichere Zeiten, wieder einmal. Konterrevolution in der CSSR. Rebellierende Studenten im Westen. Aber ein bisschen Vergnügen musste ja auch sein. Hans nahm ihn auf dem Motorroller zum Schwof in Clärchens Ballhaus mit. Werner auf dem Hintersitz. Sie hatten sich in Schale geschmissen, Krawatte und Jackett, sonst wären sie nicht reingekommen. Dort fielen ihnen die beiden Mädchen auf, wie sie tanzten und lachten, die eine mit burschikosem Bubikopf, frech in Hosen und kariertem Hemd, die andere mit langen Haaren, schon mehr junge Frau, blauer Rock bis an die Knöchel und gelbe Bluse über spitzen Brüsten. Beide flott auf ihren hübschen Tanzbeinen, so was von flott. Natürlich war es Hans, der die beiden anlachte. Aber die Langhaarige hatte Werner gleich so tief in die Augen geschaut, als sie sich zu einer Flasche Wein einladen ließen, dass es ihm bis hinunter zwischen die Beine fuhr.
Das war mal was. Zwei Brüder verknallen sich im gleichen Moment in zwei Schwestern. Wie im Kino. Ein Jahr später Doppelhochzeit, ein fast unzertrennliches Quartett waren sie, aber genau genommen nicht seinetwegen. Er hätte es vorgezogen, in der knapp bemessenen Freizeit mit seiner Frau allein zu sein. Nicht nur wegen der tiefen Blicke und spitzen Brüste. Aber dauernd hieß es, komm, lass uns was mit Hans und Renate machen.
Er ist kein Hans, kein Sonnenschein, kein Frauenheld und Hallodri, nicht immer gut drauf, nicht dauernd was zu lachen. Kaum zu glauben, dass sie dieselben Eltern haben. Christine hat es auf den Punkt gebracht: „Du, Vatersohn, Dein Bruder Hans, Muttersohn.“ Na ja, Christine hat eben Psychologie studiert. Aber mit Hans, dem Muttersohn, da war was dran. Sogar auf Arbeit. Sonst wäre er nicht wie sie zum Bako gegangen, als Konditor in die Mauerstraße, wo sie auf drei Etagen in der Manufaktur Leckereien für Devisen backen und sich seine Mutter ihren Orden redlich verdient hat.
Hans hat oft Nachtschicht. Tags fährt er dann mit der Schwalbe bei seinen Frauen vor und versorgt sie aus dem Bako mit Eiern, Milch und Marzipan. Kürzlich hat ihn die Polizei gestoppt und befragt, warum er drei Stiegen Eier auf seinem Motorroller hat. Aber Hans ist nie um eine Antwort verlegen. Große Familie, hat er gesagt. Müsste es nicht genau anders herum sein? Er, Werner, der Kleinere, der Jüngere, die Zugabe letzter Liebe, müsste nicht er der Muttersohn sein? Vielleicht war er gegenüber Hans von Anfang an im Nachteil.
Werner bleibt zwischen den Mauern seines Käfigs stehen, genau in der Mitte. Wie lange dreht er sich hier schon im Kreis? Er blickt hoch.
Über dem Maschendraht hat sich der Goldschimmerhimmel in eine Grauwolkendecke gewendet.
Er hatte es anders gemacht als Hans. Er hatte seine Familie bei der Firma gefunden.
Oder vielmehr die Firma ihn, vor 26 Jahren. Es war kein Zufall, dass sie gerade ihn beiseitegenommen hatten: einen ernsthaften jungen Mann, Sohn eines anerkannten Verfolgten des Naziregimes (VdN), mit 18 Jahren charakterlich so reif und politisch so zuverlässig, einfach schon so weit, dass er in die Partei aufgenommen wurde. Schon in jungen Jahren eine „allseitig gebildete sozialistische Persönlichkeit“, das bescheinigten sie ihm in der Beurteilung, einer aus der Arbeiterklasse mit gefestigter antifaschistischer, marxistischer Weltanschauung, ohne Verbindung in den Westen, bereit, dem Aufbau und Schutz des Sozialismus zu dienen und die DDR gegen feindliche Angriffe jeder Art zu verteidigen. Schlicht das zu tun, was sein Vater selbst nicht mehr tun konnte.
Er wollte es. Es störte ihn auch nicht, dass sie ihn noch einmal durch die Mühle drehten, nicht nur ihn, auch seine engen Verwandten und Bekannten, dass sie überall herumwühlten und peinlich genau wissen wollten, ob bei Werner Brause tatsächlich Wort und Tat stets so sauber und immer eins waren. So wie es sich für einen künftigen Angehörigen des MfS gehört. Das musste sein, um Opportunisten, Karrieristen, Leute mit Westverbindungen und andere charakterschwache Personen auszusortieren.
Alles lief nach Plan: ein halbes Jahr Wachdienst, Grundausbildung in Potsdam-Eiche, später die anderthalbjährige Ausbildung in Golm für seinen Einsatz in der Hauptverwaltung Aufklärung, der HV A. Er war jung. Seine einzige kleine Schwäche waren James Bond und Sean Connery. Wenn er sich dienstlich in Westberlin aufhielt, zweigte er ein wenig Zeit ab und ging ins Kino. Er ließ keinen der 007-Filme aus, trotz der plumpen Feindbild-Propaganda, die er natürlich durchschaute. Aber dieser smarte Typ faszinierte ihn und zugleich fühlte er sich ihm moralisch haushoch überlegen. Er hätte ihn besiegt im realen Leben. Denn er kämpfte nicht für eine morsche Monarchie, er war James Bond im Auftrag des Genossen Mielke, mitten im Kalten Krieg, in Berlin, der Hauptstadt der DDR und der Hauptstadt aller Nachrichtendienste aus Ost und West, an der Westfront des Klassenkampfs und der Nahtstelle zwischen den Systemen.
Man müsste eigentlich, dachte Werner schon damals, einen eigenen 007 erfinden. Genauso überlegen und unwiderstehlich. Aber richtig herum. Es wollte ihm nicht aus dem Kopf, schließlich sprach er darüber mit seinen Vorgesetzten. Kopfschütteln zuerst, Bedenken, Achselzucken dann. Aber am Ende war es seine Idee, die im Fernsehen eine Erfolgsrakete ohnegleichen zündete: Sie hieß „Das unsichtbare Visier“, die ersten Folgen ab 1973 in DDR 1, Einschaltquoten, die das Westfernsehen alt aussehen ließen. James Bond hieß nun auf gutddrdeutsch Werner Bredebusch und statt Sean Connery machte Armin Mueller-Stahl die Bösewichte fertig. Er tat es mindestens so gut mit seinen endlos blauen Augen, dem verwegenen Schnauzer und seiner speziellen Wirkung auf Frauen. Schon die erste Folge war ein Straßenfeger. Und die Filmmusik wurde ein Hit.
Werner war ein findiger Kopf. Als er noch bei der HV A war, lautete der operative Auftrag, feindlichen Agenten-Verkehr zwischen den Fronten aus dem Hintergrund zu überwachen und zugleich die eigenen Leute möglichst unauffällig hinüber und herüber zu schleusen. Die Überwachung des Feindes war schwer, das Schleusen leicht, solange die Grenze offen war. Nach dem Bau des antifaschistischen Schutzwalls war es umgekehrt. Jetzt wurde die Überwachung an den Kontrollstellen wesentlich einfacher, aber es machte mehr Probleme, die eigenen Einsatzkräfte unbemerkt hin und her zu bewegen. Anfangs waren sie noch viel in den Kellern und Gewölben der Gebäude nahe der Mauer unterwegs, hörten sich um, lagen auf der Lauer. Manchmal zahlte sich ihre Geduld aus und sie entdeckten Tunnel, die unter den Grenzsicherungsanlagen hindurch hinüber in den Westen führten. Dann warteten sie ab und überführten Republikflüchtlinge und kriminelle Helfer auf frischer Tat. Anschließend legten sie die Gänge still. Es war wiederum Werners Idee, einige zu reaktivieren. Für den eigenen Gebrauch.
Sie identifizierten drei besonders geeignete Objekte, bauten sie aus, sicherten und tarnten sie, um Agenten, Kuriere und Material, auch Sprengstoff und Waffen, nach West-Berlin zu bringen oder von dort abzuholen. Ein kleiner, unterirdischer, diskreter Ost-West-Verkehr, auf den sie bald häufiger zurückgriffen, und Werner war immer dabei. Er lernte alle möglichen Kollegen kennen, eigene Leute, die für die HV A ins feindliche Ausland mussten, aber auch Auslands-Agenten befreundeter Dienste. Oder Menschen, die ihm fremd waren, aber avisiert wurden, weil sie mit der Firma zu tun hatten, zum Beispiel als IM in Westdeutschland. Sie mieteten im Westen die Wohnungen mit den Kellern, in die die Gänge mündeten, eines der Häuser kauften sie sogar über einen Strohmann an. Für den Fall, dass er selbst bei einem Einsatz in West-Berlin auffliegen sollte, war er intensiv vorbereitet worden. Auch für ein verschärftes Verhör unter Einsatz amerikanischer Lügendetektoren.
Alles lief wie am Schnürchen. Sie waren zufrieden mit ihm, sonst hätten sie ihn nicht befördert und von der HV A in die 1976 neu gegründete Abteilung XXII versetzt: Terrorabwehr. Seit sich unkontrollierter Terrorismus in der Welt verbreitete, mussten auch sie sich darum kümmern, mussten diesen gefährlich um sich greifenden Bazillus vom Staatsgebiet der DDR fernhalten oder ihn umleiten, am besten in feindliche Regionen.
„Brause, sofort zum Oberst“, hieß es eines Tages nach einer Dienstbesprechung. Das war nicht unbedingt ein gutes Zeichen und Werner konnte es nicht deuten, als er alles stehen und liegen ließ, um sich auf den Weg zu seinem Vorgesetzten zu machen. Zwar hatte er bei seinem Chef einen Stein im Brett, weil er ihn über seine alten Kurier-Verbindungen aus HV A-Zeiten kontinuierlich mit echtem Hennessy Cognac aus dem West-Berliner KaDeWe versorgte. Was eigentlich nicht zu Oberst H. passte, der so gar nichts französisch Feines an sich hatte, sondern eher daherkam wie ein Sachse vom Bauerndorf, kumpelhaft, jovial und häufig ein wenig derb. Aber Werner wusste, dass dieser Mann mit allen Wassern gewaschen war. Und es angezeigt war, auf der Hut zu sein, ihn auf keinen Fall zu unterschätzen.
„Kommen Sie rein, Brause.“ Oberst H. wirkte sichtlich aufgeräumt und Werner entspannte sich. „Nehmen Sie doch Platz, da ist heute etwas ganz Besonderes, das ich Ihnen anvertrauen möchte. Zuhause alles in Ordnung?“ H. wartete die Antwort nicht ab. „Fein.“ Er lehnte sich zurück. Seine Augen fixierten Werner, als wolle er ihn hypnotisieren. „Brause, Sie wissen, dass ich Sie aufgrund Ihrer Haltung, Zuverlässigkeit, aber vor allem wegen Ihrer guten Ideen und herausragenden Leistungen besonders schätze.“
„Danke, Genosse Oberst.“
„Sie sind jetzt schon so lange Jahre im Dienst, stets bereit, immer bereit.“ Der Oberst musste selbst schmunzeln angesichts des Pioniergrußes, bevor er fortfuhr: „Trauen Sie sich zu, einen ganz speziellen Auftrag zu übernehmen? Einen Auftrag, der an Verantwortungsbewusstsein, Anforderungen und vor allem an Geheimnisstufe bei Weitem alles übertrifft, was Sie je für uns geleistet haben.“
Werner hielt seinem Blick stand: „Ich denke schon, Genosse Oberst.“
Der Oberst schien fürs Erste mit dieser Antwort zufrieden. Abrupt erhob er sich und ging hinüber zum Fenster. Eine Weile starrte er hinaus in den milchweißen Dunst, der den braunkohleverrußten Hauswänden gegenüber etwas von ihrer Tristesse nahm. „Brause, es ist eine besondere Auszeichnung, dass ich Sie für diese Operation vorgesehen habe. Und es war nicht einfach, das bis ganz oben durchzusetzen. Wenn ich Sie jetzt weiter informiere, kommen Sie aus dieser Sache nicht mehr raus. Ist Ihnen das klar?
Werner stand auf und nickte.
„Gut, dann hören Sie mir jetzt gut zu. Weil wir diese Sache ganz von vorn beginnen müssen. Und so punktgenau erledigen, als hinge davon der Weltfrieden ab samt der Zukunft unserer sozialistischen Gesellschaft. Kapiert? Das muss alles absolut diskret und reibungslos ablaufen. Mit der notwendigen Distanz, mit Fingerspitzengefühl und absolut geheim. Im gesamten Ministerium bis hinauf in die Spitze wissen gerade mal ein Dutzend Leute davon. Sie gehören nun dazu. Es ist ein Vertrauensbeweis erster Klasse. Wenn Sie das hinkriegen, dann gibt es keine bessere Empfehlung für höhere Aufgaben. Sie sind doch 38, im besten Alter. Da hat man noch viel vor sich …“ Der Oberst blickte Werner vielsagend an.
„Hatten Sie in unserer Abteilung schon einmal direkten persönlichen Kontakt mit Terroristen aus dem Westen?“
„Nein.“
„Auch nicht im Rahmen der Operation ,Stern I’, also zu Leuten aus der RAF?“
„Nein, Genosse Oberst. Nur indirekt. Am Schreibtisch. In der Aufbereitung und Bewertung abgeschöpfter Informationen für die zuständigen Stellen. Persönlich und direkt noch nie.“
„Das ist gut, Brause, sehr gut, wegen der Distanz, die Sie brauchen. Aber das wird sich jetzt ändern, Brause. Und zwar grundlegend.“
Als sein Chef weitersprach, wurde Werner schnell klar: Diesen Auftrag mochte er nicht. Mehr noch, er ging ihm grundlegend gegen den Strich.
Es war, als könnte der Oberst seine Gedanken aus seinem Hirn holen, bevor er sie selbst zu Ende gedacht hatte. Und nicht nur das, auch auseinanderpflücken und wieder neu zusammensetzen: „Brause, Sie fragen sich natürlich, warum soll unser Staat, der es selbst schwer genug hat, sich gegen die ständigen Unterminierungsversuche der Imperialisten zu behaupten, nun auch noch verzogene westdeutsche Bürgerkinder schützen? Die sich als rote Revolutionäre aufgespielt haben und sich jetzt, nachdem sie alles an die Wand gefahren und Muffensausen haben, bei uns verstecken wollen? Ja, Sie haben Recht. Mit unserem historischen Kampf gegen den Imperialismus haben diese Irrlichter so viel oder so wenig zu tun wie Spielpuppen mit dem wirklichen Leben. Die hätten natürlich wissen müssen, dass sie dabei auch mit ihrem eigenen Leben spielen.“
Der Oberst redete sich in Fahrt. „Das alles sind vollkommen berechtigte Fragen. Aber Ihnen ist vermutlich ebenso klar, dass sich die führenden Genossen längst dieselben gestellt und im Interesse unseres Staates gründlich erwogen haben. Und das Ergebnis ist klar: Nein, Brause, wir haben keine grundsätzlich neue Einstellung gegenüber diesen Revolutions-Romantikern. Wir werden diese Leute selbstverständlich nicht aus falscher Solidarität in der DDR durchfüttern. Aber, Brause, trotz allem sind es Genossen. Und immerhin haben die, die jetzt bei uns unterkommen wollen, diesem ganzen RAF-Mist abgeschworen. Die haben was kapiert. Und vielleicht kapieren sie bei uns noch mehr.“
Ein paar Sekunden ließ der Oberst seine Worte wirken, offensichtlich in der Gewissheit, Werner alles Nötige erklärt zu haben. Dann verfiel er wieder in den geschäftsmäßigen und zugleich jovialen Jargon, der ihm eigen war: „Wissen Sie, Brause, wissen Sie, wie diese RAF-Typen ihre Aussteiger bezeichnen? Fehlfarben. Fehlfarben, so sagen die zu denen. Wie bei den Karnickeln. Als wären die eine Mutation. Als hätten die eine genetische Macke.“
H. lachte kurz. Es klang wie drei Schläge auf eine Trommel. „Aber klar, die können ja nicht gut acht oder zehn Fehlfarben in Schwarzafrika verstecken, vor allem wenn die Fehlfarbe weiß ist.“
Erneut fixierte er Werner: „Also noch einmal: Die brauchen uns, wir haben die am Wickel. Schon seit geraumer Zeit. Seit wir sie über Schönefeld ein- und ausfliegen lassen, wenn ihnen der Boden in der BRD wieder mal zu heiß geworden ist. Oder wenn sie zu ihren Freunden in den Nahen Osten wollen. Und manchmal päppeln wir sie bei uns auch wieder auf, wenn sie ganz heruntergekommen sind, und lassen sie bei uns ein wenig üben. Das wissen Sie vielleicht. So haben wir sie wenigstens unter unserer Fuchtel. Und wer weiß, zu was die noch gut sind. Der Genosse Mielke denkt sogar, dass sie uns eines Tages nützlich werden können, im Endkampf: als Saboteure hinter der Front, als Bazillen im Eingeweide des Klassenfeindes. … Na ja …“
So richtig schien der Oberst an diese Idee nicht zu glauben.
„Also, Brause, wir nehmen jetzt erst einmal ihre zehn Albinos und machen daraus ordentliche Kommunisten und DDR-Bürger. Da wartet viel Arbeit, von der Vorbereitung bis zur regelmäßigen Überprüfungskonzeption. Das ist kein Pappenstiel. Dann wollen wir mal.“
Das war es, das größte Staatsgeheimnis, das sein Staat im Kampf gegen die imperialistischen Kriegstreiber im Westen zu hüten hatte. Die Operation „Stern II“.
Was Oberst H. ihm vermittelt hatte, war wohl richtig. Und klar, es schmeichelte, dafür ausgewählt worden zu sein. Dennoch blieb bei Werner ein Befremden hängen, ein unterschwelliger Widerwille. Es ging ihm gegen den Strich, irgendwelche selbst ernannte Revoluzzer, Bildungsbürgerkinder und halbgare Spinner beschützen zu sollen, die so gar nichts mit echten Kommunisten gemein hatten. Sein Vater hätte die erst einmal zu einer richtigen Arbeit verdonnert, damit sie gelernt hätten, was es heißt, ein Werktätiger zu sein.
Als sie daran gingen, „Stern II“ in die Wege zu leiten, tat er es nicht so schwungvoll oder gar begeistert wie sonst, eher ein wenig mürrisch und kühl. Zumal sie sich tatsächlich einen Haufen Arbeit aufgeladen hatten. Zunächst bauten sie speziell dafür in der Unterabteilung XXII/8 Internationaler Terrorismus eine kleine operative Diensteinheit auf. Nur Werner und zwei ihm unterstellte Kollegen. Sie fungierten unter dem harmlosen Namen „Interne Verwaltungsabläufe und Revision“, offenkundig befasst mit rein bürokratischen Angelegenheiten. Keiner scherte sich um Innendienstkram, damit hatte niemand etwas am Hut. Aber es machte die Geheimhaltung ihrer Aktivitäten wesentlich einfacher. Auch innerhalb des MfS. Nicht einmal andere Abteilungen oder die lokalen Stasi-Diensteinheiten vor Ort wurden eingeweiht. Sie berichteten ausschließlich Oberst H. direkt.
Geräusche unterbrechen Werners Kreisel im Käfig. Er bleibt stehen. Auf dem Gefängnishof klacken schwere Stiefel, eine Stimme knarrt: „Brause, raustreten.“
Sie bringen ihn zurück in die Zelle. Der Himmel ist wieder weggesperrt. Sie werden ihn hier schmoren lassen, wahrscheinlich für Tage. Jetzt erst wird ihm in aller Klarheit bewusst, wie tief er in der Patsche sitzt. Warum hat ihn der Oberst nicht längst herausgeholt? Warum gehen sie das Risiko ein, dass er die Nerven verliert?