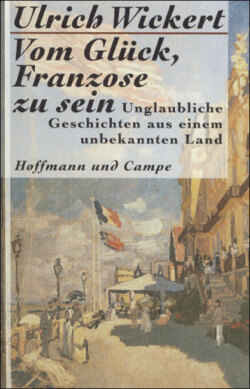Читать книгу Vom Glück, Franzose zu sein - Ulrich Wickert - Страница 5
Die liebenswerten Franzosen
ОглавлениеEs gibt Augenblicke, in denen ein normaler Mensch zu verzweifeln beginnt, nur weil eine technische Kleinigkeit nicht funktioniert, die ein Fachmann mit einem Handgriff und vielleicht einem Ersatzteil repariert. Doch leider sind Könner meist dann nicht zur Hand, wenn man sie braucht. Denn inzwischen hat sich überall in der Welt eingebürgert, daß sich Experten nach strengen Arbeitszeiten richten, und die werden immer kürzer. In Ländern wie den USA oder Deutschland erreicht man – besonders an einem Tag vor dem Wochenende oder gar einem Feiertag – schon ab mittags nur noch den automatischen Anrufbeantworter, der erbarmungslos auf die Öffnungszeit in drei Tagen hinweist. In Frankreich gilt inzwischen die 35-Stunden-Woche, aber glücklicherweise gibt es unter den Franzosen Menschen, die sich von solch modernen Regeln nicht einschüchtern lassen.
Der alte schwarze Uno sprang schon seit langem schlecht an, denn er wurde wochenlang nicht bewegt. Man hätte sich in jene Zeit zurückwünschen können, in der eine Kurbel ausgeholfen hätte. Doch da die Straße vor dem Haus einen steilen Hügel hinabführt, ruckelte der Motor, nachdem die Karre einige wenige Meter gerollt war, wenn man nicht vergaß, die Zündung einzuschalten und den zweiten Gang einzulegen. Dann tat das Benzin, was man von ihm erwartet, es zündete, trieb die Kolben an, und schon schnurrte der Motor, als sei nichts gewesen. Und nach wenigen Kilometern Fahrt war die Batterie wieder so stark aufgeladen, daß eine kurze Umdrehung des Schlüssels für die Zündung ausreichte.
Aber heute rührte sich gar nichts mehr. Gérard, der freundliche Nachbar, der einen Blumenladen in Grasse, hier unten an der Côte d’Azur, betreibt, kam herüber und schaute in den Motorraum, drehte die Stutzen an der Batterie auf, und sein Gesicht erhellte sich: »Ah, da fehlt Wasser.« Als geübter Bastler wußte er, was zu tun war. Gérard rollte den grünen Gartenschlauch neben den orangefarben blühenden Oleanderbüschen auf, öffnete den Wasserhahn und füllte mit Begeisterung und Kennernicken die Batterie auf, obwohl Adrienne zweifelnd fragte:
»Kann man dazu denn Leitungswasser nehmen?«
»Versuchen Sie’s jetzt mal!«
Tatsächlich sprang der leichte, kleine Wagen an, nachdem er nur zwanzig Meter gerollt war und Geschwindigkeit aufgenommen hatte. So konnte Adrienne hinunter ins Dorf fahren und in der abschüssigen Einfahrt von Mireille parken. Ihre beiden kleinen Kinder kletterten aus den Sitzen und sprangen in den Garten.
Währenddessen machte sich das Wasser aus dem Gartenschlauch auf den Weg zu allen Zellen der Batterie und zerstörte heimtückisch, was es – nach Gérards Vorstellung – heilen sollte. So sprang der Wagen überhaupt nicht mehr an. Der Anlasser drehte sich nicht einmal mit jenem bekannten müden Seufzen aus der Tiefe der Motorhaube, das ein Malheur ausdrückt. Gott sei Dank lag am Ortsausgang eine Fiat-Werkstatt.
Der Patron selbst kam an den Apparat, schließlich war es schon kurz nach sechs.
»Madame«, sagte er freundlich zu Adrienne, »morgen ist le quinze août. (Mariä Himmelfahrt. Und an diesem Tag, so weiß jeder Franzose, wird kein Handschlag getan.) Melden Sie sich übermorgen wieder.«
Da schnappte sich die energische Mireille den Hörer, und es sprudelte nur so aus ihr heraus, und zwar mit einer Geschwindigkeit, wie sie nur Franzosen beherrschen: »Hören Sie, Monsieur, c’est l’horreur! – Hier herrscht schlechthin das Grauen. Die junge Frau sitzt bei mir mit zwei weinenden Kindern. Und der Mann wartet darauf, abgeholt zu werden. Es hat schon richtig geknallt zwischen den beiden. Solch einen Ehekrach haben selbst Sie noch nicht erlebt. Sie können sich das gar nicht vorstellen, c’est l’horreur, Monsieur …«
Was in dem Patron vorgegangen sein mag, bleibt einem Fremden verborgen. Aber er reagierte auf jene einmalige Art und Weise, für die man Franzosen liebt: Zwanzig Minuten später startete der Motor mit einer neuen Batterie. Und weil er ja der Patron war, berechnete er nur den Preis für die Batterie, die Arbeitszeit dagegen … »Madame, c’était unplaisir … – Es war mir ein Vergnügen.«
Und auch als am Gründonnerstag die Heizung ausfiel, kam der Monteur noch abends um acht, stocherte mit einem Schraubenzieher so lange im Brenner herum, bis der wieder ansprang. Und auf den Dank antwortete er: »Madame, sonst frieren doch ihre Kinder!« So können Leute miteinander umgehen. Und weil es sich hier um Franzosen dreht, paßt, um den Geist zu beschreiben, der diese kleine Freundlichkeit beseelte, vielleicht das altmodische Wort Galanterie. Gott, sagt der Schwärmer, sind die Leute galant, die Frankreich bevölkern.
Frankreich lieben heißt für etwas schwärmen, das so zu sein scheint wie das Glück, von dem man träumt.
Woanders ist es immer besser. Das wissen wir alle. Und das gilt auch für Frankreich. Doch nehmen wir als Beispiel, um dies zu begründen, nun nicht einen der üblichen Frankophilen, die schon mit dem Deutsch-Französischen Jugendwerk oder über eine Städte-Partnerschaft Bande zu den Franzosen geknüpft haben; schieben wir den Romanisten, den Intellektuellen, den Anhänger Robespierres oder Sartres beiseite und wenden wir uns einer jungen Frau zu, die es in der deutschen Politik noch weit bringen will. Sie wurde, gerade weil sie erst 28 Jahre alt war und damit die Verjüngung der deutschen Politik darstellen sollte, als Kandidatin für die Bundestagswahl im September 1998 aufgestellt: Schließlich verkörperte Andrea Nahles als Vorsitzende der Jungsozialisten die Zukunft der SPD. Sie ist die Essenz eines gewissen deutschen Denkens.
Während des Wahlkampfes 1998 reiste sie durch die Bundesrepublik und kündete, wie es junge Leute tun sollen, von den Wundern einer besseren Politik – und eines besseren Lebens. Der Mensch solle nur noch halb soviel arbeiten und damit mehr Zeit für anderes haben. »In anderen Ländern, etwa in Frankreich«, schwärmte sie, klappe das prächtig. Überhaupt, in Frankreich, da habe man noch Zeit und Sinn für »andere Lebensentwürfe«.
Andrea Nahles behauptet zwei Dinge, von denen zumindest die erste Aussage, die Franzosen arbeiteten weniger als die Deutschen, nicht stimmt. Im Gegenteil, Franzosen arbeiten – so hält es die Statistik fest – sehr viel mehr Stunden in der Woche. Da schließen die Büros freitags nicht um zwei Uhr nachmittags, sondern um sechs oder sieben abends. Dieselbe Statistik verrät aber auch, daß die Franzosen in ihrer längeren Arbeitszeit weniger produzieren als die Deutschen. Das liegt vielleicht an ihrem »Sinn für andere Lebensentwürfe«.
Tatsächlich haben die Franzosen, anders als die Deutschen, ein entspanntes Verhältnis zur Wirklichkeit des Lebens. Eines Tages flog ich mit dem französischen Essayisten und Soziologen Jacques Leehnardt von Berlin nach Paris. Die Maschine landete in Roissy, und Leehnardt nahm mich in seinem alten Peugeot mit in die Stadt. Der verbeulte Wagen war zugemüllt. Vom Beifahrersitz mußten wir erst mal Bücher und eine leere Wasserflasche wegräumen, um Platz für mich zu schaffen.
»Meinen letzten Wagen«, so erzählte Leehnardt, »habe ich verkaufen müssen, da der Gestank selbst durch intensives Lüften nicht mehr zu beseitigen war.«
»Benzingestank?« fragte ich.
»Nein, ich hatte einen Camembert gekauft, den aber im Wagen vergessen und diesen bei größter Hitze drei Tage am Flughafen stehengelassen. So was kommt vor«, meinte er lakonisch. Verkauft hat er den Wagen im Winter, als es bitter kalt und der Gestank »eingefroren« war.
Ähnlich lakonisch gab sich mein Freund Philippe. Sein Leben lang hatte er nicht ernsthaft gearbeitet, da der Glückliche mit einer Erbschaft gesegnet war. Vor den Toren von Paris besaß er ein wunderschönes Wasserschlößchen am Wald von Chantilly, und im vornehmen 16. Arrondissement hatte er sich in einem Neubau eine große Wohnung gekauft.
Kurz nach seinem Einzug lud er zum Essen ein. Das Wohnzimmer wirkte so perfekt eingerichtet, als habe sich ein Innenarchitekt darum bemüht. Verborgene Lichter strahlten die geerbten Bilder von Matisse, Léger und Juan Gris an. Aber in der Diele und im Eßzimmer hingen noch die elektrischen Kabel an der unverputzten Wand.
»Ich weiß noch nicht«, sagte Philippe, »ob ich hier eine Tapete oder einen Wandbezug aus Stoff anbringen soll.« Er sei ja gerade erst vor zwei Monaten eingezogen.
Drei Jahre später wußte er immer noch nicht, ob Tapete oder Stoff. Aber inzwischen hatte nicht nur er sich, sondern hatten sich auch seine Freunde an den Zustand des Unfertigen gewöhnt.
Irgendwann, es mag fünf Jahre später gewesen sein, hat er einen eleganten Stoff spannen lassen.
Philippe ist kein Einzelfall. Wenn Gérard zu Sommerfesten an seinen Swimmingpool einlud, dann geschah das immer mit dem Hinweis, daß dieser noch nicht ganz fertig sei. Gérard hatte immer noch keine Steine um das Becken legen lassen. Sie waren zwar schon zwei Jahre lang in einer Ecke des Gartens gestapelt, aber …
Es muß nicht immer alles fertig und perfekt aussehen: Dies mag ein sympathischer Grundzug des französischen »Lebensentwurfs« sein.
Bevor wir uns weiter der Eigenart des französischen Lebensentwurfs widmen, sei eine kleine Zwischenbemerkung erlaubt: Selbst äußerst kritische Geister benutzen im täglichen Sprachgebrauch, wenn sie von einem Volk reden, immer wieder den Plural, sprechen von den Deutschen, den Franzosen, den Italienern etc. – aber dann stellt immer irgendwer die Frage: »Gibt es die Deutschen, die Franzosen … überhaupt?«, um dann gleich anzufügen, daß es die natürlich nicht gebe. Aber es dauert nicht lange, und wieder verfallen alle, die sich im Gespräch über »die Deutschen« etc. befinden, in den Plural. Das sei, bitte schön, auch hier gestattet. Schließlich wissen wir, daß der Plural eigentlich falsch angebracht ist, da die Deutschen schließlich keine Deutschen, sondern Bayern, Hessen oder Preußen sind, die Franzosen aber Korsen, Basken oder Bretonen. Aber trotzdem gibt es sie, die Franzosen – zumindest wenn man über sie redet.
Ja, ja, schon gut: Wenn wir dennoch von den Franzosen etc. sprechen, wissen wir, daß wir nicht das Kollektiv meinen, sondern einen gewissen Typus, eben den mit dem Camembert, der Baguette und der Baskenmütze. Schließlich haben die Franzosen auch ein gemeinsames Selbstverständnis und Grundvertrauen, weshalb sie sich alle, wenn sie von ihrem »Lebensentwurf« sprechen, etwas Gemeinsames darunter vorstellen können: etwa den Begriff der exception culturelle. Wenn es die kulturelle Besonderheit ihres Landes in Europa zu verteidigen gilt, gehen die Franzosen auf die Barrikaden, während die Deutschen entweder für den französischen, italienischen, amerikanischen, tibetanischen Lebensentwurf schwärmen oder hoffen, ihre eigene kulturelle Besonderheit möge sich möglichst schnell in Europa auflösen.
Die exception française als Lebensentwurf stellt sich gegen jene Gesellschaften, die sich nicht kulturell, sondern wirtschaftlich definieren, die sich als freie Marktwirtschaft bezeichnen oder die im Zeichen der Globalisierung das Leben modernistisch dem möglichst freien Wettbewerb der Kräfte unterwerfen und um die Deregulierung wie um ein goldenes Kalb hüpfen. Alle politischen Parteien Frankreichs bekennen sich zur exception française. Dies bedeutet, daß der französische Lebensentwurf eine kulturelle Grundlage hat, der sich wirtschaftliche und politische Theorien zu unterwerfen haben – und nicht umgekehrt, wie in den USA, in Großbritannien oder Deutschland.
Man sollte jedoch nicht glauben, die exception française ließe sich mit einem Wort erklären oder in einem einzigen Gedanken zusammenfassen. So ist es auch kein Wunder, daß sich Frankreich bis hinein in die Staatssymbole von anderen großen Nationen Europas unterscheidet. Britannia etwa und Germania sind Machtfiguren. Britannia rules the waves, herrscht also über die Ozeane der Welt; und die Germania trägt einen Brustpanzer samt Schwert. Aber es ist die Ausnahme, wenn Marianne, die Frankreich symbolisiert, ein Schwert neben sich auf den Boden stellt. Meist liegen die Waffen zu ihren Füßen, denn Marianne ist friedlich. Das zeigt sie mit ihrem entblößten Busen. Und sollte das nicht liebenswert sein?
Marianne verkörpert nicht nur die äußere Macht jenes Landes, das sich lange Zeit eine – eine?, nein: die grande nation nannte, sondern auch dessen Seele. Eine Macht läßt sich durch Truppen- und Waffenstärke definieren, eine Seele jedoch nicht. Und das ist das Schöne an Marianne, daß sie auf der einen Seite einen abstrakten Staat darstellt, auf der anderen Seite aber spricht ihre entblößte Brust von der Wirklichkeit des Volkes.
Marianne ist ein Kind der Französischen Revolution. Deshalb wird der Tag, an dem die Bastille gestürmt wurde, auch gern als Namenstag der Sainte Marianne bezeichnet. Die neue, aus der Revolution hervorgegangene patrie wurde als weiblich empfunden und geliebt. Da wird kein männliches Vaterland verehrt, das höchstens mit dem gruseligen Namen Bertha versucht, einer Kanone weiblichen Klang zu verleihen. Nein, verehrt wird la patrie nicht, das würde eine zu große Distanz zum citoyen, zum Bürger, herstellen. Man soll la patrie wie eine Frau lieben – mit all dem Ach und Weh, das solch eine Gefühlsaufwallung mit sich bringt.
Doch wie kamen die Revolutionäre auf den Namen Marianne? Im 18. Jahrhundert lautete der beliebteste Frauenname Marie-Louise, an zweiter Stelle folgte Marie-Anne. Da die französischen Könige häufig Louis hießen, war der Name Marie-Louise mit schlechten Andenken belastet. Dagegen bot sich den Revolutionären Marianne aus mehreren Gründen an. Es war nicht nur ein beliebter Name, sondern damit verband sich auch die symbolische Idee eines jungen, geliebten Mädchens, das zu erobern sich der in Liebe entbrannte Junge vornimmt. Zur Melodie eines klassischen Liebeslieds sang man schon in alten Zeiten in der Auvergne: »La bouole lo Mariano – la bouole, omaï l’aurai. (Ich will sie, die Marianne, ich will sie und werde sie haben.)« Durch diese beliebte Volksweise wurde der Name Marianne in Frankreich so populär, daß man ihn immer dann benutzte, wenn man ein geliebtes weibliches Objekt symbolisieren wollte; und so wurde die Marianne aus dem auvergnatischen Liebeslied zum Inbegriff der vom Verschwinden bedrohten okzitanischen Sprache.
Kein Volk scheint ohne Symbole auszukommen. Könige besitzen seit alters her Siegel und Wappen, in denen starke, wilde Tiere (Löwen, Bären oder Adler) die Macht verkörpern. Nun hatten die Franzosen aber ihren König und dessen Marie-Antoinette um den Kopf gebracht. Und so standen die Revolution und ihre neugeborene Republik nackt und ohne Wappentier da. Im Überschwang der Gefühle, vor lauter Liebe zu dem, was sie die universelle Revolution nannten, wählten die neuen Herren jene Marianne als ihr Wahrzeichen, das von nun an, mit einer etwas seltsamen Zipfelmütze versehen, leicht gekleidet, meist mit dem vollen Busen als Republik und Freiheit auftrat und den imperialen Adler verdrängte.
Ein einziges Tier hat im französischen Wappen die Revolution überlebt, und das tat es wahrscheinlich auch nur deshalb, weil es niemandem angst macht – der gallische Hahn. Seine Herkunft ist kein besonderes historisches Verdienst. Nur weil die Gallier herausfanden, daß der Gockel im Lateinischen gallus heißt, sahen sie eine Familienverwandtschaft zwischen gallus und Gallier.
Allerdings zog Napoleon für sein Wappen den König der Lüfte dem Herrscher des Hühnerhofs vor. Vielleicht behaupten die Franzosen deshalb, der Hahn stehe links, sei aber eher liberal denn radikal. In der Karikatur sieht man ihn auch in diesen Tagen noch häufig – Federn lassend und laut kreischend – vor dem deutschen Adler fliehen. Der Hahn schreit auf französisch: »Cocorico« statt wie im Deutschen »Kikeriki« – er hat also eine etwas tiefere Stimme. Und weil Hähne, besonders derjenige, der Frankreich symbolisiert, vor Stolz fast platzen, hat sich das Cocorico des Hahnes in der französischen Sprache zu einem eigenständigen Begriff entwickelt und bedeutet so etwas wie einen nationalistischen Brunftschrei.
Kein historisches Ereignis prägte Frankreich so sehr wie die Revolution, deren Feier zum 200. Geburtstag die ganze Welt in Atem hielt – schon allein deswegen, weil der französische Staatspräsident François Mitterrand den in diesem Jahr in Frankreich stattfindenden Weltwirtschaftsgipfel ganz bewußt zum 14. Juli nach Paris eingeladen hatte. An der Festparade sollten Dutzende von Staatsoberhäuptern und noch mehr Regierungschefs aus befreundeten Staaten teilnehmen.
An der Place de la Concorde wurden für 16000 Ehrengäste Tribünen aufgebaut. Knapp eine Woche vor der Veranstaltung fiel dem Festkomitee auf, daß für diese 16000 Menschen nicht eine einzige Toilette vorgesehen war. Nach einem kurzen Augenblick der Panik rief jemand bei einem Sanitärunternehmen an, das transportable WCs vermietet, und erkundigte sich, wie viele Häuschen denn für diese große Zahl vonnöten wären. Man nehme als Vorbild immer ein großes Langstreckenflugzeug, war die Antwort, das sei mit acht Toiletten ausgerüstet. Das Komitee rechnete nach und beschloß, für die 16000 Geladenen großzügig vierhundert Einheiten zu bestellen.
Nun konnte die Parade stattfinden. Sie dauerte vier Stunden. Nach einer Stunde verspürte eine äußerst hochgestellte Persönlichkeit jenen unwiderstehlichen, lästigen Druck auf die Blase und richtete an eine der Hostessen auf der Tribüne die Frage:
»Pardon, Mademoiselle, wo sind denn die Toiletten?«
»Ich fürchte«, antwortete sie, »es gibt keine. Aber ich werde Sie zur Organisationsleitung begleiten, und dort können wir fragen.«
Dort lautete die Antwort ganz unbeteiligt: »Nein, keine Sanitäranlagen.«
»Aber in der Zeitung hat doch gestanden, es würden vierhundert bereitgestellt …«
»Ich weiß, aber wie das so ist, es gibt keine. Und fragen Sie mich nicht, warum, denn ich weiß es nicht. Sie können sich ja mal an die Polizei wenden …«
Der erste Gendarm erklärte: »Nein, ich weiß auch nicht, was Sie da tun können …«
»Aber es drängt. Können wir Ihren Vorgesetzten fragen?«
Der zweite Gendarm war mit mehr Ehrenzeichen versehen und hatte einen höheren Rang: »Also gut, ich werde Ihnen die Absperrung an der Ecke der Avenue Gabriel öffnen, und dann – débrouillez-vous – schauen Sie zu, wie Sie zurechtkommen.«
Gesagt, getan. Der Gendarm fügte noch mitleidig hinzu: »Die armen Damen …«
Dem ersten Würdenträger folgten viele andere, so daß es in der Hitze des nächsten Tages an der Ecke der Avenue Gabriel so penetrant stank wie seinerzeit, als es in Paris noch keine Kanalisation gab, weshalb der König die Stadt verließ und sich ein Schloß in Versailles bauen ließ. Das Pikante an unserer Geschichte ist: An der Ecke der Avenue Gabriel befindet sich die amerikanische Botschaft.
Dieses Verhalten sei typisch für den französischen Staat, meint der Publizist Jean Vermeil. Er plustert sich oben auf, aber unten kümmert er sich um nichts. Oder aber, wie mein Metzger in der Rue de Varenne zu sagen pflegte: Der Hahn ist das einzige Tier, daß selbst noch hurra schreit, wenn es mit den Füßen im Mist steckt.
Marianne hat in den mehr als zweihundert Jahren seit der Revolution nichts an Bedeutung eingebüßt. Auf der Briefmarke prangt ihr Konterfei; eine Büste der Marianne steht in jeder Mairie. Daneben hängt das offizielle Foto des jeweiligen Staatspräsidenten, als bildeten sie ein Paar: sie, die dauerhafte Königin, er, der vergängliche Regent. Und wie nah Marianne dem Volk ist, zeigen ihre Gesichtszüge. Sie drücken keine hehren Ideale aus, sondern sollen Frauen des Volkes sein. Nun gut, auch da gibt es Unterschiede. Doch nicht die politische, kulturelle oder wirtschaftliche Bedeutung einer Frau führt dazu, daß Marianne nach ihren Gesichtszügen modelliert wird.
Die Liebste ist dem Liebenden immer die Schönste. Und das gilt auch für die Marianne. So werden Leinwandschönheiten, wie etwa Brigitte Bardot oder Catherine Deneuve, als Vorbild für die Gipsstatuen in den Rathäusern genommen. Einem Deutschen würde eine Schauer über den Rücken laufen, würde Germania einer Schauspielerin ähneln. Es würde als Sakrileg beklagt oder als Kitsch belacht – schließlich ist Germania für die meisten Deutschen inzwischen auf dem Sperrmüll gelandet.
Man liebt Frankreich, weil Frankreich sich durch Frauen definiert, und die Frau wiederum ist die Inkarnation der Liebe. Wobei sich die philosophische Frage stellt, was denn wohl zuerst da war, die Liebe oder die Frau? Lieben wir Frankreich, weil es die Liebe zur Frau ausdrückt?
Neben Marianne taucht auch die Säerin auf Geldstücken oder Scheinen auf – als Symbol des Fortschritts wie auch des bestellten Ackers. Doch manchen männlichen Kritikern ging das im letzten Jahrhundert entschieden zu weit: Da maßt sich eine Frau einen Männerjob an und sät auch noch falsch. Denn der nach hinten wehende Schal zeigt, daß sie den Samen gegen den Wind streut. Und welcher Bauer würde über den Acker barfuß laufen? Aber wenn es um Mythologie geht, ist viel erlaubt. Was haben die Göttinnen der griechischen Sagenwelt den Männern im Kampf um Troja nicht alles abgenommen!
Marianne ist jedoch keine Figur mit einem eindeutigen Charakter. Anfang dieses Jahrhunderts wird das Leben der Marianne in der Zeitschrift »L’Assiette au beurre« in vielen bebilderten Szenen erzählt. Ihr Vater, ein Arbeiter, hebt auf den Barrikaden die Neugeborene mit beiden Armen hoch. Ihre ersten Schritte macht sie an der Hand eines alten Mannes mit dem Gesicht von Victor Hugo in einer Umgebung, die an Jean Valjean und Cosette aus »Les Misérables« erinnert. Zur Mademoiselle gereift, läßt sich Marianne versuchen – von einem Soldaten, einem hohen Beamten, einem reichen Bourgeois. Dick geworden, weigert sie sich schließlich, in dem Bettler eine Jugendliebe wiederzuerkennen, bis sie als alte Vettel volltrunken von einem Geistlichen und einem Offizier ins Hospital gebracht wird.
Marianne stellt mindestens zwei Frauen dar. Die eine ist das jeweils wechselnde Regime, die andere die Nation – une et indivisible, einmalig und unteilbar. Unter Mariannes Namen verbergen sich auch zwei unterschiedliche Sichtweisen von der Republik: »La nôtre – die Unsere«, eine junge hübsche Frau mit nacktem Busen, zwischen einem sympathischen Soldaten und einem netten Arbeiter, hält eine große Fahne; »la leur – die der anderen«, eine fette Frau mit Küchenschürze tritt auf die Gesetzestafeln und greift mit vollen Händen in den Staatssäckel. Die eine Frau nennt sich »die Republik«, die andere »die Macht«.
Selbst unter den Linken ist man sich nicht einig, wie man diese Frau bewerten soll. Von den einen wird Marianne geliebt, von den anderen gehaßt. Bei Arbeiterdemonstrationen im 19. Jahrhundert waren Frauen selten zu sehen, doch wenn sie sich einmal emanzipiert hatten, dann liefen sie in der vordersten Reihe mit und trugen die Fahne. In den Parteibüros der Sozialisten und zu Hause bei den Genossen entwickelte sich ein wahrer Mariannenkult. Für diesen Teil des Proletariats war Marianne eine Art Madonna, die in ähnlicher Weise verehrt wurde wie Mutter Maria von den Katholiken.
Der andere Teil des Proletariats lehnte sie ab, da sie die Republik verkörperte, eine Republik, die als bourgeois verteufelt wurde. Marianne soll – als Symbol der Republik – das Volk einen, doch sie ist umstritten, weil auch die Republik keine einhellige Zustimmung erfährt. Das macht eben den Charme Frankreichs aus. Nichts ist eindeutig. Nichts entspricht einer festen Ordnung. Das mag derjenige sympathisch finden, der aus einem Land stammt, in dem die Ordnungswut herrscht. Das französische Chaos entschuldigt so vieles. Doch Jean Vermeil klagt: »Unordnung ist unser größtes Übel. Wir tun so, als wären wir stolz darauf: Das sei eben unser gallischer Einschlag, le baroud d’honneur (ein Scheingefecht), das einige Stämme noch einmal führten, bevor sie sich der Pax Romana unterwarfen. Unsere Unordnung ist das Kind von Lügen und Erfindungen.«