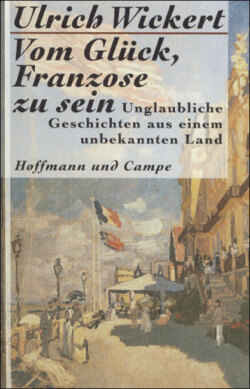Читать книгу Vom Glück, Franzose zu sein - Ulrich Wickert - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Warum wir dennoch an den Franzosen verzweifeln
ОглавлениеEs gibt so viele Gründe, Frankreich und seine Bewohner zu mögen. Doch Franzosen können auch unerträglich arrogant sein, nicht nur wenn man sie mit ausländischen Augen beurteilt. Und ich kenne Leute, die voller Abneigung gegen die Franzosen sind, weil sie sich von ihnen als Untermenschen abgelehnt fühlen.
»Ach, was sind die Italiener dagegen für liebenswerte Menschen«, sagen sie. »Wenn man die nach dem Weg fragt, überschlagen sie sich vor Höflichkeit, während ein Franzose auf die Leute hochnäsig herabschaut, die nicht mindestens so gut französisch sprechen wie sie selbst.«
Ich liebe Frankreich, denn es ist mir eine Heimat geworden. Dennoch bin auch ich nicht frei von Zweifeln. Sie fangen vielleicht schon morgens an, bei der Bushaltestelle auf dem Boulevard Saint-Germain, in der Höhe der Rue du Bac. Wie überall in der Welt kommt der Bus Nummer 83, mit dem ich morgens zur Arbeit fahre, für meine Bedürfnisse viel zu spät, denn er steckt, wie überall auf der Welt um diese Zeit, mitten im Verkehrschaos. Dann drängen sich die Passagiere hinein, und zwar nach dem Motto: Wer zuerst drin ist, kommt auf jeden Fall mit. Einer Frau oder gar einem alten, gebrechlichen Menschen den Vortritt zu lassen, scheint keiner gelernt zu haben. (Als ich im Alter von etwa fünfzehn Jahren in der Metro aufstand, um einer Frau meinen Sitz anzubieten, sprach mich ein Franzose staunend an und fragte: »Sie sind doch sicher Ausländer?« – »Wieso?« – »Ein französischer Junge wäre nie aufgestanden.«)
Und weil die Franzosen einfach nicht verstehen, weshalb sie sich hinter einen anderen in einer Schlange anstellen sollen, sei es an der Kinokasse, beim Bäcker oder an der Bushaltestelle, wurde zumindest hier in den fünfziger Jahren eine Regel gehandhabt, um Ordnung zu schaffen und die rücksichtslos drängenden Franzosen in Bahnen zu lenken. An jeder Haltestelle hing in Augenhöhe ein Kasten, aus dem der auf seinen Bus wartende Passagier ein längliches Stück Papier mit einer eingestanzten Nummer zog. Fuhr der Bus vor, erkundigte sich der Schaffner nach der niedrigsten Nummer und rief dann die Nummernfolge auf – ähnlich, wie es heute beim Besteigen der Flugzeuge üblich ist: zuerst die Reihen fünfzehn bis dreißig, dann … – Sie wissen schon, was ich meine. Wessen Zahl der Schaffner aufrief, der stieg ein.
Dieses Ordnungsverfahren wurde meist nur dann angewandt, wenn es notwendig war, morgens oder abends, wenn die Busse schon überfüllt an der Haltestelle vorfuhren. Dann brauchte man sich nicht dem Kampf mit den Ellenbogen auszusetzen, sondern war sicher, in der richtigen Reihenfolge aufgenommen zu werden, mußten doch die mit einer höheren Nummer, weil später gekommen, warten – allerdings ohne sich demütig in eine Schlange einordnen zu müssen. Hintereinander anstehen scheinen Franzosen als Zumutung, ja als Erniedrigung zu empfinden; denn da stand man sichtlich hinter jemandem, der bevorzugt war, da er ja zuerst in den Bus steigen durfte, und damit war man selber einem anderen unterworfen, wenn auch nur in einem ordnenden System.
Aber leider wurden eines Tages die Schaffner abgeschafft, dann die alten Busse, bei denen man hinten auf einer Plattform einstieg – und die Reise im Freien genießen konnte –, und schließlich auch die Kästen, an denen man sein Nümmerchen zog: denn jetzt gab es ja keinen Schaffner mehr, der sie ausrufen würde.
Der »83er« gehörte zu einer der letzten Buslinien, die noch eine Plattform hatten, wenn auch nicht die, wo man von hinten während der Fahrt aufspringen konnte. Selbst im Winter stand man bis zum Schluß draußen. Nach dem Motto: Besser in der mit Abgas geschwängerten Luft von Paris als drinnen im engen, feuchten Menschenmief.
Heute quetscht man sich vorn am Chauffeur vorbei in den Leib des Busses, weist seine Monatskarte vor oder entwertet sein Billet, in dem man es in den Schlitz eines Automaten steckt, der hinter dem Sitz des Fahrers angebracht ist und mit einem elektronischen Piepsen dem Fahrschein seinen Wert abringt. Und dann drängt man sich nach hinten. Ja, und schon tritt mir die Nachbarin mit dem spitzen Absatz auf den Fuß. »Aii!« – ruft man in Frankreich, wenn es weh tut, statt »Aua!«. Dabei dehnt man das »i« je nach der Stärke des Schmerzes.
Aus Reflex hätte ich mich bei der Dame fast dafür entschuldigt, daß mein Fuß unter den ihren geraten ist. Aber sie verzieht keine Miene, so als habe sich nichts ereignet. Wenigstens ein entschuldigendes Lächeln könnte sie mir doch gönnen, wenn schon kein »Pardon«.
Aber dann sage ich mir: Sie ist doch Französin! Und ich versetze mich in die Dame hinein und verstehe. Weil sie Französin ist, weiß sie nicht, daß Menschen sie umgeben. Vielleicht ist sie zu spät aufgestanden, vielleicht ist der Bus wieder im Verkehr steckengeblieben und zu spät dran. Dann mußte sie sich mit aller Gewalt noch durch die Tür kämpfen, und jetzt denkt sie an Jules, das Büro und vielleicht auch an ihr Kind, das sie trotz leichten Fiebers eben noch im jardin d’enfants abgeliefert hat. Sie fährt irgendwie ganz allein im überfüllten Bus und nimmt niemanden um sich herum wahr. Sie hat sich in sich selbst zurückgezogen. Sie schaut in sich hinein, als übe sie Zen, Yoga oder autogenes Training …
Dieses Verhalten ist anerzogen, es gehört zum guten Ton und hat mit dem Begriff discrétion zu tun, einer Verhaltensweise, für die ich die Franzosen liebe. Die Bourgeoisie, die heute noch den Stil prägt, versteckt ihre Häuser hinter hohen Mauern. Dieses Versteckspiel hängt auch damit zusammen, daß die Bourgeoisie schon zu Beginn ihrer sozialen Entwicklung von der christlichen Kirche beschuldigt wurde, nur an den Gewinn zu denken und nicht an die Menschen, die für sie arbeiteten. Den Gewinn versteckt die Mauer. Sich so nach außen abschotten, das kann mit dieser Perfektion nur ein Franzose. Und wer nicht gelernt hat, mit der dadurch entstehenden Distanz umzugehen, der bricht leicht in Haßtiraden über die unzugänglichen Franzosen aus.
Wenn Sie zu einem förmlichen Abendessen eingeladen werden, dann mag Ihr Tischnachbar ein äußerst eleganter Franzose sein. Sie sehen seiner dezenten Kleidung zwar nicht die neueste Mode, aber den teuren Schneider an, dem Haar den wöchentlichen Besuch beim Friseur und den Händen die professionelle Maniküre. Während des Essens unterhalten Sie sich angeregt und intelligent, denn der Mann ist galant und gebildet. Zu jedem Thema kann er beisteuern, was de Gaulle, Montesquieu, Lacan oder Sartre dazu dachte, was Bourdieu, Finkielkraut, Crozier oder BHL (so bezeichnen Wissende den inzwischen schon etwas älteren nouveau philosophe Bernard-Henry Lévy) in diesem oder jenem Fall sagen würde. Und wenn Sie sich gegen Mitternacht begeistert von den Gastgebern verabschieden und erwähnen, wie vorzüglich Sie sich unterhalten hätten, dann werden Sie plötzlich nachdenklich anhalten und sich erkundigen, wer das wohl war, neben dem Sie zwei oder gar drei Stunden saßen. Von ihm selbst haben Sie nichts erfahren: weder seinen Namen noch den seines Schneiders, nichts über seine Tätigkeit, keinerlei Andeutung seines Berufs, schon gar nicht seine eigene Meinung. Sie haben sein Inneres nicht einmal von außen gesehen. Er hat Sie mit zwar höchst interessantem, aber in jeder besseren Bibliothek nachzuschlagendem Wissen unterhalten. Über sich selbst hat er geschwiegen.
So sieht die Perfektion des sich In-sich-selbst-Zurückziehens aus, wie Franzosen es lieben. Einem Fremden mag dieses Verweigern der eigenen Person leicht als Arroganz vorkommen. Doch von Ihnen wird die Diskretion verlangt, nicht nach dem zu fragen, was der andere nicht von sich aus sagen will. Es gehört zum guten Ton, in einem Gespräch mit dem richtigen Gebrauch der Sprache zu glänzen, wie es überhaupt einer guten Erziehung entspricht, an jedem Gespräch lebhaft teilzunehmen, wobei nicht der Inhalt, sondern an erster Stelle die Form des Gesagten beurteilt wird. Und obwohl Franzosen viel reden können, ohne etwas zu sagen, so wissen sie doch auch im rechten Moment zu schweigen.
Und deshalb schauen Mitglieder der oberen Kasten auf das Volk nieder, das beim Spaziergang auf dem Land oder im Wald auch einem Fremden ein freundliches Bonjour zuruft. Das ist in dem Verständnis nobler Leute doppelt falsch, denn der gute Ton verlangt, daß ein Gruß unweigerlich mit der Bezeichnung Monsieur oder Madame verbunden wird. Die richtige Begrüßung (oder Verabschiedung) findet nüchtern und ohne viele Worte statt. Vielleicht gibt man sich die Hand, und eventuell nickt man sogar mit dem Kopf. »Bonjour, Madame – bonjour, Monsieur.«
Das Schweigen dient als Vorlauf zum nun folgenden Gespräch oder als dessen Abschluß.
Das Schweigen kann aber auch als Ablehnung gedacht sein, um einen mißliebigen Gesprächspartner in seine Schranken zu weisen; der andere wird ignoriert, nicht gesehen und damit von jedem weiteren Gespräch ausgeschlossen. In beiden Fällen lebt das Schweigen von den Worten, die ihm vorangegangen sind, die folgen oder die erwartet, aber ganz bewußt zurückgehalten werden. So setzt das Schweigen das Sprechen fort. Im richtigen Augenblick zu schweigen gilt als Zeichen guter Erziehung. Indem er das Schweigen in das Regelwerk zwischenmenschlicher Beziehungen einbezieht, will der vornehme Franzose sich von den niedrigeren Klassen absetzen, bei denen Stille ein Laster und Lärmen eine Tugend ist.
Das Schweigen dient dem einzelnen aber auch als notwendiges Gegengewicht zum manchmal erdrückenden Einfluß der häufig immer noch sehr geschlossenen Familien. Von einer Anfang des Jahrhunderts geborenen Frau stammt folgende Schilderung: »1916 ist meine Cousine, die mein geistiger ›Zwilling‹ war, gestorben. Nach einem Monat auf dem Land haben wir uns zum ersten gemeinsamen Diner versammelt, die Stimmung war so bedrückend, daß ich in Tränen ausbrach und den Tisch verließ. Niemand ist mir gefolgt, niemand hat mich getröstet, niemand hat am nächsten Tag davon gesprochen. Alle hatten verstanden, aber man hatte eine große Scheu vor Gefühlen und achtete den inneren Bereich eines jeden. So haben einige Dramen in unserer Familie stattgefunden, ohne daß auch nur ein Wort darüber gewechselt wurde; Dramen, die man nur durch irgendwelche Zeichen verstand, die man mit Besorgnis aufnahm. Auf das kleinste Zeichen hin wäre man sofort bereit gewesen zu trösten. Aber ohne das hätte man sich keinen Blick des Mitleids erlaubt.«
Der französische Sozialwissenschaftler Eric Mension-Rigau meint, der Sinn für das Schweigen erkläre sich bei den stilbildenden Schichten in Frankreich möglicherweise durch die Tatsache, »daß diese Leute in einer Umgebung leben, in der Gewalt nur in Form von Sprache erlaubt ist. Dadurch haben die Betroffenen ein starkes Bewußtsein dafür entwickelt, daß auch Worte lebensgefährliche Verletzungen beibringen können. Die Weisheit lehrt sie deshalb, voreilige Worte zu meiden und lieber zu schweigen.«
Wer lang genug unter Franzosen gelebt hat, weiß dieses Verhalten – in Grenzen – zu genießen. Es kann aber auch äußerst lästig sein, nicht wahrgenommen zu werden. Wer an einem Montagvormittag in Paris einen Laden betritt, der mag das Pech haben, daß die drei Verkäuferinnen gerade mit sich selbst beschäftigt sind. Sie stehen in einer entfernten Ecke, reden und gackern, als seien sie allein auf der Welt. Sie müssen die Erlebnisse vom Wochenende austauschen, und da stört der Fremde nur, der der Einfachheit halber nicht bemerkt wird.
Die Franzosen heben gern hervor, sie seien gegenüber den unhöflichen Teutonen nicht nur viel zivilisierter, sondern sie gingen mit Kunden auch sehr viel freundlicher um. Und sie glauben sogar, was sie da sagen. Aber auch hier zeigen die Franzosen ihre Extreme. Wir haben es erlebt. Geradezu katastrophal endete der Versuch, in der Marina Baie des Anges bei Nizza den – wie er sich selbst nennt – »größten Fitness-Club der Côte d’Azur« auszuprobieren. Die Baie des Anges ist eines jener gräßlichen Architektur-Monstren, die aus weiter Entfernung von einem Boot auf dem Meer originell wirken. Elegant schwingen sich zwei im Halbrund gebaute, pyramidenförmige Hochhäuser um einen Jachthafen. Doch einmal drinnen, erschlägt einen der Beton.
An einem Ende des Hafenbeckens befindet sich der in Ellipsenform angelegte Club Biovimer. Biologie, Leben und Meer verbindet dieser Name. »La Thalasso« bietet er an, er wirbt also mit der Heilkraft des Meerwassers; Salzwasser gehört zwar zu den ältesten Kuren im Mittelmeer, aber heute wird dem ein moderner Klang verliehen – und eine besondere, nämlich verjüngende Wirkung.
An einem regnerischen Samstag im April kamen wir auf die Idee, den Club – von dem wir uns schon Monate zuvor Prospekte besorgt hatten – auszuprobieren. Die Preise waren horrend. Ich rief an und fragte:
»Bieten Sie einen Einführungstarif an?«
»Die Tageskarte kostet 300 Franc.«
»Aber gibt es für Leute, die den Club erst einmal kennenlernen möchten, eine ermäßigte Karte?«
»Es gibt jeden Abend um 18 Uhr eine Führung.«
»Aber es gibt keinen Schnuppertarif?«
»Nein. Da müssen Sie bei unserem service commercial anrufen, der ist am Montag wieder besetzt.«
Wir sind dennoch hingefahren. Inzwischen regnete es. Es hat lange gedauert, bis wir einen Parkplatz fanden. Der Eingang des Club ist wie in einem Hollywood-Film weitläufig und prunkvoll angelegt. Dort schiebt die Empfangsdame ein ellenlanges Formular über die Theke, das zu bewältigen den Besitz einer Lesebrille voraussetzt, die aber zu Hause liegt. Denn wer nimmt schon die Lesebrille mit in die »Thalasso«? Mit dem Formular geht man zur Kasse und steht ewig an, denn das Formular muß bearbeitet werden. Keine Angestellte macht auch nur die geringste Anstrengung, Neulingen den Weg zu weisen. Also erkundige ich mich, werde an eine Garderobe geschickt, wo eine muffige Frau – ja, sie war wirklich dick und häßlich – den Ansturm der Gäste nicht bewältigt.
Das geheizte Meeresbad im Freien mit Überlaufkante tröstet über die ersten Enttäuschungen hinweg, wenn auch auffällt, daß die Mosaiksteine am Rand dutzendweise abfallen. Man hat den Eindruck, im Mittelmeer zu schwimmen. Die Luft ist kalt, es regnet, aber das salzige Wasser trägt den Körper und verleiht ihm eine angenehme Leichtigkeit. Die verliert er sofort wieder nach dem Anblick der Sauna. Die Türen faulen, weil es in Frankreich üblich ist, eine Einrichtung nicht ständig zu unterhalten, sondern sie einfach zu ersetzen, wenn sie völlig in sich zusammengefallen und nicht mehr tragbar ist. Das ist einfacher, als sie immer wieder mit Farbtopf und Pinsel auszubessern. Im Hammam, dem Dampfbad, setzt man sich nicht auf Stein, sondern auf schmutziges Plastik … Wir haben bald genug. Als ich nach draußen trete, gehe ich ein paar Schritte auf die Planken, an denen die Segelboote vertäut sind. Ein älterer Mann mit schmerzverzerrtem Gesicht humpelt mir entgegen, das linke Hosenbein hochgekrempelt. Blut läuft aus einem Loch unterhalb des Knies. Ich packe ihn unter dem Arm.
»Es geht schon«, sagt er angestrengt. Er ist bei dem Versuch, auf sein Boot zu steigen, ausgerutscht. Ich führe ihn in den Club Biovimer, der noch voll Aktivität strotzt, und bitte mit erhobener Stimme, Hilfe für den Mann zu holen. Die Dame am Empfang sagt nur: »Das ist jetzt zu spät, hier ist dafür niemand mehr.«
Wer nun als guter Franzose die Fähigkeit erlernt hat, sich in sich selbst zurückzuziehen, der gibt nach außen hin nicht zu erkennen, ob er weiß, weshalb der Nachbar plötzlich zuckt, die Luft scharf und schnell einzieht und sein Gesicht vor Schmerz verzerrt. Man tut so, als sei nichts geschehen. Das erspart Scherereien. Und zur Not läßt sich auf diese Weise auch leichter leugnen, was vielleicht doch vorgefallen ist. Blöder Kerl, was schaut er mich so aufdringlich an! Gut sieht er ja auch nicht aus.
Es gibt sogar Situationen, in denen muß man eine große Portion Liebe, Geduld und Gelassenheit aufbringen, um das Land nicht für den Rest seines Lebens zu meiden. Solchen Vorfällen wird niemand entkommen: Und sie ereignen sich – wie soll es auch anders sein – meist in dem Augenblick, in dem man es wirklich nicht brauchen kann. Mir ist so etwas immer wieder passiert. Aber, wie gesagt, ich verstecke mich ja hinter meiner Liebe zu Frankreich.
Das war letzthin noch ganz harmlos und begann so: An einem Mittwoch wollte ich in der Früh ein Flugzeug von Paris-Orly nach Nizza nehmen. Dort hatte ich schon um die Mittagszeit einen wichtigen Termin. Am Dienstag beschlossen die Feuerwehrleute der beiden Pariser Flughäfen, in den Bummelstreik zu treten. Über die Hälfte der Starts wurde gestrichen, und die übrigen Maschinen hatten stundenlange Verspätungen. Worum es bei diesem Streik wirklich ging, ließ sich genausowenig herausfinden wie eine Antwort auf die Frage, ob der Streik auch am nächsten Tag fortgesetzt würde.
Am Flughafen Orly waren alle Telefone besetzt. Aber die Air France verfügt über einen eigenen Informationsdienst. Dort rufe ich an. Eine automatische Stimme ertönt und sagt: »Guten Tag, willkommen beim Informationsdienst der Air France. Wenn Sie Auskünfte über die planmäßigen Landungen haben wollen, drücken Sie Sternchen eins. Wollen Sie Auskünfte über planmäßige Abflüge haben, drücken Sie Sternchen zwei.« Und drückt man eins oder zwei, so erfährt man bei beiden Nummern nichts über Streik oder Nichtstreik am nächsten Tag. Also rufe ich die Pressestelle von Air France an. Dort ist eine sehr freundliche, weibliche Stimme völlig verzweifelt, denn sie weiß nicht, wohin der für die Streik-Informationen Zuständige verschwunden ist. Vielleicht ist er schon nach Hause gegangen, und sie selbst weiß nichts. Aber sie hat da noch eine Nummer, die könnte ich anrufen. Doch da meldet sich dann schon wieder die automatische Stimme.
Ich hätte zur Not auf den Zug umsteigen können, aber bis Nizza dauert die Fahrt zu lange. Also wage ich den Weg zum Flughafen. Als der Taxifahrer wissen will, ob ich mich denn nach der Streiklage erkundigt hätte, erzähle ich ihm mein Leid mit den überlasteten Telefonen in Orly und dem modernen Nummerntelefon, das auf individuelle Probleme nicht eingehen kann, und er schüttelt mitleidig den Kopf: »C’est comme ça!« So sei es eben. Gewisse Dinge müsse man in diesem Land einfach gelassen sehen.
Erstaunlicherweise gibt sich die Mehrheit der unter den Streiks Leidenden tatsächlich zumeist gelassen. Als im Winter 1995 die Fahrer von Bussen, Metro und Nahverkehrszügen in ganz Paris sechs Wochen lang streikten, sind viele Menschen jeden Tag eine oder gar anderthalb Stunden zu Fuß zur Arbeit gegangen und abends wieder nach Hause. Und sie haben nicht gemurrt, denn sie standen hinter dem Streik. Nach dem Motto: Die Arbeiter drücken einen Unmut aus, der auch in uns gärt. Sie streiken also für alle anderen mit.
Und jeder, der im Juni 1998 zur Fußballweltmeisterschaft nach Frankreich fuhr – oder fahren wollte –, erinnert sich mit Grauen an das Chaos. Besonders dreist hatten die Piloten von Air France kurz vor Beginn des Wettbewerbs beschlossen zu streiken, weil man ihnen, den in der Welt am besten bezahlten Piloten, mit Monatsgehältern bis zu 30000 Mark, den Lohn um fünf Prozent kürzen wollte – um das Unternehmen zu sanieren. Das sei weiter nicht schlimm, erklärte Premierminister Lionel Jospin, denn in Europa könne sich jeder mit der Bahn oder dem Auto nach Frankreich begeben, um die Fußballspiele zu sehen.
Als die Air-France-Piloten streikten, zeichnete Plantu, der Karikaturist von »Le Monde«, was die Franzosen von den Ausländern dachten, die sich darüber beklagten: An einem Air-France-Schalter wartet ein Schlachtenbummler, um einzuchecken. Dahinter stehen mehrere Air-France-Mitarbeiter, die sich vor Lachen nicht mehr halten können.
Ein Pilot sagt: »Dieser Kerl hat 15000 Franc für eine Eintrittskarte zur Weltmeisterschaft gezahlt und will jetzt nach Paris zum Spiel fliegen.«
Ein anderer Pilot antwortet: »Was für ein Blödmann!«
Und es sollte sich auch bald herausstellen, was für Blödmänner da nach Frankreich gereist waren. Denn die Verteilung der Eintrittskarten entsprach dem Hochmut, mit dem die ausländischen Besucher verlacht wurden. Tausende von Japanern und Lateinamerikanern, die viel Geld für ihre Reise und die Teilnahme an Spielen ihrer Mannschaft ausgegeben hatten, erhielten keine Eintrittskarten. Die waren in irgendeinem Kuddelmuddel – genauer: in einem Geflecht von kriminellen Machenschaften – verschwunden.
Doch zurück zum Flughafen Orly. Auf den Monitoren ist meine Maschine gestrichen – annulé –, aber eine Stunde später soll ein anderer Flug starten. Ich stelle mich in die Schlage am Schalter, etwa zehn Leute sind vor mir. Ich denke insgeheim, die Maschine wird überbucht sein, hoffentlich erhalte ich noch einen Platz. Es dauert ewig. Und die Schlange wird aus irgendeinem merkwürdigen Grund nicht kleiner, denn immer wieder schiebt sich jemand mit spitzen Ellbogen zwischen die Wartenden, so brutal und offensichtlich, daß es einem peinlich ist, und zwar so peinlich, daß man sich nicht zu protestieren getraut. Denn das tut man eigentlich nicht – weil man die anderen um einen herum ja gar nicht wahrnimmt.
Vor mir steht plötzlich ein älterer, kräftiger Mann mit Handy, in das er mit lauter Stimme hineinspricht. Er macht sich breit. Ich drängele ein wenig, um meine Position zu verteidigen, doch er nimmt mich nicht wahr, denn er muß für alle hörbar mit seinem Büro telefonieren, wo er jemandem erklärt, er wolle den Kunden nicht sehen. »Il me fait chier.«
Am Schalter meckert er die Hosteß wegen des Streiks an, für den die Arme nun wirklich nichts kann. Wir können froh sein, daß wenigstens sie arbeitet. Aber weil ich es in der Zeitung gelesen habe, daß ein Streik der Piloten in der kommenden Woche droht, frage ich sie, ob darüber schon abgestimmt worden sei.
»Ah là, Monsieur, je regrette. – Ich bedauere, das weiß ich leider nicht.« Ich erhalte eine Bordkarte, aber der Abflug verschiebt sich voraussichtlich um eine Stunde, da die Maschine wegen des Bummelstreiks nicht rechtzeitig landen kann. Noch befindet sich meine Laune im grünen Bereich.
An der Sicherheitskontrolle packt ein Mann sein Kleingeld, einen Schlüsselbund und ein Handy auf ein Tablett und geht durch den Türbogen, der metallene Gegenstände aufspürt. Ein lautes Piepsen ertönt.
Der Sicherheitsbeamte sagt streng: »Sie müssen alle metallenen Gegenstände aus den Taschen nehmen.«
»Das habe ich getan!«
Der Passagier geht zurück. Es piepst. Er schreitet noch einmal durch den Türbogen. Es piepst.
Der Beamte wird sichtlich strenger: »Haben Sie mich nicht verstanden, alle metallenen Gegenstände hier rauf!«
Und er zeigt auf das Tablett. Der Mann kramt in den Taschen herum, zieht seinen Gürtel aus, der eine metallene Schnalle hat, und geht wieder durch den Detektor. Es piepst.
Der Beamte wird bleich und preßt nun sehr streng heraus: »Was haben Sie noch in den Taschen?«
»Nichts mehr!«
Der Fluggast macht einen ganz langsamen Schritt – aber es piepst.
»Treten Sie mal hier rüber!«
Äußerst arrogant winkt der Beamte ihn zu sich und verzieht keine Miene – in vollem Bewußtsein des kleinen bißchen Macht, die er verkörpert. Mit einem Handgerät sucht der Sicherheitskontrolleur den Mann ab, bis unter die Fußsohlen fährt er mit dem Handgerät. Nichts piepst.
Ich habe kein Kleingeld in der Jacke, keinen Schlüsselbund in der Hose und gehe durch die Schleuse. Es piepst.
»Monsieur!«
Mit starrem Gesicht, das seine Gefühllosigkeit ausdrücken soll, fährt mich der Beamte in einem Ton an, mit dem er Wichtigkeit darstellen will: »Sie müssen alle Metallgegenstände ablegen!«
Ich zucke mit den Achseln, durchsuche meine Kleidung und finde einen Kuli, der bisher nie ein Piepsen verursacht hat. Aber vielleicht ist dieses Gerät besonders fein eingestellt. Ich gehe durch den Türbogen, es piepst. Es amüsiert mich, aber das zu zeigen wäre ein Fehler. Schon straft mich ein Blick. Ich gehe zurück. Es piepst. Ich habe außer einem Taschentuch nichts mehr in Hose oder Jacke. Ganz behutsam strecke ich ein Bein vor, denke dabei an die übertriebenen Darstellungen in Stummfilmen, verlagere das Gewicht nach vorn, schiebe den Oberkörper in die Schleuse, und schon piepst’s.
Der Beamte schreit mich an, als sei ich ein renitenter Übeltäter: »Parlez-vous français?«
Er hat Macht. Er hat zwar nur ganz wenig Macht, aber sie wirkt unmittelbar auf das Opfer ein. Und deshalb macht es einen bedeutenden Menschen aus demjenigen, der diese Macht vorführt. Und die Macht wird durch Befehle gerechtfertigt, Befehle, die auf französisch gebellt werden. Wer sie jedoch nicht versteht, der verweigert den Gehorsam. Nach dem Motto: He, du Depp, hast nix kapiert? Und da steigt mir langsam die Galle hoch. Hatte ich nicht gerade den Bericht gelesen, daß die Europäische Menschenrechtskommission der französischen Polizei Folter vorwarf?
Im November 1991 war der aus Marokko stammende Holländer Ahmed Selmouni in dem Pariser Vorort Bobigny bei einer Drogenrazzia aufgegriffen worden. Vier Tage hielten die Polizisten ihn in ihrer Zelle und quälten ihn. Sie folterten ihn seelisch und körperlich. Drei Ärzte haben ihn hinterher untersucht und schwere Verletzungen festgestellt. Am fünften Tag nach seiner Verhaftung wurde Ahmed Selmouni in Untersuchungshaft gebracht, und dort meldete er sein Martyrium der Generalinspektion der Polizei. Er war mit Fäusten und Füßen, Knüppeln und Baseball-Schlägern malträtiert worden. Er erzählte, »daß man ihn an den Haaren gezogen hatte, daß man ihn gezwungen hatte, einen langen Gang hinunterzulaufen, in dem sich Polizisten verteilt hatten, um ihm ein Bein zu stellen«. Er mußte vor einer Frau niederknien, der man versprach: »Jetzt wirst du gleich jemanden singen hören.« Später hat ihm ein Polizist sein Glied gezeigt und gesagt: »Komm, lutsch es!«, um dann auf ihn zu urinieren. Schließlich steckte man ihm auch noch einen Knüppel in den After. Zum Verzweifeln! (Ahmed Selmouni wurde zu dreizehn Jahren Gefängnis wegen Drogenhandels verurteilt. Die Europäische Menschenrechtskommission rügte Frankreich wegen der Folter, aber sieben Jahre nach der Tat sind die brutalen Polizisten immer noch nicht bestraft worden.)
Da kommt in mir die ganze Wut hoch, die sich gegen Menschen richtet, die ihre Macht mißbrauchen – in welchem Land auch immer. Für mich haben sie keine Nationalität, sondern einen Webfehler im Kopf. Dabei hofft man doch, Frankreich sei wirklich das Land der Menschenrechte, worauf es sich immer wieder beruft. Die Intellektuellen haben für sich die Menschenrechte gepachtet; der Staat mißachtet sie, wenn es ihm paßt. Man denke nur an das absurde Attentat gegen Greenpeace und die Versenkung der »Rainbow Warrior«. Bei dem von der französischen Regierung befohlenen Anschlag auf das Boot der Umweltorganisation in Neuseeland kam ein Fotograf ums Leben.
Ob ich Französisch spreche, hat der Sicherheitsbeamte gefragt.
»Je vous comprends parfaitement, Monsieur.«
Ich erkläre ihm äußerst höflich, daß ich ihn wohl verstünde, und überlege, ob ich noch ein paar Verse aus Corneilles »Cid« drauflegen soll, denn das schafft bei den meisten Franzosen Respekt und Achtung, aber das traue ich mich dann doch nicht. Er würde es als Provokation empfinden – und so wäre es ja auch gemeint. Er befiehlt jetzt in herrischem Ton, ich solle durch eine andere Schleuse treten. Auch da piepst es.
Jetzt schreit der Uniformierte mich an: »Monsieur, leeren Sie Ihre Taschen.«
»Monsieur, sie sind leer!«
»C’est pas possible! – Das kann nicht sein!«
»Si – doch!«
Die Arroganz der Macht quillt ihm aus jeder Pore. Jetzt fehlt nur noch, daß er auf einer Leibesvisitation besteht. Aber glücklicherweise ist die Schlange an der Sicherheitsschleuse immer länger geworden. Der Beamte führt sich so auf, daß keiner wagt aufzumucken, und nachdem er nichts gefunden hat, wendet er sich seinem nächsten Opfer zu.
Ich ergreife meine Taschen und verschwinde fluchtartig, während hinter mir wieder der Piepton schrillt. Als ich mich genervt auf einer Bank in der Wartezone niederlasse, suche ich in der Erinnerung, in welchen demokratischen Ländern mir solch eine Demonstration der Arroganz schon einmal widerfahren ist. Da gehorcht jemand einem Piepston, der ihm vorschreibt, wie er Menschen zu behandeln hat. Und er geht davon aus, daß der technische Ton recht hat, denn das sagen ihm die Vorschriften, während der Mensch irrt oder gar böswillig betrügt.
In der Abflugslounge sitzt der laut in sein Handy redende Mann hinter mir und wiederholt in jedem Telefonat, daß irgend jemand den Satz verdient: »Il me fait chier.«
Jede Viertelstunde ertönt eine wohlklingende Frauenstimme, die nach zahlreichen Floskeln der Entschuldigung mitteilt, der Abflug werde sich verzögern. Ich werde mich doch nicht beklagen, rede ich mir Mut zu, obwohl ich dem Mann mit dem Handy inzwischen gern sagen würde: »Il me fait chier.« Die Feuerwehrleute müßte man beschimpfen.
Immerhin ist es ja inzwischen besser geworden. Vor zwanzig Jahren streikte die Müllabfuhr mindestens einmal im Jahr sechs Wochen lang, und in den Straßen von Paris türmten sich die Abfälle, bis es roch wie zu Grenouilles[1] Zeiten. Die Arbeiter in Elektrizitätswerken hatten sich als Protestmaßnahme etwas besonders Perfides ausgedacht, denn sie streikten sehr häufig, aber nur ganz kurz, nämlich täglich eine Stunde um die Mittagszeit, wenn die Leute am Herd standen und das Essen zubereiten wollten. Inzwischen streiken die Fluglotsen, die Piloten, die Eisenbahner nur noch selten. Aber merkwürdigerweise immer zu Ferienanfang oder -ende, wenn Millionen von Franzosen unterwegs sind, wenn verzweifelte Mütter mit Kindern 24 Stunden in Wartesälen ausharren müssen und die Erholung gleich wieder verloren ist.
Aber was versteht der Nichtfranzose schon von einem wohlbegründeten Protest? Denn die Streikenden drücken ja nur unser, zumindest aller Franzosen Unmut aus. Darin ist sich das ganze Volk einig: Wenn man die Schnauze voll hat, darf man dies auch kundtun. Deshalb richtet sich der Zorn des am Reisen gehinderten Franzosen selten gegen die Streikenden, sondern gegen den Staat, der die Piloten, Fluglotsen, Eisenbahner zu schlecht bezahlt – wie jeden anderen auch. Schließlich arbeitet jeder sechste im Staatsdienst und weiß deshalb genau Bescheid.
Früher war es eine Tortur, wenn man ein Flugzeug in Frankreich bestieg, denn da schlugen sich die Leute schon vor der Bordtür um die vermeintlich besten Sitze. Es dauerte länger als in anderen Ländern, bis mit den Bordkarten auch feste Plätze zugeteilt wurden, obwohl man das System doch sehr viel früher von den Bussen hätte übernehmen können. Ich habe bisher noch keine Antwort auf das Verhalten gefunden, das Franzosen dazu verleitet, sich auch heute noch – trotz der festen Zuteilung eines Sitzes – sofort nach dem ersten Aufruf des Abflugs in diese Masse hineinzuzwängen, um ins Flugzeug zu gelangen, wo doch der Sitz fest reserviert ist. Der wirklich wichtige Kampf gegen die Mitreisenden beginnt ja erst, wenn man im Flugsessel hockt.
Wer ein bißchen größer geraten ist, sollte in einer französischen Maschine den Mittelplatz vermeiden. Denn kaum sitzt man, beginnt die körperliche Auseinandersetzung um die Armlehne. In Amerika entschuldigt sich, wer den Nachbarn aus Versehen mit dem Ellenbogen berührt. In Deutschland findet schon einmal Gegendruck statt, um nicht weichen zu müssen. Aber im Flugzeug zwischen Franzosen eingekeilt zu sein bedeutet blaue Flecken am Ende der Reise.
Privat mögen die Franzosen die liebenswertesten Menschen der Welt sein, na gut – vielleicht nach den Amerikanern, den Italienern, den …, aber im beruflichen Umgang haben selbst große, harte Manager schon das Handtuch vor den Franzosen geworfen. Bei einem Abendessen in kleinem privatem Kreis saß ich neben Jürgen Schrempp, dem mächtigen Boß von Daimler-Benz, dem größten deutschen Konzern. Wir unterhielten uns darüber, weshalb es ihm als DASA-Chef nicht gelungen war, die Franzosen an den Fokker-Werken zu beteiligen, um ein europäisches Regionalflugzeug zu bauen. Als er das Wort Franzose hörte, brauste Schrempp auf und rief: »Mit den Franzosen will ich nichts mehr zu tun haben. Das müssen von jetzt an …«, und er wies auf zwei seiner Vorstandsmitglieder am Tisch, »… die beiden erledigen. Ich will mit Franzosen nichts mehr zu tun haben.«
Sie hatten ihm widerfahren lassen, was Franzosen tun, wenn sie glauben, ihr Gegenüber lasse es an Achtung für ihre Zivilisation mangeln. Chahut nennen sie dieses Verhalten, das sie schon in der Schule gelernt haben. Gegenüber einem Lehrer, der die französische Sprache nicht vollendet beherrscht, dürfen sie sich, mit heimlicher Zustimmung ihrer Eltern, austoben, denn er verfügt nicht über Autorität. Und welcher Ausländer, der nicht perfekt Französisch spricht, hat nicht schon über die Franzosen geflucht, die so tun, als verstünden sie einen Radebrechenden nicht, der nach einer Straße, einem Geschäft, einer Auskunft sucht. An diesem Verhalten kann man tatsächlich verzweifeln, besonders wenn mit der eigenen Schwäche des anderen Hochmut verbunden wird.
Jedem kann eine Szene widerfahren, wie sie Paul Theroux im Bahnhof von Menton an den Gestaden des Mittelmeers beobachtete. Menton liegt an der Grenze zwischen Frankreich und Italien. Und dort spielte sich folgendes ab: Eine Gruppe älterer italienischer Herrschaften, niemand von ihnen dürfte jünger als etwa siebzig gewesen sein, versuchte, sich hier mit Kaffee und Keksen zu versorgen. Die Französin an der Theke giftete sie an:
»Wenn Sie kein Geld haben, müssen wir hier ja wohl nicht weiter unsere Zeit vertrödeln.«
Sie hatten kein französisches Geld und konnten kein Französisch. Die Frau im Bahnhofskiosk, der vielleicht anderthalb Kilometer von der italienischen Grenze entfernt liegt, konnte kein Wort Italienisch.
»Was sagt sie?« jammerte jemand auf italienisch.
»Sie will Geld.«
»Wenn Sie was kaufen wollen, wechseln Sie doch Ihr Geld!« herrschte die Französin die Gruppe an.
»In Francs, nehme ich an.«
Ein Italiener sagte in seiner Muttersprache zu ihr: »Wir wollen doch bloß Kaffee. Es lohnt sich nicht, dafür extra Geld zu wechseln.« Ein anderer meinte: »Wir geben Ihnen jeder tausend Lire. Den Rest können Sie behalten.«
»Verstehen Sie mich nicht?« fragte die Französin. Das Geschäft kam also nicht zustande, und die Italiener erhielten nichts zu trinken oder zu essen.
Die Französin hat ihr Selbstverständnis, ihre kulturelle Überlegenheit gezeigt, aber dabei ist ihr ein anständiger Gewinn entgangen. Das aber ist ihr nicht bewußt, und hätte jemand sie darauf aufmerksam gemacht, wäre nur ein Achselzucken die Antwort gewesen.
Selbst wenn ein Franzose sich ein wenig in der Sprache eines Ausländers zurechtfindet, dann würde er nur selten davon Gebrauch machen, um dem Fremden zu helfen. Solch ein Verhalten empfindet der Franzose nicht als unhöflich, sondern er will sich nicht blamieren und seine vermeintliche Autorität verlieren, weil er die Fremdsprache nicht perfekt beherrscht. Die Sprache ist Zeichen von Zivilisation. Und von Zivilisation geht Autorität aus.
Das erlebten auch die Direktoren eines weltweit agierenden deutschen Unternehmens, das eine Firma in Frankreich erworben hatte. Die deutschen Chefs wollten so schnell wie möglich Ordnung schaffen und teilten den französischen Geschäftsführern mit, ein Treffen, zu dem auch Vertreter eines britischen Tochterunternehmens eingeladen würden, sei für den 15. August festgelegt. Für den 15. August? Die Franzosen lachten und sagten ab. Am 15. August hätten sie keine Zeit. Die Deutschen zeigten wenig Humor und noch weniger Verständnis und bestanden auf dem Treffen. Weil die Deutschen die neuen Besitzer waren und damit am längeren Hebel saßen, kam die Sitzung auch zustande. Aber die Franzosen benahmen sich wie übermütige Schuljungen, bastelten Papierflugzeuge, die sie sich zuwarfen, und nahmen niemanden ernst. Denn in ihren Augen mußte man schon ein unzivilisierter Barbar sein, um an diesem Tag ein dienstliches Treffen abzuhalten. Schließlich weiß doch jedes Kind, was der 15. August einem Franzosen bedeutet: Es ist der höchste oder vielleicht der heiligste Ferientag; am 15. August steht das Land still. Da erhält man in Paris keine Baguette, da sind alle Betriebe im Land geschlossen, denn es ist der Tag von Marie, der Schutzpatronin Frankreichs. Aber Marie ist wahrscheinlich nur ein vorgeschobener Grund, um am 15. nichts zu tun. Dieser Tag ist der Höhepunkt des Urlaubs in Frankreich, danach wechselt auch im Süden das Wetter, dann beginnt der Sommer sich behutsam zu verabschieden. Doch ehe die Hitze weicht, machen noch einmal alle Urlaub. So war es, als man ein kleiner Junge war, so war es, als man seine ersten Liebschaften am Strand oder in der Campagne erlitt, so ist es immer noch. Wehe dem, der am 15. August so schwer erkrankt, daß er auf die Notstation muß! Ein Herzinfarkt an diesem Tag bedeutet den sicheren Tod.
Den Deutschen wird vorgeworfen, sie seien die Erfinder der Bürokratie, aber ganz ausnahmsweise wird ihnen da unrecht getan. Eigentlich sollte schon der Begriff »Bürokratie« auf sein Ursprungsland hinweisen, stammt das Wort doch nicht aus dem Deutschen, sondern dem Französischen. Die Bürokratie ist französisch – und zum Verzweifeln. Sie ist offenbar erfunden worden, um dem Staat zu ermöglichen, Entscheidungen oder Vorgänge zu verhindern, ohne sie verbieten zu müssen.
Als der französische Staat die eigene Wirtschaft vor der Einfuhr billiger japanischer Videogeräte protektionistisch schützen wollte, konnte er dies wegen internationaler Abmachungen nur auf Umwegen durchsetzen. So erklärte die zuständige Verwaltung, aus Japan eingeführte Geräte müßten ein besonderes Prüfsiegel erhalten. Dies wurde in dem von allen Wirtschaftswegen weit entfernten Poitiers von einem einzigen Zollangestellten auf die Geräte geklebt. Aber der dafür abgestellte Mann war nicht nur überlastet, sondern nahm seine nationale Aufgabe – im Interesse Frankreichs – so ernst, daß er nur ganz selten dazu kam, die Marken aufzukleben. Und die Bürokratie hatte die Sache so geschickt eingefädelt, daß für die gelagerten Geräte eine Gebühr gezahlt werden mußte. So stapelten sich die eingeführten Waren in Lagerhallen, und mit jeder Woche kamen neue hinzu, bis die Japaner verzweifelt aufgaben. Diese bürokratische Maßnahme hatte also Erfolg.
Die französische Bürokratie trägt die Verantwortung für den nicht enden wollenden Zuzug von Unternehmen in die Île-de-France, das Pariser Becken. Denn, so erklärte mir der Besitzer eines mittleren Unternehmens, wegen der Papiere müsse man immer wieder zu den Behörden nach Paris. Und da sei es ökonomischer, das Unternehmen in der Nähe von Paris anzusiedeln und von seinem Betrieb nach Paris hineinzufahren, als aus der Provinz anzureisen und vielleicht innerhalb von drei Tagen doch nichts zu erreichen. Wie ein Krake – vielleicht schlimmer: wie eine unheilbare Seuche – hat sich die Bürokratie über das Land gelegt und erschwert damit auch das Geschäftsleben.
Als ich in Paris an einer Filmdokumentation arbeitete, suchte ich nach Archivaufnahmen, deren Rechte bei der INA lagen. Wir wollten sie kaufen – also richtig Geld bezahlen. Drei Tage und zahlreiche Anrufe dauerte es, bis ich den Namen der zuständigen Bearbeiterin erfahren hatte. Und es hatte auch seinen Grund, weshalb dies so mühsam war, denn die Dame war im Urlaub. In vierzehn Tagen sollte sie zurückkommen. Ob mir jemand anders helfen könne? Nein, leider nicht. Sie kam tatsächlich zurück, aber das verbesserte meine Lage auch nur wenig. Jetzt hatte ich zwar eine Gesprächspartnerin, aber sie konnte die Unterlagen nicht finden. Ob ich genauere Angaben machen könnte? Das konnte ich. Sie versprach, sich wieder zu melden. Das tat sie aber nicht. Allmählich drängte die Zeit. Ich hatte mit dem Schnitt begonnen. Weil die Archivaufnahmen die Dokumentation zusätzlich mit Glanz versehen hätten, mühte ich mich weiter, an sie heranzukommen. Aber nichts half. Die Bearbeiterin hatte kein Interesse daran, für ihr Archiv Geld zu verdienen. Und so geschieht es häufig. Ja, dieses Desinteresse kann sogar komische Züge annehmen.
Anläßlich der Zweihundertjahrfeier der Revolution wollte das deutsche Fernsehen eine Übertragung des Umzugs auf den Champs-Élysées übernehmen. Das französische Organisationskomitee verlangte astronomische Summen, und nur in äußerst zähen Verhandlungen gelang es den Vertretern des deutschen Fernsehens, einen Vertrag auszuhandeln. Die Rechte für zwanzig Minuten sollten mehr als 50000 Mark kosten. Die Sendung wurde ausgestrahlt, doch das deutsche Fernsehen erhielt nie eine Rechnung. An Ordnung gewöhnt, erkundigten sich die Deutschen schließlich, an wen sie wieviel Geld überweisen sollten. Aber da das Organisationskomitee seine Arbeit abgewickelt hatte, war es aufgelöst worden, und niemand kümmerte sich um die ausstehenden Zahlungen. Sie fielen einfach unter den Tisch.
Nun einmal mehr zurück zum Flug nach Nizza. Kaum hatte die Maschine trotz des Streiks und mit stundenlanger Verspätung und vollbepackt endlich abgehoben, geriet sie in unruhiges Wetter, und der Pilot meldete, das Flugzeug werde wegen des überfüllten Luftraums über Nizza zehn Minuten in einer Warteschleife fliegen. Der Flugraum über Nizza ist übrigens immer überfüllt.
Die Warteschleife lag unglücklicherweise mitten in einer Gewitterzone, weshalb das Flugzeug entsetzlich durchgeschüttelt wurde. Plötzlich hörte man einen Mann kräftig würgen und husten; er hatte mit der Luftkrankheit zu kämpfen und drückte in seiner Not auf den Kopf, der die Stewardeß herbeirufen sollte. Sie war eine kleine dunkelhaarige Frau mit einem netten, verschmitzten Gesicht, und bei besonders großen Luftlöchern rollte sie voll vermeintlicher Verzweiflung die großen braunen Augen nach oben. Zuerst rief sie nach hinten, sie könne den Platz nicht verlassen. Doch der arme Mann würgte und hustete, als würde er gleich sterben, so daß sie sich losschnallte, zu ihm hineilte und ihm erklärte, gleich nach der Landung werde sie sich um ihn kümmern.
Kaum hatte die Stewardeß sich wieder angeschnallt, sagte der Kapitän durch, bis zur Landung dauere es weitere fünf Minuten. Da ertönte wieder der Ruf nach der Stewardeß. Wieder erhob sie sich, doch dieses Mal war sie nicht von dem Luftkranken gerufen worden, sondern von jenem gräßlichen Menschen, der schon im Flughafen mit seinem wiederholten »il me fait chier« unangenehm aufgefallen war. Lauthals beklagte er sich über die Turbulenzen und die erneute Verspätung. Als die Stewardeß versuchte, ihn zu beruhigen, begann er zu schreien, bezeichnete die Fluggesellschaft als eine »compagnie de merde«, und dann schlug er kräftig auf die junge Frau ein, weil sie für solch eine »compagnie de merde« arbeite. Zuerst war die Stewardeß nur erschrocken, dann drehte sie sich weinend um, rannte in das Cockpit und forderte den Piloten auf, die Flughafenpolizei zu alarmieren.
Schließlich war die Maschine ausgerollt und an einem »Finger« zum Flughafengebäude angedockt, doch die Stewardeß weigerte sich, die Tür zu öffnen, solange die Polizei nicht eingetroffen sei, um den Schläger festzunehmen. Der wiederum krakeelte in der Mitte des Flugzeugs weiter. Schließlich griff der Pilot beschwichtigend ein, ließ die Tür öffnen und versprach der Stewardeß, sich um den brutalen Passagier zu kümmern. Aber er ließ ihn natürlich laufen. Alles andere wäre zu mühselig gewesen.