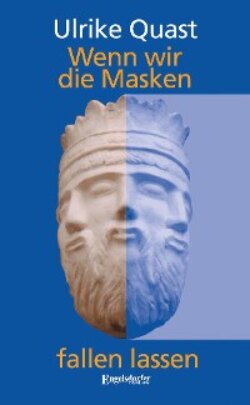Читать книгу Wenn wir die Masken fallen lassen - Ulrike Quast - Страница 7
3
ОглавлениеIn K. war der Himmel bewölkt. Schon in den frühen Morgenstunden hing ein Dunstschleier über der Stadt. Der Tag blieb trüb und die Abenddämmerung setzte früher als gewöhnlich ein. Auch im Zimmer brannte kein Licht. Hella hatte die Vorhänge zugezogen. Sie saß im Halbdunkeln. Das tut sie öfter in letzter Zeit. Sie ist dann für keinen zu sprechen. Sie ist scheinbar lautlos und unsichtbar. Ihr Dasein ist ausgelöscht. Sie ist nicht existent. – Einfach ins Nichts eintauchen! Wie in einen Sog gezogen werden und sich auflösen. Nicht da sein, nicht gewesen sein, nicht werden. Weder im Raum noch in der Zeit existieren. Eine Vision, die sie sich gerne ausmalte. Eine Idee, über die sie nachsann. Die Idee von der Nicht-Existenz. Vom Nichtsein.
Doch Hella saß da. Sie saß im Wohnzimmer und hielt diesen Brief in der Hand. Einen Brief von Robert. Nachdem sie ihn wieder und wieder gelesen hatte, zerknüllte sie das Papier. Sie drückte es fest zusammen. Bis ihre Finger zitterten. Die Worte kannte sie längst auswendig: „Ich werde nicht mehr zu dir zurückkommen. Wir haben uns auseinander gelebt und mir ist klar geworden, dass es mir ohne dich besser geht. Meine Entscheidung fühlt sich einfach richtig an. Ich hoffe, du verstehst das. Bitte glaub mir, es tut mir leid. Es tut mir leid um uns und unsere Träume! Robert.“ Er wolle noch diese Woche kommen und seine Sachen abholen.
Das klang endgültig. Unumkehrbar. Ob es ihm wirklich ernst war? Hella schüttelte den Kopf. Sie hatte auf ihn gewartet. Auch dieses Mal. Und sie hatte gehofft. Als er ihr vor einem halben Jahr mitteilte, er würde die Gastprofessur in L. antreten, redete sie ihm zu: „Der Abstand wird uns gut tun.“ Sie gab vor, seinen resignierten Blick nicht zu bemerken. Zwei Tage später fuhr er weg, ohne sich von ihr zu verabschieden. Nur ein Zettel lag auf dem Küchentisch: „Mein Zug geht um 9.28. Du schläfst noch. Ich wecke dich nicht. Mach’s gut. R.“ Früher hätte er sie gebeten, ihn auf den Bahnhof zu begleiten. Früher hätte er sich nicht von ihr losreißen wollen. Wahrscheinlich wäre er nicht einmal für eine solch lange Zeit weggegangen. Früher…
Während er in L. war, hatten sie kaum Kontakt zueinander. Nur seiner Tochter schrieb Robert jede Woche einen langen Brief. Hella öffnete die Briefe immer als Erste. Bis ihre Tochter ihr irgendwann einen Brief aus der Hand riss und tagelang schmollte. Seither erhielt das Mädchen keine Post mehr von ihrem Vater. Weshalb, das war Hellas Geheimnis. Es gab da einen alten Reisekoffer auf dem Dachboden. Ein Koffer der Erinnerungen. Erinnerungsstücke an Robert, die sie aufbewahrte und hin und wieder hervorkramte. Die sie abtastete und betrachtete. Deren erahnten Duft sie einsog und sich dabei an Roberts Worte entsann. Worte, die er vor langer Zeit gesagt hatte. Hella flüsterte sie immer wieder vor sich hin. Sie schrieb sie auf farbige Briefbögen, die sie bündelte. Der alte Reisekoffer verbarg all diese Erinnerungen. Und er hütete ihr Geheimnis. Den verrosteten Schlüssel zum Koffer trug Hella an einer Kette um den Hals.
Auch die Briefe an ihre Tochter verheimlichte Hella. Sie verheimlichte Roberts Worte, die ohnehin an sie, Hella, gerichtet waren. Worte, die aus Roberts tiefstem Innern sprachen und nur ihr galten. Zeichen, die er aussandte. Um eine Brücke zu bauen. Um sich ihr wieder zu nähern. Ja, so musste es sein. Denn ihre Beziehung hatte etwas Einzigartiges. Etwas, das zuallererst nur sie und ihn betraf. Nicht ihre Tochter und auch nicht seine Mutter. Die hatte den letzten Streit zwischen Robert und ihr überhaupt erst verursacht. Ausgerechnet an Hellas Geburtstag musste ihre Schwiegermutter erkranken. Ausgerechnet an ihrem Geburtstag musste Robert seine Mutter besuchen. Das Magengeschwür war in des Wortes wahrstem Sinn bösartig. Denn es wucherte. Es häufte einen hohen Wall zwischen Hella und Robert an. Es vergiftete ihre Liebe. Zum Glück war Roberts Mutter nun tot.
Hella sprang plötzlich auf. Sie lief im dunklen Zimmer umher. Immer auf und ab. Auf und ab. Gedanken und Bilder jagten durch ihren Kopf. Szenen, in denen Robert vorkam. In denen sich real Erlebtes und Fiktion vermischten. „Du hast verloren“, spotteten Stimmen in ihr. „Du hast ihn verloren.“ Hella hielt sich die Ohren zu, doch es höhnte weiter. – „Das werdet ihr büßen! Alle! Du wirst es büßen!“, schrie es aus ihr heraus in das dunkle Zimmer hinein. Die Worte hallten in ihren Ohren wider. Sie verselbständigten sich. Sie sprachen zu ihr. – Sie sollen endlich schweigen! Die Stimmen sollen Ruhe geben! Ruhe! – „Ich mach‘ euch fertig! Dich mach‘ ich fertig!“
Blitzartig ergriff Hella den Telefonhörer und wählte Roberts Handynummer. Eine weibliche Stimme verkündete, dass der Teilnehmer nicht erreichbar sei. – „Das kann nicht dein Ernst sein!“ Hella brüllte in den Hörer. „So einfach kommst du mir nicht davon! So nicht!“ Als sich die Mailbox einschaltete, hatte sie bereits aufgelegt. Nach kurzer Zeit wählte sie erneut. Sie drückte auf die Raute–Taste. Wieder und wieder. Worttiraden brachen aus ihr hervor. Wortschwalle, die Robert irgendwann abhören würde. Bereuen sollte er. Bereuen und sie um Verzeihung bitten. So, wie all die Male zuvor.
Noch einmal wählte sie. Doch die Nummer war besetzt. Hella warf den Hörer gegen die Wand. Das Loch in der Tapete hatte ein Gesicht. Roberts Gesicht, das sie mitleidig anblickte. Hella warf den Telefonhörer in das Gesicht: „Ich mach‘ dich kaputt! So, wie du mich kaputt machst!“ Der Hörer fiel zu Boden und ging entzwei. Sollte doch der Anschluss unterbrochen sein! Sollte doch der letzte Draht zu Robert abgeschnitten sein! …
Hella schaltete das Licht an. Sie zog die Vorhänge beiseite. Die Straßenlampe vor dem Haus leuchtete durch das Fenster. Sie schaute hinaus. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite hielt ein Taxi. Ein Mann stieg aus. Dann knallte die Autotür zu. Hella wartete nicht, bis sie den Mann im Dunkeln erkennen konnte. Stattdessen lief sie zur Eingangstür und schloss sie zweimal ab. Den Schlüssel ließ sie im Schlüsselloch stecken. Obwohl Robert ohnehin nicht hineinkäme. Einer spontanen Eingebung folgend, hatte Hella am Tag zuvor das Türschloss austauschen lassen. Nur für alle Fälle.
Sie setzte sich ans Fenster und lauschte. Das Taxi fuhr wieder ab. Es klingelte. Sicher hatte der Besucher bemerkt, dass sie zu Hause war. Es klingelte noch einmal. Doch Hella blieb sitzen. Sie zelebrierte ihre Präsenz. Mit allen Sinnen nahm sie wahr, dass sie da war. Ja, sie war anwesend und ließ ihn nicht eintreten. – Ihn da draußen zu wissen! In seiner Ohnmacht. Das fühlte sich göttlich und teuflisch zugleich an. Leise lief sie zur Tür und hielt ihr Ohr daran. Sie konnte seinen Atem hören. Und sie spürte seinen Finger auf dem Klingelknopf, als er ihn erneut drückte. Vergeblich.
Und dennoch. Sie ist da. Und sie bleibt präsent. Präsent für ihn. Wie ein unsichtbarer Verfolger wird sie ihm auf der Spur bleiben. Sie wird sich an sein Dasein heften. Weil sie existiert. Denn es ist unmöglich, nicht zu existieren. Und wie sollte sie auch das, was war und was ist, ungeschehen machen? Ins Nichts umkehren? Nein, das Nichts existiert nicht. Und Raum und Zeit haben beide mindestens drei Dimensionen. Eine davon ist das Morgen. Und das zählt.