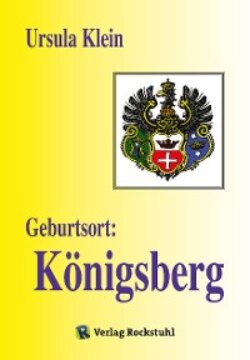Читать книгу Geburtsort: Königsberg - Ursula Klein - Страница 6
Motor der Erinnerungen
Оглавление„Hallo, Uschi! Hast du Zeit für mich? Ich soll einen Bericht schreiben und habe Angst, dass ich zu viele Fehler mache. Meine Deutsch-Lehrerin ist so streng und ich will mir meine hart erkämpfte „Drei“ nicht noch in Gefahr bringen.“
Der Lockenkopf steckte noch im Türrahmen, als seine Worte immer noch aus ihm heraussprudelten. Verschmitzt schaute er die Sekretärin an und seine Augen bettelten unnachahmbar: Gell, du hilfst mir? Ich lade dich auch ins Kino ein!
Uschi war zwar in ihrem blitzsauberen Sekretariat immer am Arbeiten, aber als dieser Lockenkopf erschien, lagen die Finger auf der Schreibmaschine wie hypnotisiert – unfähig, auch nur ein Wort fehlerfrei zu schreiben. Doch ihre Augen strahlten ein eindeutiges „Ja“, ohne dass ein Wort gefallen wäre. „Jetzt habe ich aber gerade keine Zeit, ich muss dringend etwas abschreiben. Du kannst aber heute nach Dienstschluss noch einmal kommen, dann machen wir gemeinsam deine Hausaufgaben“, war ihre eindeutige Antwort, ohne dass ein „Guten-Tag-Gruß“ gewechselt worden wäre.
Und schon war der Lockenkopf aus dem Türrahmen verschwunden und die Türe fiel ins Schloss.
Ruhe war im Zimmer. Wie nach dem Krach einer Bombe herrschte lautlose Stille. Der immer glänzend gebohnerte Fußbodenbelag sah noch aus, wie er immer aussah, die Blumen auf dem Blumenständer blühten wie vorhin, die Magnettafel für den Lehrereinsatz blieb an der Wand, die Sitzecke und der große Berliner Kachelofen hatten ihre Gemütlichkeit nicht verloren, der große, dunkle Aktenschrank sah immer noch geheimnisvoll aus.
Aber der umfangreiche, schwere, nussbaumfurnierte Schreibtisch, der sonst immer die Barriere zwischen Hörern der Volkshochschule und der Sekretärin war, hatte seine Funktion nicht erfüllt: eine Barriere zu sein. Bereits vor der Türe bis zum Schreibmaschinentisch in der Ecke hinter dem Schreibtisch war eine Brücke entstanden, die zwar nicht sichtbar war, aber mit allen Fasern von Uschi spürbar. Warum war auf einmal im Zimmer alles so anders?
Mit klopfendem Herzen und feuchtkalten Fingern setzte sie sich wieder an ihre Schreibmaschine und wollte weiterarbeiten. Bereits nach den ersten Buchstaben hatte sie sich vertippt und holte innerlich brummend einen Radiergummi aus der Schublade, um den Fehler zu korrigieren. Übertippen konnte ihr Chef überhaupt nicht leiden und so machte sie sich an die Beseitigung ihres Tippfehlers. Das war bei fünf Durchschlägen immer sehr zeitraubend und arbeitsaufwendig. Aber was half’s. Sie hatte sich eben für einen kleinen Augenblick nicht richtig konzentriert und die Strafe war sofort gefolgt.
Der Radiergummi musste bis zum Dienstschluss noch häufiger vorgeholt werden. Es ging mit dem Abschreiben überhaupt nicht mehr so flink wie sonst. Die Gedanken konnten sich einfach nicht konzentrieren. Wie freute sie sich schon auf den Feierabend. Und doch: sie musste ja erst ihre Arbeit fertig haben, sonst gab es mürrische Blicke vom Chef.
Fertig! Die zehn Seiten mit den Durchschlägen lagen gehäufelt vor ihr und mussten nur noch sortiert und geklammert werden. Auch das wurde noch vor Feierabend geschafft – immer mit einem ängstlichen Blick auf die Uhr, ob die Zeit dafür reichte.
Pünktlich auf die Minute betrat der Lockenkopf Gerd das Sekretariat und relativ schnell war die Arbeit für seine Schule erledigt. Nun blickten sich die beiden scheu an: Gerd, weil er nicht wusste, ob Uschi zur Kinoeinladung Ja sagen und Uschi, weil sie nicht zu hoffen wagte, dass Gerd die Einladung tatsächlich wahr machen würde. Doch völlig unkompliziert fragte Gerd: „Welchen Film wollen wir uns ansehen? Wann hast du Zeit?“ So einfach war das also mit dem Verabreden! Doch Gerd hatte schon alles vorher abgeklärt. Seine Gedanken bewegten sich in der Richtung, dass es nicht ein x-beliebiger Film sein dürfte, sondern für Uschi musste es schon etwas Niveauvolles, Kulturelles sein und kein Fünf-Groschen-Film. Sein Angebot war daher verlockend: „Am Dienstag wird im Capitol ‚Van Gogh‘ gespielt. Interessiert dich so was?“
Uschi war verwundert. Dieser lebensfrohe, immer zu Späßen aufgelegte Junge sieht sich ‚Van Gogh‘ an? Das war ein völlig neuer Aspekt an ihm, den kannte sie überhaupt noch nicht. Aber diese Schlussfolgerung erfüllte sie sogleich auch mit etwas Stolz: Er war eben doch anders als die anderen Jungens!
Zuhause angekommen erzählte ich bewusst so fast nebenbei, dass ich am Dienstag ins Kino gehe. „Van Gogh“ wird gespielt. Sofort horchte Dorchen auf: „Mit wem gehst du denn ins Kino, du bist doch bisher nicht alleine fortgegangen?“
Nun musste ich Farbe bekennen. Meine Hände waren sofort wieder eiskalt, mein Herz schlug für mich hörbar laut, als meine Antwort war: „Mit Gerd, der hat mit mir zusammen in der Volkshochschule die 10. Klasse abgeschlossen. Er hat mich zum Dank dafür eingeladen, dass ich ihm bei den Hausaufgaben geholfen habe.“ Dorchen bohrte weiter: „Wann ist denn die Vorstellung? Wer bezahlt die Karten? Lass dich bloß nicht wegen einer Kinokarte einfangen, so fängt es immer an!“
So, die Hürde war geschafft. Meine Schwester wusste jetzt Bescheid, dass ich am Dienstag nach der Arbeit nicht gleich nach Hause kommen würde. Das war erst einmal das Wichtigste für mich. Eigentlich hatte mich die Bemerkung „So fängt es immer an“ gar nicht geängstigt. Im Gegenteil – ich wünschte es mir direkt. Schließlich war ich ja schon 22 Jahre alt. Um mich herum waren die Mädchen in dem Alter bereits verheiratet und hatten Kinder! Doch meine innere Stimme sagte mir auch, dass die Verbindung mit einem jungen Mann mit Vorsicht zu genießen sei.
Meine ersten Kontakte mit einem jungen Mann waren nach fast 4 Jahren kläglich gescheitert. Meine Mutti lag mir damals immer in den Ohren: „Das ist kein Mann für dich – der sieht dir ja nicht einmal richtig in die Augen! Das ist nur ein Freund, aber kein Mann, den man ein ganzes Leben lang lieben muss! Der nimmt dich nur als Zeitvertreib, wenn er gerade einmal nichts Besseres zu tun hat!“ usw. Doch wer hört schon auf seine Mutter, wenn er die ersten zarten Bande mit einem jungen Mann bzw. mit einer jungen Frau hat? Ich klammerte mich an diese ersten zarten Gefühle und glaubte, dass sie die Erfüllung des Lebens seien. Und so kam, was kommen musste – wir trennten uns ohne viel Umstände, obwohl die Verlobungsringe hart erkämpft beschafft worden waren. Um die goldenen Ringe tat es mir leid, denn so schnell bekam man ja keine neuen in der DDR. Aber das war Vergangenheit.
In den Romanen hatte ich so oft gelesen, wie schön die Liebe ist, wie unvergleichlich die Gefühle und Erlebnisse sind. Ich wünschte mir auch diese starken, nie vergehenden Leidenschaften, die so oft beschriebenen heißen Küsse und Sehnsucht zueinander. So schön sollte mein Leben auch werden!
Und mein Herz sagte mir eindeutig: Jetzt oder nie! Der ist es! Kein anderer soll es sein! Aber eigentlich war ich zu diesen konkreten Gedanken gar nicht fähig – ich war einfach nur glücklich!
Schon die Einladung hatte mein Leben total verändert: Der Himmel war freundlicher, die Menschen um mich herum netter, die Blumen blühten schöner, alles war wie neu. Und doch konnte ich nicht sagen, warum ich alles anders empfand. Mich umgab auf einmal eine Welt voller Jubel und Freude.
Das Wochenende bei Mutti wollte nicht vorübergehen. Ich hing meinen Gedanken nach und wusste nur eins: Ich freue mich unbändig auf diesen Kinobesuch! In diese rosa-roten Gedanken hinein hörte ich die Frage meiner Mutti: „Was hast du denn heute, du bist ja so still. Bist du krank?“ Das fehlte mir jetzt noch, dass ich meine tiefsten Geheimnisse erzählen sollte. Doch ich brauchte nicht zu antworten, das übernahm meine Schwester: „Die ist im 7. Himmel, weil sie mit einem Gerd am Dienstag ins Kino geht!“ So, nun war es raus! Meine himmelhoch-jauchzenden Gefühle lagen jetzt ausgebreitet auf dem Esstisch – zur Allgemeinheit verkommen -zur Alltäglichkeit herabgewürdigt! Und doch war ich irgendwie zufrieden, denn nun wusste ja Mutti, dass es einen – meinen – Gerd gab. Gekonnt gleichgültig legte ich jedoch mein Buch zur Seite und gab noch – wie gelangweilt – die Zusatzinformation: „Weil ich ihm bei den Schularbeiten geholfen habe." Ich wusste nur zu gut, dass diese gute Tat von meiner Mutti jederzeit akzeptiert wurde, denn es gab nichts Wichtigeres als einen ordentlichen Schulabschluss mit guten Zensuren. Doch ihr Interesse hatte ich nun doch geweckt: „In welche Schule geht er denn noch, was macht er denn für einen Abschluss? Woher kennst du ihn denn?“ Oh, das waren unbeabsichtigt viele Fragen. Doch meine gespielt gleichgültigen Antworten ließen keine weiteren Fragen mehr offen: „Ich habe mit ihm in einer Klasse gesessen, als ich die Mittlere Reife gemacht habe und er ist jetzt im Institut zur Ausbildung von Ingenieurpädagogen. Nach drei Jahren macht er den Abschluss als Lehrmeister.“ Das saß. Das war ein toller Name der Schule. Das musste ein intelligentes Bürschchen sein! Es kamen keine weiteren Fragen und ich verabschiedete mich wieder in meine Traumwelt des Buches.
Der Kinobesuch wurde nach meinem Empfinden mit allen Raffinessen vorbereitet: Sonntagsschuhe mit passendem Kleid, gewaschene Haare (zu dieser Zeit war der Haarknoten aktuell, den ich natürlich auch hatte), ein extra Handtäschchen hatte ich morgens eingepackt und den üblichen Kosmetikaufwand betrieben, der etwas zeitaufwendiger ausgefallen war.
So vorbereitet saß ich herzklopfend an meinem Schreibtisch und verwünschte den Sekundenzeiger. Von wegen: dem Glücklichen schlägt keine Stunde! Das kann kein Verliebter gesagt haben! Die Zeit verging schleichend.
Ob er wohl pünktlich kommt? Hat er mich vielleicht schon vergessen? Bin ich hübsch genug? Was machen wir bis zum Kinobeginn? Wie war das eigentlich mit Van Gogh – wie war doch gleich sein Lebenslauf? Ich kann mich doch nicht blamieren, wenn er mich etwas zu dem Maler fragt! Ob ihm die Plätzchen schmecken, die ich eingepackt habe? Liegen meine Haare noch richtig?
Fragen über Fragen und Tippfehler am laufenden Band.
Pünktlich auf die Minute klopft jemand an die Türe. „Herein!“ Gott sei Dank! Er ist es! Mein Herz klopft noch schneller als vorhin bei der Warterei. Strahlend kommt Gerd auf mich zu und gibt mir die Hand zum Gruß. Wie alle Besucher – so bleibt auch er vor dem Ehrfurcht einflößenden Schreibtisch stehen. Doch unsere strahlenden Augen sehen keine Hindernisse, sie finden sich. Und alle Aufregung, alle Angst ist vergessen.
Nun geht alles seinen Lauf: Wir machen einen Spaziergang in dem Gothaer Park und Gerd erzählt so allerlei nette und lustige Dinge. Auch von seiner jetzigen Schule. Er ist zwar erst vier Wochen dort, aber sie sind im Internat eine lustige Truppe, die sich alle auf Anhieb gut verstehen. Viel Sport wird dort in der Freizeit auf dem abgeschlossenen Gelände betrieben, so dass die jungen Männer ihre Kräfte messen können. Auf meine Frage nach dem Unterricht antwortet er so gelassen, wie es eben geht: „Wir haben viele neue Unterrichtsfächer, von denen ich vorher noch nicht einmal gewusst habe, dass sie existieren, aber ich werde das schon schaffen. Nur Deutsch macht mir eben ein paar Probleme. Aber das war bei mir in der Schule schon immer so.“
Obwohl er ja in Gotha wohnt, kann er im Internat bleiben. Somit entfällt der tägliche Weg zur Schule und zurück. Wenn er aber so richtigen Hunger hat (und den hat er oft, wie er mir erzählt), fährt er mit dem Fahrrad oder mit der Straßenbahn nach Hause zu seinen Eltern. Wo sie wohnen, weiß ich schon, denn mein Heimweg nach der Schule führte mich immer an dem Haus vorbei und schon damals saugten sich meine Augen an den Fenstern fest, ob er nicht doch gelegentlich dort zu sehen wäre.
Die Zeit bis zum Kinobeginn vergeht in Sekundenschnelle. Alles, worüber wir uns unterhalten, ist wichtig und interessant, erzählt es doch vom Leben des anderen.
Ich bin bis zu diesem Zeitpunkt bisher nur selten im Kino gewesen, weil ein Kinobesuch in meinem Elternhaus als Luxus betrachtet wurde, obwohl eine Karte höchstens 1,80 M kostete. Und so war diese Vorstellung für mich eine Besonderheit. Zuvorkommend nahm Gerd mir an der Garderobe den Mantel ab und bezahlte (mit Trinkgeld!) die Gebühr. Er gab - ganz Kavalier - der Platzanweiserin die Karten, die uns unsere Sitzplätze höflich und freundlich zuwies. Er sah in seinem grauen Sakko, der dunklen Hose und dem dunklen Schlips feierlich, sportlich und elegant aus. Ich kam mir vor wie eine Prinzessin, die mit ihrem Prinzen im Theater placiert wird. Neugierig schaute ich mich um: alle Besucher unterhielten sich in gedämpftem Tonfall, waren etwas feierlich gekleidet, gut frisiert und machten ein wichtiges Gesicht, da der Film ein Menschenschicksal darstellte und sich jeder als kulturinteressiert einschätzte. Die Kinobesucher waren bunt durcheinander gewürfelt: junge und ältere, vorwiegend aber ältere, weil der Film ja weniger Unterhaltung, aber dafür mehr Informationen enthielt.
Doch was viel wichtiger war: Ich saß neben ihm. Ich fühlte seine Nähe, seine Wärme. Ich war glücklich. Meine bisherige Aufregung wich allmählich einem wohligen Gefühl der Geborgenheit. Die hektische Geschäftigkeit und Spannung wich einer inneren Zufriedenheit und Ruhe.
Nach dem dritten Gong verdunkelte sich das Licht, der schwere, dunkelrote Samtvorhang schob sich zur Seite. Nach den obligatorischen Werbebeiträgen und der Wiederholung von Gong und Lichtdimmer fing der Film endlich an.
Wir sahen einen ärmlich gekleideten jungen Mann als Lehrling in der Kunsthändlerausbildung, der recht unglücklich in seinem Beruf war. Danach versuchte er sein Heil als Prediger in einem Bergbauzentrum. Doch was sollte das mit dem berühmten Maler zu tun haben?
Unsere Blicke fanden sich auch im Dunkeln des Kinosaales und fragten gegenseitig: Gefällt dir das? Und so ist es nicht verwunderlich, dass unsere
Aufmerksamkeit anfänglich gequältes Interesse heuchelte, denn das war sogar nicht unsere jetzige Welt, in der wir uns befanden. Aber so ungelegen kam uns diese Situation gar nicht, denn somit hatten wir Zeit und Gelegenheit, die Zweisamkeit besser zu spüren.
Doch dann kam etwas: Van Gogh begann aus eigenem Gefühl heraus zu malen, ohne dass ihm jemand gezeigt hätte, was er alles berücksichtigen muss. Nach so allerlei Versuchen und einem ärmlichen Leben zieht er zu seinem Bruder nach Paris. Hier verändert sich sein Stil dahingehend, dass seine dunklen, düsteren Bilder in grell-leuchtende Farbgebung wechseln. Das gefiel uns schon etwas besser. Und als schließlich Van Gogh aus seiner Krankheit heraus einen Selbstmordversuch machte und er später in völliger Armut starb, flossen bei mir die Tränen und ich schluckte kräftig, damit es nicht so auffiel. Gerd hatte natürlich auch mit seinen Gefühlen zu kämpfen. Er zeigte es mir aber dadurch, dass er die eine Hand festhielt und die andere streichelte. Das tat ja so gut! Doch als das Licht wieder eingeschaltet wurde und sich der Vorhang schloss, sah ich immer noch verheult aus. Und ich schämte mich. Doch Gerd sah mich liebevoll an, zog aus seiner Hosentasche ein Taschentuch hervor und wischte mir die Tränen aus dem Gesicht.
Da war der Bann gebrochen: ich konnte wieder lächeln und fühlte mich verstanden in meinen Gefühlen. Und dann bemerkte ich auch in seinen Augen Spuren der Rührung aus der Filmhandlung. An der frischen Luft waren dann alle Gefühlsausbrüche vergessen.
Doch eins hatte der Film bei uns neben der Information bewirkt: wir waren uns sehr nahe gekommen. Ich wusste nun: das war kein „Hans-Dampf-in-allen-Gassen“, sondern er konnte seine Gefühle genauso zeigen wie ich. Für mich war das nicht nur ein Kinobesuch schlechthin gewesen, sondern ein erstes starkes Band des sich Kennenlernens und Verstehens. Wir waren jetzt nicht mehr nur zwei ehemalige Schüler, die sich kannten, sondern mit unseren Gefühlen miteinander verbunden.
Das zeigte sich dann auch äußerlich darin, dass Gerd mich jetzt öfter besuchte, ohne dass ich für ihn etwas schreiben sollte. Mir war es mehr als recht.
Doch damit begannen auch einige Probleme:
Ich wohnte von Montag bis Sonnabendmittag mit meiner Schwester in einem möblierten Zimmer in Gotha. Nach der Arbeit fuhren wir mit der Waldbahn nach Hause zu unseren Eltern nach Friedrichroda.
Und damit stand fast täglich Gerd zum Dienstschluss vor der Volkshochschule, um mich abzuholen und „nach Hause“ zu bringen. Der gemeinsame Weg durch den Park wurde heißersehntes Tagesziel. Und so wurden auch die Wege immer verschlungener und weitläufiger, so dass ich immer später bei meiner Schwester eintraf. Da sie schon sehr früh mit ihrer Arbeit als Buchhalter begann (sie musste schon um 5 Uhr aufstehen), war natürlich ihre Arbeitszeit auch früher beendet und sie wartete täglich mit dem Abendbrot auf mich. Nur wurde die gemeinsame Mahlzeit immer öfter nach 19 Uhr verlegt und sie wurde darüber – verständlicherweise – etwas brummig. Doch letztlich hatte sie auch Verständnis dafür, denn sie war ja selbst verlobt.
Auch die Eltern von Gerd wurden allmählich neugierig, mit wem da ihr Sohn so oft spazieren geht, obwohl er doch eigentlich lernen sollte. Da unser Weg oft an der Wohnung vorbeiführte, lauerte sein Vater ab und zu am Fenster, um zu sehen, wer das wohl sein könnte und vor allem, wie sie aussah.
Es war schon Spätherbst. Ich hatte eine von Dorchen genähte wunderschöne warme rotgefütterte schwarze Wolljacke an, das Kopftuch – damals ganz modern gebunden - und Gerd an meiner Seite. Unsere Blicke gingen gemeinsam zum Fenster hin, wo auch tatsächlich der Vati zu sehen war. Gerd winkte herauf, ich tat das Gleiche, Vati winkte zurück und lächelte dabei. Obwohl die Wohnung im dritten Stockwerk war, konnte – oder wollte? – ich Zustimmung erkennen. Und schon war der Kontakt hergestellt.
Als mich Gerd am nächsten Tag abholte, sagte er mir voller Stolz: „Meine Eltern wollen dich kennenlernen. Wäre es dir morgen nach der Arbeit recht?“ Im ersten Moment empfand ich Freude, aber im nächsten Augenblick fürchtete ich mich etwas vor diesem Ereignis. Aber egal – einmal musste es ja sein und schließlich wollte ich es ja eigentlich auch.
Und so ging ich mit Gerd am Dienstag in das Treppenhaus hinein, das einen dunkelgrünen Sockel, ausgetretene Fliesen und eine total verschmutzte weiße Wandfarbe hatte. (Wenn ich dieses Haus aber verglich, so sah es bei uns auch so ähnlich aus.) Die gewendelte, enge Treppe lag im Dunkeln und mir kam es so vor, als ob es eine Turmtreppe sei. Immer und immer höher führte die enge Treppe, bis Gerd schließlich am Ende die Wohnungstüre öffnete.
Ein freundlich-lächelnder Mann begrüßte mich. Sein Gesicht war schmal, die hellen Haare streng nach hinten gekämmt, die Geheimratsecken leuchteten. Er war nicht so groß wie Gerd, dafür aber rundlich, wie es eben so im entsprechenden Alter ist. Nach dem ersten freundlichen Guten Tag und dem Händedruck wich auch etwas Druck von mir. „Das ist Uschi“, hörte ich Gerd sagen. Es klang voller Stolz. Mein Gefühl sagte mir, dass diese Vorstellung noch mehr bedeutete – so etwa: das ist sie, das wird einmal meine Frau. Da die Begrüßung in der Küche stattgefunden hatte, wurde ich nun in die Stube gebeten. Dort erhob sich seine Mutti und begrüßte mich ebenfalls freundlich. Etwas verschüchtert wusste ich jetzt nicht, ob ich mit Straßenschuhen auf den guten Teppich treten durfte, der noch wie neu aussah und auf dem der runde Tisch mit den Stühlen stand. Ein sehr schönes Goldrand-Kaffee-Service stand auf dem Tisch und selbst gebackener Kuchen. Das zeigte mir eindeutig, dass ich von seinen Eltern liebevoll erwartet worden war. Das Wohnzimmer war urgemütlich eingerichtet: Im Blickfeld stand ein Bufet (es sah aus, wie selbst mit Liebe und voller Stolz hergestellt), darauf eine Bufet-Uhr und hoheitsvoll thronte ein Porzellan-Hund daneben. Gleich rechts neben der Türe stand in der Ecke auf einem kleinen Tischchen ein großes Radio und zwei bequeme, weiche Sessel, an der Wand gegenüber stand ein Sofa, darüber hing ein Ölbild mit einer Heidelandschaft. Eine Kommode mit einem Fernsehgerät vervollständigten die Einrichtung. Gleich links neben der Türe war ein hellgrüner Kachelofen, der von der Größe her wunderbar in die Stube passte und mollige Wärme im Winter versprach. So schön war es bei uns Zuhause nicht – war meine sofortige Feststellung. Fernsehapparate waren 1962 in den Haushalten noch sehr selten. Und seine Eltern besaßen einen! Das machte mir bewusst, dass wir in Friedrichroda doch relativ arm eingerichtet waren.
Doch diese Feststellung wurde bald weggewischt, als seine Mutti sagte: „Kommen Sie, setzen Sie sich!“
Kuchen und Kaffee schmeckten wunderbar. Noch während der Kaffeezeit fragten seine Eltern interessiert und für meine Begriffe etwas neugierig: „Als was arbeiten Ihre Eltern?“ Da musste ich das erste Mal erkennen, dass ich einem Vergleich mit anderen und besonders mit seinen Eltern nicht standhalten konnte. „Mein Papa“, so fing ich vorsichtig an, „ist 1950 als Kriegsinvalide aus sowjetischer Gefangenschaft gekommen und bekommt seit dieser Zeit eine kleine Rente. Meine Mutti war früher Hilfsschwester, kann aber jetzt nicht mehr arbeiten, weil sie es gesundheitlich nicht mehr schafft, bekommt aber keine Rente (weil ihr, so habe ich später erfahren, ein Drittel Prozent an der erforderlichen Zahl für die Invalidität fehlten. Sie war durch den Krieg bedingt mit den Nerven völlig am Ende, hatte aber weniger organische Krankheiten.) Darum habe ich mir mit meiner Schwester hier in Gotha ein möbliertes Zimmer gemietet, wir versorgen uns selbst und geben Zuhause noch etwas Geld ab, damit Mutti und Papa sich versorgen können.“
„Wenn Ihre Mutti kriegsbedingt so krank ist – woher kommen Sie denn?“
„Meine Eltern, Großeltern und alle Verwandten wohnten in Königsberg. Wir sind Weihnachten 1947 als Flüchtlinge nach Friedrichroda gekommen, weil dort eine Schwester meiner Mutti bereits vor dem Krieg geheiratet hatte und wir die Adresse im Lager angeben konnten.“
„Ja, ja, der Krieg, der hat viel Unheil gebracht. Unser Vati hat auch immer noch einen Splitter im Kopf und hat auch mit seinem Magen durch die Gefangenschaft viele Probleme“, war die einfühlsame Antwort von Gerds Mutti.
Doch Gerd horchte auf . „Wo bist du geboren?“ Der Tonfall seiner Frage war gleichzusetzen mit „Kommst du vom Mond?“ Einen Ortsnamen wie Königsberg hatte er noch nie gehört. Und zum anderen: Was sollte denn das! Wir leben ja schließlich in der DDR, da brauchen wir keine Könige und Kaiser mehr! Also musste ich auch aus einer Welt kommen, die lange vor dem Krieg existiert hatte und ich musste noch so ein Überbleibsel sein. Auf alle Fälle lag das Königsberg nicht in der engeren Umgebung, das hatte er bereits richtig vermutet.
Und so versuchte ich es ihm klarzumachen, dass Königsberg in Ostpreußen lag. „Wo liegt nun wieder Ostpreußen? So ein Land habe ich in Erdkunde nicht kennengelernt.“
„Ostpreußen war der nordöstlichste Teil Deutschlands vor dem Krieg. Du kennst doch die Ostsee in der Darstellung einer betenden Jungfrau? Da, wo sie kniet, lag Ostpreußen mit der Stadt Königsberg“, versuchte ich ihm zu erklären, er sah mich aber nur ungläubig an. Meine Ergänzung: „Heute heißt die Stadt aber Kaliningrad und liegt in der jetzigen Sowjetunion“, brachte ihm auch keine eindeutige Klarheit in seiner Vorstellung. Für ihn war ich auf alle Fälle irgendwo weit weg geboren worden – es musste furchtbar weit weg sein, wenn es jetzt Sowjetunion war, denn dazwischen lag ja auf alle Fälle auch noch Polen.
Für seine Eltern war Königsberg aber keine so unbekannte Größe. Sie redeten auf ihn ein und versuchten es mit ihren Vorstellungen zu erklären. Zuletzt holte Gerd noch einen Atlas hervor und ich zeigte ihm auf der Karte, wo diese Stadt gelegen hatte.
Das Gespräch hatte auf einmal eine interessante Wendung für alle Beteiligten genommen. Noch nie zuvor hatte ich irgendwo etwas über meinen Geburtsort aussagen müssen und wahrscheinlich hatte Gerd noch nie Kontakt mit einem Menschen gehabt, der so weit weg seinen Geburtsort hatte.
Und so fand ich die Fragen gar nicht mehr so schrecklich, die sich zwangsläufig anschließen mussten: „Wie alt waren Sie denn, als Sie in Friedrichroda ankamen? Wie haben Sie denn noch nach dem Krieg dort oben gelebt?“ Ich ahnte, dass damit viele Informationen verbunden waren, die seine Eltern – nicht aus Neugier, sondern aus Interesse an mir – von mir haben wollten.
„Ich bin im September 1940 geboren und war demnach, als wir aus Königsberg umgesiedelt wurden, 7 Jahre alt. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keine Schule besucht und war total unterernährt. Wir hatten dort viele Krankheiten und haben versucht, uns mit Betteln und Arbeiten in Litauen über Wasser zu halten.
Sehr viele Menschen sind noch nach dem Krieg gestorben, aber wie Sie sehen können, wir leben noch. Meine eigentliche Kindheit fing dann auch erst in Friedrichroda an, so dass ich auf die Frage, wo haben Sie denn Ihre Kindheit verlebt? sagen kann, in Friedrichroda in Thüringen“.
Selbstverständlich blieb es nicht aus, dass auch vom Krieg erzählt wurde, wie er in Gotha erlebt wurde. Auch hier hatte man Angst vor den Bomben, auch hier wurde gehungert. So konnte Gerd als Baby nur in allerletzter Minute noch von seiner Schwester aus seinem Bettchen genommen und in den Luftschutzkeller gebracht werden, als dann sofort danach die Bombe in unmittelbarer Nähe im Nachbarhaus einschlug und damit sein Leben gerettet werden konnte.
Doch resolut, wie die Mutter von Gerd war, beendete sie dann das traurige Thema, um auf die schöneren Seiten des Lebens zu kommen. Und so unterhielten wir uns über Handarbeiten, Lesen, Essen, Feiern und eben über alles, was man so allgemein erzählen kann, wenn man sich kennenlernt.
Es war schon Zeit für das Abendessen und ich verabschiedete mich mit dem Gefühl, dass Gerds Eltern nette Menschen sind, die ich auch gerne haben könnte. Gerd brachte mich natürlich noch bis zu meiner „Bude“, wo Dorchen schon mit dem Abendessen auf mich wartete. Neugierig fragten ihre Augen: „Na, wie war es?“ Eigentlich konnte ich gar nicht viel erzählen, denn es waren ja nur allgemeine und bekannte Themen gewesen.
Und trotzdem war meine Information: „Das sind nette Leute, die kann man richtig gern haben. Ich habe den Eindruck, dass sie mich auch mögen.“
Am nächsten Tag holte mich Gerd wieder von der Arbeit ab. Allmählich hatte ich auch ein schlechtes Gewissen, denn dadurch blieb ihm ja nicht viel Zeit zum Lernen. Aber er war der Meinung, dass er mir unbedingt etwas mitteilen müsse. Er hatte nämlich im Institut in der Bibliothek im „Meyers Neues Lexikon“, Ausgabe 1962, über meinen Geburtsort nachgelesen: Ein Königsberg war nicht drin, sondern nur der Ort Kaliningrad mit folgenden Informationen: Bis 1946 Königsberg. 15.100 qkm, … 1961 664.000 Einwohner … an der Mündung der Pregolja (Pregel) in der Ka.-bucht (Frisches Haff an der Ostsee), durch Seekanal mit Vorhafen Baltisk verbunden.
Er steckte sein Zettelchen mit diesen Notizen in die Hosentasche und zeigte sich immer noch etwas enttäuscht – war das doch so ein schöner Name einer Stadt und es stand so wenig im Lexikon. An seiner Reaktion merkte ich, dass er ganz andere Informationen erhofft hatte. Aber ich konnte ihm auch keine geben. Jedoch allein dadurch, dass er im Lexikon nachgelesen hatte, wurde mir bewusst, dass ihn alles, was um mich herum war, interessierte. Oder betrachtete er mich als eine Art Exot, weil ich nun einmal nicht in der jetzigen DDR geboren war? Es gab doch hier viele Umsiedler, das hätte ihn doch gar nicht so tief bewegen dürfen. Oder war es die Situation, dass er – wohl behütet – auch jünger an Jahren, den Krieg nie bewusst erlebt hatte? Betrachtete er mich als Beispiel einer lebendigen Geschichte?
Aber eigentlich waren diese Fragen gar nicht so wichtig. Viel wichtiger war, dass wir uns gern hatten und uns äußerst gut verstanden.
Nur eine Tatsache hatte ich ihm bisher verschwiegen: meine Eltern waren tief gläubig und hatten uns auch in diesem Sinne erzogen. Mutti mahnte uns immer an, nur mit einem Partner eine Verbindung zu planen, der auch gläubig war – sonst liege kein Segen darauf. Bisher hatte ich dieses Thema der kirchlichen Erziehung nie angesprochen und Gerd war auf diese Problematik nie gekommen. (Zum Kaffeetrinken bei seinen Eltern war mir sofort aufgefallen, dass vor dem Essen kein Gebet gesprochen worden war.) Wie sollte ich das nur Gerd beibringen? Ich hatte Angst, dass er für unseren Glauben kein Verständnis haben könnte. Würde er mich dann trotzdem noch gern haben? Allmählich beschlich mich Angst, wenn ich an dieses Thema dachte, befürchtete ich doch, dass sich dann unsere Verbindung lösen könnte. Darum überließ ich diese Problematik erst einmal dem Selbstlauf und genoss die augenblickliche Situation.
In der DDR hatte sich, das sei zum allgemeinen Verständnis gesagt, die Ideologie des Materialismus als Staatslehre durchgesetzt. Damit war verbunden, dass das In-die-Kirche-gehen unmodern geworden war, ja geradezu als altmodisch und überlebt dargestellt wurde. Darum lenkte auch der Staat die Erziehung der Jugendlichen im Geiste des Marxismus-Leninismus, forcierte die Feiern der Jugendweihen und zog mit allerhand Aktivitäten und Fördermaßnahmen die Jugendlichen an sich.
Dass Gerd nicht konfirmiert worden war, sondern über die Feier der Jugendweihe berichtet hatte, machte mir nur allzu deutlich bewusst, dass er nicht Mitglied einer Kirche oder Kirchengemeinde war. Daraus ließ sich leicht schlussfolgern, dass er auch nicht die Anforderungen meiner Eltern in den Glaubensfragen erfüllte, also aus der Sicht meiner Mutti für mich als Mann nicht in Frage kam.
Und so kam, was kommen musste: eine kleine Katastrophe.
Mutti war es nicht mehr zu verheimlichen, dass alle meine Gedanken nur noch um Gerd kreisten. So kam ich auch nicht mit der nächst möglichen Waldbahn am Sonnabend nach Hause, sondern erst mit der übernächsten, die Gespräche Zuhause interessierten mich nicht mehr – ich beteiligte mich also nur in Spurenelementen daran, war schweigsam, erledigte die kleinen Hausarbeiten, die am Wochenende Zuhause auf uns warteten, las viel, ging brav am Sonntag mit in die Kirche, sang im Kirchenchor mit, verhielt mich für meine Begriffe ruhig und erwachsen und war doch wiederum manchmal spontan, unruhig und gereizt. Mutti, die uns immer interessiert und liebevoll beobachtete, stellte nach mehreren Wochenenden unvermutet an mich die Frage: „Na, du hast wohl den Gerd sehr gern? Du hast dich so verändert. Erzähle mir doch etwas über ihn.“
Wo sollte ich anfangen, was war für meine Mutti von Interesse? Ich druckste herum. „Na, wie sieht er denn aus“, war die diplomatische Frage von Mutti. Damit war der Bann gebrochen. „Ach, Mutti, er ist wunderschön. Er hat dunkle Locken, ist einen Kopf größer als ich, schlank, sportlich, ganz Kavalier, immer zu Späßen aufgelegt, aber man kann sich auch wunderbar über ernste Themen mit ihm unterhalten. Er hat die Facharbeiterausbildung als Dreher, die er im VEB Getriebewerk Gotha gemacht hat, wo auch sein Vater als Dreher arbeitet. Und du weißt ja, dass er mit mir in der Volkshochschule war. Seine Mutti ist Postfrau. Seine Eltern sind sehr nett; ich habe dir ja schon erzählt, dass ich dort zum Kaffeetrinken eingeladen war.“ Nun sprudelte es nur so aus mir heraus, und ich war glücklich, endlich einmal so richtig ausführlich darüber sprechen zu können, denn Geheimnisse konnten und wollten wir nicht lange vor unserer Mutti verbergen.
Sie merkte auch mit dem Instinkt einer Mutti, dass diese Situation einer Klärung bedurfte. Und so war es nach der Unterhaltung wie selbstverständlich, dass sie sagte: „Na, dann lade doch deinen Gerd zum Sonntagnachmittag zu uns ein, dann will ich mir den Prinzen ja auch einmal ansehen.“
Das war ein wichtiger Satz. Wir durften zwar als Mädchen unsere Freundinnen und Werner – unser Bruder – seine Freunde mit nach Hause bringen, aber umgekehrt war Mutti nicht begeistert; dann musste es schon etwas „Festes“ sein. Also schlussfolgerte ich, dass Mutti einsah, dass Gerd für mich keine vorübergehende Freundschaft war.
Dieser Gedanke bewirkte in mir ein großes Glücksgefühl. Schnell stand ich auf, umarmte Mutti glücklich und drückte ihr einen Kuss auf den Mund.
Die Woche, die zwischen Sonntag und dem nächsten Sonntag lag, war sehr lang. Außerdem trafen wir uns nur zweimal, so dass ich schon Angst hatte, ich könnte ihm die Einladung zu uns nach Hause gar nicht mitteilen.
Am Sonntag hörte ich die Predigt wie durch einen Schleier und musste mir Mühe geben, mich zu konzentrieren, was der Prediger sagte. Aber während einer Predigt sieht ja keiner, welche Gedanken einen bewegen, und so war ich froh, als wir nach Hause gehen konnten, um Mittag zu essen und nach dem Mittagessen konnte ich Gerd von der Bahn abholen.
Der Himmel war strahlendblau. Die Bäume hatten zwar Ende November keine Blätter mehr, aber das Laub lag in allen Farben leuchtend auf der Erde. Er nahm mich in seine Arme und die Welt war noch viel schöner. In der Hand hielt er einen kleinen Blumenstrauß. Freudestrahlend sagte er: „Der ist für deine Mutti!“ Mein erster Gedanke war: „Na, da sammelt er aber Punkte.“ Aber mein Gerd war eben ganz Kavalier und wusste, was sich gehörte. Alle Achtung! Langsam schlenderten wir zu uns – verliebt und glücklich.
Nun führte ich Gerd in das Haus, in dem wir wohnten. Die Treppe war zwar blitzsauber gebohnert, aber Farbe war an den Wänden kaum zu erkennen.
Mein Herz klopfte bis zum Hals hinauf, als wir die Türe öffneten. Auch hier war der Tisch gedeckt (wie bei seinen Eltern). Artig sagte Gerd zu meiner Mutti: „Ich danke Ihnen für diese Einladung“ und überreichte ihr strahlend lächelnd die Blumen. Muttis Augen leuchteten – wie lange war das her, dass sie – ohne dass sie Geburtstag gehabt hätte – Blumen bekommen hatte!
Auch bei uns stand ein Tisch in der Mitte des Zimmers, aber er hatte dreierlei Stühle, ein Stuhl stand neben dem kleinen transportablen Kachelofen und Besuch musste sich immer auf das „Sofa“ setzen. Das war zwar nur eine Kastenmatratze auf Holzklötzen, aber mit einer Decke abgedeckt und mit selbstgestickten Sofakissen zum Sofa erhoben. Auch bei uns in der Ecke war ein Radio auf einem kleinen Tischchen, aber kein Fernsehapparat zu sehen. Vor den beiden Fenstern standen zwei Holzsessel, die mit Sitzkissen versehen Bequemlichkeit ausstrahlen sollten. Die Prachtstücke unserer Einrichtung waren aber zwei Kommoden, die total unterschiedlich aussehend unsere Wäsche beherbergten. Sie waren, wie alle anderen Möbelstücke, von irgendwelchen Gemeindemitgliedern oder Bekannten nach der Umsiedlung aus Königsberg meinen Eltern geschenkt worden, damit wir überhaupt etwas in die Wohnung stellen konnten. Auf dem Fußboden lag ein einfacher Flickenteppich - das Prachtstück des Zimmers. Doch trotz aller Ärmlichkeit strahlte das Zimmer Gemütlichkeit aus, denn gestickte oder gehäkelte Deckchen und ein paar Blumentöpfe verzierten das Zimmer. Über dem Sofa hingen zwei wunderschöne Aquarelle von Dorchen, die eindeutig zeigten, dass Talent in ihr steckt. Mein Bruder Werner hatte bereits im Sommer seine Renate geheiratet. Sie hatte auch etwas zur Zimmergestaltung beigetragen und Mutti zwei Bilder mit getrockneten Blumen und Gräsern geschenkt. Als einziger Nachlass aus Königsberg hing das Bild meiner Großeltern an der Wand, das Mutti von ihrer Schwester bekommen hatte.
Aber Gerd schaute sich gar nicht lange um und setzte sich auf den ihm zugewiesenen Platz auf das „Sofa“. Er war groß und konnte – im Gegensatz zu mir – trotzdem noch auf den Teller sehen. Der Kaffee – heute einmal richtiger Bohnenkaffee – wurde eingeschenkt und duftete herrlich. Er wurde nach einem besonderen Ritual gekocht: Die Kaffeekanne wurde zunächst mit kochendheißem Wasser ausgespült, die Kaffeelöffel voll Kaffee abgezählt in die Kanne gegeben und danach mit kochendem Wasser übergossen. Sorgfältig wurde der Schnabel der Kanne mit Papier verschlossen, damit kein Aroma entweichen konnte. Bis dann der Gast kam, wurde die Kanne unter einer Kaffeemütze warmgehalten, so dass der Kaffee auch richtig durchziehen konnte. Der Deckel der Kaffeekanne wurde mit einem Deckelhalter, der auch gleichzeitig als Tropfenfänger fungierte, festgehalten. Bevor der Kaffee eingeschenkt wurde, musste der Pfropfen aus dem Kaffeegrund, der sich in dem Schnabel gebildet hatte, erst entfernt werden. Danach erst konnte der Bohnenkaffee durch ein Sieb gegossen werden und landete in der Tasse.
Jeder nahm sich nun ein Stück Kuchen vom Kuchenteller. Für Gerd war es das Zeichen: jetzt kann ich essen. Aber erschrocken hörte er meinen Papa sagen: „Wir wollen erst einmal danken.“ Nun war es heraus. Gerd nahm den Kuchenlöffel wieder aus dem Mund, legte ihn auf den Teller und schaute mich fragend an. Ich – ängstlich, aber tapfer – lächelte ihn an, senkte meinen Kopf, schloss die Augen und faltete die Hände. Aus meinen Augenwinkeln heraus konnte ich erkennen, dass er es mir alles genau nachgemacht hatte. Gott sei Dank! Das war gut gegangen. Von ihm kamen nach dem Gebet keine Fragen, Bemerkungen oder eine andere Reaktion. Mir saß immer noch der Schrecken in den Gliedern, obwohl ich es doch hätte wissen müssen, was passiert. Aber ich war zu feige. Doch Gerd lächelte mich nur an und wollte mit dem Essen beginnen. Da es zur Feier des Tages einen belegten Tortenboden gab, drückte er den Kuchenlöffel in den Kuchenrand – und schwups – war das Stückchen auf seiner Hose. In Blitzesschnelle hatte er einen hochroten Kopf . Erschrocken suchte er das Stückchen auf dem Fußboden, fand es und steckte es in den Mund. Mutti tröstete sofort: „Das ist nicht schlimm, das Ihnen das passiert ist. Der Kuchenrand ist etwas hart geraten. Ich muss mich dafür bei Ihnen entschuldigen. Ihre Hose ist doch nicht beschmutzt?“
Aber in unserer Familie gab es immer genug Gesprächsthemen und Mutti lenkte gleich ab.
Unter dem Tisch fanden sich unsere Hände, die wir verstohlen drückten. Schneller als vermutet, hieß es dann aber: „Nun muss Gerd aber gehen, sonst verpasst er die Waldbahn.“
Ich brachte ihn die Treppe hinunter. Er nahm mich ganz fest in seine Arme. Der lange, innige Kuss hatte mich so aufgewühlt, dass ich vor lauter Freude und Erregung drei Stufen mit einem Mal nahm, bis ich wieder, viel zu früh, in der Wohnung war. Ich war noch total erregt und nicht fähig, auch nur einen klaren Gedanken zu fassen, als ich – wie aus der Ferne – meine Mutti hörte: „Na, wie hat es ihm bei uns gefallen?“ „Das kann ich dir gar nicht so eindeutig sagen, ich habe ihn nicht gefragt“, war meine schnelle Antwort. Mein Gedanke war nur: hoffentlich fragt sie nicht, was wir so lange im Flur gemacht haben. Wir hatten uns nämlich über nichts unterhalten, sondern nur immer und immer wieder geküsst. Und das war für mich das Wichtigste, denn es gab mir doch gleich Bestätigung, dass wir für ihn nicht zu ärmlich wohnten, er gegen das Beten nichts hatte und er mich ebenfalls liebte.
Nach diesem Besuch von Gerd bei uns lag mein Leben in Gedanken klar vor mir: es war ein gemeinsames, schönes Leben mit Gerd. Ich war mir meiner Sache so sicher, dass gar keine Fragen oder Zweifel mehr aufkamen.
Mir fiel nur auf, dass er gelegentlich nach Königsberg fragte, obwohl für mich mein Geburtsort keine so große Bedeutung hatte, denn ich lebte ja jetzt im Frieden, brauchte keine Angst mehr zu haben, hatte mein Essen, mein Zuhause und war außerdem noch glücklich und verliebt. Wenn er jedoch danach fragte, erzählte ich ihm dann so ein paar Einzelheiten aus dem Krieg. Für ihn waren dann meine Erzählungen wie Geschichten aus einem Bilderbuch.
*
Die Zeit verging in Riesenschritten. Wir verloren allmählich die Einstufung bei den Einheimischen, „Flüchtlinge“ zu sein.
Jedoch die folgenden Beispiele brachten mir meine Vergangenheit im Laufe der Zeit wieder etwas zurück.
Wir wollten heiraten und meldeten uns beim Standesamt an. Zunächst musste ich natürlich dem Standesbeamten eingestehen, dass ich keine Geburtsurkunde besaß, sondern nur einen „Auszug aus dem Taufregister der Evangelischen Kirchengemeinde Königsberg/Pr.- Ponarth“. Diese Urkunde – von Mutti für die Lebensmittelkarten-Beschaffung über viele Beamtenwege - heiß erstritten wurde von uns immer lächelnd als „Existenzberechtigungsschein“ bezeichnet. Hier stutzte der Beamte, denn eigentlich war eine Heirat ohne Geburtsurkunde beamtenrechtlich gar nicht möglich. Zum anderen war ich angeblich in einem Ort geboren, den es gar nicht mehr gab. Darum machte er den Vorschlag: „Na, da schreiben wir doch beim Geburtsort Kaliningrad hin, das hat doch wenigstens eine konkrete Aussage!“ Kleinlaut protestierte ich: „Aber in der Bescheinigung steht doch „Königsberg/Pr.“, da kann man doch nicht einfach einen anderen Namen einsetzen – oder geht das?“ Er schüttelte nur verständnislos den Kopf und fügte sich dieser besonderen Situation.
*
Viele Jahre später: unsere Tochter war – wie ich damals – verliebt. Eines Tages fragte mich der junge Mann: „Stimmt das wirklich, dass Sie in Grönland geboren sind?“ Ich schaute ihn zunächst verständnislos an. Er versuchte mich aufzuklären. „Na, Ihre Tochter hat doch gesagt, dass Sie ganz oben im Norden geboren sind – in Grönland.“ Da dämmerte bei mir etwas: Im Atlas war mein Geburtsort nicht mehr zu finden und ich hatte immer gesagt, dass Königsberg im Norden liegt. In der Folgezeit lächelten wir noch öfter über dieses Missverständnis.
*
Die Informationen im West-Fernsehen wurden über die ehemaligen deutschen Gebiete immer umfangreicher – Kriegsfilme spiegelten Fluchtgeschichten wider, Berichte über Samland, Kurisches Haff, Königsberg, Masuren, das Bernsteinzimmer u. ä. kamen zwar vereinzelt, brachten mir aber ab und an Informationen über meine Heimat, die ich nur von Kriegserlebnissen her kannte. Äußerst interessiert hörten wir uns diese Berichte an, sahen die Filme und ich erkannte in einigen Situationen die eigene Vergangenheit.
Auch unsere Nachschlagewerke gaben uns nun schon mehr Informationen. So las ich im Universallexikon, das 1986 erschienen war, Königsberg:
1255 Gründung der Burg Königsberg
1457/1525 Sitz der Hochmeister des Deutschen Ritterordens
1525/1618 Sitz der Herzöge von Preußen
1618 ging Preußen an Brandenburg
1813 Ausgangsort der Erhebung Preußens gegen Napoleon I. K. hat 375.000 Einwohner, Industrie- und Kulturzentrum, Verkehrsknotenpunkt, Theater, landeskundliches Museum, zoologischer Garten, Fernsehsender, Maschinenbau, Lokomotiv- und Waggonbau, Reparaturwerft, Zellstoff- und Papierindustrie, Nahrungsmittelindustrie/Fischverarbeitung, Universität, 2 Hochschulen, bei K. mehrere Seebäder. Im 2. Weltkrieg wurde die zur Festung erklärte Stadt von faschistisch-deutschen Truppen von Januar 1945 bis zum 9. 4. 1945 hartnäckig verteidigt und dabei stark zerstört. Die faschistischen Truppen in K. wurden am 9. 4. 1945 von der Roten Armee zur Kapitulation gezwungen. Auf Beschluss der Potsdamer Konferenz wurde die Stadt mit etwa ein Drittel des ehemaligen Ostpreußens an die UdSSR übergeben. 1946 Umbenennung in Kaliningrad. Rascher Neuaufbau der Stadt.
Nun wurde es für mich und meinen Mann interessant. Das waren Informationen, die für uns völliges Neuland waren.
Dann kam die alles entscheidende Situation: Die Grenze zwischen der BRD und der DDR fiel über Nacht am 9. November 1989. Nun konnten wir in alle Länder reisen und unsere Verwandten in Westdeutschland besuchen. Meine Tante übergab mir während eines Besuches zwei Bücher mit Bildmaterial über Königsberg mit vielsagendem Blick und der Bemerkung: „Hier hast du die Bücher, damit du weißt, wo du herkommst, ich kenne das ja alles.“ Zunächst betrachtete ich diese Bücher als reine Information über eine Stadt, die ich nicht kannte. Aber je mehr ich mich mit der Geschichte der Stadt vertraut machte, um so verbundener fühlte ich mich mit ihr. Mutti hatte uns in unserer Kindheit auch anhand von familiären Erlebnissen viel aus der Zeit Königsbergs erzählt, als der zweite Weltkrieg diese Residenzstadt noch nicht zerstört hatte. Diese Erzählungen kamen spontan wieder hoch und anhand der Bücher wurden einige Begriffe vorstellbar.
Das Maschennetz der Neugierde über Königsberg zog sich immer enger. So berichtete mir auch mein Cousin, dass er mit einem Reiseunternehmen schon eine Bustour nach Königsberg gemacht hatte. Mein Mann war Feuer und Flamme: „Nächstes Jahr, wenn du Rentner bist, fahren wir mit unserem Auto nach Königsberg! Das sehen wir uns einmal richtig an. Vielleicht steht auch noch der Rest von dem Haus deines Großvaters, von dem du mir erzählt hast. Würdest du dich darüber freuen?“
Doch meine Reaktion war sehr verhalten darüber, denn ich konnte mich ja an das Königsberg aus der Literatur fast gar nicht erinnern. Ich hatte schlicht Angst, in eine Stadt zu fahren, die ich kennen sollte, aber nicht kannte. So wurde ich in meinen Gedanken hin- und hergerissen.
Zunächst besorgte ich mir weitere Literatur und versuchte, die historischen Seiten kennenzulernen. In einem Bildband fand ich in einer Straßenkarte auch den Platz, an dem das Haus meines Großvaters gestanden hatte. Ich war furchtbar aufgeregt, in Gedanken ging ich immer und immer wieder in das Haus hinein, in der Wohnung herum, versuchte den Weg zur Wohnung meiner Eltern mit der Straßenbahn nachzuvollziehen und konnte mehrere Nächte nacheinander nicht schlafen. Alle Erinnerungen aus dem eigenen Erleben - vermischt mit den Erzählungen meiner Mutti - kamen in mir hoch und ich fragte mich: Wie war wohl ihr Leben im Schoß der Familie zu Kaisers Zeiten, nach dem Ersten Weltkrieg, während der Inflation und der Hitlerzeit gewesen? Woher hatte sie die Kraft genommen, uns 4 Kinder in den Kriegsjahren vor allen Gefahren einer Fehlentwicklung zu beschützen? Fragen über Fragen, die mich – nun auch Mutter und Oma – bewegten.
Und so unterlag ich meiner Neugierde und dem Zwang des Alters, an die Wurzeln meiner Vergangenheit zurückzukehren.
*