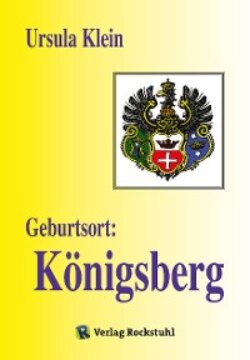Читать книгу Geburtsort: Königsberg - Ursula Klein - Страница 7
Zuhause in „56“ (1918-1925)
ОглавлениеIn der Ponarther Straße 56 war zu Ostern 1918 hellste Aufregung: Hanna, die zweitälteste von den fünf Kindern von Otto und Anna Krohn sollte in die Schule kommen. Ostern war für die Kinder ein besonderer Feiertag, denn zu diesem Fest bekamen sie fast alle ein neues Kleidchen und durften, falls das Wetter es erlaubte, das erste Mal Kniestrümpfe anziehen. Für jedes der Kinder lagen die Kleidungsstücke fein sortiert, gewaschen und gebügelt als Kleiderhäufchen auf dem roten Plüschsofa. Das war das Prachtstück in der Wohnstube, auf dem sie nur selten herumtollen durften. Das Exemplar war aber auch besonders hübsch: in dem Plüsch waren Ornamente eingedrückt und an der geschwungenen Rückenlehne in Kopfhöhe kleine gehäkelte Deckchen, damit der Stoff nicht schmutzig werden konnte.
Lisbeth, die Älteste mit ihren acht einhalb Jahren, ging der Mutter schon tüchtig zur Hand. Zum einen konnte sie sich - und auch Hanna - bereits alleine anziehen und zum anderen halfen beide, wenn auch noch linkisch, den Geschwistern. Herta mit ihren fünf Jahren brauchte Hilfe bei den Zöpfen, Fritz mit drei einhalb Jahren brachte die Mädchen völlig mit seinem eigenwilligen Köpfchen durcheinander und riss immer aus, sobald z. B. ein Strumpf angezogen war. Er war eben ein richtiger Lorbass Der Vater saß im Ohrensessel, der neben dem großen, grünen Kachelofen stand. Gedankenverloren zwirbelte er an seinem Kaiserschnauzer herum und schaute dem Treiben einfach zu. Hin und wieder rief er zur Ordnung und mit Windeseile reagierten die Kinder auf den Tadel. Sie liebten ihren Vater sehr, fürchteten aber auch seine strenge Hand. Nur Lotte wurde von der Mutter betreut. Sie hatte den Vorteil, noch von ihr gefüttert und angezogen zu werden, denn sie war ja erst 14 Monate alt.
Vor dem Frühstück sprach Vater gemeinsam mit allen das Gebet: „Komm, Herr Jesu, sei unser Gast und segne, was DU uns bescheret hast. Amen.“ Dabei falteten alle am Tisch die Hände, schlossen die Augen und senkten die Köpfe, damit sie nicht von dieser Zwiesprache abgelenkt werden konnten.
Nachdem der Tisch abgeräumt war – alle mussten helfen – wurde die Morgenandacht gehalten. Vater nahm die Bibel und las: „Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein von der Tür … Die Hüter aber erschraken vor Furcht und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel antwortete und sprach zu den Weibern: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr Jesum, den Gekreuzigten, suchet. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und sehet die Stätte, da der Herr gelegen hat. Und gehet eilend hin und sagt es seinen Jüngern, dass er auferstanden sei von den Toten … “. Nach alter Gewohnheit knieten alle nieder, falteten die Hände, legten sie auf den Stuhl, auf dem sie gesessen hatten, und nahmen die gleiche feierliche Haltung ein wie beim Tischgebet. Vater dankte Gott für die Gnade, die sie alle durch die Auferstehung Jesu erhalten durften, dankte für die erholsame Nacht und bat um den Segen für den jetzigen Tag. Nach dem „Amen“ standen alle wieder auf und machten sich für den Kirchgang fertig.
Trotz aller Aufregungen wegen Ostern und der Schuleinführung waren dann doch endlich alle Familienmitglieder zum Kirchgang angezogen. Vater konnte nun das große Haus verschließen, in dem 12 Familien wohnten.
Stolz gingen die vier Kinder vor den Eltern her, die Mutter schob den Kinderwagen und der Vater kontrollierte mit strenger Miene die Familienprozession. Neu war dies für keinen in der Familie, denn zum Sonntag gingen sie immer alle in die Kirche in die Speichersdorfer Straße und immer waren alle besonders hübsch angezogen.
Das war gar nicht so einfach, denn der Krieg, der schon 1914 begonnen hatte, brachte für alle Menschen auch in Königsberg Hunger und Not. Aber die Mutter hatte alle Kinder ohne ernsthaftere Erkrankungen durchgebracht, denn die kleine Selbstversorgung mit einem Gemüsegarten, den Kaninchen und dem Schwein hatte alle vor dem großen Hunger bewahrt, als der Vater Soldat war. Aber schwer war das Leben schon in den Jahren von 1914 bis 1918, als der Mann und Vater nicht bei der Familie sein konnte. Doch in solchen schweren Stunden half der Mutter der Glaube an Gott und seine Hilfe in der Not. Und im Stillen sagte sie zu sich, was in der Bibel stand: „Sorget nicht für den morgigen Tag. Es ist genug, dass ein jeglicher Tag seine eigene Plage habe.“ Das Wort machte sie still und die Kinder sahen nicht, dass Mutter Sorgen hatte, summte sie doch dann ein Lied vor sich hin und war getröstet.
Und darum war der Kirchgang in dieser Familie nicht eine traditionelle Zeremonie, sondern ein Bedürfnis und eine Möglichkeit, mit den Gemeindemitgliedern Gott zu danken für alle Hilfe, Liebe und Fürsorge, die sie bisher erfahren hatte. Und Anna hatte täglich wenigstens einen Grund, um Gott zu danken.
Ihr innigstes Dankgebet war aber vor ein paar Wochen, als Otto aus dem Krieg nach Hause kam. Die Kinder spielten gerade vor dem Haus auf dem Bürgersteig, als ein Soldat mit müden Schritten auf das Haus zuging. Hanna sah sich den Mann an: Was wollte der in ihrem Haus? Doch der Mann – unrasiert, verschmutzt und etwas hinkend - sah Lisbeth und Hanna - länger als fremde Menschen das tun -an, kam auf die beiden mit ausgebreiteten Armen zu. In seinen Augen war ein eigenartiges Leuchten, als er sagte: „Lisbeth, Hanna, ich bin wieder Zuhause! Ich bin euer Vater! Ich darf jetzt hier bleiben.“ Die beiden sahen sich ängstlich an. Doch dann kam die Erinnerung bei Lisbeth: „Vater, du bist wieder da! Da wird sich Mutter aber freuen! Komm rein, es gibt bald Mittagessen!“
Hanna ging den beiden mit eigenartigen Gedanken hinterher. Das sollte der Vater sein? Er hatte zwar den Kaiserschnauzer, von dem die Mutter immer so geschwärmt hatte, aber sonst stimmte nichts an der Beschreibung. Dieser Mann hier war nicht so schön, wie Mutter ihn beschrieben hatte. Aber Lisbeth hatte ja bestätigt, was der Mann gesagt hatte, dass er der Vater sei.
Es war schon eigenartig: Da kam ein Mann daher und sagte: „Ich bin euer Vater!“ Bisher waren sie doch ganz gut alleine mit Mutter ausgekommen. Gab es vielleicht jetzt noch weniger zu essen, wenn nun ein Esser mehr am Tisch saß? Die Gedanken wirbelten Hanna nur so im Kopf herum und langsam ging sie den beiden hinterher.
„Mutter, Mutter! Vater ist wieder da!“ Lisbeth stürmte in die Wohnung und Mutter kam sofort aus der Küche. Mit einem Aufschrei der Freude fielen sich beide in die Arme und hielten sich eng umschlungen. Mutter weinte. Das hatte Hanna noch nie gesehen. Vater drückte Mutter und küsste sie immer und immer wieder. Ihre Augen suchten und fanden sich. In ihnen war ein Leuchten und eine Freude! Auch das hatte Hanna bei Mutter bisher nicht gesehen. Lange standen so alle im Korridor. Herta, Fritz und Lotte kamen aus der Stube und wunderten sich noch mehr als die beiden Großen über den fremden Mann und die Freude der Mutter. Liebevoll streichelte Mutter das Gesicht von Vater und sagte: „Du bist schmal geworden, du wirst Hunger haben. Das Essen ist gleich fertig. Zieh dir die Wehrmachtklamotten aus! Ich hole dir frische Wäsche und deine Haushose! Du kannst dich auch erst ein bisschen waschen! Kinder, geht mal in die Stube und deckt schon den Tisch. Wartet, bis wir in die Stube kommen! Beschäftigt euch mit Fritz und Lotte! Herta soll euch helfen!“ Doch nach dieser Organisationsflut sah sich Vater erst einmal um, nahm die Kleinen - Lotte und Fritz - auf den Arm, drückte und küsste sie, streichelte die Wangen der drei Großen und auch dabei leuchteten seine Augen voll Liebe und voller Stolz. „Seid ihr aber alle groß geworden! Und so hübsch seht ihr aus! Jetzt bleibe ich bei euch. Ich muss auch nicht wieder fort, der Krieg ist für mich zu Ende. Gleich morgen gehe ich in meinen Betrieb und arbeite, dann hat Mutter wieder mehr Geld und kann euch etwas Schönes zu essen kochen.“
Das Letztere waren verheißungsvolle Worte. Nun konnten sie sich auf den fremden Mann, der ihr Vater sein sollte, auch freuen.
Und schneller als gedacht, hatten sich die Kinder wieder an den Vater gewöhnt und auch dass er ab und zu einmal ein Machtwort sprach. Darum gingen die Kinder am heutigen Ostersonntag zum Gottesdienst zwar wohlerzogen vor ihren Eltern her, aber innerlich kribbelte und krabbelte es am ganzen Körper, denn heute früh hatte jedes der Kinder als Osterüberraschung ein neues Kleidungsstück erhalten und ein paar Bonbons. Und solche Überraschungen gab es nur noch zu Weihnachten.
In der Sonntagsschule für die Kinder in der Gemeinde Speichersdorfer Straße, die parallel zum Gottesdienst für die Erwachsenen war, erzählte Onkel Fritz, der Bruder von Opa, wunderbare Geschichten und zeigte dazu schöne Bilder. Und heute – zu Ostern – war die Geschichte besonders ergreifend, denn Jesus war auferstanden von den Toten und darüber freuten sich alle. Hanna kannte zwar die Geschichte, aber Onkel Fritz erzählte so schön. Oft bekamen sie auch kleine Bilder geschenkt, über die sie sich ganz besonders freuten, denn sie wurden in einem kleinen Buch, das extra dafür geschaffen worden war, gesammelt. Wenn die Kinder also regelmäßig in die Sonntagsschule kamen, hatten sie auch eine komplette Bildersammlung für die biblischen Geschichten. Eifrig wurden auch manchmal zu den Festlichkeiten in der Kirche Gedichte gelernt, die die Kinder vor der ganzen Gemeinde vortragen durften. Das Herzchen schlug dann zwar bis zum Hals, aber Onkel Fritz saß immer in der ersten Reihe und half, falls einer nicht weiter wusste. Besonders schön klangen auch die Lieder mit Harmoniumbegleitung. Die Kinder sangen aus voller Kehle mit, achteten aber immer auf den Mund von Onkel Fritz, denn der kannte den Text. Aber mit der Zeit prägten sich die Lieder ein, ohne dass die Kleinen lesen konnten. Stolz hielt aber jedes Kind das Kinderliederbuch „Das Singvöglein“ in der Hand und erkannte die Lieder an den dazugehörigen Zeichnungen. Besonders gern sang Hanna das Lied:
Weil ich Jesu Schäflein bin, freu ich mich nur immerhin
Über meinen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewirten,
der mich liebt und der mich kennt und bei meinem Namen nennt.
Das Stillsitzen in der Kirche war trotzdem für Hanna eine Qual, war sie doch ein so temperamentvolles Kind. Darum wurde der Weg nach Hause als Wettlaufstrecke genutzt, obwohl sie immer nur bis zur nächsten Ecke laufen durften. Aber es war ja so befreiend, nach dem langen Sitzen laufen zu können.
Bis das Mittagessen Zuhause fertig war, durften die Kinder noch ein bisschen im Hof spielen. Manchmal hatte Hanna Pech und kam mit einem Loch im Strumpf oder einem schmutzigen Kleid in die Wohnung. Dann kam ein Donnerwetter auf sie herab und sie war traurig über sich, dass sie ihrer Mutti nun wieder Arbeit bereitet hatte. Aber dann kehrte wieder Ruhe ein, wenn alle am Tisch saßen und gemeinsam das Gebet sprachen.
Am Dienstag nach Ostern war es endlich so weit: Die Mutti steckte in einen Ranzen eine Schiefertafel, an der ein nasser Schwamm und ein trockener Lappen hingen, einen Griffelkasten, in dem zwei gespitzte Schiefergriffel lagen und das Lesebuch. Eine Schnitte Brot vervollständigte die Ausrüstung. Schwamm und Lappen hingen an der Seite aus dem Ranzen heraus und baumelten munter umher. Die Schiefertafel klapperte beim Gehen. Hanna fühlte sich durch den Ranzen gleich viel größer. Die Mutter ermahnte liebevoll: „Hanna, sei vorsichtig mit deinem Ranzen und der Schiefertafel, wir können so schnell nichts Neues kaufen! Sei auch vorsichtig auf der Straße und höre, wenn Lisbeth dir etwas sagt!“
Innerlich sträubte sich Hanna gegen diese Worte, denn sie war ja jetzt auch schon groß, und immer wurde Lisbeth als Vorbild hingestellt. Aber gehorsam nahm sie die Hand ihrer Schwester und gemeinsam machten sie sich auf den Weg.
Wie ein Klassenzimmer auszusehen hatte, wusste Hanna ja schon von ihrer Schwester. Und so war es auch: Für den Lehrer gab es ein hohes Schreibpult, auf dem Kreide und ein Rohrstock lagen. Eine große dunkle und zugleich geheimnisvolle Tafel stand den Schülern gegenüber und wartete darauf, dass sie beschrieben wurde. Die Schulbänke waren alt und stabil und hatten sicher schon vielen Kindergenerationen als Sitz- und Arbeitsfläche gedient. Gleich neben der Türe stand ein eiserner Ofen und daneben ein Eimer mit Holz und Kohlen. An der Wand hing in einem würdevollen Rahmen das Bild Kaiser Wilhelm I. Ehrfurchtsvoll setzte sich Hanna gleich in die erste Bank. Leider konnte sie nicht mit dem Stuhl kippen, denn die Sitzfläche war mit der Schreibfläche verbunden. Am oberen Teil der Schreibfläche war ein Tintenfass unter einem Deckel verborgen. Das brauchten aber nur die Großen, denn sie schrieben nicht mehr auf der Schiefertafel, sondern auf richtigem Papier. Wenn sie dann lange genug geübt hatten, mit Bleistift zu schreiben, durfte die Tinte zusammen mit einem Federhalter benutzt werden. Der Hausmeister war dafür verantwortlich, dass immer genug Tinte in den kleinen Fässchen mit den Deckeln enthalten war. Hanna kontrollierte gleich, ob das auch wirklich so war. Aber bis sie selbst mit Tinte schreiben durfte, musste sie noch zwei Jahre warten.
Nach dem „Guten Morgen, Kinder! – Setzen!“ hagelte es auch gleich Anweisungen zum Verhalten. Darum saßen alle Kinder zunächst wie angenagelt auf ihrem Platz. Der Lehrer sah drohend aus: Er hatte zwar auch wie der Papa einen Schnurrbart – einen Kaiserschnautzer –, aber die Augen waren nicht so freundlich und verständnisvoll, sondern streng und fordernd.
Hannas erster Eindruck war: Bei dem Lehrer muss ich artig sein, sonst lerne ich den Rohrstock kennen. Gerade hatte sie das gedacht, da sagte er das auch schon: „Kinder, bei mir herrscht Ordnung! Wer nicht spurt, bekommt meinen Rohrstock zu spüren!“ Alle Kinder duckten sich ab. Nun wurde der allgemeine Ablauf trainiert: „Wenn ich in die Klasse komme, steht ihr sofort von euren Plätzen auf und antwortet mir ‚Guten Tag, Herr Lehrer.‘ Es heißt auch nicht einfach ‚Ja‘, sondern ‚Jawohl, Herr Lehrer!‘ Sagt einer von euch etwas unaufgefordert, also plachandert er, so steht er für den Rest der Stunde in der Ecke. Wenn ich einen von euch etwas frage, so steht er auf, stellt sich neben die Bank und antwortet mir klar und laut. Wenn einer etwas sagen will, so bleibt er artig auf seinem Platz sitzen und hebt die Hand, bis ich ihn aufrufe. Hat einer von euch die Arbeiten nicht ordentlich gemacht, so muss er das üben, also jede Zeile fünfzigmal schreiben, damit er es lernt. Habt ihr mich verstanden?“ Wie trainiert antworteten die Kinder: „Jawohl, Herr Lehrer!“ Hanna rutschte immer tiefer. Das konnte ja heiter werden. Und darauf hatte sie sich gefreut? Doch nach dieser Moralpredigt ging es endlich mit der Schule los, denn sie wollte ja lesen, schreiben und rechnen lernen.
Und schon kam das Kommando: „Alle nehmen die Tafel und den Griffelkasten aus dem Ranzen. Jeder nimmt den Griffel in die rechte Hand! Wir schreiben ein A. Seht alle her, wie ich es mache.“ Noch eingeschüchtert versuchte jeder sein Bestes. Die Griffel quietschten und kratzten auf den Tafeln, denn jeder drückte mit voller Kraftanstrengung den Griffel auf die Schreibfläche. Je mehr sich Hanna Mühe gab, desto lauter war der Stift zu hören. Dann ging der Lehrer durch die Reihen und kontrollierte - auch Hanna. „Was hast du denn da für ein Gekritzel gemacht?“ Er nahm den Schwamm, der ja an der Seite herunter baumelte und wischte die ganze Mühsal einfach fort. Nun stand überhaupt nichts mehr auf der Tafel! Ihre ganze Arbeit war umsonst gewesen. Ihr standen die Tränen in den Augen. Sie hatte sich doch so große Mühe gegeben, besser konnte sie es nicht. Zu allem Überfluß sagte er auch noch: „Sieh her, so wird das geschrieben! Zuhause kannst du üben und die ganze Tafel mit dem Buchstaben vollschreiben.“ Er zog ein kleines Notizbuch hervor, notierte den Namen von Hanna und überließ sie ihren traurigen Gedanken und Empfindungen. Sie wusste jetzt schon: diese Schule gefiel ihr nicht, da war die Sonntagsschule in der Kirche viel schöner. Da konnte sie den Geschichten lauschen und Lieder singen, die so schön waren. Verträumt dachte sie gerade daran, als sie vor ihren Augen auf der Bank den Rohrstock niedersausen hörte. „Hanna, träume nicht, schreibe lieber!“ Aber – Gott sei Dank – die Schulglocke wurde vom Hausdiener gerade geläutet.
Zuhause erzählte sie der Mutter alles, was sie erlebt hatte, und zeigte traurig ihre Tafel. Tröstend hörte sie die Mutter sagen: „Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Setz dich gleich hin und schreibe so schön, wie es nur irgend geht.“ Dabei strich sie ihr liebevoll über die Haare und lächelte sie freundlich an. „Ich schaue mir deine Arbeit an, wenn du fertig bist, und dann können wir ja immer noch ein paar Zeichen erneuern.“ Die tröstenden und aufmunternden Worte von der Mutter hatten Hanna gut getan. Doch traurig malte sie Buchstabe für Buchstabe. Sie gab sich die größte Mühe beim Schreiben, aber ihr A war nicht so schön wie das vom Lehrer, das wie ein Vorbild leuchtete.
Draußen war herrliches Wetter zum Spielen. Die anderen Kinder waren alle schon im Hof oder auf der Straße.
Doch mit der Zeit gewöhnte sich auch Hanna an die Schule mit ihrer strengen Ordnung. Zuhause hatte sie immer genug Auslauf und konnte mit den anderen Kindern im Wirtschaftshof und im Garten prima spielen.
Mit einfachen Mitteln wurden Verkleidungen erfunden: ein Kodder (Lappen) fand sich immer, das mit Fitzelband (Nahtband) zusammengebunden wurde, ein Stückchen Stoff war der Brautschleier. Ein Stückchen Holz stellte eine Puppe dar, ein Karton war das Bettchen oder ganz und gar das Haus für das Singspiel:
Als wir kleine Kinder waren,
spielten wir Soldatje,
oder Braut und Bräutigamm,
oder Muttchje, Vatje.
Ein anderes Mal wurde aus einfachen Mitteln ein Ball selbst angefertigt, z. B. ein Stück Stoff mit Heu und Stroh und einem Stein gefüllt und kunstgerecht zusammengenäht. Das Nähen mussten immer die größten Mädchen übernehmen, die sowieso nicht so oft mitspielten, weil sie im Haushalt helfen mussten. Mit so einem Ball konnten herrliche Spiele gemacht werden. Besondere Freude bereitete immer das Balltreiben. Leider waren die Jungens bei diesem Spiel immer am besten, weil sie am weitesten werfen konnten, aber das machte nichts. Beim Völkerball dagegen waren die Mädchen wieder gefragt, weil sie flink ausweichen konnten. Doch manchmal flog der Ball im hohen Bogen über das Ziel hinaus und landete in einer Fensterscheibe. Brummend setzte der Vater die Scheiben dann wieder ein, um die Mieter nicht zu verärgern. Doch die Folge für Hanna war in solchen Situationen, dass sie der Mutter mehr helfen musste oder auf ihre Geschwister aufpassen. Und Mutter konnte immer Arbeit verteilen, sie hatte genug. So musste die Wäsche in der Waschküche, die auf dem Hof war, gewaschen werden. Dafür musste aus dem Brunnen, der zwischen Vorder- und Hinterhaus stand, das Wasser geholt und in Eimern über den Hof getragen werden. Damit das Wasser erwärmt werden konnte, wurde das Brennmaterial aus dem Holzstall geholt. Die Asche wurde im Garten verstreut und damit als Düngung verwendet. Das Helfen beim Essenkochen, Abwaschen, Fegen, Wischen, Aufräumen usw. war immer an der Tagesordnung. So ein Waschtag war aber jeden Donnerstag und hatte es in sich. Er war aber auch immer notwendig, denn jedes Kind hatte für den Alltag nur einmal Wechselkleidung und für den Sonntag die Sonntagssachen. Selbstverständlich wurde die Kleidung von allen nachwachsenden Geschwistern aufgetragen, so dass eigentlich immer nur die Größeren neue Sachen bekamen.
Doch die Arbeit war ja mit dem Waschen und Trocknen nicht beendet. Kleidung und Wäsche wurde ausgebessert, verkürzt oder verlängert, je nach dem, wer die Garderobe bekam.
Für das Bügeln musste auch der Herd in der Küche geheizt werden, damit das Bügeleisen erwärmt werden konnte. Mutter hatte zwar ein ganz modernes Bügeleisen vom Vater bekommen, das mit glühenden Kohlen gefüllt wurde, aber es hatte auch seine Tücken. Es war zwar länger heiß, aber wenn es zu heiß war, konnte die Wäsche beim Glätten auch verbrennen.
Da war es für Hanna schon einfacher, auf Fritz und Lotte aufzupassen als im Haushalt zu helfen. Da wurde sie ja nie fertig!
Und darum schmeckte ihr die Arbeit im Haushalt nicht. Die Mutter klagte dann nur: „Ach, Hanna, an dir ist ein Junge verloren gegangen.“
Und das war begründet, denn für Hanna gab es keinen Unsinn, den sie nicht mit ihren Cousins ausprobiert hätte. Stallungen und Wirtschaftshof boten viele Möglichkeiten. So nahmen sie wie eine verschworene Gemeinschaft die Forke und trieben das Schwein mit „Hallo“ aus dem Stall, um es dann quiekend wieder einzufangen. Die Häsin wurde heimlich gedeckt und der Vater wunderte sich, warum sie schon wieder tragend war. Im Gemüsegarten wurden die Karotten heimlich gegessen und das Kraut wieder kunstgerecht in die Erde gesteckt, damit der Verlust nicht auffiel. Birnen und Äpfel wurden vom Baum geschüttelt, damit sie „molsch“ waren und gegessen werden durften. Die Hühnereier wurden abgenommen und ausgetrunken, obwohl sie die Mutter dringend für die Versorgung brauchte. Der Ideenreichtum auf diesem Gebiet war unerschöpflich.
Wurden Wettkämpfe ausgetragen, strengte sich aber jeder wie zu Wettbewerbsbedingungen an und hatte am Abend einen hochroten Kopf, wenn es hieß: „Reinkommen! Abendbrot essen!“ Das war meist eine Milchsuppe, die schnell sättigte und außerdem billig war. Denn zwei Liter Milch wurden mit so viel Wasser verdünnt, bis die Menge für 7 Personen reichte. Ein Löffel Zucker und Mehlklunkern machten die Sache dick und schmackhaft.
Oft machte die Mutter erst eine Inventur bei Hanna: „Was hast du denn da für eine Brusche (Bäule)? Deine Schlorren (Holzschuhe mit Lederoberteil) sind ja so moddrig (verschmutzt) – du musstest wohl wieder unbedingt durch ein Patschloch (Pfütze) durch?“ In der Aufregung war Mutter ins Plattdeutsche geraten, obwohl sie nachdrücklich auch bei den Kindern auf die hochdeutsche Sprache bestand.
Schuldbewusst senkte Hanna dann den Kopf und war traurig über sich selbst. Doch Mutter konnte mit den Kindern nicht lange schimpfen. Wenn die Kinder dann vor dem Bett knieend das Abendgebet sagten, war aller Kummer vergessen und sie schliefen mit dem Versprechen ein, Böses nie wieder tun zu wollen. Und Hanna versprach das auch ehrlichen Herzens.
*
Aber manchmal war es auch in der Schule schön, wenn nämlich der Herr Lehrer in die Klasse trat und nach der Begrüßung sagte: „Heute will ich euch eine Geschichte erzählen, wie nämlich Königsberg entstanden ist. Wer weiß denn von euch, woher unsere Stadt seinen Namen hat?“ Eifrig meldeten sie fast alle Kinder. „Weil der König im Schloss wohnt!“ „Warum heißt es aber Königsberg/Preußen?“ „Weil Königsberg in Preußen liegt.“ „Gibt es dann noch ein anderes Königsberg?“, war die bohrende Frage des Lehrers. Hier wurden alle stutzig. Und darum fing der Lehrer zu erzählen an.
„Ja, es gibt noch einen anderen Ort in Deutschland, der auch so heißt. Aber er hat nicht so eine große Bedeutung wie unsere Stadt. Unsere Stadt ist vor vielen, vielen Jahren gegründet worden und das kam so:
Es war im Jahre 1231, als Ritter des Deutschen Ordens – das sind Ritter der Kirche – unter Führung des Ordensmeisters Hermann v. Salza von der Richtung Lübeck kommend in Richtung Osten marschierten.“ Dabei zeigte er auf die Landkarte und die Richtung, die die Ordensritter genommen hatten. „Sie wollten dem Herzog Konrad von Masovien helfen, sich gegen die Pruzzen zu verteidigen.“ Gespannt hörten die Kinder zu. Der Lehrer fragte: „Wisst ihr, wie Ritter aussehen?“ Vor lauter Aufregung erzählten sie alle durcheinander, bis der Lehrer sagte: „Hans, erzähle du bitte, wie ein Ritter aussieht!“ Hans – der Auserwählte – stellte sich sofort brav neben die Bank und mit bedeutungsvoller Stimme und leuchtenden Augen sagte er: „Ritter sind Kämpfer. Sie haben eine Rüstung. Das ist ein Anzug aus Metall, der schön glänzt und auch Verzierungen hat. Die Ritter sitzen hoch zu Ross – wie Kaiser Wilhelm I auf dem Denkmal – und haben Spieße, Stangen, Lanzen und Schilde, mit denen sie gegen die anderen kämpfen. Ritter wohnen auf einer Burg und sind immer tapfer.“ Beifallheischend setzte er sich wieder in seine Bank. Aber der Lehrer sagte einfach: „Ja, das stimmt, was du sagst.“
Der Lehrer setzte nun seinen Vortrag fort und die Kinder wurden wieder ruhiger. „Unterstützt durch die Kreuzfahrer aller Nationen der Christenheit drangen die Ritter unter dauernden Kämpfen bis zum Frischen Haff vor – immer an der Weichsel entlang. Es gab dabei viele Tote und Verwundete, denn die Pruzzen – das wird übersetzt mit Undeutschen, also den Alteingesessenen – wollten ihr Land nicht den Kreuzrittern überlassen. Die Kämpfe waren sehr hart und dauerten lange. Dabei wurden viele Menschen verwundet und getötet. Der Deutsche Orden als Armee der Kirche war aber gut im Umgang mit den Waffen ausgebildet und hatte auch viele Waffen. Und so konnte er nach langen Kämpfen siegen. Nur das stark befestigte Samland wurde erst erobert, als der polnische König Ottokar II. von Böhmen mitkämpfte. Ihr wisst ja, dass das Samland zwischen dem Haff und der Ostsee liegt und dort die Bernsteinvorkommen sind. Als der Deutsche Orden gesiegt hatte, baute er sich eine Ordensburg auf den Trümmern der Feste der Pruzzen. Die Feste war das schlossähnliche Gebäude der Pruzzen gewesen, die durch den Krieg kaputtgegangen war. Da mit Hilfe König Ottokar II. der Krieg gewonnen werden konnte, bestimmte er auch in diesem Gebiet und benannte die Burg Königsberg. Kurz darauf erhielt die Siedlung die Stadtrechte von ihm. Heute sind an dieser Stelle die Reichsbank und das Denkmal Friedrichs I.
Damit hatte der Deutsche Orden mit Hilfe des polnischen Königs ein Zentrum im Osten und konnte die unterworfenen Stämme kontrollieren und befehligen.
Die Bauern und Händler waren gegenüber dem Orden auch zinspflichtig, das heißt, sie mussten an ihn landwirtschaftliche Produkte oder Geld liefern. Je mehr Bauern sich also ansiedelten, um so mehr Einnahmen hatte der Orden für seine Ritter und Bediensteten. Außerdem hatte er auch das alleinige Recht zum Bernsteinhandel. Der Orden hatte also das Staatsmonopol. Man nannte es auch das Regal. Habt ihr auch schon einmal Bernstein an der Küste gefunden?“ „Ja“. „Ja“. „Meine Mutti auch“. „Und was habt ihr damit gemacht“?, war die Frage des Lehrers. „Wir haben ihn mit nach Hause genommen“. „Wir haben einen schönen Anhänger vom Juwelier machen lassen, den meine Mutti gern trägt.“ „Meine Mutti hat einen schönen Ring bekommen.“ Es gab viele Antworten. Doch mit ernster Miene sagte der Lehrer: „Wenn zu dieser Zeit jemand Bernstein fand, ihn ausgrub oder im Fischernetz fing, musste er alles – auch das kleinste Stückchen – dem Deutschen Orden abgeben. Wer den gefundenen Bernstein behielt, wurde hart bestraft.
Der Deutsche Orden war als ‚Großschäfferei‘ das größte mittelalterliche kaufmännische Unternehmen in Königsberg.
Schon 25 Jahre später, im Jahre 1257, erbaute der Orden östlich dieser provisorischen Verschanzung ein festes Haus aus Ziegel und Stein, wo heute vermutlich die Schlosskirche steht.
Natürlich konnte nicht nur eine Burg der Sitz der Ordensritter sein, sondern es mussten auch Häuser für die Bediensteten gebaut werden. Auf dem Burgberg bauten die Ordensritter die notwendigen Gebäude: Herrengebäude, Krankenhaus und Altersheim für die Ordensritter, das Kornhaus, das Marschallhaus und andere Vorratsgebäude und Wirtschaftshäuser für die Handwerker, die direkt dem Orden unterstanden. In den Kellern des Marschallhauses wurde viele Jahre später die Gaststätte ‚Blutgericht‘ eingerichtet. Kennt ihr diese Gaststätte?“ fragte der Lehrer. Nur Karl und Helga sagten leise: „Ja, Herr Lehrer.“ Und weiter erzählte der Lehrer: „Königsberg wurde zum wichtigsten Zentrum des Deutschen Ordens, zumal der Hauptsitz nach Marienburg verlegt worden war. Die älteste Siedlung zur Burg gehörig entstand dort, wo heute der Steindamm ist. Jedoch diese Siedlung ging ein paar Jahre später in Flammen auf, als die Pruzzen gegen die Ordensherrschaft aufstanden und gegen sie kämpften. Doch die Ordensritter siegten. Damit die Bediensteten im Schutz der Burg leben konnten, wurde eine neue Siedlung zwischen der Burg und dem Pregel gegründet. So entstand die heutige Altstadt. Schon am 28. Februar 1286 erhielt die Ansiedlung mit der Burg die Gründungsurkunde – die sogenannte ‚Handfeste‘ nach Kulmischem Recht – vom Landmeister Konrad von Thierberg. Kulmisches Recht deshalb, weil der Orden in Kulm an der Weichsel eine solche Grundordnung für Städte ausgearbeitet hatte. Somit konnten Bürgermeister, Rat und Gericht die Arbeit der Stadtverwaltung übernehmen.
Es kamen viele Menschen aus nah und fern in dieses östliche Gebiet, das der Orden zur Besiedlung freigab. Hier konnten sie allerlei Handel treiben und Gewerbebetriebe gründen. So wuchsen die Ansiedlungen sehr schnell und es wurde eng in der Stadt. Jede Ritterburg hatte nämlich im Mittelalter die Häuser eng an die Burg bauen lassen und alle Gebäude wurden mit einer großen Mauer umgeben, damit der Feind nicht in die Stadt eindringen konnte. Darum bekam auch die Burg von Königsberg die Sicherungsanlagen, die damals notwendig waren, und zwar im Osten und Westen eine Mauer und Türme mit drei Toren (Steintor im Westen, dem Löbenichtschen Tor im Osten und dem Krämertor vor der Krämerbrücke). Im Süden wurden der Pregelarm und im Norden der Burgkomplex als Sicherung genutzt. Nun platzte aber die Stadt aus allen Nähten und die Menschen mussten sich außerhalb dieser Burgsicherung ihre Häuser errichten und waren dadurch schutzlos.
Darum erhielt die Ansiedlung außerhalb der Burg – es waren vor allem Handwerker und Mälzenbräuer - bereits am 27. Mai 1300 das Stadtrecht und den Namen ‚Löbenicht‘, da die Siedler nicht den Namen ‚Neustadt‘ wollten, sondern den pruzzischen Namen.
Für die vielen Kaufleute, die sich in diesem Gebiet ansiedeln wollten, blieb nur noch das sumpfige Gelände, das südlich der Altstadt – vom Pregel umflossen – lag. Diese Gegend ist nur mit Brücken zu erreichen und hatte damit die besten Bedingungen für die Kaufleute, um auch mit Schiffen und Kähnen die Waren zu transportieren. Auf diesem Gelände wurde von den Kaufleuten eine große Kirche gebaut – der Königsberger Dom. Bereits 1327 erhielt auch diese Stadt das Stadtrecht und wurde nach dem pruzzischen Wort kipnaw, dem sumpfigen Gelände, zum Kneiphof.
Rekonstruktion von Friedrich Lahrs, der auch die neue „Stoa Kantina“ am Dom entwarf. Die Schlosskirche gab es noch nicht, dort befand sich das Ordenshaus (wie in der Marienburg). Reste davon sollen noch im 17. Jahrhundert gestanden haben. Der Schlossturm hat eine Haube, die nur aus der Beschreibung bekannt ist. Die älteste Wiedergabe des Schlosses ist von Braun und ist – wie bekannt – unzuverlässig.
Jede Stadt hatte nun für sich das Stadtrecht und die Stadtverwaltung. Es gab also damals drei Städte, die zu Königsberg gehörten.
Viele Jahre später, nämlich 1512, zog der Hochmeister Markgraf von Brandenburg in das Königsberger Schloss ein. Es war die Zeit, in der Martin Luther die Reformation der katholischen Kirche forderte. Das bewirkte eine große Bewegung innerhalb der Kirche, viele übernahmen den reformierten Glauben und wurden somit evangelisch. Da aber der Landesherr auch der reformierten Kirche beitreten wollte und somit nicht mehr Hochmeister im katholischen Orden sein durfte, legte er das Ordenskleid ab und verwandelte den Ordensstaat in ein Herzogtum. Das ging natürlich nicht so einfach, denn der Orden wollte nicht die Macht und das Land aufgeben. Der polnische König musste ebenfalls noch nach altem Recht zustimmen. Diese Diskussionen waren in Krakau und im Ergebnis sprechen wir vom Krakauer Frieden. Nach langer Diskussion lässt der polnische König Sigismund dem Herzog Albrecht zwar freie Hand, der muss ihm aber den Treueeid leisten. In diesem Zusammenhang spricht man in der Geschichte von ‚Sekularisierung‘, das heißt, dass der kirchliche Besitz aufgehoben und dem Herzog Albrecht zugesprochen wurde.
Am 9. Mai 1525 zog dann endlich Markgraf Albrecht in einer feierlichen Prozession als Herzog in das Schloss ein. Seit diesem Tag regierte nicht mehr der katholische Orden unsere Stadt, sondern der Herzog Albrecht.
Bilderläuterung; Altstadt in 1613
Der östliche Renaissancebau des Herzog Albrecht ist deutlich zu sehen. Rechts davon ist die alte Vorburg sichtbar, zwischen der und dem Hauptschloss sich noch immer der Graben befand. Im Schlosshof sind die Rundtreppe und das Marschallhaus deutlich zu erkennen. Die Altstädtische Kirche nimmt die Sicht auf den Schlossturm und die Ordenskirche.
Drei Jahre später lässt sich Herzog Albrecht von Lucas Cranach d. Ä. – der damals schon sehr berühmt war – malen.
Zweihundert Jahre lang existierten die drei Städte Königsberg. Jede hatte ihre eigene Verwaltung, jede ihre Rechte nach der ‚Kulmischen Handfeste‘.
Erst 1724 wurden die bestehenden drei Städte zu einer Stadt – Königsberg -vereinigt. Dieser Zusammenschluss ist heute noch in unserem Stadtwappen zu sehen, das die Wappen der drei Städte in sich vereinigt. Zuhause lasst euch das erklären. Nächste Woche sprechen wir darüber und wer will, kann das auch in einem kleinen Vortrag machen.“
Der Lehrer schaute sich erwartungsvoll in der Klasse um, aber keiner der Schüler meldete sich. Trotzdem schmunzelte er wissend, denn aus den vergangenen Jahrgängen wusste er, dass die Kinder dieses Thema sehr interessierte und immer ein paar Schüler auf Spurensuche über die Heimatstadt gegangen waren. Er war auch in diesem Jahrgang gespannt auf die Beiträge.
„So, Kinder, das war – kurz zusammengefasst – die Entstehung unserer Stadt. Nächste Woche seit ihr an der Reihe. Prägt euch auch die Jahreszahlen und Namen ein, die ich euch genannt habe, die frage ich nächste Woche ab.“
Wie stolz war Hanna heute, dass sie das alles gehört hatte und dass sie in einer so schönen Stadt Zuhause war, wo es ein richtiges Schloss gab, einen Tiergarten, den prächtigen großen Dom, die Hafenanlagen, Brücken und alle die großen Gebäude, die so hübsch aussahen. Es war schon ein erhebendes Gefühl, dass Ritter ihre Heimatstadt gegründet hatten, in der sie lebte. Nur eins hatte ihr nicht gefallen: Der Lehrer hatte zwar etwas von den Stadtteilen Altstadt, Löbenicht und Kneiphof erzählt, aber nichts von Ponarth, wo sie wohnte. Dabei gehörte doch Ponarth zu Königsberg!
Zuhause angekommen fragte Hanna sofort die Mutter nach dem Königsberger Wappen. Sie sagte aber: „Lass dir das vom Vater erzählen, der weiß das genau.“
Als der Vater am Abend von der Arbeit kam – er war Maurer bei der Eisenbahngesellschaft, die die Bahnhofsgebäude errichteten – war er zwar müde, aber er erklärte seiner Tochter geduldig alles, was sie wissen wollte. Hanna versuchte auch, sich alles genau einzuprägen, aber die anderen Kinder riefen schon nach ihr und sie rutschte ungeduldig auf dem Stuhl hin und her. Doch sie wagte es nicht, den Vater zu unterbrechen, denn schlechte Zensuren durften die Kinder nicht nach Hause bringen.
Aber – wenn das ab und an geschah - denn zog Vater Krohn nur kurz am Riemen und so mancher Ledertanz vollzog sich am Rückenende. Auch deswegen schon strengte sich Hanna an, um sich alles zu merken.
Und so verliefen die Schulstunden zwischen Angst, Pflichterfüllung und geforderter Disziplin. Fast jedes Kind war froh, wenn der Hausmeister mit der Glocke kam und das Ende des Unterrichts einläutete.
Doch auf die Stunde mit den Rittern freute sie sich schon, denn sie hatte ja über das Wappen viel von ihrem Vater erfahren. Doch zunächst wurde sie bitter enttäuscht, als der Lehrer mit strenger Miene und dem Rohrstock in der Hand die Mädchen abfragte:
Wann kamen die Ritter des Deutschen Ordens in unser Gebiet?
Wie hieß der Ordensmeister, der die Ritter geführt hat?
Wem wollten die Ritter helfen?
Wer sind die Pruzzen?
Was ist eine Großschäfferei?
Warum ist König Ottokar II in die Geschichte eingegangen?
Wann wurde die Burg errichtet?
Wann wurde die Altstadt gegründet?
Wie hieß die Gründungsurkunde?
Wann erhielt die neue Stadt Löbenicht das Stadtrecht?
Warum wurde sie Löbenicht genannt und nicht Neustadt?
Wann wurde die Stadt Kneiphof gegründet und wann erhielt sie die Urkunde?
Die Kinder hatten gar keine Zeit, lange zu überlegen, so schnell stellte der Lehrer die Fragen. Wer die Frage nicht richtig beantwortete, wurde sofort aufgeschrieben und musste für den Rest der Stunde neben der Bank stehen bleiben. Wer gar keine Antwort geben konnte, musste die Handflächen zeigen und der Rohrstock sauste über die Fingerspitzen. Schmerzverzerrt schlossen sie die Augen. Hanna hatte Glück mit ihrer Antwort. Erleichtert saß sie nun in ihrer Bank und wartete darauf, dass sie etwas über das Stadtwappen erzählen konnte.
Zaghaft und durch die strenge Wiederholung eingeschüchtert meldete sie sich und hob dabei ein Blatt Papier hoch, auf dem das Stadtwappen von Königsberg abgebildet war.
„Das Wappen unserer Stadt hat vier Teile“, hörte man vorsichtig und leise. „Der preußische Adler mit der Krone ist der obere Teil und hat in der Mitte das Zeichen von Friedrich Wilhelm I.“ Dabei zeigte sie mit dem Finger auf die Stelle im Wappen, über die sie gerade erzählte.
„Darunter in der Mitte ist das Wappen für die Altstadt. Es ist ein Schild von einem Ritter, der in dem oberen Teil die Krone des Königs Ottokar II. von Böhmen zeigt, nach dem ja das Schloss und später die Stadt benannt worden sind. Auf dem unteren Teil des Schildes ist ein weißes Kreuz auf rotem Grund zu sehen. Das ist das Zeichen für die hansische Bürgerfreiheit. Rechts neben dem Wappen der Altstadt ist das Stadtwappen von Löbenicht, links von der Altstadt ist das Wappen vom Kneiphof.
Mein Vater hat mir gesagt“, so erzählte Hanna weiter, „dass über diese ehemaligen drei einzelnen Städte gesagt wird:
in der Altstadt die Macht,
im Kneiphof die Pracht,
im Löbenicht der Acker.
Denn in der Altstadt ist das Schloss, im Kneiphof steht der Dom und sind die Speicherviertel als Zentrum des Handels mit den dazugehörigen Geschäftshäusern und im Löbenicht eben die landwirtschaftlichen Betriebe. Das Wappen vom Kneiphof kann bedeuten, dass die Wasserstraßen des Pregel die Grundlage für den Reichtum sind. Mein Vater wusste es aber nicht genau. Die beiden Hörner können zu den Schiffen gehören, die geblasen werden mussten, wenn sie nachts durch die geschlossene Balkensperre fahren wollten, um in die Altstadt zu kommen.
Auf allen drei Wappen ist die polnische Krone als Zeichen der Vorherrschaft durch König Ottokar von Böhmen. Mein Vater“, so sagte sie kleinlaut, „wusste aber nicht, was die beiden Sterne im Wappen von Löbenicht bedeuten. Es kann sein, dass sie für die Berufe stehen, nämlich für Handwerker und Bierbrauer, die damals vorrangig dort ausgeübt wurden.“ Hanna atmete tief durch und sagte: „Mehr weiß ich nicht“.
Sehr zufrieden schaute sie der Lehrer an und sagte: „Das hast du aber gut gemacht. Dafür gebe ich dir eine Eins. – Setz dich!“
Hanna freute sich sehr über diese Zensur, denn ein Lob erntete sie wegen ihrer schlechten Schrift nicht sehr oft.
Allen Mut nahm sie zusammen, als sie fragte: „Herr Lehrer – Ponarth ist doch auch ein Stadtteil von Königsberg. Seit wann gehören wir denn dazu, wenn wir schon nicht im Stadtwappen enthalten sind?“ Etwas erstaunt schaute er auf das kleine, etwas schmächtige Mädchen.
„Ponarth war in der Vergangenheit ein Vorort von Königsberg, ein uraltes Pruzzendorf. Hier siedelten sich Bürger an, die nicht Deutsche waren, z. B. Litauer, Russen, Polen, Böhmen, aber für den Deutschen Orden arbeiten wollten. Seine Bedeutung hatte dieser Vorort dadurch, dass in mittelalterlichen Zeiten die Fürsten, die Königsberg besuchen wollten oder auf dem Weg von Petersburg nach Paris waren, in dem nächstgelegenen Gasthof abstiegen und dort von den Ratsherren von Königsberg empfangen wurden. Daher hat Ponarth auch ein umfangreiches Braugewerbe. Die dort hergestellten Bier- und Likörsorten werden in Königsberg gern von den Erwachsenen getrunken. Später kamen noch die Betriebe der Eisenbahn und des Militärs hinzu. Daher hat sich Ponarth wirtschaftlich schnell entwickelt. Als dann 1905 einige Vororte, darunter auch Ponarth, eingemeindet wurden, hatte die Stadtkasse damit auch mehr Einnahmen. Aber in das Stadtwappen wurden die anderen Stadtteile nicht mehr übernommen.– Reicht dir die Antwort?“
Hanna war zufrieden. Stolz konnte sie noch ergänzen: „Mein Vater arbeitet in der Hauptwerkstatt von der Bahn und wir wohnen gegenüber der Ponarther Brauerei!“
Angeregt durch das Interesse von Hanna ergänzte der Lehrer noch: „Die anderen Stadtteile oder Bezirke, wie Nasser Garten, Rosenau, Speichersdorf, Hufen, Amalienau usw. wurden entweder auch 1905 eingemeindet oder werden noch in den nächsten Jahren eingemeindet (Hinweis: Sie erfolgte 1927/1929). Dagegen die Gebiete von Roßgarten, Sackheim und Tragheim existierten bereits im Mittelalter und gehörten zu Königsberg, ohne eigenes Stadtrecht zu haben. – Es freut mich, liebe Hanna, dass du dich so für die Geschichte unserer Stadt interessierst.“
Freudig erregt lief sie nach Hause. Ach, wie sangen doch die Vögel so schön! Wie hübsch war der Löwenzahn, der zwischen Häuserwand und Gehsteigpflaster hervorlugte! Sie hätte am liebsten die ganze Welt umarmt.
Fröhlich trällernd kam sie nach Hause und strahlte über das ganze Gesicht ihre Mutter an. „Na, du freust dich ja so – heute hat es in der Schule wohl ganz besonders gut geklappt?“ „Ja – und wie! Der Lehrer hat mich gelobt und ich habe außerdem eine Eins bekommen!“ Mutter nahm Hanna in die Arme, drückte sie voller Freude und Mitgefühl und strahlte ihre Tochter an.
„Ach, Mutter, ich bin ja so glücklich!“ Mutter hatte sofort den Flickenkorb zur Seite geräumt, als Hanna nach Hause kam. Mutter hatte immer Zeit für alle. Mutter war immer freundlich und verständnisvoll. Eigentlich konnte sie mit den Kindern gar nicht richtig schimpfen, wenn es auch öfter notwendig gewesen wäre. Immer wirkte sie versöhnlich, wenn sich die Kinder untereinander gestritten hatten, immer fand sie tröstende Worte für den einen und den anderen und zum Schluss waren wieder alle friedlich. Keines der Kinder sah ihr an, wenn sie große Sorgen plagten. Sie trug die Last alleine, niemals war sie mürrisch oder ungerecht. Alle Kinder liebten darum Mutter so sehr, dass sie ihr keinen Kummer bereiten wollten. Und wenn dann doch ein Missgeschick geschah und Mutter traurig war, so war das für die Kinder schon Strafe genug. Die strenge Hand hatte dafür aber der Vater.
„Na, da wollen wir einmal gemeinsam überlegen, was wir am Sonntagnachmittag zur Belohnung unternehmen. Wollen wir einen Ausflug zum Schlossteich machen?“ „Oh ja, das wäre schön!“ Hannas Augen leuchteten voller Freude, denn ein Ausflug in die Stadt wurde nur selten gemacht. Die Eltern hatten nur die 30 Reichsmark, die der Vater wöchentlich Freitag immer nach Hause brachte, denn die Mieteinnahmen wurden für das Haus gebraucht. Und so war immer ‚Schmalhans Küchenmeister‘ und für Ausgaben, die nicht direkt mit der Versorgung zu tun hatten, blieb kaum Geld. Die Kinder bewegten sich deshalb nur in der Nähe des Hauses oder in Ponarth. Und damit war dieser Ausflug ein besonderes Ereignis.
Nach dem Besuch der Kirche am Sonntag konnte Hanna es kaum noch aushalten. Sie war so aufgeregt, dass sie nach dem Essen von der Küche in die Stube, von der Stube in das Schlafzimmer lief und nicht wusste, warum. Die Mutter sagte verständnisvoll: „Hanna, Lisbeth und Herta – helft mir in der Küche, dann können wir schneller fortgehen!“ Hanna war wie ein Wiesel. Die drei Mädchen teilten sich die Arbeit auf: Lisbeth wusch das Geschirr, Hanna trocknete ab und Herta verwahrte alles. Dazu musste sie einen Stuhl vor den Küchenschrank schieben, um an die Fächer zu gelangen. Der Küchenschrank war neben dem Tisch und den Stühlen das einzige Möbelstück in der Küche, so dass sie gar nichts falsch einsortieren konnte. Unter dem Küchenfenster war nur noch ein Vorratsschrank, der – weil die Hauswand an dieser Stelle dünner war – gleichzeitig als Kühlschrank für die Lebensmittel benutzt wurde. Über dem blank gescheuerten Herd mit der Backröhre und dem Wasserschiff prangte eine feine Kreuzsticharbeit „Eigener Herd ist Goldes Wert“. Aus der Besenkammer gleich links neben der Türe nahm Hanna zum Schluss noch den Besen und kehrte die Küche aus. „Fertig!“ strahlten alle drei.
Die Mutter hatte in der Zwischenzeit die beiden Kleineren - Fritz und Lotte -angezogen. Vater war noch vom Kirchgang im Sonntagsstaat. Seine gute schwarze Hose und den ‚Rock‘ – so wurde die Jacke bezeichnet – hatte die Mutter schon am Sonnabend ausgebürstet und vor dem Schrank auf den Bügel gehängt, damit gleich alles griffbereit war. Mit dem Hemd ging das schon anders zu: Es war das Flanellhemd, das auch wochentags – und manchmal auch nachts - getragen wurde, denn so viele Anziehsachen konnte sich der Maurer mit seinen fünf Kindern nicht leisten. Natürlich wurde dieses Hemd mit einem weißen, steifen Papierkragen verschönt, der am Halsausschnitt angeknöpft wurde. Das Jabot – ein steifer, weißer, meist in feinen Falten gelegter Einsatz wurde wie ein Latz am Kragen befestigt und darauf ein Schlips gebunden. Am Handgelenk schob Vater – ebenfalls aus Papier bestehend – eine Manschette in die Jacke und fertig war der Sonntagsanzug. Diese Papiereinsätze waren nicht sehr teuer, aber besonders fest und man konnte sie sogar ein wenig mit Wasser säubern. Somit ging jeder Mann am Sonntag mit Schlips und Kragen, wie es volkstümlich hieß.
Der Einkaufskorb wurde noch mit Kuchen, Kaffee und Milch, einem kleinen Tischtuch und Tassen gefüllt, auf den Kinderwagen gestellt, in dem Lotte saß, Vater setzte den Hut auf, nahm den Spazierstock, Fritz an die Hand und leitete damit den Ausflug ein. Mutter band noch schnell die Küchenschürze ab, die drei Großen bekamen ihre frisch gebügelten Sonntagsschürzen um, schnell noch eine Schleife in die dünnen Zöpfe und ab ging die Post bis zur nächsten Straßenbahnhaltestelle. Die war den Kindern gut bekannt, denn sie war gar nicht weit weg. Aber mit der Straßenbahn auch fahren zu dürfen gehörte zum Luxus.
Es dauerte den Kindern viel zu lange, bis die Straßenbahn kam. Mutter stimmte darum das Kinderlied zum Zeitvertreib an und alle sangen mit:
Ling, ling, ling, die `Lektrische kommt,
Schaffner muss sich plagen.
Wer noch fünfzehn Pfennig hat,
der steige in den Wagen.
Die Lotte, die Lotte, die Lotte ist schon groß,
die kauft sich einen gelben Schein
und fährt alleine los.
Das Lied wurde nacheinander mit allen Namen der Kinder gesungen, bis die Elektrische endlich kam. Vater half Mutter, den Kinderwagen hinein zu heben, dann durften Lisbeth, Hanna und Herta einsteigen, Vater half den beiden Kleinen bei den hohen Stufen. Im Waggon war noch viel Platz, denn von Ponarth aus ging es in Richtung Zentrum. Die Schaffnerin zog an der ledernen Leine und für den Zugführer erscholl die helle Klingel als Zeichen dafür, dass alle Leute eingestiegen waren und er abfahren konnte. Vater holte das Portemonnaie hervor und sagte: „2 Erwachsene, 3 Kinder. Muss ich für die Kleinen und den Kinderwagen auch bezahlen?“ „Für den Kinderwagen den halben Preis“, war die Antwort der Schaffnerin. Sie öffnete ein Buch mit vielen Fahrscheinen, riss zwei gelbe und vier rote heraus und sagte: „Sieben Dittche, bitte.“ Hanna hatte das gehört und dachte erschrocken: siebzig Pfennig – das ist aber viel Geld! Nun wusste sie, warum sie so selten mit der Straßenbahn fuhren.
Es war ein wunderschöner Sonntag: Die Sonne strahlte vom Himmel, es war warm. Alle Spaziergänger und Fahrgäste hatten sich sonntäglich herausgeputzt. Die Mutter hatte ihr Sonntagskleid an, das sie sich, als Vater aus dem Krieg nach Hause gekommen war, nach der neuesten Mode geschneidert hatte. Denn die Mode hatte sich grundlegend verändert: Noch zur Jahrhundertwende hatten die Röcke der meist einteiligen Kleider noch kleine Schleppen. Die Betonung der Silhouette lag in der Schulterpartie. Sie wurde durch breite Kragen, Schultervolants und Keulenärmel erreicht. Der Prinzessschnitt war Mode und die sehr langen Ärmel wurden enger. Man schnürte Leib und Hüfte mit dem Korsett zu einer geraden Front und betonte die Büste, so dass der Körper von der Seite aus einer "S-Form" glich. Nach 1900 wurden die Röcke kürzer und die gesamte Kleidung legerer. Bedingt durch die Gleichstellung der Frau im beruflichen, privaten und politischen Bereich wollte man in der Kleidung keine Einengung mehr durch ein Korsett, verzichtete auf die Betonung der weiblichen Formen und verlangte nach Beinfreiheit. Die Folge waren vereinfachte Schnitte und kurze Röcke. Vor allem die Tageskleidung war nun praktisch und bequem.
Darum hatte sich Mutter auch an ein neues Kleid gewagt, obwohl sie in der Mode etwas ängstlich und konservativ war. Denn von ihrem Korselett wollte sie sich auf keinen Fall trennen, das gab ihr im Rücken den notwendigen Halt für einen geraden Gang. Aber sie musste ganz einfach auf die Rückkehr des Vaters mit einem neuen, modernen Kleid reagieren, um ihrer Freude besonderen Ausdruck zu geben.
Darum zog sie dieses Kleid nun immer an, wenn die Familie in die Kirche ging. Und heute war Mutter besonders schön: Die schwarzen, etwas gewellten vollen Haare waren wie immer zu einem Knoten gesteckt. Aber heute – weil man ja in die Stadt fuhr – hatte sie noch einen kleinen braunen Hut auf dem Kopf, der mit freundlich wirkenden Blumen geschmückt war. Wichtig war auch, dass der Hut mit einer Hutnadel am Knoten befestigt war. Das war nicht nur hübsch, sondern auch praktisch zugleich, hielt doch die Nadel bei Wind den Hut fest. Und Wind gab es oft. Die Zierde des Hutes war aber ein cremefarbener Schleier, der sparsam um den Hut gelegt war und hinten in einer Schleife endete. Als Mutter sich diesen Hut gekauft und ihn Zuhause gezeigt hatte, wertete Otto diese Errungenschaft: „Das sieht ja wie ein Topf aus. Und das soll modern sein?“ Mutter war damals etwas niedergeschlagen, aber sie hatte sich die Modezeitschriften genau angesehen. Das war gerade modern. Und darum setzte sie das gute Stück auch voller Stolz auf. Ein Paar passende Spangenschuhe in braun vervollständigten das Bild in Farbe und Harmonie der Kleidung.
Doch das alleine war es nicht, was die Mutter heute so festlich erscheinen ließ. Sie hatte zwar ihr wadenlanges, dunkelbraunes Sonntagskleid an, das die Taille mit einem Gürtel betonte, aber es hatte heute einen ganz fein gehäkelten großen cremefarbenen Kragen, der bis an die Schultern reichte. Hanna erinnerte sich, dass die Mutter viele Abende daran gearbeitet hatte. Aber wenn es dann zu dunkel geworden war, legte sie die Arbeit in einen Handarbeitskorb, um die Augen nicht zu sehr zu belasten und strickte an den Strümpfen und Pullovern weiter - und die Nadeln flogen wie automatisch. Aber gerade dieser Kragen war heute für Hanna wichtig, da er ihre Mutter in der Kleidung den reichen Bürgern gleichstellte. Da dieses Kunstwerk geschont werden musste, hatte der Kragen eine feste Kante am Hals und konnte mit Druckknöpfen befestigt werden, so dass er eben nur zu besonderen Festlichkeiten genutzt wurde. Und heute war so ein Tag. An den Ärmelbündchen schaute eine ebenfalls selbst gehäkelte gekräuselte Spitze hervor, die dem Sonntagskleid etwas Vollkommenes und Vornehmes gab. Auch diese Spitze hatte die Mutter heute extra hervorgeholt und kunstgerecht so befestigt, dass sie auch schnell wieder abgenommen werden konnte. Die Krönung war aber eine silberne Brosche, die den Spitzenkragen am Kleid befestigte und außerdem noch wunderschön aussah. Alles in allem war Mutter heute die Schönste und Hanna musste sie immer wieder anschauen und bestaunen.
Dass die Kinder mit der Straßenbahn fahren durften und sie außerdem auch noch gemeinsam einen Ausflug zum Schloss und zum Schlossteich machten, war für sie ein besonderes Ereignis. Alle waren aufgeregt, aber trotzdem verhielten sie sich in der Bahn äußerst vorbildlich. Kam noch ein Fahrgast – meist Frauen mit ihren Kindern - in die Bahn, schnellten sie von ihren Sitzen hoch, machten einen Knicks und sagten „Guten Tag – darf ich Ihnen meinen Platz anbieten?“
Die Fahrt durch die Hintere und Vordere Vorstadt ging schnell vorbei, denn es gab viel zu sehen. Vater sagte an der Grünen Brücke, die über den Pregel führte, dass dort rechts in dem großen Gebäude die Börse sei. Dort werde der Preis für unsere Waren ausgehandelt, die wir ausführen und von anderen Ländern einführen. Dann kam auch schon die Kneiphofsche Langgasse und Vater fragte Hanna: „Na, weißt du noch, zu welchem Stadtteil diese Straße gehört und welcher berühmter Bau hier ist?“ Hanna überlegte blitzschnell: Pregel – Brücke – Kneiphofsche Langgasse – das konnte nur der Stadtteil Kneiphof mit dem Dom sein. „Richtig“, sagte der Vater, „du hast gut aufgepasst“. Nach der Krämerbrücke kam dann auch schon die Kantstraße und gleich danach der Kaiser-Wilhelm-Platz. Das waren hier alles so schöne Gebäude, viel schöner und größer als in Ponarth. Der Vater sagte: „Die nächste Station – Gäsekusplatz – steigen wir aus. Wir wollen uns erst das Schloss von außen ansehen und dann zum Schlossteich gehen, wo wir unser Picknick machen.“
Gesagt – getan. Für Lisbeth und Hanna war es ein erhebendes Gefühl zu wissen, dass in dem Schloss der König wohnte und dort auch wichtige Verwaltungseinrichtungen waren (Herta, Fritz und Lotte waren noch etwas zu klein für solche Empfindungen).
Anmerkung; Gäsekusplatz
Vom Walter-Gäsekus-Platz aus blickte man auf die imposante Westfassade des Schlosses. Das Bild wird von der Schlossansicht beherrscht.
Der Vater nahm Lisbeth und Hanna an die Hand. „Ihr habt doch beide von eurem Lehrer über die Chronik Königsbergs schon viel gehört. Wisst ihr noch, wann die Burg gebaut wurde?“ Hanna war sofort bei der Sache. „1255 haben die Ordensritter auf dem Burgberg die erste kleine Burg gebaut.“ „Richtig“, lobte der Vater. „Als Albrecht als Herzog hier im Königsberger Schloss einzog, ließ er dann den Ostflügel durch Nürnberger Bauleute bauen, später kam dann der Südflügel dazu. Denn als Herzog brauchte er ja auch viele Räumlichkeiten für seinen Hofstaat. Wir sind zwar nicht dort vorbeigekommen, aber dort ist auch ein Relief Herzog Albrechts in Stein gehauen. Der Südflügel hatte den Vorteil, dass Herzog Albrecht nur über den Kirchplatz zu gehen brauchte, um in die Altstädtische Kirche zu gelangen. Herzog Albrecht hat viel für die Kunst, Musik, Medizin, Bildung und insgesamt für die Entwicklung der Stadt getan. Besonders bekannt sind die Silberbibliothek und sein Prunkschwert, das sogenannte ‚Albrechtsschwert‘, das für die Königskrönungen verwendet wurde. Da er auch eine öffentliche Bibliothek - und natürlich auch eine private – einrichtete, förderte er damit auch die Buchdruckerkunst in Preußen. Somit konnte z. B. 1527 das erste Preußische evangelische Gesangbuch gedruckt werden.“ „Ist das das Gesangbuch, das wir in der Gemeinde haben?“ „Es ist nicht dasselbe, sondern ein Nachdruck, aber damals wurden die Grundlagen geschaffen. Er erlaubte auch einem Wittenberger Unternehmen, die Bücher nicht nur in der damals gültigen lateinischen Sprache zu drucken, sondern auch in deutscher, pruzzischer, litauischer und polnischer Sprache.“
„Kannst du noch mehr aus der damaligen Zeit erzählen?“ Hanna und Lisbeth waren dankbare Zuhörer. „Da gibt es noch so viel zu erzählen, dass ich gar nicht weiß, womit ich anfangen soll. Ich versuche es einmal:
Nachdem Herzog Albrecht in das Schloss als Schlossherr eingezogen war, versuchte er, das Land auch nach weltlichen und nicht nur nach katholischen Richtlinien zu regieren. Seine Verdienste liegen darin, dass er z. B. kurz nach seiner Machtübernahme das ehemalige Ordenskrankenhaus – das ja in herzoglichen Besitz übergegangen war – der Stadt stiftete. Damit hatte die Stadt ein gut funktionierendes Krankenhaus. In der damaligen Zeit gab es eine fürchterliche Krankheit: die Pest.
Als dann Anfang des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts insgesamt fünf mal Pestepedemien ausbrachen und 1831 auch noch die Cholera, reichte das große Krankenhaus noch nicht einmal aus, um alle kranken Menschen aufzunehmen und vor allem von den noch gesunden Menschen zu isolieren.
Er förderte ganz besonders die Berufe der Kunsthandwerker, Baumeister, Ärzte. So gab es damals beispielsweise den Beruf eines Plattners, der Prunkharnische anfertigte, die Büchsenmeister, die Geschützgießer und Goldschmiede. Die vielen guten Handwerker kamen auch deshalb nach Königsberg, weil sie als Anhänger der Reformation meist in ihren alten Ortschaften nicht bleiben konnten und in Königsberg durch Herzog Albrecht Schutz erhielten. Wer damals ein sogenannter ‚Abtrünniger des Glaubens‘ war, wurde exkommuniziert, d. h. er durfte die Kinder nicht taufen lassen, wurde nicht begraben, erhielt keine Absolution durch die Beichte und hatte auch sonst sehr wenig Rechte. Wir brauchen keine Beichte in der Kirche abzulegen, denn wir erhalten Vergebung durch unseren Herrn Jesus, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, wenn wir unsere Fehler nur richtig bereuen.
Auf Herzog Albrecht geht auch die Gründung der Königsberger Universität zurück, die bereits 19 Jahre nach seiner Machtübernahme erfolgte. Sie erhielt nach ihm den Namen ‚Albertina‘. Ärzte, Prediger, Dichter, Schriftsteller, Philosophen sowie Maler, Bildhauer und alle anderen wichtigen Leute für die Entwicklung einer Stadt und die Hofhaltung kamen nicht als Nachwuchs von Königsberg, sondern aus anderen Ländern. Mit der Gründung der Universität hat Herzog Albrecht die Grundlage für eine eigene Entwicklung Königsbergs gelegt, in der ganz berühmte Persönlichkeiten tätig waren. Zum Beispiel Immanuel Kant war so berühmt, dass er heute noch bei allen Königsbergern und in anderen Ländern geehrt wird.
1618 wurde dann das Herzogtum Königsberg mit dem Kurhaus Brandenburg vereinigt. Damit war Königsberg dann nicht mehr die Residenz des Landesherren und der preußischen Könige, sondern eben nur noch eine Stadt wie jede andere größere in Brandenburg.
Anmerkung: Die Krönung 1861
Die Krönung Friedrich Wilhelm V. zum König von Preußen in der Schlosskirche am 18.Oktober 1861. Die Schlosskirche ist reichlich verziert. Die Orgel steht noch auf der Südempore. Der König steht mit seinem Rücken zum Altar. In seiner Hand das Krönungsschwert Herzog Albrechts, gefertigt von Jobst Freudener.
Am 18. Januar 1701 wurde Friedrich I in unserem Schloss zum König von Preußen gekrönt. Wilhelm V. setzte sich am 18. Oktober 1861 in unserer Schlosskirche die Königskrone auf. Er wurde später gegen seinen Willen zum Deutschen Kaiser in Versailles gekrönt. Vorhin sind wir am Bismarck- und Kaiser-Wilhelm-Denkmal vorbeigegangen und der Platz wurde nach dem Kaiser benannt. Bismarck war fast 20 Jahre preußischer Ministerpräsident.
Anmerkung: Die Huldigung
Nach der Krönung des letzten „nur“ Königs von Preußen, Friedrich Wilhelm V., kam es zur Huldigung der Stände auf dem Schlosshof. Dies war der letzte selbstständige und schicksalslose Höhepunkt der Preußischen Monarchie (auf den Tag genau 198 Jahre nach der Huldigung des großen Kurfürsten). 1871 wurde er, gegen seinen Willen, zum Kaiser in Versailles gekrönt.
Aber Königsberg hatte nicht nur schöne Tage erlebt. So war unsere Stadt im Siebenjährigen Krieg vier Jahre lang, und zwar von 1758 bis 1762 von den Russen belagert und ausgeräubert worden. Viel schlimmer war es dann aber im Juni 1807, als die Franzosen in Königsberg einmarschierten und die Stadt niederbrannten, außerdem noch eine große Summe an Kriegsschuld gezahlt werden sollte, nämlich 12 Millionen Franc. Königsberg zahlte an dieser Summe bis zum Jahre 1900.
Anmerkung: Im Schlosshof „In 1800“
Durch diese Kriegseinwirkungen und Feuersbrünste sind sehr viele alte Häuser abgebrannt. Darum gibt es nur noch sehr wenige aus dieser Zeit. Die alte Stadtbefestigung ist z. B. nur noch ein kleiner Rest und die alten Patrizierhäuser sind auch fast alle aus den vergangen Zeiten nicht mehr da.
Als Napoleon dann mit seinen Truppen in Richtung Russland marschierte, wurden die durchziehenden Soldaten in Königsberg stationiert. Damals waren so ungefähr 12 000 Franzosen einquartiert, die hier alle verpflegt und beherbergt werden mussten. Obwohl die Bürger durch den Krieg sehr arm waren, mussten sie das letzte Brot noch mit den Soldaten teilen.“
Das kam Hanna nun wieder bekannt vor, denn in Königsberg liefen sehr viele Soldaten herum und Mutter hatte erzählt, dass zu Beginn des Russlandfeldzuges 1914 auch viele Soldaten in Königsberg ernährt werden mussten. Vater meinte: „Ja, das war damals ganz genauso, weil Königsberg die letzte große Stadt im Nordosten des Deutschen Reiches und damit Versorgungspunkt für die Soldaten war.“
„Damals brachte die Hunger- und Kriegssituation das Fass zum Überlaufen. Und als bekannt wurde, dass die französische Armee in Russland geschlagen war, stand die deutsche Bevölkerung mit Beteiligung des Landadels, des Bürgertums und der Armee unter der Planung von Yorck auf und befreite sich im Februar 1813 von der napoleonischen Herrschaft. Das Haus in der Landhofmeisterstraße 16 - 18 trägt zur Erinnerung an den 5. Februar ein eisernes Kreuz mit den Worten ‚Februar 1813‘. Damals wurden auch die Grundzüge für eine Landwehrordnung entworfen, d. h. so eine Art Plan für die Selbstverteidigung mit Mobilisierung der Bevölkerung. Mein Großvater hat mir erzählt, wie stolz alle waren, die bei den Befreiungskämpfen dabeigewesen sind.“
Der Vater machte eine kleine Pause und hing seinen Erinnerungen für kurze Zeit nach. Mit einem Blick nach hinten vergewisserte er sich jedoch als Familienoberhaupt, dass seine Frau mit den drei Kindern noch da war. Ihre Blicke trafen sich in gegenseitiger Liebe. Beide waren glücklich, dass sie als Familie wieder zusammen sein konnten. Annas Blicke ruhten voller Stolz auf ihrem Mann, der sich mit den beiden Großen so schön unterhalten konnte. Sie merkte an den Bewegungen seiner Arme, dass er ab und an auf einzelne Gebäude hinwies. Also erzählte er den Kindern etwas über Königsberg. Das war auch gut so, denn über seine Heimatstadt sollte man schon Bescheid wissen. Und außerdem konnte Anna feststellen, dass die anfängliche Scheu von Hanna gegenüber ihrem Vater einer allgemeinen Vertrautheit gewichen war. Vater hatte aber auch immer wieder Kontakt und Verständnis gesucht und die Scheu voreinander war gewichen.
Auch Anna unterhielt sich angeregt mit den Kleinen, zeigte ihnen in den Grünflächen die Blumen, machte sie auf kleine Kriechtiere, Käfer und Vögel aufmerksam und erfand kleine Geschichten.
Sie kamen nun am Eingang des Stadtarchivs vorbei und Vater erklärte, dass dort alle wichtigen Unterlagen – auch von vor vielen Jahren – aufbewahrt werden, zum Beispiel Gesetze, Baupläne, Geburtsurkunden usw. Hanna lächelte ihren Vater an und sagte voller Stolz: „Du weißt aber viel! Hast du das auch alles in der Schule gelernt?“ „Ja, mein Kind, unser Lehrer hat uns immer wieder, immer wieder abgefragt – und wenn wir etwas nicht wussten, gab es ´was auf den Hosenboden. Wir haben uns dann lieber freiwillig hingesetzt und gelernt, bis wir alles konnten.“
Die Gruppe kam der Schlosskirche immer näher und Mutter fragte von hinten: „Wollen wir uns in der Kirche ein wenig ausruhen und ein kurzes Gebet halten?“ Alle waren sofort damit einverstanden. Der erste Weg war in der Sommersonne schon ein wenig ermüdend für die kleinen Füße der Kinder.
Ehrfurchtsvoll betrat die Familie die hohe, wunderschöne Schlosskirche. Die Kinder wussten ja, wie sie sich in der Kirche zu verhalten hatten: andächtig und ruhig. Aber diese Kirche war gegenüber dem Gemeindesaal kein Vergleich! Voller Staunen war ihr Blick. Und hier drin war der König gekrönt worden? Die Größeren konnten es kaum glauben, dass sich hier eine ganz einfache Familie aufhalten durfte, und doch war es so. Es war ja eine Kirche, und die war für alle Menschen da. Hanna schaute sich um. Die Bänke hatten schöne geschnitzte Verzierungen, die Säulen endeten in der hohen Decke in kunstvoll gestalteten Verstrebungen. Hanna verglich dies mit ihrer Hand. Der Arm war die Säule, die Finger die Verstrebungen, die in der obersten Stelle der Decke endeten. Die Plätze auf den Emporen waren sicher für die reichen Bürger. Der Altar war für Hanna beeindruckend schön. Vater sagte: „Schaut mal nach hinten. Dort oben ist eine Orgel eingebaut. Sie klingt wunderschön – viel schöner als unser Harmonium in unserem Gemeindesaal.“ Und wie auf Kommando ertönte zunächst in leisen, dann in immer lauter werdenden Tönen die Orgel. Hanna erkannte das Lied „Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit.“ Sie strahlte ihre Eltern an zum Zeichen, dass sie die Melodie erkannt hatte und Mutter nickte ihr zu. Dass in einer Kirche die Musik so schön klingen konnte, hatte sie nicht vermutet. Ein Gefühl überwältigte sie, wie groß der liebe Gott sein musste, wenn in seinem Haus die Musik so schön war. Mutter und Vater setzten sich für einen Moment in eine Bank, falteten die Hände und dankten Gott für diesen schönen Tag mit der ganzen Familie.
Nach diesem beeindruckenden Erlebnis machten sie sich wieder auf den Weg, denn sie wollten ja noch bis zum Schlossteich gehen. Damit sie schneller voran kamen, erzählte der Vater kurz, dass in der Nordseite des Schlosses, an der sie jetzt vorbeigingen, das Marschallhaus steht. Vater sagte mit verschmitztem Lächeln: „Darin ist schon viele Jahre die Gaststätte ‚Das Blutgericht‘. Dort feiern die Offiziere, reiche Bürger und Edelleute große Feste. Aber wir feiern lieber Zuhause – das ist billiger.“ Hanna lenkte gleich ein: „Das hat unser Lehrer auch erzählt. Aber warum heißt es denn so?“ Vater wusste, dass zu Herzog Albrechts Zeiten dort der Marschall, also der oberste Heerführer, sein Haus hatte, der die Kriege organisieren musste und Recht für die Soldaten sprach. Da auch einige Soldaten im Gerichtsurteil die Todesstrafe erhielten, also Blut floss, nannte man es damals das Blutgericht. Aber die Nachforschungen haben ergeben, dass gar nicht so viel Blut geflossen ist. Und jetzt wird dort viel gesungen, gelacht und getrunken.
Vater erzählte verschmitzt, dass er als junger Mann auch mit Freunden dort gemütlich zusammengesessen und am Nachbartisch eine frohe Schar Jugendlicher Trinksprüche am laufenden Band gesagt haben, um dabei immer ein Gläschen leer zu trinken. Einige habe er noch in Erinnerung:
„Das Wandern ist des Millers Lust,
lass ihm man ruhig wandern.
Ich nehm erst einem fiere Brust
und denn auch foorts dem andern.
So leb denn wohl, du edler Geist,
wo jedem schmeckt und keinem beißt! Prost!“
Oder:
„Wenn ich dir seh, denn muss ich weinen,
weil du so klein geraten bist.
Drum muss ich leider dir vertilgen
mit Andacht und mit Hinterlist.
Bestimmt, du musst mir auße Augen.
Ich kann mir selbst nich weinen sehn.
Drum kuller runter längs e Gurgel,
und grieß man auch den Magen scheen. Prost!“
Anmerkung: Schloss und Stadt
Im Vordergrund der Münzplatz. Der Östliche Renaissancebau des Herzog Albrecht ist links zu sehen. Die selten fotografierte Nordseite des Schlosses ist rechts vorn.
Lisbeth und Hanna konnten sich nicht vorstellen, dass man an einem so hässlichen Ort lustig sein konnte. Schon alleine der Gedanke machte sie traurig, dass dort Menschen gestorben waren. Aber Vater hatte sie vollkommen von ihren traurigen Gedanken abgelenkt, auch durch die Tatsache, dass er ostpreußischen Dialekt gesprochen hatte, was nur äußerst selten vorkam.
Um noch den letzten Rest der traurigen Gedanken seiner Kinder zu verscheuchen, lenkte er sie ab: „Seht mal nach vorn, wo die Burg zu Ende ist, da beginnt gleich der Schlossteich.“ Und schon waren die Gedanken der Kinder in Richtung Wasser und Kuchen essen. Wie von einer inneren Macht getrieben, liefen sie schneller als vorhin.
Jetzt hatten sie wieder ein schönes Ziel vor den Augen. Vater und Mutter suchten auch nicht lange nach einer leeren Bank und holten den Esskorb aus dem Kinderwagen. Wie schmeckte es doch so gut in der frischen Natur! Am Sonntag! Am Schlossteich!
Anmerkung:
Das Südende des Schlossteiches mit dem Blick auf das Schloss. Der Schlossteich war der Wasservorrat der Gründer und ersten Bewohner des Ordensschlosses.
Auf dem Wasser schwammen die großen Schwäne und hinter ihnen – wie im Gänsemarsch – fünf kleine hinterher. Durch die vielen Spaziergänger angelockt, schwammen sie auch manchmal an den Uferrand und ließen sich füttern. „Mutter, darf ich dem Schwan auch etwas geben?“ „Ja, aber bitte nur ein bisschen, sonst hast du nicht genug“, war die Antwort. Und kaum war es ausgesprochen, da stürmten alle vier an den Teichrand. Lotte wollte mit ihren kleinen Beinchen natürlich auch dorthin und strampelte im Kinderwagen aus Leibeskräften. Der Mutter blieb nichts anderes übrig, als sie an die Hand zu nehmen und mit ihr auch dorthin zu gehen. Die Schwäne waren schon dicht an den Teichrand herangeschwommen und Fritz natürlich furchtlos in nächster Nähe. Die Mädchen hielten ein wenig auf Abstand. Die Kuchenbröckchen wurden in Richtung Schwäne geworfen und alle Schwäne versuchten, einen Brocken zu bekommen. Es dauerte auch nicht lange, und die Kinder wagten sich immer näher an die Schwäne heran. Aber die Schwaneneltern passten auf ihre Jungen so gut auf, dass ihnen nichts passieren konnte. Mutter mahnte: „Ihr müsst auch essen, ich habe nicht noch mehr Kuchen mit!“ Als die Kinder dann nichts mehr zum Fressen in den Teich warfen, machten die Schwäne ganz schnell kehrt und schwammen zur nächsten Futterstelle.
Mitten in dem Teich war eine Insel, die mit einem Zaun umgeben ein hübsches Schwanenhaus hatte. Hier konnten die Schwanenpaare mit ihren Jungen ungestört die Nacht verbringen, hier konnte sie niemand vertreiben oder jagen. Nur ab und zu kam dort ein Paddelboot vorbei und die Insassen betrachtete sich die Insel aus der Nähe.
Vater machte die Kinder auf die Schönheit dieser Insel aufmerksam. „Kinder, könnt ihr euch vorstellen, wie schön es im Mai war, als sich die Studenten der Universität mit Fackeln auf dem Schlossteich in geschmückten Booten zum Mai-Singen trafen? Das soll ein großes Erlebnis nicht nur für die Studenten, sondern auch für alle promenierenden Menschen gewesen sein. Meine Kollegen haben mir davon erzählt. Das hat viel gewaltiger geklungen als der Gemeindechor in Ponarth. Vergleichbar ist das mit dem Harmonium bei uns und der Orgel in der Schlosskirche.“
Mutter war voller Freude und Glück über diesen schönen Sonntag. Wie stolz war sie auf ihre Kinder, ihren Mann, auf das schöne Land. In diesem Hochgefühl fiel ihr ein Gedicht ein, das sie einmal in der Schule gelernt hatte und nun den Kindern vortrug:
„Ich weiß ein Land, so eigen,
so schön, als wär´s erträumt.
Wo stolze Tannen ragen
Und weiße Woge schäumt.
Wo segenschwere Erde
Des Wandrers Schritte trägt
Und frohe, lebensstarke,
gesunde Menschen prägt.
Und fragt ihr nach dem Namen,
so sei er stolz genannt:
Das Land, so schön, so eigen,
Ostpreußen heißt das Land!
Den möcht´ ich glücklich preisen,
der hier Zuhause ist,
wo aus der Ackerkrume
das starke Leben grüßt.
Drum dank´ ich meinem Schöpfer,
bin betend ich allein,
der mich für wert befunden,
Ostpreußens Kind zu sein.“
Auch die Kinder erkannten in diesem Gedicht die Liebe zu ihrer Heimat.
Der Kuchen war gegessen, der Kaffee getrunken, die Kinder wollten noch ein bisschen herumtoben. „Ihr vier Großen dürft bis zur Schlossteichbrücke laufen. Wartet dort auf uns. Rennt aber keine Spaziergänger um! Lotte geht mit uns, denn sie kann ja noch nicht so gut alleine laufen.“ Hanna sagte gleich: „Wer am schnellsten ist, hat gewonnen. Auf die Plätze, fertig, los!“ Und mit Feuereifer schmissen die Kinder die Beine und liefen, so schnell es ging. Nur die Passanten auf dem Promenadenweg waren ihnen hinderlich. Fritz war ganz raffiniert: Er lief ganz eng an den Büschen lang, da kam ihm niemand entgegen. Hanna hingegen, wollte am schnellsten sein und musste mitten auf dem Weg laufend den Spaziergängern ausweichen. Trotzdem konnte Hanna gewinnen, denn sie war ja viel älter und Lisbeth nicht so sportlich.
Die Eltern freuten sich über ihren Kindersegen. Aber als sie gemeinsam weitergingen, sagten sie sorgenvoll: „Was wird uns das Leben wohl noch an bösen Überraschungen bringen?“ Der Vater war zwar durch den Friedensvertrag von Brest-Litowsk zwischen Russland und Deutschland im Januar gleich nach Hause entlassen worden, aber allgemein gab es noch keinen Frieden, es wurde immer noch geschossen, es gab immer noch Tote und Verwundete. Auch sah es so aus, als ob Deutschland den Krieg verlieren würde. Was wird dann aus uns? In Russland hatte die Revolution den Zaren gestürzt und Lenin war an der Macht. Was sollte dann aus unserer Regierung werden, vor allem – wer wird uns regieren? Es gab schon viele Anhänger von Arbeiterparteien, so der SPD, USPD und der Kommunisten, die alle mitbestimmen wollten.
Die Versorgung wurde immer schlechter, weil die Bauern durch den Krieg nicht mehr die Felder bestellten. Die eigene Versorgung mit dem Gemüsegarten und den Kleintieren reichte nicht aus, um die Kinder satt zu kriegen. Das Geld war knapp - es gab außerdem nichts zu kaufen. Die meisten Väter und Männer waren noch als Soldaten im Feld oder als Verwundete entlassen. Wer sollte den kleinen Leuten helfen, wieder richtig leben zu können? Anna und Otto erkannten zwar die Probleme, aber ihr Glaube ließ sie nicht verzweifeln.
Ihre traurigen und Angst bringenden Gedanken waren aber an der Schlossteichbrücke durch ihre fröhlichen Kinder wie weggeblasen. Schnell waren alle Sorgen vergessen und die Kinder freuten sich gemeinsam mit den Eltern beim weiteren Spazierengehen über die Brücke. Da die Zeit doch recht schnell vergangen war, mussten jetzt alle schneller gehen. Fritz wurde nun mit in den Kinderwagen gesetzt, denn der jammerte schon lautstark, dass er müde sei.
Darum gingen sie ohne viel Erklärungen am Albrechtsbau mit der Hauptwache vorbei. Vater erzählte nur noch beim Weitergehen, dass auf dem Schlossturm ein Türmer vormittags um 11.00 Uhr das Lied „Ach bleib` mit Deiner Gnade, bei uns Herr Jesus Christ … “ und abends um 21.00 Uhr „Nun ruhen alle Wälder … “ blase. Übermütig formten die Kinder die Hände vor dem Mund und summten die Lieder. Der Vater mahnte: „Aber Kinder, es ist doch die falsche Zeit!“ Die Passanten sahen der Familie aber freundlich lächelnd hinterher. Weiter ging es über den Schlossplatz mit dem Denkmal König Friedrich I. und zurück zum Gäsekusplatz.
Glücklich und mit neuen Eindrücken beladen, stiegen sie wieder in die Straßenbahn und fuhren nach Hause. Jetzt waren die Kinder nicht mehr so ausgelassen wie auf der Hinfahrt, sondern müde und schweigsam. Jeder hatte so viel erlebt, dass die Gedanken zunächst beschäftigt waren.
Als die Kinder dann im Bett lagen, betete Hanna voll Dankbarkeit für diesen Tag:
„Müde bin ich geh zur Ruh,
Schließe beide Augen zu.
Vater, lass die Augen Dein
Über meinem Bettchen sein.
Hab ich Unrecht heut getan,
Sieh es lieber Gott nicht an.
Deine Gnad und Jesu Blut
Machen allen Schaden gut.
Alle, die mir sind verwandt,
Gott, lass ruh`n in Deiner Hand.
Alle Menschen groß und klein
Sollen Dir befohlen sein.
Kranken Herzen sende Ruh,
Nasse Augen schließe zu.
Hab auf alles gnädig Acht,
Schenk uns eine gute Nacht. Amen.“
Glücklich, zufrieden und behütet schliefen die Kinder ein, doch die Eltern sorgten sich um die Zukunft der Kinder.
Es war Herbst geworden. Schon bald wurde des duster. Für Hanna hatte sich das Leben bisher von der besten Seite gezeigt, denn es verlief in dem gewohnten Rhythmus: Schule, im Haushalt ein wenig helfen, spielen und am Sonntag in die Kirche gehen.
*
Mutter und Vater waren für die Kinder immer da und kümmerten sich wenig um Regierung und Politik. Wenn nur endlich der Krieg zu Ende wäre – das war der wesentlichste Wunsch aller! Doch zunächst lasen sie an den Litfasssäulen, dass am 29. Oktober die Kriegsmarine gegen England eingesetzt worden war, aber die Besatzung sich weigerte, den bereits verloren geglaubten Krieg noch weiterzuführen. Vater schüttelte verständnislos den Kopf: Soldaten hatten den Wehrdienst verweigert – das es so etwas gab!
Und unübersehbar waren auf den Litfasssäulen Plakate mit den Informationen zu lesen: „Revolution“, „Mitspracherecht“, „der Kaiser soll abdanken“. Die Kommunisten warben für eine sozialistische Gesellschaftsordnung, in der alle gleich sind, wie in Russland, die Sozialdemokraten wollten demokratisch wählen und das Leben für alle sozial gestalten usw. Was waren das nur für viele neue Begriffe, mit denen man gar nicht so recht wusste, was man damit anfangen sollte? Es war ein allgemeines Durcheinander und eine große Unruhe in der Bevölkerung. Lisbeth und Hanna spürten instinktiv, dass die Eltern große Sorgen hatten. Und darum fragten die beiden Großen oftmals, was das ganze Geschehen zu bedeuten habe. Aber auch ihre Eltern wussten oft keine Antwort auf ihre Fragen, denn keiner wusste, wie das Leben weitergehen sollte. Jeder spürte aber, dass große Veränderungen im Gange waren.
Auch die Soldaten bzw. Offiziere lehnten sich gegen die Regierung und den Kaiser auf, wollten ebenfalls mitbestimmen. Vater hatte auch im Betrieb gehört, dass sich Arbeiter- und Soldatenräte im Reich gebildet hatten und eine solche Vereinigung in Königsberg „Ostpreußischer Provinzial- Arbeiter- und Soldatenrat“ hieß. Das konnte doch nicht gut gehen! Bisher hatten wir doch immer einen Kaiser oder König! Oftmals sahen sich Anna und Otto fragend an und wussten auf die Alltagsprobleme keine Antwort. Die Welt stand Kopf. Nichts war mehr so, wie es bisher gewesen war. Sicher - von Königsberg waren schon öfter neue Ideen ausgegangen, wenn man nur an Herzog Albrecht dachte. Auch die vielen Wissenschaftler hatten schon früher revolutionäre Ideen nach Königsberg gebracht, aber jetzt drohte ungeahntes Unheil in ganz Deutschland.
Auf einmal horchten alle auf: Der deutsche Kaiser Wilhelm II. hatte am 9. November abgedankt und war nach Holland ins Exil geflohen!
Aber im gleichen Atemzug wurde auch bekanntgegeben, dass der SPD-Vertreter Philipp Scheidemann und der Sozialist Karl Liebknecht die Republik ausgerufen hatten. Die Entscheidung, wer nun eigentlich die Regierung übernehmen sollte, ergab sich dadurch, dass der Reichskanzlertitel an den SPD-Vorsitzenden Ebert übergeben worden war.
Doch wer regierte nun eigentlich? Wer hatte die Machte und bestimmte, was getan werden musste? Was war eigentlich eine Republik? War das so wie in der Sowjetunion, von der sie nun doch schon so einiges gehört hatten? War damit auch der Krieg beendet? Blieben die alten Gesetze noch bestehen?
Auf allen Straßen bildeten sich Menschengruppen, die heiß diskutierten. In den Betrieben wurde zwar offiziell noch weiter gearbeitet, aber während der Arbeitszeit gingen die Unterhaltungen nur um das eine Thema: Wie wird unsere Zukunft sein, wenn wir keinen Kaiser mehr haben?
In den niedrigeren Klassen hatten die Kinder drei Tage schulfrei, so auch Lisbeth und Hanna. Obwohl ihnen die Sache nicht so ganz geheuer war, denn die allgemeine Aufregung hatte sich auch auf die Kinder übertragen, freuten sie sich doch über diese zusätzlichen Ferien.
Bei ihnen stellten sich ganz praktikable Fragen zur Schule ein: Ob wohl der Lehrer in einer Republik nicht mehr so streng sein durfte? Ob das Kaiserbild wohl noch im Klassenzimmer hängen blieb? Bekamen sie nun neue Lesebücher? Auch für die Kleinen gab es viele Ungereimtheiten, waren sie doch in eine Welt hinein geboren, in der die Obrigkeit das Sagen hatte und man gehorchen musste. Vater hatte Hanna und Lisbeth erklärt, dass „Demokratie“ mit dem Wort „Mitbestimmung“ zu erklären sei. Ob es dann in der Schule auch so etwas geben würde? Bestimmt nicht, denn einer – der Lehrer – müsste ja den Schülern sagen, was sie zu tun haben. Mutter beruhigte ihre beiden Schulkinder: „Wartet ab, es wird sich alles mit der Zeit klären.“ Das tröstete nun wieder die beiden Mädchen und sie machten sich an ihre Arbeit.
Und schon nach drei Tagen, nachdem die Republik ausgerufen worden war, wurde der Waffenstillstandsvertrag abgeschlossen.
Vater Krohn kam mit dieser freudigen Botschaft nach Hause. Der Krieg war zu Ende! Eine bessere Nachricht konnte es nicht geben!
Mutter freute sich auch sehr und verband diese Situation gleich damit, dass es ihnen in Zukunft sicher wieder besser gehen werde. Doch Vater meinte beschwichtigend: „Na, warte mal ab, Anna, wir haben ja schließlich den Krieg verloren. Das dicke Ende wird bestimmt noch kommen."
In der Familie wurde aber erst einmal freudig das Kriegsende begrüßt, alles andere werde sich schon mit Gottes Hilfe finden.
Lisbeth und Hanna konnten aber diese Veränderung nicht begreifen. Sie hatten doch erst in diesem Jahr so viel über den König, den Kaiser und Königsberg gehört und vor allem in der Schule gelernt. Der Lehrer hatte die Kinder immer und immer wieder abgefragt, die Jahreszahlen im Exerzierton verlangt und viele Kinder hatten den Rohrstock zu spüren bekommen, wenn nicht sofort die richtige Antwort kam. Wenn nun der Kaiser nicht mehr an der Macht war – mussten sie dann trotzdem noch die vielen Jahreszahlen und Begriffe kennen? Hatte die Vergangenheit keine Bedeutung mehr? Fragen über Fragen. Hanna kam alleine mit ihren Überlegungen nicht zurecht und fragte kurz entschlossen die Mutter, die ja immer Zuhause war. Doch darauf gab es vorerst keine Antworten, denn niemand wusste, wie sich alles entwickeln werde. Nur eine Frage beantwortete die Mutter mit großer Sicherheit: „Königsberg wird sicher Königsberg bleiben. Unsere Stadt bekommt bestimmt keinen neuen Namen, nur weil uns kein Kaiser mehr regiert.“ Das tröstete Hanna schon einmal, denn auf den Namen ihrer Geburtsstadt war sie mächtig stolz.
Auch Vater sprach nach der Arbeit viel mit den Kindern und brachte fast jeden Tag neue Informationen mit. Der Betrieb war für ihn – neben den Informationen an den Litfasssäulen – die wichtigste Informationsquelle, denn Geld für eine Zeitung wollte Vater Krohn nur selten ausgeben. Er hatte zwar noch Arbeit, aber das verdiente Geld ließ erst recht in diesen unsicheren Zeiten die Ausgaben für solche Sachen nicht zu. Dadurch erfuhr er zwar immer erst einen Tag später, welche Neuigkeiten es in Deutschland gab, aber das war ja nicht so schlimm.
Selbst in der Gemeinde – nach dem Gottesdienst – diskutierten die Männer und politisierten. Doch alle Gemeindemitglieder waren sich einig: Es ist alles Gottes Fügung. Sie vertrauten auf Gott und seine Hilfe in der Not. Hatte der Krieg mit Gottes Hilfe ein Ende gefunden, so wird der Herr ihnen auch in diesem politischen Wirrwarr beistehen. In der Gemeinsamkeit des Glaubens fühlten sie sich nicht verloren und allein. Und so gingen sie nach dem Gebet gestärkt nach Hause.
Auch Zuhause waren die Gebete gefüllt mit den Alltagssorgen in der Zwiesprache mit Gott. Alle Kinder hörten den Gebeten der Eltern immer aufmerksam zu und bekräftigten mit ihrem „Amen“ die Sicherheit, dass der liebe Gott schon alles zum Guten wenden werde. Danach fühlten sie sich doppelt behütet und beschützt: einmal durch den lieben Gott und zum anderen durch ihre Eltern.
*
Zuhause – ja das war das schöne, große Haus in der Ponarther Straße 56. Zwar war alles ein wenig eng für die Familie, aber in die größere Wohnung im Haus wollten sie nicht umziehen, denn das hätte ja Mietverlust ergeben. Und in diesen unruhigen Zeiten mussten sie sich weiterhin einschränken. Also freuten sich alle über den Frieden und das zukünftige schöne Leben ohne Krieg, Einquartierungen von Soldaten und Flüchtlingen und sonstigen Belastungen.
Weihnachten wurde vorbereitet – das Fest des Friedens. In diesem Jahr sollte es ganz besonders schön werden, war doch der Vater bei ihnen und der Krieg war zu Ende. Am Abend saß die Familie bei Kerzenschein zusammen – es wurden Weihnachts- und Adventslieder gesungen, denn wer ein Lied hören wollte, musste es auch selbst singen und wer Musik wollte, musste selbst ein Instrument spielen (oder eine Musikkapelle bestellen! Und schon alleine dieser Gedanke war verwegen!). Und so erklangen im trauten Familienkreis die altbekannten Advents- und Weihnachtslieder.
Für das Krippenspiel in der Kirche wurde der Text gelernt, den die Mutter oder der Vater abhörten. Selbstverständlich musste auch der kleinste Vers mit Liebe vorgetragen werden. Darauf achtete die Mutter ganz besonders. Abstoßend brachte sie Beispiele, wenn ein Gedicht lieblos vorgetragen wurde. Nein, so sollten die Kinder ihren Text wirklich nicht herunterleiern, das klang ja furchtbar! Darum gaben sie sich bereits Zuhause große Mühe, nicht nur den Text zu können, sondern auch den Inhalt durch die Betonung richtig darzustellen.
Wie in der Kirche, so stellten sich die beiden Großen hin und sagten die Verse abwechselnd auf:
„Das Stroh in der Krippe spricht:
Im Sommerwinde waren wir Halm und Ähre,
wir trugen des Brotes Duft und Schwere,
wir schaukelten hin, wir schaukelten her,
wir waren ein wogendes goldenes Meer.“
„Zu unsern Füßen wuchs Rade und Mohn,
heut sind wir das Bettlein dem Gottessohn;
heut halten wir ihn, das himmlische Brot,
und statt dem Mohn, so blutig rot
halten wir ihn, den Erlöser der Welt.“
„Ob ihm sein armes Bettlein gefällt?
Es liegt so hart, es liegt so arm
Und es muss frieren, dass Gott erbarm!
Was sind wir hart, wir Hälmlein Stroh!
Leg deine Liebe dazu, dann wird es froh.“
Nach langem Üben klappte es auch Zuhause. Lächelnd und stolz zugleich schauten die Eltern ihre Großen an, wenn sie die Texte immer und immer wieder wiederholten. Die Aufführung der Weihnachtsgeschichte mit der Geburt Jesu wurde mit dem Jugendbund und den Kindern aus der Sonntagsschule zum Heiligabend gemeinsam aufgeführt. Lisbeth, Hanna und Herta hatten zwar nur das Gedicht zu sagen, aber sie fühlten sich sehr wichtig.
Die beiden Großen taten geheimnisvoll in der Vorbereitung von selbst gebastelten Geschenken. Sie hatten sich hier und da mit kleinen Dienstleistungen ein paar Pfennige verdient, für die sie Wolle, Häkelgarn, Weihnachtspapier und Schleifen gekauft hatten. Nun saßen sie möglichst versteckt in der Stube, so lange das Tageslicht noch ausreichend war und jeder versuchte sein Bestes.
Für die Mutter sollte unbedingt ein Deckchen für das Nähtischchen gehäkelt werden. Das hatte sich Hanna vorgenommen und für diesen Zweck eine Extraanleitung von Tante Malche erhalten. Nun saß sie da, die Hände hielten krampfhaft Häkelnadel und Garn, die Zunge half vor lauter Anstrengung mit. Die Hände wurden feucht. Ach, das ist ja so mühsam, stöhnte sie insgeheim.
Lisbeth wollte das Kunstwerk anstreben und der Mutter ein Paar Handschuhe stricken. Auch diese Arbeit war sehr schwer. Bei Mutter sah es immer so einfach aus, wenn sie abends strickte. Sie unterhielt sich sogar dabei und schaute manchmal auch weg, konnte aber trotzdem die Maschen ohne Anstrengung finden. Lisbeth kämpfte mit den fünf Nadeln, weil immer einmal eine Nadel aus den Maschen herausrutschte. Aber sie gab nicht auf, denn die Handschuhe brauchte Mutter dringend.
Der Vater sollte einen warmen Schal bekommen. Daran arbeiteten Lisbeth und Hanna gemeinsam, denn der brauchte viel Zeit und Wolle. Immer wenn die Handarbeitskünstler dachten, dass sie schon recht viel gestrickt hatten und die Länge an sich selbst ausprobierten, mussten sie feststellen, dass er noch lange nicht fertig war. Dann atmeten sie nur tief durch, schauten sich fragend an und machten sich wieder an die Arbeit.
Vater und Mutter taten so, als ob sie nicht wüssten, woran die beiden arbeiteten, um ihnen nicht die Vorfreude zu nehmen. Aber sie konnten sich alle nur im Wohnzimmer treffen, weil hier der Ofen warm war und die Lampe über dem Tisch hing. Das Zimmer hatte zwar nur die eine Lampe, die von der Decke bis dicht über den Tisch zum Arbeiten und Lesen heruntergezogen wurde, aber alle konnten ihre Arbeit sehen. Dabei war die Familie mächtig stolz, dass in ihrer Wohnung schon das elektrische Licht brannte und nicht die „altmodsche“ Petroleum- oder Gaslampe leuchtete.
Die anderen Kinder spielten in den Ecken und Winkeln der Wohnstube. Draußen stiemte es. Eisiger Wind heulte, trug den Schnee durch die Straßen und häufte ihn an geschützten Stellen zu Schneebergen auf. In die Röhre des Kachelofens hatte Mutter Äpfel aus dem Garten zum Schmoren gelegt, die wunderbar süßlich rochen. Lisbeth kam auf die Idee: „Mutter, erzähle uns doch bitte eine Geschichte, es ist gerade so gemütlich!“
Mutters liebe und gütige Augen blickten in die Runde. „O ja, Mutter, erzähle uns bitte, bitte eine Geschichte. Wir sind auch ganz leise und hören zu.“ Und Mutter erzählte die Geschichte eines Pfefferkuchenmannes:
„Es war einmal ein Pfefferkuchenmann,
von Wuchse groß und mächtig.
Und was seinen inneren Wert betraf,
so sagte der Bäcker: „Prächtig!“
Auf dieses glänzende Zeugnis hin
erstand ihn der Onkel Heller
und stellte ihn seinem Patenkind,
dem Fritz, auf den Weihnachtsteller.
Doch kaum war mit dem Pfefferkuchenmann
der Fritz ins Gespräch gekommen,
da hatte er schon – aus Höflichkeit –
die Mütze ihm abgenommen.
Als schlafen ging der Pfefferkuchenmann,
da bog er sich krumm vor Schmerze;
an der linken Seite fehlte fast ganz
sein stolzes Rosinenherze.
Als Fritz tags drauf den Pfefferkuchenmann
besuchte ganz früh und alleine,
da fehlten, o Schreck, dem armen Kerl
ein Arm schon und beide Beine.
Und wo einst saß am Pfefferkuchenmann
die mächtige Habichtsnase,
da war – ein Loch! Und er weinte still
eine bräunliche Sirupblase.
Von nun an nahm der Pfefferkuchenmann
ein reißendes, schreckliches Ende.
Das letzte Stückchen kam schließlich durch Tausch
in Schwester Margretchens Hände.
Die kochte als sorgliche Hausfrau draus
für ihre hungrige Puppe
auf ihrem neuen Spiritusherd
eine kräftige, leckere Suppe.
Und das geschah dem Pfefferkuchenmann,
den einst so viele bewundert
in seiner Schönheit bei Bäcker Schmidt
im Jahre neunzehnhundert.“
Sehnsüchtig schauten die Kinder die Mutter an und jeder hatte nur den einen Wunsch, auch so einen schönen Pfefferkuchen zu besitzen. Mutter sagte darum: „Das Gedicht von Paul Richter hat euch bestimmt so aus dem Herzen gesprochen, dass ihr alle Appetit bekommen habt. Heute essen wir erst einmal jeder einen geschmorten Apfel und morgen Abend können mir die Großen beim Kneten helfen. Wir werden dann übermorgen für jeden von euch auch einen so schönen Pfefferkuchenmann backen.“ Alle Kinderaugen strahlten wie der Weihnachtsengel persönlich. Jeder rechnete sich sofort aus, wann wohl der günstigste Moment zum Naschen war und in Gedanken schmeckten sie schon den würzigen, rohen Teig, der beim Ausstechen und Formen – also ungebacken – am besten schmeckte.
Am nächsten Tag war strahlend blauer Himmel. Der Schnee am Brauereiteich lud zum Rutschen und Schlittenfahren ein. Und nach der Schule – Hanna konnte es kaum erwarten – ging es mit den anderen Kindern an den Hang, der genau gegenüber vom Haus war und das Wasser der Brauerei staute. Mutter rief noch hinterher: „Aber geht mir nicht auf das Eis, es ist noch nicht fest genug!“ Jedoch Hanna hatte schon ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Hang gerichtet, krabbelte den Berg hinauf, setzte sich auf den Schlitten und fuhr mit dem Ausruf „Bahn frei!“ den Berg wieder hinunter. Ach, wie schön war der Schnee. Wie herrlich war die Welt. Dass Hanna auf ihren Bruder Fritz aufpassen musste und ihn auch den Berg hinaufziehen musste, störte sie wenig. Bei der Abfahrt saß er vor ihr und sie hielt ihn fest. Meistens jedoch rutschte er in das Schlittenloch hinein, denn der Schlitten war eigentlich nur für ein Kind gebaut. Aber alle hatten ihren Spaß. Es wurde schon dunkel, als Fritz auf einmal anfing zu weinen. Er hatte kalte Hände und Füße. Nun merkte auch Hanna, dass ihre Kleidung nass geworden war. Und besonders kalt war es an den Oberschenkeln. Sie hatte zwar eine warme Wollhose an, die bis zu den Strümpfen reichte, aber beim Spiel war öfter Schnee unter den Rock gekommen und war durch die Körperwärme getaut. Im Ergebnis stellte sie fest, dass die gestrickte Hose steif gefroren war und Kälte sich breit machte.
„Wir müssen uns mehr bewegen“, sagte Hanna zu Fritz und damit war der neue Plan auch schon fertig. „Wir bauen jetzt einen Schneemann.“ Als Hanna mit Fritz das Werk begannen, machten innerhalb kurzer Zeit auch noch John und Karl mit und schnell war das Werk vollbracht. Da keine Möhre für solche Sachen von Zuhause zu erwarten war, wurden Steine aus dem Schnee herausgebuddelt und für Augen, Nase und Mund verwendet. Auch der Hut wurde aus Schnee geformt, denn keiner wollte und durfte seine warme Mütze dafür hergeben. „Fertig!“ Die Kinder sahen ihr Prachtexemplar mit strahlenden Augen an und freuten sich, dass er wie ein Wächter zwischen den Bäumen, die an der Teichsohle standen, hervor schaute.
Vielleicht hatte Mutter sie vom Küchenfenster aus beobachtet – jedenfalls genau, als der Schneemann fertig war, rief Mutter: „Kinder, kommt rein!“ In der Küche mussten dann erst Schuhe, Mantel, Kleid, Strümpfe und Wollhosen ausgezogen werden. Der Schnee wurde abgeklopft und die Sachen auf den Ofen zum Trocknen gelegt. Hemd und Leibchen – an dem die Strumpfbänder befestigt waren -waren als einzige Kleidungsstücke trocken geblieben. Mutter machte den beiden ein Fußbad mit etwas Salz und wickelte sie in eine Decke. Es dauerte auch gar nicht lange – und beide Kinder waren pudelwarm.
Gerne hätten sich die beiden auch – wie an jedem Sonnabend – in den Waschzuber in der Küche aufgewärmt, aber Ganzkörperwäsche gab es eben nur am Sonnabend. Zu diesem Zweck wurde dann der Waschbottig in die Küche gestellt und mit warmem Wasser gefüllt. Natürlich musste dafür extra in der Küche Feuer im Herd gemacht werden, damit das Wasser erwärmt werden konnte. Zwar hatte die Wohnung auch bereits einen Gaskocher mit zwei Brennstellen, aber die großen Töpfe wurden schneller auf dem Herd heiß und die Küche gleich warm. Darum war es nur zu verständlich, dass immer gleich zwei Kinder zur gleichen Zeit gewaschen wurden, damit nicht so viel Brennmaterial für das warme Wasser verbraucht wurde. Weil das alles mit viel Arbeit verbunden war, konnte der Waschakt eben nur einmal in der Woche passieren.
Zuerst kamen an den Waschtagen meistens Lotte und Herta in das Wasser, denn die Kleinste musste ja zuerst in das Bett und Herta konnte mit der kleinen Schwester in der Wanne herumplanschen. Oft protestierte aber Lotte mit wildem Geschrei, wenn das Badevergnügen durch Mutter beendet wurde. Bis die kleine Schwester zum Schlafen angezogen, der Hahnenkamm gekämmt und das Fläschchen getrunken war, aalte sich Herta noch ein bisschen alleine in der Wanne. Doch war sie dann auch trocken und hatte das Nachthemd an, wurde Fritz gerufen, der noch in das gleiche Wasser kam. Er war ja der Junge und durfte immer alleine in das Wasser. Die Mädchen hatten dann in der Küche keinen Zutritt. Nur Mutter beaufsichtigte den Reinigungsakt.
Er ließ sich immer ganz besonders viel Zeit mit der Wäsche, denn meistens durfte er als „Krohn-Sohn“ auch Spielzeug mit in das Wasser nehmen und konnte sich dadurch nur schwer von seinem Schiffchen aus Papier oder Holz trennen.
Die beiden Großen – Hanna und Lisbeth – passten zwar nicht mehr so gut zur gleichen Zeit in die Wanne, aber einer der beiden durfte als erste in das neue, saubere Wasser steigen. Wer sich also nicht schnell genug auszog, hatte das Nachsehen und musste warten oder sie mussten schon vorher das Versprechen abgeben, sich nicht zu kabbeln.
So war der Sonnabendabend immer angefüllt vom freudigen Empfinden der Kinder über das Baden und den laufenden Ermahnungen der Mutter, nicht so viel zu planschen, damit der Fußboden nicht gar zu nass werde.
Wie schmeckte nach dem Baden doch das Abendessen so gut. Am liebsten hätten Hanna und Fritz noch einmal Nachschlag gehabt, aber Mutter hatte den Topf Milchsuppe aufgeteilt und mehr war eben nicht da.
Glücklich, warm, fast satt und zufrieden kniete Hanna vor dem Bett, in dem sie gemeinsam mit Lisbeth schlief, nieder und sprach das Abendgebet. Heute hatte sie zwar nicht an den Weihnachtsgeschenken gearbeitet, aber morgen wollte sie ganz fleißig sein. Das nahm sie sich ganz fest vor. Und schon war sie eingeschlafen.
*
Die Sorgen und Probleme, die die Eltern hatten, bemerkten die Kinder nicht. Und es gab viele Probleme. Die Welt hatte sich total verändert, seitdem der Kaiser abgedankt hatte. In Königsberg war seit November ein „Ostpreußischer Provinzial-Arbeiter- und Soldatenrat“ an der Macht, der sich nach harten Auseinandersetzungen zu Ebert und der Nationalversammlung bekannte und nicht – wie die Unabhängige Sozialdemokratische Partei es anstrebte - einen Rätestaat nach sowjetischem Vorbild schuf. Außer diesem Gremium hatte sich die „Matrosenwehr“ gebildet. Die Verantwortlichen saßen sogar im Schloss!
Dafür wurden die Unruhen auf den Straßen immer größer, öfter und gewalttätiger. Vater erzählte Mutter dann am Abend, was er so gehört hatte: „Stell dir vor, Anna, im Weihnachtsmonat gab es in Berlin den ersten Reichskongress der Arbeiter- und Soldatenräte. Vielleicht haben die dann gesagt bekommen, was sie hier bei uns machen müssen, damit es uns besser geht.“ Aber Anna erwiderte logisch: „Die haben das doch nicht gelernt, woher sollen sie wissen, was sie tun müssen?“ „Im Betrieb haben die Arbeiter auch erzählt, dass sich die Kommunisten, die auch mitbestimmen wollen, einen erbitterten Kampf mit den Freikorps und anderen bewaffneten Einheiten geliefert haben“, sagte Otto zu seiner Frau. „Dabei hat es viele Tote und Verwundete gegeben.“ „Ach, die wollen doch alle bloß an die Macht und den Rahm abschöpfen“, war die einfache Feststellung von Anna. „Da tun einem nur die armen Leute leid, die dabei gestorben sind oder verwundet wurden.“
Doch Otto hatte schon mehr Hintergründe erfahren: „Die Sozialdemokraten und die Kommunisten wollen eigentlich das Gleiche, aber sie sind sich nicht in allem einig. Die Kommunisten wollen es wie in Russland – der jetzigen Sowjetunion – machen und die Industriellen, Junker und die Adligen entmachten und enteignen und die Betriebe dem Volk geben. Die Sozialdemokraten wollen aber durch eine Wahl und eine allgemeine Mitbestimmung gerechte Gesetze für alle Mitbürger erlassen und die gewählten Vertreter würden dann unsere Regierung sein. Das klingt zwar gut, aber was wird dann bei uns aus den Industriellen, Bankiers und Grundbesitzern? Freiwillig werden die ihr Hab und Gut nicht hergeben. Die Sozialdemokraten haben versprochen, wenn sie an die Macht kommen, dass in den Betrieben wirklich nur acht Stunden am Tag gearbeitet werden darf und jeder dafür einen Mindestlohn erhält, der dann in allen Eisenbahnbetrieben gleich ist.“ „Na, das wäre ja nicht schlecht“, meinte Anna, dafür kannst du ja sein.“ „Ja, aber wenn ich diese Gedanken unterstütze, müsste ich in die SPD oder in die Gewerkschaft eintreten.“ „Das kommt gar nicht in Frage! Wir sind nicht für Politik! Wir sind in der Kirche! Da wissen wir wenigstens, woran wir glauben können“, war die Entscheidung von Anna. Das war eigentlich auch Ottos Meinung. Er engagierte sich ja auch schon im Gemeinderat und hatte dort genug zu tun. Aber wie sollte es werden, wenn alle Menschen so dachten?
Und so einfach war es auch gar nicht, die Politik nicht zu beachten, denn es passierte am laufenden Band etwas. Im Januar brachte Vater ein Flugblatt der Kommunistischen Partei mit nach Hause, in dem stand, dass Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg von der Reichswehr ermordet worden seien. In Weimar – das lag irgendwo in Thüringen – sollte die Wahl zur Nationalversammlung stattgefunden haben. Das bedeutete endlich etwas Gutes, denn dann hatte Deutschland wieder eine Regierung. Ein Friedrich Ebert war zum ersten Präsidenten, ein Philipp Scheidemann zum ersten Ministerpräsidenten gewählt worden, die Reichswehr sollte in Zukunft von einem Gustav Noske aufgebaut werden. Diese Namen sollte man schon wissen, wenn sie sicher auch nicht so bekannt würden, wie die Namen der Könige und Kaiser.
Außerdem hatte die Friedenskonferenz in Paris begonnen, über das Schicksal Deutschlands zu entscheiden.
Doch um die Familie Krohn gab es auch ganz praktikable Vorgänge: In den Straßen – auch in Ponarth – formierten sich Demonstrationszüge mit Transparenten. Die SPD-Demonstranten forderten auf ihren Plakaten mehr Mitspracherecht, die Kommunisten wollten „Alle Macht dem Volke“, die Nationalsozialisten wollten eine saubere Nation, nur die bürgerlichen Parteien, die die Mehrheit auch in der Nationalversammlung hatten, sahen das als Aufruhr und manchmal löste die Landwehr die Demonstrationen auf. Dann kam es meist zu Auseinandersetzungen. Die Landwehr – hoch zu Ross - arbeitete mit Gummiknüppeln. Die Demonstranten antworteten mit Steinen und Stöcken. In solchen Situationen wurden die Straßen zum Risikofaktor. Aber im Vergleich zu anderen Städten ging es noch friedlich zu.
Auch heute hörte Mutter schon von weitem die Blaskapelle. Immer näher kamen auch die Geräusche von vielen Menschen. Schnell riss sie das Fenster auf und rief ängstlich nach den Kindern. Sie kamen auch gehorsam bis zum Haus und stellten sich unter das Fenster. Bettelnd hörte Mutter sie sagen: „Mutter, wir wollen doch nur sehen, wie die Menschen marschieren. Die Musik ist doch so schön!“ Und tatsächlich: es war eine Musik, die zum Mitmarschieren animierte. Der Zug musste sich erst am Bahnhof formiert haben, denn es waren noch nicht so viele Menschen und alle liefen friedlich und hielten Plakate in den Händen. Fritz war kaum zu halten – unbewusst setzte er im Rhythmus der Musik seine Beine und war schon am Hausende, als Mutter das sah. „Fritz! Bleib hier! Komm sofort zurück“, war ihre bestimmte und zugleich ängstliche Stimme. Und Fritz strahlte seine Mutter an, sattelte sein Gewehr, das aus einer Holzstange und einem Strick bestand, machte kehrt in Richtung Mutter und sang begeistert: „Ritz, Mutterke, de Landwehr kimmt! Se piepe schon, se drommle schon … “
Mutter war fassungslos. Dass der Junge so viel Spaß an dieser Sache haben konnte, machte sie noch ängstlicher, als sie ohnehin schon war, wenn sie eine Demonstration sah. Na ja, er ist ja noch so klein und kann die Gefahr nicht begreifen, beruhigte sie sich selbst. Doch gerade deshalb wurde sie energisch: „Du kommst jetzt sofort rein! Und außerdem wird nicht plattdeutsch gesprochen, das weißt du!“ Den Ton kannte Fritz, da gab es keine Widerrede, sonst rechnete am Abend Vater mit dem Lederrriemen ab. Aber der Demonstrationszug war auch schon fast vorbei und darum war auch bald wieder alles uninteressant.
Als am Abend Vater nach Hause kam, wurde natürlich über die Demonstration gesprochen. Aber Vater beruhigte die Mutter: „Wenn die Landwehr nicht auf der anderen Seite der Straße steht, kann eigentlich nichts passieren.“
Trotzdem erklärte Vater noch einmal allen Kindern mit ernster Mine, dass sie sofort zu Mutter nach Hause kommen müssten, weil auch geschossen werden könnte und auch viele unbeteiligte Passanten in diesen Kampf einbezogen würden. „Erst vergangene Woche“, so erzählte er überzeugend, „ist eine Demonstration von den Arbeitern der Elektrizitäts- und Stadtwerke und der Straßenbahn – andere Demonstranten hatten sich noch angeschlossen - von der Landwehr aufgelöst worden. Sie kamen auf Pferden und schlugen auf die Menschen wahllos ein, so dass viele verwundet wurden, weil sie nicht rechtzeitig ausreißen konnten. Dabei wurden auch Kinder und Jugendliche, die sich die Demonstration ansehen wollten, getroffen. Viele Arbeiter wurden auch von der Polizei festgehalten und auf Autos geladen. Keiner wusste, wohin die Leute gebracht wurden. Aber sicher werden sie bestraft.“
Hier machte er eine Pause und schaute seine Kinder der Reihe nach an. „Wir möchten nicht, dass euch etwas passiert, nur weil ihr neugierig seid. Habt ihr uns verstanden?“ Alle Kinder nickten mit dem Kopf. Sie hatten verstanden. Ihren Eltern wollten sie keinen Kummer machen. Aber innerlich zweifelten doch Hanna und Fritz, ob es denn wirklich so gefährlich sei, auf der Straße zu stehen und zuzusehen, wie die Menschen demonstrieren. Die Musik hatte doch auch Erwachsene auf die Straße gelockt. Aber – sie wollten und mussten ja gehorchen. Damit war das Thema für alle Kinder erledigt und sie konnten am nächsten Tag wieder drüben im Wäldchen oder im Hof spielen.
Doch für Vater Krohn war das Thema noch nicht beendet. Als die Kinder im Bett waren, erzählte er, dass in seiner Hauptwerkstatt Arbeiter entlassen worden seien, die gut gearbeitet hatten, aber den Ruf hatten, Kommunisten zu sein. Was war das nur für eine aufregende Zeit! „Otto“, sagte Anna, „wir haben unseren Glauben an Gott und Jesus Christus. Wir haben unseren Halt und können uns immer in unserer Not an IHN wenden. Auch wenn unsere Zukunft und die unserer lieben Kinder noch ungewiss und sorgenvoll erscheint, wir können uns an Gottes Wort aufrichten. Höre, was ich hier gerade in der Bibel aufgeschlagen habe: ‚Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer sänken, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind.‘ Das steht im 46. Psalm. Ist das nicht tröstlich? Wir brauchen vor der Zukunft keine Angst zu haben. Der Herr ist bei uns, was auch noch alles passieren mag.“
Otto und Anna knieten nieder und dankten Gott von Herzen, der ihnen durch die Heilige Schrift die Antwort auf ihre Alltagsfragen gegeben hatte.
Bereits nach ein paar Wochen – am 3. März 1919 – wurden in der Stadt die Stadtverordneten nach dem neuen Wahlrecht gewählt. Auch Otto und Anna Krohn waren zwar widerstrebend, aber letztlich doch entschlossen zur Wahl gegangen, um der Arbeiterpartei ihre Stimme zu geben. Durch das Wahlergebnis war geklärt, dass die USPD (Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands) und die SPD die Verantwortung für Königsberg unter Mitwirkung der Deutschen Volkspartei, der Demokraten, der Deutschnationalen und der Zentrumspartei übernommen hatten.
August Winnig als Reichskommissar für Ost- und Westpreußen, der seinen Sitz in Königsberg hatte, war ‚Fachmann gegen die Gefahr, die Ostpreußen von der Sowjetunion‘ her drohte. Sein Ziel war, die Staatsautorität mit Hilfe der gewählten Parteien wieder herzustellen und für Ruhe und Ordnung zu sorgen.
Die „Matrosenwehr“ als Teil des „Ostpreußischen Provinzial-Arbeiter- und Soldatenrates“ hatte jedoch zum Ziel, der sowjetischen Weltrevolution nachzueifern. Darum konnte sie nicht mit einer Umwandlung in eine „Einwohnerwehr“ einverstanden sein. Um diese Gefahr für seine Zielstellung auszuschalten, nutzte Winnig seine Machtbefugnisse, die Freikorps gegen die Roten Matrosen einzusetzen und sie als Widerstandsnest zu liquidieren. Das Blutbad am 4. März wurde von vielen - auch von den Sozialdemokraten – verabscheut. Die Königsberger Regierung hatte ihre erste Zerreißprobe, an deren Ende nur in letzter Minute ein Generalstreik verhindert werden konnte. Winnig erreichte aber trotzdem, dass eine Neuordnung der Volkswehr als kasernierte Truppe unter der Befehlsgewalt eines Generals genehmigt wurde und außerdem eine neue Sicherheitspolizei für Ruhe und Ordnung in der Stadt verantwortlich war. Damit hatte er die Gefahr eines bolschewistischen Umsturzes abgewandt und die neuen demokratischen Organe konnten ihre Arbeit im Sommer aufnehmen.
Schneller als gedacht gewöhnten sich alle Königsberger wieder an Ruhe und Ordnung. Die Kinder gingen wieder brav zur Schule – einige kamen nach dem Unterricht mit rot geschwollenen Fingern nach Hause. Die Väter gingen zur Arbeit, die Mütter machten den Haushalt, am Sonntag gingen alle zur Kirche.
Ostern kam Herta in die Schule, die war genauso aufgeregt wie damals Hanna. Auch sie bekam einen Schulranzen, der – wie bei den Geschwistern – acht Jahre halten musste. Hannas war schon etwas lädiert und musste öfter zum Schuster gebracht werden, damit er einen Flicken draufsetzte oder die Schnallen erneuerte. Jedesmal schaute Hanna ihre Mutter schuldbewusst an und beteuerte, in Zukunft mit dem Ranzen vorsichtiger umzugehen.
Doch lange währte die Ruhe nicht. Aufgeregt kam Vater Anfang Mai mit einer Zeitung nach Hause. Er war furchtbar aufgeregt und sagte nur immer wieder: „Das ist ja furchtbar, das können die mit uns doch nicht machen! Wie sollen wir denn da noch leben!“ Dabei hielt er die Zeitung hoch und sagte: „Mutter, komm schnell her! Das muss ich dir vorlesen!“ Er konnte es kaum erwarten, bis er in seinem Sessel am Ofen saß und Anna neben ihm stand.
„Hör mal her!: In Versailles haben die Siegermächte Friedensbedingungen für Deutschland festgelegt:
Das Reichsheer wird auf maximal 100.000 Mann dezimiert, das hauptsächlich nur zur Grenzsicherung eingesetzt werden soll, die Reichsmarine darf maximal nur noch 15.000 Mann haben, die auf normalen Schiffen Dienst tun, U-Boote und Luftstreitkräfte darf Deutschland überhaupt nicht mehr haben und die allgemeine Wehrpflicht soll abgeschafft werden. Das ist ja noch nicht so schlimm. Aber, was viel wichtiger ist: Deutschland muss die überseeischen Besitzungen abtreten, Japan und China müssen entschädigt werden, Deutschland wird für die Wiedergutmachung der Schäden an der Zivilbevölkerung verantwortlich gemacht, insgesamt 269 Milliarden Goldmark sollen wir zahlen!
Aber was das Allerschlimmste ist: Ostpreußen wurde neu aufgeteilt, große Gebiete gehen an Polen, das Gebiet um Königsberg wird zur Insel, denn es wird umringt von der Sowjetunion, Polen und der Ostsee. Nur ein kleiner Landstreifen, der sogenannte polnische Korridor, soll die Versorgung der Menschen und den Handel in Ostpreußen ermöglichen.“
Vater atmete tief durch. Mutter war ganz still. Auch die Kinder hatten zugehört. Doch die ganze Tragweite konnte keiner so richtig erfassen.
Nur langsam löste sich der Schock. Otto war der Erste, der in der Lage war, Schlussfolgerungen zu ziehen. „Stell dir vor, Mutter, wenn wir keine Wehrpflicht mehr haben, gibt es auch keine Soldaten mehr, die vom Staat bezahlt werden. Dann haben wir Arbeitslose und die vielen Betriebe, die die Soldaten versorgt und belieferten, haben keinen Umsatz mehr. Dadurch werden viele Geschäfte schließen müssen.
Wenn unser Preußen nur noch über einen Korridor mit dem Reich Verbindung haben kann, werden Handel und Eisenbahnverkehr auch dorthin eingeschränkt. Wir leben aber doch hauptsächlich vom Handel! Dann bekommen auch die vielen Tagelöhner im Hafen und auf den Märkten keine Arbeit mehr. Das bedeutet vielleicht auch, dass ich meine Arbeit als Maurer bei der Bahn verliere.
Wenn dann die Zahlungen der Entschädigungen für die anderen Länder fällig werden, erhöhen sich auch die Abgaben und Steuern für uns, die Waren werden teurer verkauft und das Geld hat weniger Wert. Außerdem haben wir ja von unseren Kolonien Rohstoffe und Lebensmittel billig erhalten. Das fällt ja nun auch weg. Wenn wir wenigstens im Reich wohnen würden, wäre vielleicht die Verteilung gerechter.“
Traurig über seine eigene Bilanz senkte Otto den Kopf. Auch Anna konnte ihn nicht trösten. Nur eines sagte sie mit aller Bestimmtheit und Zuversicht: „Wir haben uns und unsere Kinder. So lange wir leben, gibt es auch immer mit Gottes Hilfe einen Weg.“
Die Kinder merkten sehr schnell, dass etwas Wichtiges passiert sein musste und spielten mit ihren Sachen ruhig in der Ecke. Kein Streit – kein lautes Wort war von ihnen zu hören.
Seufzend stand Mutter auf und bereitete in der Küche das Abendbrot vor. Wie immer gab es Klunkersuppe und eine Schnitte Brot. Nun hieß es wahrscheinlich noch sparsamer mit dem Haushaltsgeld umzugehen. Und dafür musste man schon einige Ideen entwickeln. Ab morgen wollte sie gleich nicht mehr drei Liter Vollmilch, sondern Magermilch für die Kinder kaufen, die dann mit zwei Liter Wasser verdünnt wurden, in die Mehlklunkern würde sie nur noch für die insgesamt sieben Personen zwei Eier einrühren und den Rest Wasser nehmen und den Zucker zum Süßen musste sie wenigstens um ein Drittel verringern.
Am Abend waren die Gebete von Otto und Anna lang und inbrünstig. Angst wollte sich bei ihnen breit machen. Doch Vater las aus der Bibel den 25. Psalm Vers 17 vor: „Die Angst meines Herzens ist groß; Führe mich aus meinen Nöten“ Und danach auch noch gleich den 23. Psalm: „Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.“ Und je länger sie Zwiesprache mit Gott hielten, um so zuversichtlicher wurden sie. Dankbar für ihr bisheriges Leben und mit dem Vertrauen auf Gott legten sie sich zur Ruhe. Doch der erlösende Schlaf wollte nicht kommen. Zu groß war die Ungewissheit. Nur die Kraft ihrer Liebe ließ sie alle Sorgen für kurze Zeit vergessen.
Und es dauerte auch nur ein paar Wochen, und Königsberg sowie Preußen richteten sich nach dieser historischen Umwälzung neu ein.
Es wurde die Kommunale Verwaltung in Königsberg neu geordnet. Nun gab es einen Oberbürgermeister (Hans Lohmeyer) und einen Bürgermeister (Carl Goerdeler), die einzelnen Verwaltungen begannen zu arbeiteten. Die wichtigste Reform war jedoch, dass städtische Betriebe für die Bereiche Verkehr, Energie und Hafen gegründet wurden, die sich wirtschaftlich selbst tragen mussten. In der Union-Gießerei und in der Königsberger Waggonfabrik wurde noch gearbeitet, es gab also noch in einigen kleinen und großen Betrieben Lohn und Brot. Auch eine Stadtbank wurde gegründet, die der Verwaltung der Stadt Kredite gab, um neue wirtschaftliche Initiativen zu unterstützen. Damit war das Alltagsleben, wie es vor dem Krieg gewesen war, teilweise möglich. Jeder versuchte, eine positive Lebenseinstellung zu zeigen. Anna ganz besonders, denn sie fühlte neues Leben in sich.
Vielleicht wird es ein Christkind? Die Weihnachtsvorbereitungen wurden intensiver als sonst gemacht, denn nach der Entbindung war ja nicht viel Zeit für den Haushalt. Obwohl Anna nun schon das 6. Kind erwartete, war es doch immer wieder ein wunderbares Gefühl, das Leben in sich zu spüren. Zwar war sie oft müde und schlapp, denn sie war ja auch schon 40 Jahre alt. Aber was der Herr ihr schenkte, wollte sie auch dankbar annehmen. Als sie spürte, dass das Kind kommen sollte, schickte sie alle Kinder zu Tante Malche. Ihre Schwester kannte ihre Pflichten: die Hebamme bestellen und die Kinder versorgen. Die Hebamme würde dann Bescheid sagen, wenn alles vorbei war. Am nächsten Tag, am 18. Januar 1920 wurde Lena geboren. Die Geschwister sahen sich das kleine Wesen erstaunt an, zählten die Finger, besahen sich Kopf, Beine und Arme und staunten, dass alles dran war. Mutter ruhte sich noch einen Tag im Bett aus und alle, die helfen konnten, halfen im Haushalt mit.
Aber nun wurde es eng im Schlafzimmer: Die Eltern schliefen sowieso in einem Bett, das quer an der Hinterwand stand, Lisbeth und Hanna schliefen in dem Bett, das längs davor stand und vor diesem Bett stand noch eines in Richtung Fenster, in dem Herta und Lotte schliefen. Fritz lag noch im Gitterbett links neben der Türe. Ein Schrank für Wäsche und Kleidung rechts neben der Türe lastete den Schlafraum vollends aus. Für Lena konnte also nur ein Wäschekorb als Bettchen eingerichtet werden, der vor dem Bett der Eltern stand.
Am Abend kehrte immer nur langsam Ruhe ein. Die Kleineren schliefen zwar durch, wenn sie erst einmal eingeschlafen waren, aber die Größeren wurden doch etliche Male durch das Weinen von Lena geweckt. Obwohl Mutter dann schnell in das Körbchen griff und Lena an die Brust zum Stillen nahm, waren eben doch immer ein paar Kinder munter geworden. Vater musste aber unbedingt schlafen, wenn er am nächsten Tag wieder an der Arbeit seine Leistung bringen sollte. Also hieß es dann: „Bsch, seid leise, Vater muss schlafen.“ Die, die munter geworden waren, gingen meistens gleich noch auf das Töpfchen, das unter jedem Bett stand. Der Mitschlafende im Bett musste dann meistens nach dieser Aktion ein wenig zur Seite gedrückt werden, weil er sich breit gemacht hatte. Aber nach kurzer Zeit trat dann doch meistens wieder Ruhe ein.
Morgens ging es dann doch nicht so ruhig zu. Jeder suchte ein Kleidungsstück, war noch nicht gewaschen (in der Küche unter fließendem kalten Wasser) oder gekämmt, hatte sein Frühstück noch nicht gegessen, kurz um, Mutter war immer froh, wenn die Schulkinder erst einmal alle aus dem Haus waren, damit sie sich den Kleinen widmen konnte. Mutter war noch lange schwach und konnte darum nicht jedem Kind helfen. Radikal führte darum Vater ein: „Jeder legt seine Sachen, die er am nächsten Tag anzieht, auf den Stuhl, auf dem er sonst sitzt, putzt am Abend die Schuhe und stellt seinen gepackten Ranzen daneben. Am Morgen braucht er dann nur alles nacheinander zu nehmen und es gibt keine Sucherei. Habt ihr mich verstanden?“
Verstanden hatten alle Kinder diese einfache Anweisung. Aber ob es auch klappte? Wenn dann alle Kinder im Bett waren, schaute Mutter noch einmal jedes „Häufchen“ an, um auch gleich zu kontrollieren, ob alles sauber und ganz war. Und es klappte fast immer. Freundlich nickte sie dann ihrem Mann zu, wenn alles in Ordnung war. Aber es ging ja auch gar nicht anders. In der kleinen Wohnung musste Ordnung herrschen.
Aber die Ordnung in der Regierung hatte sich immer noch nicht gefestigt. Im März hatte die Reichswehr unter Kapp die Regierung gestürzt und die Nationalversammlung aufgelöst. Doch der Putsch war gescheitert. In Königsberg wurde der Oberpräsident Winnig, der mit den Putschisten sympathisiert hatte, seiner Ämter enthoben und es wurde wieder friedlicher.
Nur ab und an gab es noch Demonstrationen der Nationalsozialisten, die im Land „aufräumen“ wollten und der Linken, die sich um die Früchte ihres Kampfes betrogen fühlten. Aber im Gegensatz zu Thüringen, Sachsen und im Ruhrgebiet verliefen diese Volksansammlungen relativ ruhig.
*
Auch Otto und Anna glaubten wieder an eine glückliche Zukunft. Sie lebten in „56“ ruhig und zufrieden. Otto hatte Arbeit und freute sich jeden Tag, wenn er von der Arbeit nach Hause kam, er seine Frau umarmen konnte und wenn ihn seine Kinder freudig begrüßten.
Aber manchmal mussten sie auch beichten, was sie für Dummheiten tagsüber gemacht hatten. Das war für sie eigentlich die schlimmste Strafe, denn sie mussten nicht nur bis zur Heimkehr des Vaters warten und Besserung geloben, sondern manchmal löste Vater auch den Lederriemen vom Hosenbund und es gab eine Tracht Prügel, die man nicht so schnell vergaß. Heulend zog sich dann der arme Sünder in ein Eckchen zurück und bedauerte selbst seinen Schmerz. Und jedes Mal folgte im Stillen der heilige Schwur: „Ich will das nie wieder machen!“ Mutter war während der Erziehungstortour immer in der Küche, weil sie es nicht mit ansehen konnte, wenn der Vater zu solchen Mitteln griff. Aber manchmal war es schon notwendig, dass die Kinder mit allem Nachdruck auf den Gehorsam aufmerksam gemacht wurden. Und schließlich war bisher noch kein Kind davon gestorben – Schläge waren ein allgemeines Erziehungsmittel.
Krohns Kinder bekamen gar nicht oft solche Erziehungsmaßnahmen zu spüren, denn kleine Zänkereien oder Hänseleien wurden sofort von Mutter geklärt. Hatte aber ein Kind die Unwahrheit gesagt oder war es wiederholt faul gewesen, dann spürten sie Vaters Hand.
Jedoch verging kein Tag, an dem ein Kind bockig oder böswillig ins Bett ging. Das gemeinsame Abendgebet machte allen Kindern durch den Glauben bewusst, dass Jesus auch den schlimmsten Sündern vergab, also auch ihnen. Und mit einem Gute-Nacht-Kuss vom Vater waren Schmach und Schmerz wieder vergessen, aber das Versprechen auf Besserung nicht.
Im Stillen und ganz geheim tauschten die Kinder nach solchen Berührungen mit dem Stock oder dem Riemen gegenseitig die Erfahrungen aus. Hanna wusste aus der Schule, dass in den Wintermonaten der Rohrstock des Lehrers – auf den warmen Ofen gelegt – sehr schnell seine Wirkung verlor, weil er durch das Austrocknen in tausend Stücke zerfiel, sobald er auf den Hosenboden oder die Hände niedersauste. Drohend stellte dann zwar der Lehrer die Frage: „Wer hat das gemacht?“, aber keiner der Kinder meldete sich freiwillig. Jedoch schneller als gedacht, hatte sich der Lehrer einen neuen Rohrstock besorgt und für die nächsten Tage legte er ihn auch nicht während der Pause aus der Hand.
Eine andere, auch ganz gut funktionierende Methode war, dass man unter den Schlüpfer Zeitungspapier legte. Dadurch entstanden nicht so schmerzende Riemen auf dem Hintern und man konnte sich besser wieder hinsetzen, denn sonst tat es höllisch weh. Bei manchen klappte dieser Trick aber nicht, wenn nämlich der Lehrer das zu dicke Polster entdeckt hatte. In solchen Fällen wurde dann kurzer Prozeß gemacht: Hose runter und der Rohrstock tanzte auf dem nackten Hintern.
Eigentlich durfte der Lehrer gar nicht so sehr schlagen, aber wo sollten sich die Kinder schon beschweren? Wenn sie Zuhause ihr Leid klagten, bekamen sie höchstens noch eine Ohrfeige dazu, weil sie nicht aufgepasst hatten.
Die größeren Kinder waren aber auf eine ganz tolle Idee gekommen: Ihr Lehrer schlug nicht auf den Hosenboden, sondern auf die Fingerspitzen.
Das tat furchtbar weh und außerdem konnte der so disziplinierte Schüler nicht mehr gut schreiben. Um den Schmerz besser äußerlich sichtbar zu machen, rieben sich die Kinder – die schon solche Maßnahmen ahnten – die Finger mit Zwiebeln ein. Wenn dann der Lehrer auf die Fingerspitzen einschlug, schwollen sie an und manchmal platzte auch die Haut auf. Wenn das erreicht war, konnte sich der Schüler beim Direktor beschweren. Und das tat gut, denn dann musste der Lehrer zur Schulleitung gehen und sich rechtfertigen. Das konnte natürlich auch weitere Konsequenzen für ihn haben. Der größte Wunsch der Schüler für solch einen Lehrer war, dass er in eine andere Schule versetzt würde.
*
So waren schon viele Generationen erzogen worden und die Erfahrungen gingen von Hand zu Hand.
Und es waren langjährige Erfahrungen auf diesem Gebiet, denn Königsberg hatte schon seit 1699 die erste Armenschule, in der nicht nur lesen, schreiben und rechnen gelehrt wurde, sondern auch Hausandachten tägliche Pflichterfüllung waren. Anlässlich der Krönung erhielt die Schule 1701 das Prädikat „königlich“. Später wurde daraus das „Collegium Fridericianum“, allen bekannt als angesehendste aller ostpreußischen Schulen. Die Schulen vor dieser Zeit waren die sogenannten „Winkelschulen“, in denen „Lehrer unterrichteten“, die unausgebildet und desinteressiert waren, da sie nur ein ganz geringes Entgelt für ihre Arbeit erhielten. Doch bereits 1732 wurde die allgemeine Schulpflicht eingeführt und die Prediger für die Qualität des Unterrichts und der Unterrichtenden verantwortlich gemacht. Dadurch bedingt gab es 10 Jahre später bereits 18 Armenschulen, d. h. Volksschulen. Nun wurden auch die Lehrer richtig ausgebildet, und zwar in Deutsch, Litauisch und Polnisch, denn alle Sprachen waren in und um Königsberg gebräuchlich.
Nach diesen grundsätzlichen Anfängen und mit dem geistigen und kulturellen Aufschwung in und um Königsberg wurden noch weitere Bildungseinrichtungen geschaffen. So wurde 1840 die Kunstakademie gebaut, eine Meisterschule des deutschen Handwerks, 1914 das Hufe-Gymnasium, die Burgschule, die Friedrich-Ebert-Schule als Volksschule, die Taubstummenanstalt, die Blindenanstalt, 1930 die Handelshochschule als Mädchengewerbeschule, die im Volksmund „Klopsakademie“ genannt wurde, um nur einige zu nennen.
Die wesentlichste Bildungseinrichtung war und blieb jedoch die Universität, die durch Herzog Albrecht 1544 gegründet worden war. Hier wurden zwar anfänglich für das eigene Land vorwiegend Theologen, Juristen und Ärzte ausgebildet, jedoch wurde sehr schnell besonders über Immanuel Kant der gute Ruf über die Universität verbreitet.
Die Königsberger ehrten ihn durch ein Denkmal am Paradeplatz. Sein Grabmal am Dom ist heute noch ein wichtiges Kulturzeugnis aus dieser Zeit. Aus allen wesentlichen Städten, in denen Universitäten waren, kamen die Professoren zu Vorlesungen und Diskussionen, da hier eine freie und offene Meinungsäußerung die Kultur der Universität kennzeichnete. So setzten Johann Friedrich Herbart, Friedrich Wilhelm Bessel, Felix Dahn, der auch gleichzeitig Dichter war, Wilhelm v. Humboldt, Konrad Lorenz aus Österreich, Walther Ziesemer, Alfred Uckeley, Hans Rothfels und viele andere Gelehrte die Meilensteine für die Entwicklung der Universität und begründeten den Ruf für Königsberg.
Selbstverständlich waren bei den politischen und religiösen Streitgesprächen auch Grenzen gesetzt. So wurde Julius Rupp – ein Divisionsprediger - mehrmals inhaftiert, da er die Forderungen von Kant im Zusammenhang mit der christlichen Humanität predigte und somit nicht im Einklang der Kirche handelte. Um seine Ideen letztlich doch noch durchsetzen zu können, gründete er mit seinen Anhängern die „Freie evangelisch-katholische Gemeinde“, durfte aber keine kirchlichen Handlungen mehr vornehmen.
Bis zur Eingliederung Ostpreußens 1871 in das Deutsche Reich war Königsberg Bildungszentrum für Ostpreußen und natürlich auch Zentrum für die Verwaltung, das Militär und den Handel. Danach kämpfte Königsberg gegen die Zentren anderer deutscher Städte, um nicht zur Provinzstadt herabgewürdigt zu werden. Mit dem Versailler Vertrag und der Abspaltung Ostpreußens vom Deutschen Reich wussten sich die Königsberger mit eigener Kraft wieder Ansehen und Anerkennung zu verschaffen.
Durch die ständig wachsenden Zahlen der Studenten an der Königsberger Universität (1930 waren es über 4000, davon über 700 Frauen) wurde ein neues Gebäude errichtet, da die alten Gemäuer den Erfordernissen nicht mehr genügten. In dieser Zeit war es dann auch, dass Paul Stettiner als Stadtschulrat von Königsberg und treibende Kraft in allen kulturellen Dingen Vorlesungen und deutsche Sprachkurse organisierte. Damit hatte die Universität schon fast Volkscharakter erlangt, da die Litauer, Polen und Russen Deutsch als Umgangssprache brauchten.
*
„Anna“, sagte Otto, „am Montag komme ich später nach Hause. Die Gewerkschaft hat im Betrieb einen Aushang gemacht. Sie bietet allen Interessierten einen Vortrag über die Wirtschaft unseres Landes nach dem Krieg an. Ich werde mir das einmal anhören, damit ich weiß, welche Probleme auf uns zukommen können. Vielleicht höre ich auch etwas über unsere Hausfinanzierung, denn wir haben ja noch eine Restschuld des Kredites von unserem Haus.“ „Die werden dir aber nicht sagen, wovon wir den Kredit bezahlen sollen, wenn du arbeitslos wirst, wenn die Mieteinnahmen weiterhin staatlich gelenkt werden und nicht erhöht werden dürfen, wo doch jetzt schon alles immer teurer wird. Aber geh` nur hin – vielleicht erfährst du ja etwas Interessantes.“
Hanna hatte zwar gehört, worüber sich die Eltern unterhalten hatten, aber den Inhalt hatte sie nicht verstanden. Was hatte der Hauskredit vom Vater mit einer Versammlung zu tun? Aber Mutter und Vater wussten ja immer Rat, also brauchte sie sich keine Gedanken darüber zu machen.
Als Otto nach Arbeitsschluss in die Eingangshalle kam, war sie schon fast überfüllt. Jeder, der sich einen Stuhl aus dem Betrieb organisiert hatte, konnte sich setzen, die anderen standen dichtgedrängt. Alle Männer – Frauen gab es kaum im Betrieb – unterhielten sich angeregt und lautstark. Jeder hatte etwas seinem Arbeitskollegen über sein Geld oder seine Geldsorgen zu erzählen, jeder hatte seine Probleme. Viele unterhielten sich auch darüber, wer Schuld an der ganzen Misere hätte, denn seit dem Krieg ging es allen sogenannten „kleinen Leuten“ immer schlechter.
Ein Mann stellte sich hinter einen Tisch, legte ein paar Zettel drauf und schaute in die Menge. Schnell trat Ruhe ein.
„Liebe Kollegen“, begann der Redner in normaler Zimmerlautstärke und zwang damit auch die letzten Diskutierer zur Ruhe.
„Ich kann euch nicht mehr Geld geben und darum auch nicht sagen, was und wieviel ihr essen könnt, aber ich kann versuchen, euch die Zusammenhänge zu erklären, warum wir seit 1914 nicht mehr so leben können, wie wir das gewohnt waren.
Die Regierung musste für den Krieg zur Versorgung der Soldaten mit Lebensmitteln – und natürlich auch mit Waffen – diese Güter dem sogenannten inländischen Sozialprodukt entnehmen, d. h. diese Güter waren eigentlich für die Versorgung der Bevölkerung gedacht. Es waren für die Kriegsversorgung keine Reserven vorhanden. Darum wurden die Waren des täglichen Bedarfs für die Bevölkerung immer weniger und darum stiegen die Preise immer mehr an. Die Einführung der Lebensmittelkarten für Fleisch, Schmalz, Zucker, Milch und Kartoffeln bewirkte nur eine Notversorgung der Bevölkerung. Diese „Kriegsration“ konnte noch nicht einmal von uns armen Leuten in vollem Umfang in Anspruch genommen werden, weil es nicht so viel gab. Die Waren auf den Lebensmittelkarten hatten zwar die vom Staat verordnete Preisobergrenze und die Löhne und Gehälter waren angehoben worden (um ca. 100 %), aber die Lebensmittel reichten nicht. Viele griffen zu Ersatzmitteln: Wer es sich leisten konnte, kaufte auf dem Schwarzmarkt zusätzlich Lebensmittel ein, die Armen griffen zu Notlösungen und stellten z. B. das sogenannte Kriegsbrot aus Zuckerrüben her.
Diese Situation sah die Bevölkerung noch als kriegsbedingt an und hoffte auf einen Sieg, damit das Leben wieder besser werden könne.
Zwar haben wir nach dem Krieg eine neue Regierung bekommen, die eigentlich unsere Interessen vertreten soll, aber die stand vor großen Problemen:
Der Rat der Volksbeauftragten konnte die finanziellen Verpflichtungen aus dem Kaiserreich nicht zurückweisen, weil das den Staatsbankrott bewirkt hätte. Damit hätten unter dieser neuen Regierung die kleinen Anleihezeichner (und auch die großen) schwere Verluste gehabt. Um die Wählerstimmen der „Kleinen Leute“ warb man aber in der neuen Regierung.
Die neue Regierung hatte sich auch das Ziel der Vollbeschäftigung für die Arbeiter gesteckt. Darum konnte nun wiederum die Steuerschraube für die Eigentümer der Betriebe nicht zu hoch gedreht werden, um zu notwendigen Einnahmen zu kommen, denn ein Unternehmen muss sich ja für den Unternehmer lohnen. Außerdem sitzen in der neuen Regierung auch wieder Abgeordnete, die Vertreter der Großgrundbesitzer und der Industrie sind, und damit gegen einnahmeträchtige Steuern stimmten. Die wenigen beschlossenen Steuerveränderungen brachten aber nicht die erforderlichen Staatseinnahmen. Die Schulden des Reiches durch den Krieg aus dem Versailler-Vertrag waren bis 1919 auf 92,4 Milliarden Mark angewachsen, d. h. die Zinsaufwendungen wurden immer höher. Die ungedeckte Schuld betrug 63,7 Milliarden Mark. Für diesen Betrag hatte die Regierung keine Einnahmen. Das war zunächst das direkte Erbe aus dem Kaiserreich.“ Der Redner blickte in die Runde und sah allgemeines Kopfnicken.
„Das wissen wir ja, dass der Versailler-Vertrag uns alle ruiniert hat. Aber dafür haben wir ja auch für unsere Rechte gekämpft, damit es uns unter der neuen Regierung besser geht! Dafür haben wir sie doch gewählt! Die sollen sich doch was einfallen lassen!“
Dieser Sprecher erntete eine allgemeine Zustimmung. Die Versammelten waren auf seiner Seite. „Ihr von der Gewerkschaft müsst doch auch wissen, was zu tun ist! Ihr müsst doch unsere Rechte vertreten und dafür sorgen, dass die Reichen nicht noch reicher und die Armen nicht noch ärmer werden! Ich denke, das ist euer Ziel“, kam die erregte Stimme aus einer anderen Ecke.
Der Redner fühlte sich in die Ecke gedrängt und versuchte zu beruhigen. „Ich habe euch eingangs gesagt, dass ich euch nicht mehr Geld geben kann, sondern nur versuchen werde, euch die Zusammenhänge zu erklären. Zum Schluss hat dann noch jeder Gelegenheit, Fragen zu stellen. Können wir so vorgehen?“ Allgemeines Kopfnicken zeigte Zustimmung. Nun waren auch wieder alle zum Zuhören bereit.
„Die direkten Kriegsfolgen lasten also schwer auf dem Staatshaushalt“, fuhr der Redner nun in ruhigem Ton fort. „So mussten die Kriegsinvaliden und die Hinterbliebenen der gefallenen Soldaten mit Renten versorgt werden, entlassene Frontsoldaten mussten wieder Arbeit bekommen. Der Rat der Volksbeauftragten hatte als sozialen Ausgleich für die Soldaten beschlossen, dass diese mindestens drei Monate in ihrem alten Betrieb wieder eingestellt werden mussten, obwohl bereits viele Arbeitslose registriert waren. Für die Arbeitslosen musste die Regierung die Hälfte der Kosten der Erwerbslosenfürsorge aufbringen, die Länder und die Gemeinden zahlten die andere Hälfte, da dieses Gesetz die Arbeitslosen zu spät zur Selbstbeteiligung verpflichtet hatte und keine Rücklagen für die Zahlung vorhanden waren. Der Staat selbst hatte zusätzliche Ausgaben für die Unterhaltung der Truppen, die zur Sicherung der Grenzen der Republik und zur Wahrung der inneren Ruhe unter Waffen standen. Doch der größte Schuldenberg blieb die Bezahlung der Reparationsleistungen. Das war zunächst die finanzielle Hinterlassenschaft für die neue Regierung.“ Allgemeines Kopfnicken zeigte dem Redner an, dass jetzt keine Meinungsverschiedenheit bestand.
„Doch problematischer war die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln, da die Erträge der Landwirtschaft durch den Einsatz der Bauern als Soldaten stark zurückgegangen waren und damit die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln immer dürftiger wurde.“ Jetzt blickten alle Augen nach vorne. „Zu allen Problemen kam noch hinzu, dass die ehemals deutschen Gebiete des Rheinlandes und Ostpreußens – also auch euer Territorium – von Deutschland abgeschnitten wurden und damit alte Handelsbeziehungen und Versorgungsleitungen zerbrachen. Die für die Betriebe notwendigen Rohstoffe mussten nun aus anderen Ländern geliefert werden, z. B. auch Kohle, Eisenerz usw. Auch die Absatzmärkte brachen weg. Kurz: Handel und Industrie mussten neu organisiert werden. Ihr habt es von den Betrieben und Handelshäusern sicher schon gehört.
Darum konnte das Angebot an Gütern für den zivilen Bedarf nach der Beendigung des Krieges nicht erhöht werden, weil auch die Umstellung vieler Betriebe von der Kriegs- auf die Friedensproduktion nicht so schnell möglich war. Die Betriebe waren außerdem veraltet, da in den Kriegsjahren nur in einigen wenigen Betrieben – eben für die kriegsbedingte Produktion – investiert worden war. Außerdem verlangten die Unternehmer Entschädigungen für die erlittenen Verluste aus den besetzten Gebieten.
Zur Finanzierung des Krieges machte unser Staat folgenschwere Fehler: Der Reichstag beschloss, dass die Reichsbank von der Pflicht befreit wird, ihre umlaufenden Banknoten mit Gold zu sichern. Lediglich ein Drittel sollte noch mit Gold gedeckt sein. Damit konnte zwar die Regierung mehr Papiergeld drucken, aber dieses Geld hatte nicht mehr den erforderlichen Gegenwert. Die Entwertung nahm ihren Anfang.
Das Ausland nahm aus diesem Grunde nur noch zögerlich die Mark als Zahlungsmittel für deutsche Importe an. Die Wechselkurse verschlechterten sich von Jahr zu Jahr. So wurden für Schweden-Stahl 1914 für 100 Mark noch 122,60 Schweizer Franken verrechnet, im Folgejahr nur 109, im Jahre 1916 waren es nur 95, 1917 gar nur noch 66 Schweizer Franken. Wir müssen also heute fast das Doppelte an Geld bezahlen, ohne dass eine Preissteigerung der Ware berücksichtigt worden wäre, das waren nur Kursverluste. Dieses Warnsignal wurde von der Regierung nicht verinnerlicht.
Im Gegenteil: Die Reichsregierung führte den bargeldlosen Zahlungsverkehr ein und hoffte, damit den Papiergeld-Verbrauch einzudämmen. Sie berücksichtigte dabei aber nicht, dass die Konten bei Gebrauch auch in Geldscheinen den Wert verkörpern mussten.
Um die Arbeiter nicht für Hungerlohn arbeiten lassen zu müssen, weil sie für ihr Geld nichts mehr bekamen, wurden vor zwei Jahren – also 1918 – Teuerungszulagen z. B. bei der Firma Siemens in Höhe von 50 – 60 % verrechnet. Wobei hier in eurer Firma dieser Satz etwas niedriger lag. Damit wurde wieder mehr Geld in Umlauf gebracht, ohne dass ein Gegenwert vorhanden war.
Ein weiterer Fakt, dass unser Geld nicht mehr viel Wert ist, war die Situation, dass das System der Höchstpreise für die Eisen- und Stahlindustrie Anfang 1919 aufgehoben wurde und darum bis heute – Mai 1920 – Preiserhöhungen um 900 % möglich wurden. Und wieder wurde Geld gedruckt, um die Waren bezahlen zu können.
Doch welchen Wert die Mark wirklich hatte, stellte sich durch folgende Situation dar: Während des Krieges war Amerika vom Schuldner zum Gläubiger geworden, da es mit zu den Siegermächten gehörte. Der US-Dollar entwickelte sich zur Leitwährung des internationalen Zahlungsverkehrs. Einige Spekulanten haben bereits begonnen, US-Dollar zu kaufen, weil das Vertrauen in die Deutsche Mark gesunken ist. Das möchte ich Ihnen anhand einer Zahl verdeutlichen: 1914 waren 2,9 Milliarden Mark in Umlauf, 1917 bereits 28,3. Das heißt: Für die fast gleiche Warenproduktion ist fast zehnmal mehr Geld in Umlauf, obwohl wir weniger Waren kaufen können.
Doch es gab noch weitere Ursachen, warum es zu der heutigen inflationären Entwicklung kommen konnte:
Die sich durch den Mangel an Waren ergebenden Preissteigerungen nach dem Krieg hätte die Regierung beeinflussen können, wenn sie die vorhandenen Geldmengen in den Händen privater Nachfrager verringert hätte. Für den kleinen Mann hatte das keine Bedeutung, denn der hatte nicht viel.
Doch die Kriegsgewinnler der Industrie konnten einen hohen Ertrag verbuchen. Die Regierung schöpfte aber erst Ende 1916 für Einkommen und Vermögen Steuern ab. Dies war erst zu diesem Zeitpunkt durch Gesetzesänderung möglich, da die Bundesstaaten die Hoheit über die direkten Steuern bis dahin hatten, also z. B. auch unser Preußen durch die politische Situation sich selbst keine Steuern auflud, da ja die Großagrarier und die Schwerindustrie für sich selbst keine Steuern beschloss. Doch die Wirkung dieses Gesetzes kam viel zu spät. Zwar wurde auch Ende 1919 das sogenannte „Reichsnotopfer“ als einmalige, jährliche Vermögensabgabe von 10 % auf 65 % bei Vermögen über 2 Millionen Mark erhöht, aber auch das brachte nicht die erforderlichen Einnahmen für den Staat.
Sicher hat der eine oder andere von Ihnen“, hier schaute der Redner einige Personen direkt an, „sich bei den Volksanleihen beteiligt und ist durch den Ausgang des Krieges herb enttäuscht worden. Hat doch jeder, der dem Staat sein Geld für den Krieg zur Verfügung stellte, auf Gewinn gehofft. Doch dieser Gewinn wäre von den Völkern bezahlt worden, die den Krieg verloren hätten. Da wir ihn verloren haben, müssen wir an diese Staaten zahlen.
Doch es wurden noch andere Aktionen durch die Regierung vorgenommen, die nicht zur Stabilisierung der Mark führten. So stellte sie sogenannte Schatzwechsel zur Finanzierung des Krieges aus und stellte sie den Handelswechseln gleich. Damit konnte die Staatsbank bei Diskontierung – also bei Einlösung – für diese Staatswechsel Banknoten drucken lassen, obwohl keine Golddeckung oder Deckung durch Waren vorhanden war. Das führte wiederum zur Erhöhung des Geldumlaufes.
Der Lombardkredit, der als Sicherheit Waren oder Wertpapiere hatte, wurde in Darlehenskassenscheinen zum Nennwert ausbezahlt, also mit dem Markbetrag, der angegeben war. Damit hatten Gemeinden, Körperschaften, Privatleute, ja sogar die Bundesstaaten die Möglichkeit, gegen Verpfändung der Gegenstände oder Immobilien zu Geld zu kommen. Da die Reichsbank diese Kassenscheine 1916 neben dem Gold in die Primärdeckung nahm, also als Sicherheit wie Gold wertete, wurde die Ausgabe von Geldscheinen ins Uferlose möglich, da ja eine tatsächliche Deckung nicht vorhanden war.
Vergangenes Jahr versuchte die Regierung, an der Börse die Nachfrage und damit den Wert der Mark zu stabilisieren, indem sie die Mark aufkaufte. Das gelang auch für kurze Zeit – die Mark rutschte nicht noch mehr im Wert ab. Wir können nun nur noch hoffen, dass dies so bleibt.
Das waren meine Ausführungen zum Thema: ‚Die finanzielle Situation in unserem Staat.‘
Nun machte der Redner eine kurze Pause und sah sich in den Zuschauerreihen um.
Alle hatten ihm aufmerksam zugehört. Jetzt jedoch machte sich ein allgemeines Gemurmel breit. Dass das Geld nicht mehr viel wert war, wussten alle. Wie aber soll es weitergehen? Es gab schon so viele Arbeitslose und die, die noch Arbeit hatten, konnten sich für das Geld schon lange nicht mehr das kaufen, was sie noch vor Jahren dafür bekommen hatten. Nur einige, wenige – so hörte man hinter vorgehaltener Hand - machten schwarze Geschäfte und wurden reich.
„Wenn Sie noch Fragen haben, so fragen Sie – falls ich Ihnen Antwort geben kann, so tue ich das gerne“, war die aufmunternde Formulierung des Redners. „Auch ist es an der Zeit, dass jeder Arbeiter nicht nur seinen Arbeitsplatz sieht, sondern sich weiterbildet und für die allgemeinen Rechte aller Arbeiter eintritt. Dafür sind wir da, dies gegenüber den Arbeitgebern für euch durchzusetzen. Wer also in die Gewerkschaft eintreten will und damit auch seinen arbeitsrechtlichen Schutz bekommt, kann sich ein Formular hier bei mir holen. Ich gebe gerne jedem Auskunft.“
Gewerkschaftsmitglied wollte Otto auf keinen Fall werden, aber ihm lag eine Frage auf der Zunge: „Ich habe auf mein Haus einen Kredit beim Bauen aufnehmen müssen. Ich muss auch noch abzahlen. Wie soll ich mich verhalten, um nicht am Bettelstab zu landen?“
„Mein Herr, das ist eine gute Frage. Ich würde Ihnen Folgendes raten: Da die Kreditsumme sich ja nicht erhöht, sie aber jetzt fast das Doppelte verdienen als vorher – wenn auch die Mark nicht mehr so viel wert ist – versuchen Sie von Ihrem Einkommen auf alle Fälle die Tilgung und Zinsen zu bezahlen. Da diese Beträge bleiben, aber die Scheine immer größer werden, haben Sie einen Vorteil. Es ist also – ehrlich gesagt – besser, Sie nehmen Kredite auf mit festen Zinssätzen und zahlen diese zurück, als dass Sie Ihr Geld sparen und später eine Barzahlung vornehmen. Ich gehe einmal davon aus, dass die Geldentwertung weiter voranschreitet. Wenn dies eintrifft, wird Ihr Spargeld auf der Bank – was sie sich heute vom Mund abgespart haben – immer weniger wert. Ein Kredit bleibt aber in der einmal gewährten Höhe bestehen, egal, was das Geld bei der Rückzahlung wert ist.“
Die Arbeiter schauten sich verwundert an. Sollte das wirklich so funktionieren? Ein weiterer Zuhörer meldete sich zu Wort. Er sah in seinem Anzug wie ein besserer Angestellter aus. Und seine Frage bestätigte auch die Vermutung: „Wenn ich mir also heute auf der Bank einen Kredit besorge, dafür ein Grundstück kaufe und diesen Kredit mit einer Laufzeit von ca. 10 Jahren tilge, habe ich ein Geschäft gemacht?“ „Sie haben dann unter zwei Bedingungen ein tolles Geschäft gemacht: einmal muss die Inflation sich rasant weiterentwickeln und zum anderen müssen Sie die Tilgung und Zinszahlungen auch wirklich bezahlen können. Ist das zu einem bestimmten Termin nicht möglich, kann Ihnen das Grundstück wieder gepfändet werden und sie erhalten zu diesem Zeitpunkt nur den Markbetrag, den Sie bis zu diesem Zeitpunkt eingezahlt haben. Für diesen Betrag können Sie dann aber vielleicht nur noch ein Brot kaufen.“
„Ich habe für meinen Lebensabend geplant, von den Mieteinnahmen zu leben, um nicht von meinen Kindern abhängig zu sein oder im Armenhaus zu landen. Ist das der richtige Weg in die Zukunft?“, war eine weitere Frage aus der Zuhörerschaft. „Das kann – muss aber nicht – eine sichere Bank sein. Hier müssten drei Bedingungen gelten: einmal müssen die Wohnungen immer vermietet sein, zum anderen müssen die Mieter auch die Miete bezahlen. Wenn aber die Mietpreisbindung vom Staat nicht aufgehoben wird, sind die Mieteinnahmen durch den Wertverlust des Geldes nichts mehr wert. Das heißt, Sie müssten die Miethöhe dem Wertverlust des Geldes anpassen. Nur dann haben Sie die Möglichkeit, von dem Geld auch zu leben.“
„Ich habe für meine Familie ein Sparkonto angelegt, damit ich unvorhergesehene Ausgaben oder lange geplante bezahlen kann, zum Beispiel die Ausbildung meiner Kinder. Soll ich jetzt das Geld ausgeben und mir Sachen dafür kaufen, die ich nicht so dringend brauche?“ „Mein Herr, “ und hier trat eine absolute Stille ein, „das gesparte Geld in der Zahl, also z. B. 2400 Mark bleibt. Nur was Sie sich dafür in zwei Jahren kaufen können, ist fraglich. Bezahlen Sie aber jetzt schon die Aussteuer für Ihre Tochter, ist Ihnen die Ware sicher, die Sie heute kaufen.“
„Wenn dann – nach Ihrer Prognose – das Geld nichts mehr wert ist, wie sollen wir dann unsere Nahrungsmittel bezahlen?“, fragte ein kleiner Mann ganz hinten in der Ecke. Der Redner atmete tief durch, machte eine kleine Pause und sagte: „Ich bin kein Prophet. Ich weiß nur, dass der Finanzhaushalt unseres Staates total am Boden liegt und dass wir uns in einer schleichenden Inflation befinden. Da bisher noch keine gravierenden Maßnahmen vom Staat erlassen worden sind, um die Inflation aufzuhalten, wird sie sich weiterentwickeln. Damit werden die Löhne mit großer Wahrscheinlichkeit in die Tausend wachsen und die Preise werden sich ebenfalls so entwickeln. Jeder, der Arbeit hat, wird sich also sein tägliches Brot kaufen können, wenn nichts Schlimmeres folgt.“ „Und wer keine Arbeit mehr bekommt?“ Doch diese Frage wurde von dem Vertreter der Gewerkschaft schon im allgemeinen Gemurmel überhört.
„Wenn also keine weiteren Fragen sind, möchte ich mich für Ihr Interesse an meinem Vortrag bedanken und hoffe, dass ich Ihnen mit meinen Ausführungen einige Informationen geben konnte.“ Der Redner nahm seine Zettelchen vom Tisch und löste damit die Versammlung auf.
Bedrückt machte sich Vater Krohn auf den Heimweg. Ihm schwirrte der Kopf von den vielen Informationen, die er bekommen hatte. Mit seinen Einnahmen und Ausgaben war er bisher zwar immer klargekommen, aber was er heute alles gehört hatte, waren ungewohnte Informationen für einen Maurer. Aber er freute sich über sich selbst, dass er es gewagt hatte, die Frage zu stellen. Auch die anderen Fragen und Antworten beschäftigten ihn so sehr, dass er gar nicht bemerkt hatte, dass er Zuhause angelangt war.
Mutter begrüßte ihn freudestrahlend, war sie doch immer froh, wenn er nach Hause kam. Eine liebe Umarmung, ein liebevoller, kleiner Kuss und die traurigsten Gedanken waren nicht mehr die wichtigsten auf der Welt. “Na, erzähle mal, wie ist die Lage der Nation?“ war ihre mehr scherzhaft gemeinte Frage. Doch der Tisch war schon für das Abendbrot gedeckt und die Kinder warteten schon auf die Milchsuppe. Vater bekam noch zusätzlich eine Scheibe Butterbrot, denn er hatte ja im Betrieb kein Mittagessen. Das Dankgebet von Vater für die Abendmahlzeit fiel heute besonders intensiv und innig aus. Die größeren Kinder lauschten und merkten, dass Vater ein Problem hatte, das er mit seinem Gott besprach. Doch dann durften sie endlich den Löffel in die Hand nehmen und essen, denn der Magen knurrte schon hörbar. Auch Mutters fröhliches und zufriedenes Aussehen hatte sich geändert. Sie war sehr still geworden und wartete geduldig auf die Informationen, bis die Kinder im Bett waren.
Wie immer, wenn der Abend ihnen alleine gehörte, nahm sie den Handarbeitskorb vor und arbeitete an den Kindersachen weiter.
„Mutter, “ und Ottos Stimme klang traurig und deprimiert, „wir werden wahrscheinlich noch schlechteren Zeiten entgegengehen“. Und dann sprudelten die Informationen nur so aus ihm heraus. Als er geendet hatte, sagte Mutter: „Aber Otto, sei doch nicht so kleingläubig. Der Herr hat uns bis hierher geholfen, er wird uns auch weiterhin helfen. Sieh mal, es sieht doch gar nicht so schlecht aus. Du hast immer noch Arbeit und wirst sie in den nächsten Monaten auch noch weiter behalten. Solltest du auch arbeitslos werden, dann bekommen wir ein halbes Jahr Sozialgeld und dann findest du bestimmt wieder wo anders Arbeit, denn du bist doch so tüchtig. Bis jetzt haben auch alle Mieter immer pünktlich ihre Miete bezahlt und sie hat gereicht, um den Kredit und die Zinsen vertragsgemäß zu bezahlen. Wir werden die Miete auch erst erhöhen, wenn es gar nicht mehr anders geht. Dann zieht auch keiner aus. Spargeld haben wir keines, dann kann auch nichts entwertet werden. Im Garten werde ich noch mehr Beete anlegen, damit wir mehr Gemüse haben und uns selbst versorgen können, wir werden die Henne noch einmal sitzen lassen und haben dann mehr Hühner, also auch mehr Eier und Fleisch. Damit die Hühner Nahrung haben, verkleinern wir den Hinterhof und erweitern den Hühnerauslauf. Die Kinder müssen sich dann eben auch ein bisschen einschränken mit ihren Spielen und mir mehr bei der Gartenarbeit helfen. Wir kaufen einen neuen Brotkasten mit einem Schloss davor. Dann kann ich auch kontrollieren, dass sich zwischen den Mahlzeiten keiner mit Brot bedient. Außerdem hat mir vergangene Woche meine Cousine Hedwig aus Maraunenhof wieder ein Ferkel angeboten, das wir großziehen können. Unsere Küchenabfälle werden sicher nicht für die Mast reichen, aber wir können ja die Mieter fragen, ob wir ihre Abfälle mit verwenden dürfen. Wenn alle Stricke reißen, können wir ja zu Markttagen die Abfälle zusammen sammeln und verfüttern. Und an die Kosten für die Ausbildung unserer Kinder brauchen wir jetzt noch nicht zu denken, denn Lisbeth ist erst 11, Hanna 9, Herta ist gerade in die Schule gekommen, Fritz wird erst 6 Jahre, na und bei den beiden Kleinen haben wir noch mehr Zeit“.
Mutter hatte vor lauter Eifer rote Wangen bekommen. Das war in letzter Zeit selten der Fall. Meistens war sie blass und schmal im Gesicht. Verliebt sah Otto seine Frau an. Im Stillen dankte er Gott für seine Anna, die die viele Arbeit ohne zu murren machte. Im Gegenteil: oft, auch wenn sie Sorgen hatte, summte sie ein Lied vor sich hin und gab dadurch sich und ihm Kraft. Den Kindern war sie eine liebevolle Mutter und ihm eine herzensgute Frau. Er stand auf und umarmte sie zärtlich. „Du hast dir wahrscheinlich schon früher als ich Gedanken gemacht, wie wir alles bewältigen. Aber du hast ja Recht, wenn wir nicht die Hände in den Schoß legen, uns lieben und außerdem auf unseren Herrn vertrauen, kann uns nichts geschehen.“
Für Anna und Otto waren diese gemeinsamen Abendstunden die Quelle ihrer immer wieder neuen aufkeimenden Liebe. Der Gedankenaustausch gab ihnen Sicherheit und Zufriedenheit in seelischer Verbundenheit zu ihrem Glauben.
Und gleich am nächsten Tag fingen Mutter und Vater zur Verbesserung der Selbstversorgung tatkräftig mit der Arbeit an: Die Henne wurde gesetzt, der Garten mit seinen Beeten anders angeordnet, der Hühnerauslauf eingezäunt und der Gerümpelschuppen zum Schweinestall hergerichtet. Die Arbeiten mussten zügig vorangehen, denn es war Frühjahr und gerade noch die richtige Zeit, um die Früchte der Arbeit noch in diesem Jahr ernten zu können. Die größeren Kinder wurden über die Planung informiert und halfen, wenn auch nicht immer mit Freudengeheul.
Und so wie Krohns ging es auch einigen anderen Menschen: Tatkräftig gingen sie an die Aufgaben des Tages. Am Abend wurden im Familienkreis die Sorgen und Nöte dem Herrn im Gebet vorgetragen. Dadurch wussten die Kinder immer, welche Probleme ihre Eltern dem lieben Gott erzählten und welcher Kummer sie bewegte. Nach dem gemeinsamen „Amen“ hatten alle das Gefühl, dass sie mit ihren Problemen nicht alleine waren und der liebe Gott in der höchsten Not, wenn sie nur richtig beteten, ihnen auch helfen wird. Diese Sicherheit übertrug sich auch auf die Kinder und sie hatten vor keinem Problem mehr Angst, wenn sie ins Bett gingen.
Auch Hanna hatte nach dem Gebet keine Angst mehr vor dem Morgen. Sie fühlte sich geborgen. Fest nahm sie sich vor: „Wenn ich groß bin und eine eigene Familie habe – dann mache ich es auch so!“
Auch in der Gemeinde wurden optimistische Gedanken ausgetauscht und trotz aller Probleme, die es gab, wurden die Menschen wieder aufgeschlossener und fröhlicher.
Denn es gab zwei wesentliche Ereignisse in Königsberg, die an einen Aufschwung glauben ließen. Zunächst wurde im Sommer der „Seedienst Ostpreußen“ eingerichtet. Das war eine tiefgreifende Maßnahme, konnten doch dadurch die Königsberger und alle anderen Ostpreußen mit dem Schiff ins Reich fahren, ohne den Landweg – den polnischen Korridor – zu benutzen. Die Schifffahrt ermöglichte auch, die alten Handelsbeziehungen wieder aufzunehmen. Das alleine war eine positive Entwicklung, die viele Menschen beflügelte. Die Dampfer des „Seedienstes“ legten in Swinemünde und Pillau an, später auch in Travemünde und Helsinki. Der Reisedienst Meyhoefer organisierte Fahrten nach Warschau, Finnland, Memelland, Litauen, Lettland, Estland, Finnland, Russland und Polen und auch nach Berlin. Damit war verkehrsmäßig die Verbindung zum „Reich“ wieder verbessert und die Grundlage geschaffen, die Ostmesse in Königsberg, die am 28. September 1920 eröffnet wurde, zu einem Erfolg werden zu lassen. Sogar der Reichspräsident Friedrich Ebert bekundete für dieses weitere große Ereignis durch seine Anwesenheit die Verbundenheit des Reiches mit Ostpreußen und gab damit der Messe ein besonderes Gepräge. Damit war Königsberg im Osten Deutschlands wieder zu einem Handelsplatz geworden und war außerdem nicht mehr vom Reich so stark abgegrenzt. Es herrschte Volksfeststimmung.
Viele Händler kamen nach Königsberg, um in der neuen Messe ihre Produkte auszustellen und sie zum Verkauf an andere Händler anzubieten. Zwar gab es zur Eröffnung nur einen einzigen Steinbau – nämlich den Eingangsbereich, in dem sich auch die Verwaltung der Messe befand – aber die anderen Aussteller behalfen sich mit provisorischen Unterkünften. Dafür war der Eingangsbereich ein sehr schönes, langgestrecktes Gebäude, das die Interessenten förmlich zur Besichtigung einlud.
Auch Vater leistete sich das Vergnügen und schaute sich die ausgestellten Erzeugnisse an. Begeistert erzählte er seiner Anna, dass sich die Messe sehr viele Leute angeschaut haben, überall Fahnen wehen, die Menschen miteinander sprechen und verhandeln, viele Stände mit Holz, Teer, Fisch, Fleisch, Obst, Gemüse, Haushaltsgeräten und vieles andere zu sehen war und auch Maschinen für die Landwirtschaft von der Firma Hanomag entwickelt worden sind, damit die Arbeit der Bauern erleichtert werden kann.
„Wenn dann wieder mehr angebaut wird, haben wir auch wieder mehr zu essen, “ war seine logische Schlussfolgerung an seine Frau. „Dass unser Oberbürgermeister, Herr Lohmeyer, und der Bürgermeister, Herr Goerdeler, eine solche Messe bei uns in Königsberg organisiert haben, bringt uns bestimmt wieder voran. Denn wenn wir wieder mehr handeln, geht es uns auch wieder besser. Außerdem muss ja dann auch wieder gebaut werden, und dann habe ich weiterhin Arbeit.“ „Na, siehst du, Vater, jetzt glaubst du auch wieder an eine bessere Zukunft, “ freute sich Anna mit ihm.
Und wie zur Bestätigung, dass das alte Leben weiterging, hörten sie von der Straße her – wie immer montags - den Lumpensammler rufen:
„Lumpen, Knochen, Eisen, Altpapier,
ausgestopfte Teddys und viel mehr sammeln wir.“
Diesen Ausruf kleidete er in eine sich nie verändernde Melodie, so dass alle Bewohner, die ihn hörten, auch gleich aus dem Fenster sahen und ihn um Geduld baten, bis sie die Sachen geholt hatten. Der Händler besah sie sich und je nach dem, was er am besten weiterverkaufen konnte, fiel auch das Entgelt aus, das er auszahlte. Es waren zwar nur kleine Beträge, aber so konnte jeder seine entbehrlichen Gegenstände loswerden und hatte auch gleich noch ein wenig Geld. Nur bei Familie Krohn bekam er selten etwas zum Kauf angeboten, denn es wurde ja alles verarbeitet oder verwendet. Aber der Lumpenmann mit seinem Karren gehörte zum Stadtbild. Und mit zuverlässiger Pünktlichkeit kam er immer gegen 17 Uhr am Haus vorbei.
Der Milchmann kam mit seinen Milchkannen auf dem Karren immer vormittags gegen 10 Uhr. Er sang kein Lied, sondern hatte eine Glocke, die er in dem entsprechenden Häuserbereich läutete und somit seine Kunden lockte. Peinlich genau wurden die Messbecher in der großen Milchkanne gefüllt und darauf geachtet, dass kein Tröpfchen daneben ging. Auch die Kannen mit den unterschiedlichen Farbmarkierungen für Magermilch, Vollmilch, Buttermilch und Molke wurden mit den Augen kontrolliert, dass man nicht etwa Magermilch bekam und Vollmilch bezahlt hatte. Der Fritz, so wurde er allgemein anonym bezeichnet, kam schon viele Jahre mit seinem zweirädrigen Karren, dem Stützfuß und der langen Lederleine, die er sich um die Schultern legte, wenn er seinen Wagen zum nächsten Häuserkomplex zog. Er war auch immer zu kleinen Scherzen aufgelegt und die Frauen wiederum freuten sich über eine kleine Abwechslung im täglichen Einerlei des Haushaltes. Auch erzählte er oft die neuesten Informationen über Politik und Wirtschaft und war darum nicht nur allgemein der Milchmann, sondern gleichzeitig noch ein bisschen Zeitung. Wenn sich nun eine Familie keine Zeitung leisten konnte, bezahlte sie zwar einen geringen Beitrag mehr für die Milch, hatte aber auch die Stadtinformationen und die Milch gleich Zuhause.
Die Fischfrau kam mittwochs. Auch sie hatte einen zweirädrigen Karren. In großen Fässern waren die unterschiedlichen Fische untergebracht, die, frisch gefangen, noch am gleichen Tag in den entsprechenden Straßen der Vorstädte verkauft wurden. Damit hatte zwar der Händler mehr Arbeit, weil er ja zu den Kunden hinfuhr, aber er hatte auch mehr Umsatz. Für Anna war das Angebot der Fischfrau immer sehr günstig, denn freitags bekam Vater Geld. Am Mittwoch und Donnerstag war nicht mehr viel im Geldbeutel drin. Aber für eine Fischsuppe reichten die letzten Pfennige immer noch, auch wenn es vielleicht nur Fischköpfe waren. Und darum gab es bei Familie Krohn immer mittwochs und donnerstags zum Mittagessen Fisch, weil das die billigste Mahlzeit war und Mutter nicht in die Stadt fahren musste. Die Fischfrau, Frau Grieß, hörte man schon von weitem rufen: „Frische Därsch! Holt Stint, so lang noch welche sind!“ Sie hatte eine sehr kräftige Stimme, unverkennbar ein Fischweib, wohlgenährt und vollbusig wie auf dem Fischmarkt.
Der fand wochentags auf der Fischbrücke statt. Das war die gepflasterte Uferstraße am Pregel. Dort hatte die Familie auch einen Stand, der immer guten Umsatz mit den frischen und zum Teil noch lebenden Fischen machte. Wie jeder Fischer brachte ihr Mann den Fang in den frühen Morgenstunden in den Hafen. Dann wurde von der ganzen Familie sortiert und verkauft. Manche Fischer verkauften auch gleich aus dem Kahn oder Fischkutter an die Kunden und sparten sich so das Standgeld. Der Verkauf durfte aber erst beginnen, wenn das Marktzeichen, eine Fahne, für alle sichtbar war. Gegenüber den anderen Händlern mit Frischware hatten die Fischverkäufer eine Ausnahmegenehmigung: Damit die frischen Fische auch tatsächlich frisch bei den Kunden ankamen, durften die Wiederverkäufer, also Zwischenhändler, bereits nach der Morgenmesse größere Mengen aufkaufen.
Die Bauern, die ihre Waren anboten, wurden – wie auch die Fischhändler – von Marktboten, Ratsherren und Gewerkmeistern überprüft. Da ein sogenannter Vorkauf streng verboten war, also vor den Toren und außerhalb des Marktes kein Handel stattfinden durfte, wurden die Zufahrtswege der Märkte besonders überprüft. Kein Bürger und kein Handlungsdiener durfte die Bauern auf dem Weg zum Markt abfangen und Verhandlungen beginnen. Das ging so weit, dass niemand die Wagen oder Schlitten begleiten und auch nicht die Hand auf die Fuhrwerke auflegen durfte als Zeichen dafür, dass er bereits Besitzer sein könnte. Da die Märkte alle in der Innenstadt waren, hatten die Händler, die die Vorstädte versorgten, eine Sondergenehmigung.
Ab und an fuhr Anna auch in die Stadt. Aber seit alles teurer geworden war, sie nun schon sechs Kinder hatte und sie sich fast auf Selbstversorgung eingerichtet hatten, war der Gemüsemarkt oberhalb der Schmiedebrücke überflüssig geworden. Ihr Interesse galt dann mehr dem Textilhaus Siebert und dem Altstädtischen Markt sowie der Langgasse. Hier konnte sie die vielen Kleinigkeiten finden, die sie für den Haushalt brauchte, ganz besonders Wolle, Häkel- und Nähgarne, Druckknöpfe, Knöpfe, Schleifen, Bänder und Stoffreste, um für die Mädchen daraus etwas zu nähen. Vorrangig bekam Lisbeth, die Älteste, etwas Neues anzuziehen, weil die jüngeren Geschwister die Kleidung nachtrugen. Aber auch Fritz als einziger Junge brauchte Hosen und Hemden, denn er sollte ja auch wie ein Junge aussehen. Aber Mutter versuchte, möglichst allen Kindern zu den Feiertagen eine Freude zu machen und sie hübsch anzuziehen. In die anderen Geschäfte, die Glas, Porzellan, Bücher, Pullover, Kleider, Blusen, Hüte und vieles mehr anboten, ging sie gar nicht erst hinein, sondern schaute sich nur flüchtig die Auslagen an. Wie gerne hätte sie aber auch einmal ein neues Kleid gehabt, aber den Gedanken konnte sie gleich vergessen. Aber wenn sie verglich, was jetzt gerade in Mode war, erschrak sie. Die jungen Frauen waren heutzutage ganz anders gekleidet. Auch die Haare waren meistens kurz und in Wellen gelegt. Farblich – oft beige, orange, weiß, hellblau – waren Kleid, Hut und Handtasche aufeinander abgestimmt, lange Ketten reichten bis über die Brust, Pelzcapes wurden auch im Sommer präsentiert, die Schuhe hatten eine ganz andere Form, die Strümpfe waren fein gewirkt und fast durchsichtig, die Kleider und Röcke kürzer. Kurzum: Wenn sie ihre Kleidung mit der der modernen Frauen verglich, sah sie zwar sauber und ordentlich, aber total altmodisch aus. Und darum fasste sie einen Entschluss: Ich werde wöchentlich Geld sparen, mir Stoff und einen Schnittmusterbogen kaufen und mir für nächstes Jahr zu Ostern, wenn Fritz in die Schule kommt, ein neues, modernes Kleid nähen. Damit überrasche ich Otto. Schon alleine dieser Gedanke erfüllte sie mit Freude und darum fiel es ihr auch gar nicht schwer, bei der Konditorei mit dem Königsberger Marzipan vorbeizugehen und nur die Auslagen genüsslich anzuschauen. Und was sich Anna einmal vorgenommen hatte, setzte sie auch meistens in die Tat um.
Diese Gedanken bewegten sie nur ein paar Sekunden und doch hatte die Unaufmerksamkeit gereicht, dass Fritz den Kinderwagen losgelassen hatte und einem kleinen, niedlichen Hund hinterherlief, der gerade über die Straße rannte. Mutters Herz blieb vor Schreck fast stehen. „Fritz! Bleib stehen!“ Er hatte wohl selbst die Gefahr erkannt und blieb sofort stehen. Mutter lief eilig hin und ratsch – hatte er eine Ohrfeige. Fritz heulte. Mutter war selbst über sich erschrocken. Das passierte selten genug, dass es eine Ohrfeige setzte, aber da hatte wahrscheinlich die Angst den Hebel angesetzt. Ja, mit den drei kleinen Kindern war ein Einkauf wahrlich keine besondere Freude. Wie ein Dompteur musste sie auf die Kinder aufpassen und außerdem ihre Neugierde befriedigen, wenn Fritz und Lotte je rechts und links am Kinderwagen anfassen mussten, während Lena im Kinderwagen saß. Autos, Straßenbahnen, Fahrräder, Händler, Passanten – es war ein quirliges Treiben in der Stadt. Und darum war sie dann immer heilfroh, wenn sie alle Kinder wieder wohlbehalten in der Straßenbahn hatte und die Fahrt wieder nach Hause ging. So ein Ausflug war und blieb ein besonderes Ereignis. In Ponarth war alles viel ruhiger und gemütlicher und außerdem kostete ein Einkauf im Kolonialwarengeschäft kein Geld für die Straßenbahn. Aber in Ponarth gab es nicht immer das, was Anna brauchte.
Aber so ein Stadtbesuch forderte auch viel Zeit und die hatte Anna nicht. Denn morgens, wenn die Großen in die Schule gegangen waren, mussten ja noch die Kleinen versorgt und das Mittagessen vorbereitet werden. Meist blieb nur eine kurze Zeit, bis die Kinder wieder nach Hause kamen und Hunger hatten.
Wenn es ihr gelungen war, alle Aufgaben zu erledigen, zeigte sie dann den Großen ihre Einkaufsschätze voller Stolz. Besonders Lisbeth war daran interessiert, was wohl die Mutter alles nähen und stricken wollte.
Doch Mutter hatte auch Sorgen mit den Kindern: Hanna, die Zweitälteste, war eigentlich für die Schule nicht kräftig genug und hatte einen schwachen Rücken. Oft musste sie ermahnt werden, dass sie gerade gehen solle, doch war sie aus dem Blickwinkel verschwunden, rutschte sie wieder in sich zusammen. Tante Malche riet: „Reibe doch den Rücken von Hanna täglich mit Franzbranntwein ein, das durchblutet den Körper und festigt die Muskulatur.“ Besorgt schaute Mutter ihre Tochter an und stellte außerdem fest, dass sie viel zu mager war. Sie tollte aber auch viel zu viel herum und die wenige Nahrung reichte nicht zum Speckansetzen.
Das nächste Sorgenkind war Herta. Sie kam in der Schule nicht richtig mit und oft saßen Lisbeth und Hanna mit ihr am Nachmittag, damit sie ihre Schularbeiten ordentlich machte. Eigentlich hatte sie eine sehr schöne Schrift und rechnen konnte sie auch, wenn sie die Aufgaben Zuhause nacharbeitete, das Lesen ging – wie eben in der 1. Klasse – und doch war mit Herta, seitdem sie in der Schule war, eine Wandlung vorgegangen. Sie war sehr zurückhaltend, sehr still und in sich gekehrt. Manchmal träumte sie und hörte gar nicht, wenn Mutter oder die Kinder sie riefen. Am liebsten spielte sie alleine. Mutter konnte sich auch nicht erklären, warum Herta ihre Aufgaben Zuhause sehr ordentlich und auch richtig machte, während sie in der Schule viele Fehler hatte, Aufgaben angefangen und nicht beendet waren, ein allgemeines Durcheinander herrschte.
Mutter nahm sich ein Herz und ging zum Lehrer. Das war bei Krohns gar nicht üblich. Doch sehr freundlich wurde sie begrüßt: „Guten Tag, Frau Krohn. Na, was haben Sie denn für Sorgen?“ „Ach, Herr Gland, meine Herta macht mir Sorgen. Zuhause machte sie ihre Schularbeiten ganz vorbildlich und die Aufgaben in der Schule sind ein einziges Durcheinander. Ich kann mir das nicht erklären.“
„Liebe Frau Krohn. Ich habe beobachtet, dass Ihre Herta, wenn ich vor ihr stehe und sie direkt anspreche, auch bei mir in der Schule alles richtig macht. Vor ein paar Tagen bin ich auf die Idee gekommen, bei ihr eine Gehörprobe zu machen und stellte fest, dass sie sehr schlecht hört. Daraufhin habe ich sie in die ersten Reihe gesetzt und seit gestern haben sich die Leistungen bereits verbessert. Wenn sie also die Aufgaben nicht richtig gemacht hat, war es bei ihr nicht eine Frage der Konzentration oder des Nichtwissens, sondern sie hat einfach die Aufgabenstellung nicht verstanden. Vielleicht sollten Sie ihr auch eine andere Frisur machen, die Zopfschnecken über den Ohren verschlechtern vielleicht auch noch ein wenig die Hörfähigkeit.“
Mutter war einigermaßen überrascht über diese Situation, wenn sie auch schon so etwas vermutet hatte. „War Ihre Tochter denn als Kleinkind schwer krank, so dass sich das auf die Gehörorgane gelegt haben könnte? Ich würde Ihnen empfehlen, mit ihr zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt zu gehen. Vielleicht kann der Schaden noch behoben werden.“
Bedrückt ging Mutter nach Hause. Das war also die Ursache, die sie bisher nicht wahrhaben wollte. Nun konnte sie sich nachträglich viele Situationen erklären. Aber nie war sie auf die Idee gekommen, dass Herta tatsächlich schwerhörig sein könnte.
Der Facharzt konnte aber keine Besserung in Aussicht stellen. „Sie müssen sich damit abfinden, dass Ihr Kind auf diesem Ohr fast nichts hört und eine Besserung kaum möglich ist. Sprechen Sie Ihr Kind immer direkt an – nicht von hinten – und vor allem deutlich. Sie werden merken, dass sich die Kleine dann wie die anderen Kinder weiter entwickeln wird.
Das war zunächst keine gute Nachricht. Aber Herta und alle um sie herum mussten sich in diese Situation fügen. Manchmal wurde sie zwar von anderen Kindern gehänselt, aber solidarisch nahmen alle Geschwister in solchen Situationen Partei für Herta ein. Und das tat ihr gut. Auch Herta lernte mit dieser Einschränkung umzugehen.
Und so war es für Mutter eine große Freude, als Tante Hedwig aus Maraunenhof in einem Brief schrieb, dass sie gerne zwei Kinder in den Sommerferien zu sich nehmen würde. Sie schrieb „ … damit ich euch ein wenig helfen kann und sich wenigstens zwei Kinder wieder richtig satt essen können.“ Und das war im Sommer 1922 bereits fast zum Luxus geworden.
Hinter vorgehaltener Hand sprach man „im Reich“ bereits von der „galoppierenden Inflation“. Eine Straßenbahnfahrt kostete in Berlin bereits 4,- Mark, ein Brief bereits 6,- Mark, ganz zu schweigen von den Preisen für Lebensmittel. Spargeld hatte niemand mehr. Die Banken vergaben für die kleinen Leute keine Kredite mehr, da durch den Rückgang des Giroverkehrs der Spielraum der Banken zur Abschöpfung des Bargeldes eingeschränkt war. Die Preise verteuerten sich schneller als die Löhne und Gehälter mit einer Inflationsrate angehoben wurden. Die Mehrzahl der Bevölkerung lebte in völliger Armut, während einige wenige durch die Inflation reich wurden. Sie hatten ihr Kapital rechtzeitig in ausländischer Währung angelegt und lebten von ihren Zinsen herrlich und in Freude. Für diesen Personenkreis begann die Jagd auf Dollar und Rubel.
In Ostpreußen und besonders in Königsberg hatte diese wirtschaftliche Entwicklung bisher nicht so stark gegriffen. Durch die vom Magistrat geschaffenen Königsberger Betriebe (Straßenbahn, Reinigungs- und Fuhrunternehmen, Schlacht- und Viehhof, Stadtbank, Kauf des ehemaligen Festungsgürtels zur Umgestaltung als Grünanlagen usw.) und die Nutzung der inflationären Entwicklung des Geldes zur Bezahlung der Immobilien war es dem Magistrat gelungen, die Arbeitslosigkeit nicht so krass werden zu lassen wie im Reich.
Doch das Geld von Vater reichte zum Einkaufen höchstens für fünf Tage, dann war die Eigenversorgung gefragt, die für diesen Zeitraum nicht ausreichend war. Und so war bei Familie Krohn oftmals „Schmalhans“ der Küchenmeister.
Darum war es gar keine Frage: Hanna und Herta durften fahren. Eilig wurden die Vorbereitungen getroffen: noch schnell ein Kleidchen und eine Schürze für jeden genäht, die Unterwäsche ergänzt, Söckchen gestrickt, die Füße von den Kniestrümpfen angestrickt. Mutters Stricknadeln flogen in jeder freien Minute.
Hanna und Herta waren glückselig. Sie durften Urlaub auf dem Land bei Tante Hedwig machen! Das war kaum zu begreifen. Die beiden tuschelten jetzt oft miteinander, malten sich Bilder aus, was sie alles anstellen würden. Wieviel sie wohl zu essen bekommen? Gerne würden sie auch auf dem Bauernhof helfen. Hanna meldete sich schon jetzt zum Hühnerfüttern an, Herta würde die Häschen betreuen, beide wollten auf der Wiese das Heu wenden, mit dem Hund spielen, die Gänse jagen, auf die Schafe aufpassen. Vielleicht sogar einmal auf dem Pferd sitzen? Ach, es träumte sich so schön!
Endlich, endlich war der Tag gekommen. Die Mädchen meinten, ihnen müsse jeder ihr persönliches Glück ansehen und jeder sich mit ihnen freuen.
Die anderen Geschwister mussten mit dem Vater Zuhause bleiben, denn die Straßenbahnfahrt wäre für alle viel zu teuer gewesen. Und so hatte Mutter für alle das Sonntagsessen vorgekocht, die Wäsche für die Kinder – wie üblich – gehäufelt auf das Sofa gelegt und allen noch die notwendigen Ermahnungen gegeben, wie sie sich zu verhalten hatten. Sie war aufgeregter als Herta und Hanna, denn sie hatte ihren Mann mit den Kindern bisher noch nie alleine gelassen. Darum wurde Tante Malchen nebenan noch schnell informiert, damit Vater Hilfe hatte, falls er mit dieser Situation nicht alleine fertig wurde.
Und so war dieser Sonntag ein ganz besonderer Tag: Nach dem Frühstück und der Morgenandacht zogen sich Vater, Lisbeth, Fritz und Lotte an, Lena wurde von Mutter betreut. Jeder bekam noch ein Abschiedsküsschen von Mutter und nochmals gute Ratschläge mit auf den Kirchenweg. Vater umarmte seine Frau liebevoll und meinte: „Sei schön vorsichtig beim Ein- und Aussteigen, damit du nicht hinfällst. Lass auch lieber die Taschen von den beiden Mädchen tragen, ich möchte nicht, dass unserem Nachwuchs etwas passiert.“ Dabei streichelte er ihr liebevoll über den Bauch, in dem neues Leben bereits erwacht war.
Nachdem Vater mit den Kindern das Haus verlassen hatte und in Richtung Kirche gegangen war, setzte sich Mutter erst einmal hin und atmete tief durch. Hanna sagte gleich zur Mutter: „Bleib sitzen, wir räumen auf und waschen das Geschirr ab.“ Und flink wie die Wiesel sausten sie durch die Wohnung und machten Ordnung.
Ach, die Ruhe tat Anna gut. Sie erwartete mit ihren 42 Jahren nun schon ihr siebentes Kind. Die viele Arbeit im Haushalt und die Sorgen um das tägliche Brot hatten ihre Kräfte fast völlig aufgezehrt. Doch während die beiden die Arbeit machten, faltete sie die Hände, dankte Gott für diesen schönen Tag, bat um Hilfe für den Vater, der das erste Mal mit den Kindern einen Tag alleine war und um Kraft für das neue Leben in sich. Öfter als früher musste sie sich jetzt ausruhen und auch die Handarbeiten strengten sie an. Der Rücken schmerzte. Die Augen wurden schneller müde. Doch Gott hatte ihre Bitten erhört und ihnen bisher immer das tägliche Brot gegeben. Und nun wurden auch noch Herta und Hanna bei ihrer Schwester vier Wochen lang versorgt. „Herr, hab Dank für deine Güte und Freundlichkeit!“
Anna freute sich schon auf den Besuch bei ihrer Cousine, sahen sie sich doch nur bei großen Feierlichkeiten.
Um so herzlicher war der Empfang. Hedwig nahm die Kinder mit offenen Armen auf und umarmte Anna herzlich. „Kommt herein, ich habe schon auf euch gewartet und den Kaffeetisch gedeckt.“ „Kinder, esst, so viel wie ihr essen könnt! Morgen kann ich einen neuen Kuchen backen.“ Das ließen sich Hanna und Herta nicht zwei mal sagen und in kürzester Zeit war der Napfkuchen fast aufgegessen. Hedwig und Anna sahen sich an und verständigten sich über den Appetit mit Augenzwinkern. Noch mit vollem Mund stürmte Hanna auf den Hof, um die Inspektion zu beginnen.
„Lege dich hier ein bisschen auf das Sofa und ruhe dich aus, du wirst müde sein“, war die einfühlsame Aufforderung an Anna. Nur zu gerne genoss Anna diese Situation für eine kleine Weile und genüsslich legte sie sich hin. Sie fühlte sich eigenartig wohlig und behütet. Wann hatte sie sich schon einmal am Sonntagnachmittag hinlegen können? Hedwig holte noch eine Wolldecke, deckte damit ihre Cousine zu und setzte sich daneben. Sie hatten sich viel zu erzählen.
Doch so viel Zeit war gar nicht und die Zeit verging wie im Flug, denn vor dem Abendbrot wollte Anna wieder Zuhause sein. Hedwig packte schnell ein paar Würste, eine Seite Speck, ein Glas Schmalz und ein paar Eier für Anna ein.
„Hanna, Herta, kommt her, eure Mutter will sich verabschieden!“ erscholl es über den Hof. Beide kamen sofort angerannt. Die Augen strahlen. Am liebsten hätten sie gleich alles herausgesprudelt, was sie bereits in dieser kurzen Zeit erlebt hatten, aber Tante Hedwig bremste sie: „Das könnt ihr mir alles heute zum Abendbrot erzählen. Verabschiedet euch von eurer Mutter, sie hat Sehnsucht nach den anderen Kindern und nach euerem Vater!“ Lächelnd übergab sie Anna die Esswaren. „Hanna, sei nicht so wild! Helft Tante Hedwig bei der Hausarbeit, im Garten und wo sonst eure Hilfe gebraucht wird. Wer essen will, muss auch arbeiten! Denkt daran!“ Schnell bekam die Mutter ein Küsschen und schon waren beide wie der Wind wieder weg. „Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, ich werde mit den beiden Mädchen schon einig werden“, waren die gut gemeinten Worte an Anna.
*
Die Zeit verging im Sauseschritt.:
Am 19. 8. 1922 wurde Erna geboren.
Innerhalb eines Jahres veränderte sich das wirtschaftliche Leben in Deutschland total: 1922/23 sprach man nun offen von einer schweren Wirtschaftskrise. Die Abwertung der Reichsmark trudelte ins Bodenlose. Die Steuereinnahmen des Staates deckten nur noch 1 % der Ausgaben des Staatshaushaltes, 99 % mussten durch den Druck von Papiergeld finanziert werden. Die Kapazität der Notenpressen und des Papiers reichte nicht mehr aus.
Früher holte ein Bote die Lohngelder von der Bank, jetzt musste es waschkörbeweise mit Lastkraftwagen geholt und an die Leute verteilt werden. Die Teuerungsrate z. B. für Lebensmittel entwickelte sich so rasant, dass Anfang Januar 1923 ein Kilogramm Roggenbrot 163,- M und am 19. November schon 233 Milliarden Mark kostete. Ein Zentner Brikett hatte Anfang Januar noch einen Preis von 1865,- M, am 19. 11. kostete er aber schon 1 Billion und 372 Milliarden Mark. In ähnlicher Weise entwickelten sich die Preise für alle Waren.
Die Betriebe gingen dazu über, die Lohnzahlungen täglich vorzunehmen, da eine Verrechnung am Wochenende für den Arbeiter keinen Wert mehr hatte. Dadurch konnten in den Betrieben mehr Angestellte arbeiten, aber es ermöglichte auch die Hamsterkäufe in verstärktem Maße, da ja das Geld sofort in den Geschäften wieder umgesetzt wurde. Wer das im großen Stil betreiben konnte, wurde dabei reich. Viele Geschäfte mussten jedoch schließen, da sie die Waren zum verkauften Preis nicht wieder einkaufen konnten. Es kam in einer Reihe von Städten zum Sturm auf die Lebensmittelgeschäfte und deren Plünderungen.
Es fehlte in den Geschäften an Nachschub, denn die Bauern weigerten sich, die Ernte zu verkaufen, da sie nach 14 Tagen für das Geld nichts mehr bekamen. Die, die noch etwas verkauften, verlangten dafür Dollar oder Rubel, da diese Währungen stabil geblieben waren und Sicherheit versprachen. Und so ging man auch dazu über, für Dienstleistungen Naturalien zu verlangen. So musste man für eine einfache Beerdigung 10 Eier und für eine Grabrede nochmals 40 Eier beim Prediger abliefern. Auch Ärzte, Schuhmacher, Frisöre usw. gingen dazu über, nicht mehr für Geld zu arbeiten.
Die Nachfrage nach Naturalien und fremder Währung wurde immer größer, da mit dem eigenen Geld keine Versorgung mehr möglich war. Wer Geld hatte, tauschte es, obwohl im November 1923 ein US-Dollar einen Wert von 4,2 Billionen Reichsmark hatte.
Anfang August 1923 wurde in Königsberg das Notgeld herausgegeben.
Vorder- und Rückseite eines Notgeldscheines der Provinz Ostpreußen 1922/23
Es wurden z. B. von den Städten – so auch von Königsberg – Gutscheine für oder in Form von Waren herausgegeben für Roggen, Kartoffeln, Stromverbrauch, Holz, Kohle, Gas- und Wasserverbrauch. In Thüringen wurde das Notgeld in Form von Lederstücken, in Bielefeld aus Leinen und Seidenspitzen herausgegeben, da der Papierverbrauch für die Gelddruckereien nicht mehr ausreichend war.
Die Masse der Bevölkerung war am Ende. Sparer hatten ihr Geld verloren, die Rentenansprüche waren nichts mehr wert, der Hausbesitz warf wegen der staatlichen Mietbindung keinen realen Ertrag mehr ab. Persönliche Gegenstände (Schmuck, Hausrat, Möbel) wurden an „Raffkes“ verkauft, um sich vielleicht ein Brot dafür einhandeln zu können. Alles, was entbehrlich war, wanderte in das Pfandleihhaus. Es gab viele Obdachlose und viele, die sich das Leben nahmen.
Für die Reichen entstanden Luxusgeschäfte und Luxusgaststätten und allgemein die „Goldenen Zwanziger Jahre“.
Bei Familie Krohn waren die Probleme genau wie bei den anderen Menschen in der Stadt, die die Nachteile der Inflation tragen mussten. Die Mutter konnte die Kinder nicht mehr zum Einkaufen schicken, da sie mit den großen Summen auf den Geldscheinen nicht mehr klar kamen. Oftmals wusste Mutter nicht, wie sie die sieben Kinder satt bekommen sollte. Sie schickte dann die Großen auf die Wiesen der näheren Umgebung, damit sie Sauerampfer, Brennnesseln, Melde und Löwenzahn zum Essen und Huflattich und Wegerich als Heilkräuter sammelten.
Aber zu Weihnachten - da sollte das mit aller Liebe gefütterte Schwein endlich geschlachtet werden. Kinder und Eltern malten sich aus, dass dann alle für lange Zeit viel zu essen hätten. Doch ein paar Tage zuvor, als Mutter füttern wollte, war es nicht mehr da! Der Stall war zwar verschlossen, aber das Schwein war weg. Keiner konnte das Unfassliche begreifen. Mutter stand zunächst wie versteinert vor dem Stall und rief dann nach den Kindern, ob die vielleicht etwas wüssten. Auch die Hausbewohner hatten nichts gehört und gesehen, dass ein Unbekannter im Hof gewesen wäre. In dieser schweren Zeit war die grösste Versorgungsreserve einfach gestohlen worden!
Was half da aber alles Jammern. Vater musste nun aber mit allen Mitteln die Sicherheit erhöhen und ein neues Tor zwischen Vorder- und Hinterhaus bauen, damit die Verluste nicht noch größer wurden, denn die Kaninchen, Hühner und das Gemüse wollten sie nicht auch noch einem ungebetenen Gast überlassen.
Die Kinder beobachteten ihre Mutter aufmerksam und konnten es gar nicht glauben, dass sie, obwohl nun die Versorgungslücke so groß war, noch singen konnte. Aber Mutter summte still ein Lied nach dem anderen vor sich hin und machte dabei ihre Arbeit. Eigentlich sang Mutter immer leise vor sich hin, wenn sie Kummer hatte, nie war es aber Hanna so aufgefallen, wie heute. „Mutter, wie kannst du noch singen, wenn du doch nun so große Sorgen hast?“ „Ach, Kind, gerade weil ich Sorgen habe, tröste ich mich mit meinen Liedern. Dadurch finde ich Trost und Gott gibt mir wieder Kraft, alle Sorgen und Nöte zu ertragen. Das ist für mich wie ein Gebet, nur kann ich dabei meine tägliche Arbeit tun.“
Jetzt kannte Hanna das Geheimnis um ihre Mutter: Sie sang sich einfach ihre Sorgen fort. Darum war sie immer so ausgeglichen und freundlich. Daher konnte sie in jeder Situation den kleinen und großen Menschen Trost geben. Eigentlich war das ein einfaches Rezept. Das wollte sie in Zukunft auch bewusster anwenden, wenn sie einmal Probleme hatte. Und lächelnd summte sie das Lied, das ihre Mutter angestimmt hatte, mit.
*
Die beiden letzten Jahre waren die bisher schwersten in der Familie Krohn. Zwar hatten sie das Haus noch behalten und Vater hatte immer noch Arbeit, aber der Hunger und die allgemeine Armut waren groß. Rein statistisch gesehen sank das Realeinkommen eines Reichsbahn-Betriebsarbeiters, also bei Vater Krohn, von 1913 bis 1923 auf 50 % bei 48 Wochenstunden Arbeitszeit. Familie Krohn musste also bei einer ständig größer werdenden Familie mit der Hälfte des Geldes auskommen. Die Kinder bestaunten zwar die immer größer werdenden Summen auf den Geldscheinen, konnten aber nicht so recht glauben, dass man dafür im Laden nur so wenig Waren erhielt.
Und Otto und Anna suchten im täglichen Gebet gemeinsam mit den Kindern Trost und Hilfe. Ihre Zwiesprache mit Gott war jedoch immer auch von Dankbarkeit getragen, dass ER sie in diesen schweren Zeiten bisher so treu versorgt hatte.
Neben dem täglichen, sich ständig wiederholenden Ablauf beobachtete Vater Krohn besonders die wirtschaftlichen Vorgänge in der Stadt und im „Reich“. Alle Informationen, die sein persönliches Leben und das seiner Familie betreffen könnten, registrierte er unter der einfachen Berechnung: „Wenn das …. jetzt so ist, dann kann das …. Folgen für uns haben.“
Und so registrierte er zufriedenstellend, dass durch die Inflation wieder einige Betriebe ihre Arbeit aufnahmen, da es sich für einige Kapitaleigner lohnte, Kredite aufzunehmen, weil der Zinssatz real ständig sank. Die Bestätigung hatte er durch den Hauskredit. Der Betrag für die Zinsen blieb fast immer wie früher, obwohl nun schon mit Billiarden gerechnet wurde.
Im vergangenen Jahr, also 1922, hatte die Produktion schon wieder 80 % des Vorkriegsstandes erreicht. Wer also Arbeit hatte, konnte sich unter den gegebenen Bedingungen auch zur Not versorgen. Zwar war gerade die Arbeitslosenzahl im November wieder auf 23,4 % im Reich gestiegen, weil auch wieder sehr viele Kleinbetriebe Bankrott anmelden mussten, aber an diese allgemeine Situation hatte man sich schon fast gewöhnt.
Auch die Länder und Gemeinden – genau wie Vater Krohn – nutzten die Inflation, um die Schulden zu tilgen, so auch Hypothekenschulden. Doch dieser „Bezahlung von Grundschulden“ setzte das Reichsgericht dann einen Riegel vor. Es erzwang die Aufwertung „alter“ Grundschulden für Gebäude, die vor dem 1. 7. 1918 bezugsfertig gewesen waren. Für diese Objekte musste eine „Hauszinssteuer“ in Höhe von 25 % extra entrichtet werden. Nun war guter Rat teuer. Das traf auch für „56“ zu.
Vater blieb nichts anderes übrig, als zu seinen Mietern zu gehen und ihnen die Sonderzahlung anzukündigen. Lange Gespräche waren mit den 11 Mietparteien des Vorderhauses notwendig, da keiner zahlungsfähig war. Auch empfanden die Mieter es als ungerecht, dass diese zusätzliche Zahlung für die 3 Mietparteien des Hinterhauses nicht erforderlich waren. Mit Einzelgesprächen kam Vater nicht voran. Er lud kurzerhand alle in seine Wohnung ein. Jeder musste seinen Stuhl mitbringen. Und heiß entbrannten die Diskussionen.
Doch ausziehen wollte keiner der Mieter. Alle fühlten sie sich wohl in einer sauberen Umgebung, in dem Haus, wo keine Zwietracht geduldet wurde, jeder ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der anderen hatte, gegenseitige Hilfe und Achtung groß geschrieben wurden. Und so kam Vater Krohn letztlich doch noch zu einer Einigung mit allen Mietern. Es sollte in Kürze eine grundlegende Wende in der Währung kommen:
Am 15. November 1923 konnte man an allen Litfasssäulen das Wort „Währungsreform“ dick gedruckt lesen. Große Menschenmengen drängten sich vor den Plakaten, Jeder wollte wissen, was das nun schon wieder bedeutete. Vater Krohn kaufte kurz entschlossen eine Zeitung, denn das wollte er in Ruhe Zuhause studieren und Mutter auch gleich über diese Neuigkeit informieren. Da stand in großen Lettern:
„Währungsreform!
Am 15. 10. 1923 wurde die „Deutsche Rentenbank“ gegründet, die vom Staat unabhängig arbeitet. Ihr Grundkapital ist eine hypothekarische Belastung allen gewerblich-genutzten Grundbesitzes zu ihren Gunsten. Die Berechnungsgrundlage war der 1913/14 erhobene "Wehrbeitrag“, - einer Vermögensabgabe der einzelnen damaligen Betriebe in Höhe von 3,2 Milliarden Mark. Auf der Grundlage dieser fiktiven Deckung gibt die Deutsche Rentenbank eigene Wertscheine heraus. Die „Rentenbankscheine“ lauten auf „Rentenmark“. Eine Rentenmark entspricht einer Goldmark. Diese Scheine sind noch kein öffentliches Zahlungsmittel, sie müssen aber von öffentlichen Kassen angenommen werden.
Das Reich – also die noch bestehende Reichsbank - erhielt heute von der „Deutschen Rentenbank“ 1,2 Milliarden Rentenmark als zinslosen Kredit und 1,2 Milliarden Rentenmark zur Weiterleitung an die Geschäftsbanken. O, 8 Milliarden Rentenmark behält die Deutsche Rentenbank als Reserve. Heute werden die Notenpressen stillgelegt.
Damit wird die Papiermark stabilisiert, weil die Deutsche Rentenbank streng auf die Begrenzung der 3,2 Milliarden Rentenmark als Höchstgrenze achtet. Die Berechnungsgrundlage für 1 Rentenmark = 1 Billion Mark.“
(Quelle: Blaich, Deutsche Geschichte der neuesten Zeit)
Vater legte die Zeitung weg und atmete tief durch. „Na, Gott sei Dank, dass ich nicht mehr mit einer Tasche voll Geld einkaufen muss und dafür kaum etwas Essbares bekomme“, sagte Mutter zufrieden. „Das war aber auch höchste Zeit, dass sich der Staat etwas einfallen ließ. So konnte es ja nicht weitergehen! Hoffentlich hält die Deutsche Rentenbank, was sie versprochen hat, nämlich nicht mehr Geld zu drucken als auch Gegenwerte dafür vorhanden sind.“
Nach einer kleinen Pause sagte Mutter etwas schüchtern: „Nun brauchen wir nur noch die neuen Geldscheine. Wer weiss, wann die in Umlauf kommen. Aber jetzt haben wir wenigstens schon einen Preisvergleich, wenn wir auf die Rentenmark umrechnen können. Wenn dann nicht jeder sein Geld sofort wieder in die Geschäfte trägt, weil er keine Angst mehr zu haben braucht, dass es in ein paar Stunden nichts mehr wert ist, bekommen wir vielleicht wieder mehr Waren zu kaufen, ich muss nicht mehr so lange im Geschäft anstehen und alles wird besser.“ (Anmerkung: Die Rentenmark wurde erst am 30. 8. des folgenden Jahres als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt und hatte immer noch den Verrechnungswert von 1 Billion Mark. Die „alte“ Mark wurde bis Juli 1925 aus dem Verkehr gezogen.) „Na, siehst du, Anna, „Gott hilft nicht zu jeder Frist, hilft er doch, wenn's nötig ist.“
Obwohl sich das Leben nicht grundsätzlich geändert hatte, bewirkte die Währungsreform doch bei den Menschen für die Zukunft so etwas wie Sicherheit und Perspektive. Sie vertrauten – auch wenn etwas verhalten – auf diese neue Währung, da sie auf Grund und Boden beruhte.
Und so wurde bei Familie Krohn wieder Weihnachten vorbereitet, das von der Vorfreude und dem sich gegenseitig Freude bereiten geprägt war.
Und Ostern wurde eine neue Etappe eingeleitet: Lisbeth wurde am Palmsonntag konfirmiert und begann die Lehre als Schneiderin. Die Eltern hatten auch nur zu gerne einen Lehrmeister für diese Ausbildung gesucht, denn dadurch konnte Mutter besser entlastet werden. Lisbeth hatte schon immer gerne bei den Näharbeiten geholfen, doch nun wollte sie es richtig lernen.
Die Erstgeborene war schon immer die „Große“, obwohl sie klein von Wuchs war. Aber Konfirmation bedeutete auch gleichzeitig, in die Reihen der Erwachsenen aufgenommen zu werden. Und das bewirkte allerhand Änderungen: Das Konfirmationskleid war kein Kinderkleid, sondern wie für eine junge Dame von Mutter geschneidert worden. Die Zöpfe wurden zu einer „Gretchen-Frisur“ um den Kopf gelegt, damit später ein fraulicher Haarknoten daraus werden konnte. Feierlich hatte Vater ihr zum Tag der Einsegnung ein silbernes Kreuz mit Kette um den Hals gelegt und ihr den väterlichen Segen gegeben. Nun war sie kein Kind mehr. Obwohl sie selbstverständlich noch Zuhause wohnte und Vater auch für die Ausbildung das Lehrgeld bezahlt hatte, war dieser Tag eine Wende. Nun sollte sie ‚erwachsen‘ sein. Das bedeutete auch, dass sie in den Kirchenchor aufgenommen wurde, ein eigenes Gesangbuch und eine Bibel bekam und ein richtiges Gemeindemitglied wurde. Wenn sie sich dann später eine Gitarre oder Mandoline kaufen konnte, wurde sie auch in diesen Verein aufgenommen.
Die feierliche Einsegnung in der Kirche war für alle ein erhebendes Gefühl. Die Konfirmanden saßen in der ersten Reihe. Sie hielten das Gesangbuch und ein Taschentuch in der Hand. Bei den Mädchen war es mit einer feinen Spitze umhäkelt und eine Zierde, sollte aber auch das Buch vor den vor lauter Aufregung schweißnassen Händen schützen. Onkel Fritz hielt eine wunderschöne Predigt unter der Losung „Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit um meiner Feinde willen; richte deinen Weg vor mir her“. (Psalm 5, Vers 9). Alle Konfirmanden fühlten sich von diesem Text angesprochen und jeder gelobte auch im Stillen, der Kirche und dem Glauben treu zu bleiben. Das Glaubensbekenntnis „Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erden und an Jesus Christus, … “ kam Lisbeth aus ehrlichem Herzen und innerer Überzeugung über die Lippen.
Mutter nahm ihre Große nach der Einsegnung in die Arme. Tränen der Rührung schluckte sie herunter. „Meine Große“, sagte sie, „du bist schon immer meine Große gewesen. Manchmal warst du schon so vernünftig wie eine Erwachsene: hast deine Geschwister oft betreut und Verantwortung getragen, mir im Haushalt ohne Murren geholfen und trotzdem in der Schule gut gelernt. Viel Zeit zum Spielen ist dir nicht geblieben. Und doch warst du immer fröhlich und guter Dinge. Gehe deinen Weg weiter, wie du ihn begonnen hast. Der Herr wird dir auch in trüben Tagen Helfer und Beschützer sein.“
Am Nachmittag kamen einige Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen zum Kaffeetrinken. Es war eine fröhliche Runde. Die Kleinen durften danach auf dem Hof herumtollen und die üblichen Spiele machen. An solchen Tagen machte das Spielen noch mehr Spaß, da die Cousins und Cousinen alle mitmachten.
Die Großen, zu denen ja nun auch Lisbeth gehörte, unterhielten sich angeregt mit der Verwandtschaft. Aber lange dauerte das nicht, denn wie selbstverständlich wurden zu solchen Gelegenheiten gerne Lieder gesungen. Alle Chorstimmen waren in der Familie Krohn vertreten und so hörten auch die Passanten die Kirchen- und Volkslieder auf der Straße mit. Viele blieben stehen und lauschten dem manchmal andächtigen und manchmal freudigen Gesang, je nachdem, welches Lied gerade gesungen wurde. Und es gab viele Lieder. Jeder hatte so sein Lieblingslied, das er anstimmte und alle anderen sangen dann mit, bis einer zum Aufbruch mahnte. Dieses Mal war es Mutter, die das Ende des Gesanges ankündigte, denn Erna musste ja mit ihren gut eineinhalb Jahren rechtzeitig ins Bettchen gebracht werden und alle Gäste mussten rechtzeitig zum Abendbrot wieder Zuhause sein.
So harmonisch verliefen alle Familienfeiern. Darum war es auch gar nicht so wichtig, wieviel Kuchen auf dem Tisch stand oder was – wie heute – für Getränke gereicht wurden. Es war einzig und alleine die Freude des Zusammenseins und des gemeinsamen Gesangs.
Diese Harmonie der Familienfeiern war Tradition und wurde von Kindern und Kindeskindern übernommen.
Doch nicht nur in der Familie Krohn wurde gefeiert, sondern auch in der Stadt. Am folgenden Ostermontag, so war überall zu lesen, ist die „Kantfeier“. Der berühmteste Königsberger wurde zu seinem 200. Geburtstag geehrt.
Schon lange vor diesem Tag wurden in der Universität Vorlesungen besonderen Inhalts von Gastprofessoren gehalten, Schriften veröffentlicht und dem neu gegründeten Stadtgeschichtlichen Museum Dokumente aus fernen Ländern übergeben, die von Kant stammten oder über ihn berichteten, denn eine Abteilung war ihm gewidmet. Zwar war der Nachlass des kinderlosen Philosophen nach seinem Tode verkauft und verstreut worden, aber was erhalten geblieben oder später mühsam wieder zusammengetragen worden war, bildete einen besonderen Anziehungspunkt für die Besucher aus aller Welt. Der Weltweise war kein Heimatromantiker, aber bewusst ein Königsberger. Er hat seine Geburtsstadt nur selten, Ostpreußen nie verlassen hat. Er scheute nicht die Welt, sondern blieb in seiner Vaterstadt, weil er nach seiner Meinung in ihr alles vorfand, was er brauchte. Als die Stadt eine Kantmedaille stiftete und mit ihr verdiente Frauen und Männer auszeichnete, ehrte sie damit nicht nur ihren größten Mitbürger, sie bekannte sich damit auch zu seiner Heimatgeborgenheit und Weltoffenheit, die sie siebenhundert Jahre lang in besonderer Weise ausgezeichnet hat.
Und so strömte, alles, was Beine hatte, zum Dom und Kneiphof, um wenigstens den Festzug sehen zu können. Die „Königsberger Allgemeine Zeitung“ vom 22. April 1924 lässt (auszugsweise) erkennen, in welchem Umfang das geschah:
„Als eine Kantfeier besonderer Art ist unter den Veranstaltungen des ersten Haupttages noch ein Essen zu verzeichnen, zu dem die Königsberger Allgemeine Zeitung eingeladen hatte, das am Sonntag Abend in der Wohnung des Chefredakteurs Wyneken stattfand. Es war der Wunsch der Zeitung gewesen, einige Stunden im Zeichen Kants gesellig mit den Persönlichkeiten aus aller Herren Länder zu verleben, wie es Kant getan hätte. Alle, die an der Festzeitung mitgewirkt hatten, Vorlesungen und Diskussionen vorbereitet und Studien zum Thema „Kant“ veröffentlicht hatten, waren eingeladen. Und so wurde beim Essen im Kreis honoriger Herren, wie es die Überlieferung aussagte, gefachsimpelt, Theorien aufgestellt und wieder verworfen. Doch alle waren sich einig, dass die wissenschaftlichen Leistungen Kants unantastbar waren.“
Wie die Feierlichkeiten im Dom abliefen, beschreibt die Zeitung folgendermaßen: „Regenschwer und windbewegt hat der 2. Ostertag begonnen, grau und tief hängen die Wolken über den Straßen der Stadt. Der Himmel zeigt sich Kants Verehrern von der rauhesten und unfreundlichsten Seite; durchnäßte Kleider und aufgespannte Schirme scheinen das Kennzeichen des Tages werden zu wollen.
Trotzdem ist Leben und Zudrang zum Kneiphof. Ein Teil der Brodbänkenstraße und das große Rund des Domplatzes sind von einer dichten harrenden Menschenmenge eingerahmt, die von einem Spalier von Sicherheitsbeamten zurückgehalten werden – trotz des Regens und der nordischen missmutigen Witterung ein Bild von verhaltener Teilnahme und Erwartung, wie man es seit vielen Jahren in unserer Stadt entbehrt hat. Man ist sich bewusst, ein großes und einmaliges Ereignis zu erleben. Die Menschen wollen wenigstens aus der Ferne dabei gewesen sein, sie wollen davon erzählen, wollen sich daran erinnern können.
Aber erst, wenn man den Dom betritt, wird man in eine andere Welt von der Stimmung der weihevollen Gehobenheit empfangen und getragen. Die graue, regenschwere Nüchternheit des Tages ist zurückgeblieben – hier unter den hohen gotischen Spitzbögen leuchten die zahllosen Kerzen der großen Kronleuchter, goldene Schnitzereien, lateinische Inschriften funkeln auf, im Hintergrund streben die goldenen Zierrate des Altars empor. In diesem gedämpften Licht, mitten unter alter Architektur, ist alles Sammlung und Andacht und Erinnerung. Das große Schiff der Kirche und die Orgelempore sind von einer dichten Menschenmenge gefüllt.
Die Hoffnung der draußen auf den Zugangsstraßen geduldig wartenden Zuschauer wurde leider enttäuscht. Denn der Festzug durch die Straßen musste ausfallen und sich auf den kurzen Weg vom Stadtgymnasium bis zum Dom beschränken. So staute sich denn die neugierige Menge um so dichter auf dem Domplatz, der durch Schupobeamte (Polizei) zu Pferde und zu Fuß recht streng abgesperrt war. Galt es doch, den recht umfangreichen Auto- und Wagenverkehr zu regeln, der sich bei Anfahrt der Gäste in dem sich sonst verhältnismäßig ruhigen Domviertel entwickelte.
Als dann unter den wuchtigen Akkorden der Orgel der Festzug im Portal des Domes erschien, und sich in würdigem Schritt durch den Mittelgang zum Altar bewegte – welch farbenprächtiges Bild! Im Dämmerdunkel des Kirchenraumes gestaltete es sich um so wirkungsvoller. Jeder empfand aber zugleich in dem Äußeren des Bildes dessen symbolische Bedeutung: Ein Huldigungszug Deutschlands, Europas, ja der Welt vor Königsbergs größtem Sohn, der zu einem Genius der Menschheit geworden ist. Das Licht des Weisen, der niemals über die Grenzen Ostpreußens hinausgekommen ist, hat inzwischen längst den Siegeszug über die Ozeane angetreten, so dass in Japan, wie der erste Festredner des Tages, Stadtschulrat Stettiner, später bemerkte, von einer weitverzweigten Gesellschaft der Geburtstag Kants regelmäßig festlich begangen wird.
Der Zug wurde eröffnet durch den Oberbürgermeister Lohmeyer im Schmuck der schlichten Amtskette, die auch Zeuge und Zeichen der deutschen Not- und Kampfjahre Königsbergs ist. Mit dem Oberbürgermeister schritten Bürgermeister Goerdeler und Stadtschulrat Stettiner. Dann folgte Kultusminister Boelitz in Begleitung des Kurators Hoffmann, hinter ihnen die Studenten als ein wandelnder Wald von Fahnen und Bannern, bestickt mit den tapferen Sprüchen akademischer Jugend. Die Königsbergs Studentenschaft nahm mit Recht bei dieser Huldigung einen breiten Platz ein. Denn sie ehrte, wie sie da festlich mit Pekesche und Schläger aufmarschierte, zugleich mit dem Weltweisen den größten Professor der Albertina, der ihr unsterblichen Ruhm bereitet hat. Mahnte schon dieses Bild der studentischen Verbindungen an die Tatsachen, welche Mächte die Traditionen und ehrwürdigen Bräuche der Universität darstellen, so wurde dieser Eindruck noch verstärkt, als jetzt im imposanten Zuge die Rektoren der anderen Universitäten mit dem Barett, den feierlichen Sammetmänteln und der Rektorkette bekleidet, vorbeizogen. Man glaubte, dass hier ein Bild Dürers lebendig geworden sei, wenn man in der ehrwürdigen Umrahmung diesen und jenen Charakterkopf bemerkte, der durch langes Forschen jenen unverkennbaren Stempel der Denkarbeit bekommen hatte, wie es ein besonderer Geleitbrief der geistigen Menschen ist. Zugleich wurde man aber auch an ein Wort Kaiser Wilhelms erinnert, der einmal dem Rektor der Berliner Universität sagte, dass er verstanden hätte, wie ein König zu repräsentieren. Auch diese Rektoren, jeder ein kleiner König im Reich der Wissenschaft, hatten diese selbstverständliche Würde.
Es folgten in kaum übersehbarer Fülle die Professoren der verschiedenen Fakultäten, auch sie in ihrer überlieferten, vielgestaltigen Tracht. Dann leuchteten zwei scharlachrote Mäntel auf: die Universitätspedelle mit den zepterartigen Stäben. Sie schreiten vor der Magnifizenz, die die Universität gewissermaßen inkarniert (verkörpert), vor dem Rektor der Albertina, Professor Uckeley. Ihm, dem das feierliche Ornat des Rektors besonders gut ansteht, folgt wiederum eine Fülle von Professoren und Gästen. Am Altar teilt sich der Zug.“
Der Gottesdienst beginnt. Auch Vater Krohn war – mit einem Schirm bewaffnet – in den Reihen der Wartenden. An der Hand hielt er Hanna und Fritz. Beide Kinder waren hell begeistert über das, was sie gesehen hatten. Aber in den Dom kamen sie nicht mehr hinein.
Und so machte Vater aus der Not eine Tugend und zeigte den Kindern das Grabmahl Kants, das anlässlich dieses Tages erneuert und im Farbton dem Dom angepasst worden war. Es war an diesem Tag besonders reich mit Blumen und Kränzen geschmückt, die direkt am Sarkophag lagen und auch vor dem Eisengitter. Hanna konnte nur mit Mühe die Inschrift lesen, da sie teilweise von Blumen verdeckt war: „Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir“
„Versteht ihr das?“ Hanna antwortete nach kurzem Nachdenken: „Na, ja, je öfter ich am Abend den Sternenhimmel anschaue, desto schöner erscheint er mir, aber auch immer wieder neu. Man kann sich eigentlich gar nicht satt daran sehen, so schön ist er. Und je älter ich werde, um so lieber schaue ich mir abends einmal die Sterne an.“ „Und was meint Kant mit dem moralischen Gesetz in uns?“ Darauf wussten beide keine Antwort und Vater erklärte: „Als ihr noch viel kleiner gewesen seid, habt ihr euch um vieles keine Gedanken gemacht. Wenn ihr etwas Verbotenes getan habt, wurdet ihr bestraft oder wir haben euch euer Fehlverhalten erklärt. Nun ist Lisbeth zum Beispiel erwachsen und muss selbst bestimmen, was falsch und richtig ist. Diese Entscheidungen über falsches und richtiges Handeln werden immer schwieriger, weil man sich – wenn man älter ist – über alles mehr Gedanken macht über Wenn und Aber, weil man alles komplex betrachtet. Als Jugendlicher urteilt man oft spontan, im Alter wägt man seine Entscheidungen und Worte länger ab.“ Das hatten sie begriffen.
Obwohl es immer noch regnete, zeigte Vater seinen beiden Kindern auch noch das Denkmal für Julius Rupp, das von Käthe Kollwitz geschaffen worden war, denn es war ihr Großvater. Hanna erinnerte sich, dass sie über ihn schon einmal etwas gehört hatte. Aber sie wusste es nicht mehr so genau und Vater erzählte: „Julius Rupp war Verfechter der philosophischen Ideen Kants, die er als Königsberger Divisionsprediger in die kirchliche Lehre einbringen wollte. Es kam zum Streit zwischen den kirchlichen Würdenträgern und Rupp. Er wurde aus der Kirche ausgeschlossen und durfte keine kirchlichen Handlungen mehr vornehmen. Darum gründete er eine Freie evangelisch-katholische Gemeinde. Rupp blieb aber in Königsberg, auch wenn er nach der Revolution seine Dozentur an der Universität verlor. Er betätigte sich weiter kirchlich und literarisch. Somit ist auch er als Königsberger ein Sinnbild des freien Denkens.“
Die Inschrift auf dem Denkmal war noch recht gut zu erkennen: „Wer nach der Wahrheit, die er bekennt, nicht lebt, ist der gefährlichste Feind der Wahrheit selbst“. Das begriffen die Kinder sofort. Lügen durften sie nicht.
Langsam entfernten sie sich vom Domgelände und Vater erzählte noch ergänzend, dass der Dom auf mehreren hundert Eichenpfählen ruht, die in den moorigen Untergrund gerammt wurden, damit das Fundament fest war. „Als die Mauern des Chores bereits hochgezogen waren, ahnte der Hochmeister Luther von Braunschweig, welch gewaltiges Bauwerk entstehen würde, eine richtige Kirchenburg. Das wollte aber der Orden nicht dulden und es wurden viele Veränderungen nachträglich festgelegt, da der Dom auf keinen Fall die Ordensburg in den Schatten stellen sollte. Erst nach 50 Jahren, nämlich 1380, war der Dom fertiggestellt und wurde trotzdem zum eigentlichen Wahrzeichen unserer Stadt.“
Als die Kinder von weitem die Straßenbahn sahen, freuten sie sich wieder auf Zuhause, denn nun war es durch den Regen und Wind doch empfindlich kalt geworden. Mutter machte schnell einen warmen Tee und die Kinder erzählten begeistert von den Erlebnissen. Fritz äffte die Professoren mit steifem Rücken und ernsten Gesichtern nach, erzählte aber auch, was sie für schöne Kleidung angehabt hatten.
*
Ein paar Wochen später, am 14. Juni 1924, wurde der Flughafen Devau feierlich eingeweiht. Und wieder strömten die Königsberger hin. In der Königsberger Hartungschen Zeitung hieß es an diesem Tage: „Eine ganze Anzahl Straßenbahnwagen beförderte gegen 4 Uhr die Schar der Festteilnehmer nach dem festlich geschmückten Flugplatz Devau hinaus zur Einweihungsfeierlichkeit … Zwei Fokker und ein Junkersflugzeug sowie A. G. G. Doppeldecker des Aero Lloyd waren vor den Hallen zur Begrüßung aufgestellt und ließen mitunter den kraftvollen Gesang ihrer Motoren ertönen. In den Hallen sah man weitere Flugzeuge … “
Der Luftverkehr für die abgetrennte Provinz Ostpreußen hatte eine immense Bedeutung. Die wichtigste Linie war „Berlin – Danzig – Königsberg“, brachte sie doch die schnelle Verbindung zum Reich. Aber ebenso wichtig auch für den Handel waren die beiden anderen Verbindungen in den Norden und Osten: von „Königsberg nach Moskau“ und von „Berlin – Königsberg – Insterburg – mit Anschluss an die Linie Stockholm – Petersburg“. Hiermit hatten Reisende die Möglichkeit, innerhalb eines Tages von Berlin nach Moskau zu gelangen. Natürlich war das nur für Geschäftsleute und Politiker erschwinglich, denn ein Hin- und Rückflug nach Berlin kostete nach dem 30. 8. immerhin 82,50 Reichsmark.
Es wurden aber auch für die Flüge zum Teil Nachtstunden ausgenutzt. Und so wurde die Luftlinie „Berlin – Königsberg“ als eine der ersten mit Nachtbeleuchtung ausgestattet, so dass hier für das gesamte deutsche Flugwesen sehr wertvolle Erfahrungen gesammelt werden konnten.
Ein weiterer wichtiger Fortschritt war im gleichen Jahr die Inbetriebnahme des Königsberger Rundfunkbetriebes, den der Kaufmann Walter Zabel gegründet hatte. Weithin sichtbar waren die großen, hohen Sendemasten neben der Alten Pillauer Landstraße zu sehen, die alle Königsberger ehrfurchtsvoll bestaunten. Keiner konnte sich so richtig vorstellen, wie ein Rundfunk funktionieren sollte, dass Musik aus einem Kasten kam, in dem keine Musiker saßen.
Bei den „Reichen“ erfreute sich aber diese technische Neuerung großer Beliebtheit, wurden doch Sinfonie- und Künstlerkonzerte übertragen. Mit dem Rundfunk wurde der Dirigent Hermann Scherchen ab 1930 bekannter, als wenn er „nur“ im Saal dirigiert hätte.
Die letztgenannten Ereignisse hatten zwar wieder einen optimistischen Charakter, sie täuschten aber nicht darüber hinweg, dass das Leben nicht einfach war. Zwar war im April 1925 Hindenburg zum Reichspräsident gewählt worden und alle Menschen hofften auf Besserung, aber die wirtschaftliche Entwicklung wollte nicht kommen. Im Gegenteil: in diesem Jahr musste Königsberg 139 Konkurse registrieren.
Und so lebten Otto und Anna mit ihren Kindern immer im Glauben an eine bessere Zukunft und im Vertrauen auf Gott.
*