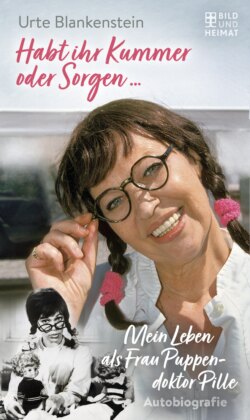Читать книгу Habt ihr Kummer oder Sorgen … - Urte Blankenstein - Страница 5
ОглавлениеArbeitertheater und meine zweite Schwester
Unsere Schweriner Wohnung erstreckte sich wieder mal über zwei Stockwerke. Im ersten Stock befand sich das Wohnzimmer, im zweiten das Schlafzimmer von Elke und mir. In einem klitzekleinen Raum daneben schlief Mutti. Oben wohnte auf demselben Flur noch eine Familie, durch deren Küche wir gingen, um in unsere Küche zu gelangen. Zwischen beiden Küchen befand sich das Bad, das beide Familien nutzten.
Glasermeister Bolze und seiner Familie gehörte nicht nur die Glaserei im Haus, sondern auch die Wohnung, in der sie das Bad mit uns teilen mussten. Wir kamen uns nie in die Quere. Vielleicht verließen wir morgens früher das Haus und gingen am Abend eher schlafen? Es war ein gutes Nebeneinander. Bolzes hatten drei Kinder, mit ihrem Sohn Helmut freundeten wir uns an. Wunderbar war, dass diese Familie in späteren Jahren einen Fernseher besaß. Wir Kinder durften dann öfter mal in ihr Wohnzimmer zum Fernsehen.
Unsere Wohnung lag in der Salzstraße, die zum Theater führte. Wie oft hingen Elke und ich am Fenster und bewunderten die festlich gekleideten Theatergänger! Manchmal hatten wir das Fenster weit geöffnet, und wenn die eleganten Besucher die Straße entlangkamen, begannen wir laut im Kauderwelsch zu reden: »Etabachterumsdadrumsda …« Wir sprachen ausländisch. Die sollten gucken, wir waren etwas ganz Besonderes!
Unser Vormieter hatte ein Klavier in der Wohnung stehen lassen. Das gefiel mir: Mutti am Klavier, wenn wir feierlich zweistimmig Weihnachtslieder sangen. Das Klavier war nun mal da, also lag es auf der Hand, dass Elke und ich Klavierunterricht bekamen. Ich ging auf die Musikschule, da war der Unterricht kostenlos. Elke hatte eine Klavierlehrerin. Meine Schwester spielte längst bekannte Musikstücke, während ich monatelang endlos »Czerny-Fingerübungen« in die Tasten hämmerte. Das reichte mir irgendwann, ich weigerte mich, weiterzumachen. Leider gab die Mutti meinem Wunsch nach. Ich wollte eben richtig Musik machen – und kann genau das bis heute nicht.
In unserem Schlafzimmer hatte ich eine Wäscheleine gespannt, an die ich Fotos von Schlagersängern klammerte. Auch Fotos von Schauspielern hingen dort. Das alles ertrug Elke ja noch. Aber als ich auf unserer »Goebbels Schnauze«, dem einzigen Radio in unserer Wohnung, Sender suchte, die Schlager spielten, gab es mächtigen Krach.
Mutti schritt ein und jede von uns bekam bestimmte Zeiten, in denen sie ihre Musik hören durfte. Elke konnte ihre Opern und Operetten genießen und ich meine Cornelia Froboess und Peter Kraus: »Wenn Teenager träumen« und dergleichen mehr. Schlimm war nur, dass jede von uns beiden die Musik der anderen mithören musste.
Wie das Leben so spielt: Elke wurde Opernregisseurin, ich moderierte die Sendung »Musikalisches Intermezzo« (Operette/Musical) – und konnte dank Elke fast jeden Titel mitsingen. Fantastisch! Meine Liebe zu Schlagern teile ich heute mit meinem Publikum beim Seniorenprogramm.
Ich kam in die 5. Klasse und wurde sehr schnell in den Kreis meiner neuen Mitschüler aufgenommen. Mein großes Problem hieß Mathematik. Unser Mathelehrer Herr Hoffmann war ein Kriegsheimkehrer, der zwar von Hause aus kein Lehrer war, wohl aber ein kluger Mensch. Es mangelte an Lehrern. Mit Herrn Hoffmann machten wir uns gern den Spaß und stellten »Hoffmannstropfen« auf seinen Tisch. Diese kamen vornehmlich bei Übelkeit und Ohnmacht zum Einsatz, und wir waren stolz auf diesen grandiosen Einfall. Herr Hoffmann spielte mit.
Nie vergessen werde ich meine Mathematikprüfung in der 8. Klasse. Herr Hoffmann gab mir einen Zettel, auf dem die Aufgabe stand. An der Tafel sollte ich deren Lösung finden. Die war so leicht, dass ich zunächst dachte, es sei eine Falle. So begann ich, mit Hilfe irgendeiner Formel auf dem umständlichsten Weg mit den Zahlen zu jonglieren. Zum Glück stimmte letzten Endes meine Lösung. Warum einfach, wenn’s auch umständlich geht?
Heute weiß ich, dass mir dieser liebe, kluge Mensch ganz bewusst die leichteste aller möglichen Aufgaben zugedacht hatte. Ich denke, er wird während meiner Rechnerei noch mehr geschwitzt haben als ich. Übrigens stehe ich mit Mathe immer noch auf totalem Kriegsfuß. Ich bin nicht fähig, Mathematik logisch zu erfassen. Inzwischen hat das Ganze sogar einen Namen: Dyskalkulie, zu Deutsch: Rechenschwäche. Offenbar haben sich zwei Synapsen nicht getroffen in meinem Hirn. Und ich bin sicher, das ist erblich. Tut mir leid, meine Lieben.
Ganz anders erging es mir in Religion, was damals noch ein normales Schulfach war. Ich liebte dieses Fach, der schönen Märchen wegen. Ziel jenes Unterrichts war die Konfirmation. Diese zu erreichen, hatten wir im Dom von Schwerin nachmittags zusätzlich Christenlehre. Es gab bunte Bilderchen und einen Stempel, wenn wir erschienen. Wer am Ende zu wenig Stempel vorwies, wurde nicht konfirmiert. Die Sammelbilder waren schön, bei den Stempeln schummelten wir oft. Wir stempelten einfach die Karte einer Freundin mit ab, die nicht anwesend war.
Schließlich kam der große Tag der Konfirmation: Ich in einem schwarzen Taftkleid, meine Locken gebändigt im Pferdeschwanz, im Dom von Schwerin. Alle Familienangehörigen waren da, die Orgel spielte, es war sehr feierlich.
Meine Konfirmation, in schwarzem Taft und mit Pferdeschwanz
Religionsunterricht und Christenlehre gehörten damit der Vergangenheit an. Deutsch, Geschichte, und Staatsbürgerkunde waren Fächer, in denen ich meiner Phantasie freien Lauf lassen konnte. Unser Klassenlehrer Herr Klosa, genau wie Herr Hoffmann ein älterer Herr, unterrichtete uns darin. Er forderte und förderte mich. Meine Aufsätze musste ich immer vor versammelter Mannschaft vorlesen, besonders in Staatsbürgerkunde erfand ich die tollsten Geschichten.
Diese erfundenen Storys habe ich leider allesamt vergessen. Ich weiß aber noch, dass ich zu aller Erheiterung Berichte vom letzten Ernteeinsatz schrieb, vom Kartoffelkäfersammeln oder vom Rübenverziehen. Darin vermeldete ich, dass Rosi sich vor den Käfern ekelte und wir das nutzten, um sie in die Flucht zu schlagen. Wer am meisten Kartoffelkäfer gesammelt hatte, war der Käferkönig und wurde gekrönt und überraschend getauft, indem er einen Topf Wasser über den Kopf gegossen bekam.
Wer beim Kartoffeleinsatz die meisten Körbe am Lkw ablieferte, durfte auf dem Lkw mitfahren. Letztlich fuhren fast alle mit. Unvergessen die Fahrten auf dem Pferdewagen, einer von uns durfte die Zügel halten. Der größte Anreiz war aber, dass wir am Abend auf dem Ackergaul reiten durften.
Ich malte alle Pannen, aber auch die erstaunlichen Begebenheiten in den buntesten Farben, und unter Lachen erkannten sich die jeweiligen Akteure wieder. Wenn ich die Figuren beschrieb, die wir, mich inbegriffen, auf dem dicken Gaul abgaben, erklang beim Vorlesen jeweils großes Gelächter.
Wunderschön waren die Abschlussabende am Lagerfeuer, mit Kartoffeln am Stock und Würstchen. Erzähle ich heute, dass wir im Ernteeinsatz waren, sagen die Leute oft entrüstet: »Ihr musstet bei der Ernte helfen? Das darf ja wohl nicht wahr sein!« Aber wir Zeitzeugen sind ja noch da, um kundzutun, wie viel Spaß wir bei dieser »Arbeit« hatten.
Mit der Unterstützung von Herrn Klosa schrieb ich auch Sketche, die dann unter meiner Regie einstudiert und von Mitschülern aufgeführt wurden. Darin ging es um den Schulalltag, um Freundschaften, ums Verliebtsein …
Meine Mutti setzte sich jedes Mal an die Schreibmaschine und tippte etliche Durchschläge für die Darsteller. Ich fand neulich einige dieser Manuskripte … o nein, wie grausig!
Letztes Jahr allerdings, beim Klassentreffen in Schwerin, erzählten Mitschüler von genau diesen Aufführungen und wie viel Spaß es ihnen gemacht hatte, meine Sketche zu spielen. Eine Klassenkameradin sagte sogar, dass sie sich damals von mir ein Autogramm geben ließ. Für den Fall, dass ich mal berühmt werde.
Anfang der achtziger Jahre war ich mit meinem Kinderprogramm in Schwerin. Wir traten im Alten Garten auf den Museumstreppen auf. Die halbe Klasse – alle, die noch in Schwerin lebten, saßen im Publikum. Eine mir unbekannte Frau ließ mich wissen: »Robert kommt auch gleich.«
Ich lächelte, ohne die geringste Ahnung, wer sie oder Robert waren. Dann stand er vor mir, ihr Mann Robert. Herr Klosa war es, der mich an jenem Tag mit großer Freude agieren sah. Ich umarmte ihn anschließend und bestätigte ihm, dass er einen großen Anteil an meinem Tun hat. Spielte ich in Schwerin, veranstaltete er fortan ein kleines Klassentreffen in seiner Wohnung.
Wenn Mutti nicht gerade einen meiner Sketche abtippte, arbeitete sie als Tbc- und Krebs-Fürsorgerin. Sie fuhr auf die Dörfer, setzte Spritzen und kümmerte sich um die Angelegenheiten der Kranken. Manchmal erzählte sie, dass es in einigen Haushalten so viele Kinder gibt. Da war zum Beispiel eine Familie mit sage und schreibe acht Kindern! Auf meine Frage hin, warum das gerade in den Dörfern so sei, meinte sie nur: »Da ist ja sonst nichts, kein Kino, kein Theater, manche haben nicht mal ein Radio – was sollen sie denn anderes machen?«
Mutti erlebte noch während ihrer Tätigkeit, dass in der DDR der Kampf gegen die Tuberkulose siegreich endete. Es blieben ihr die Krebspatienten.
Ich hatte nie auch nur im Geringsten das Gefühl, dass wir arm sind. Wenn die Klasse am Wandertag eine Radtour unternahm, war ich nicht die Einzige, die zu Hause blieb. Die Hälfte der Klasse besaß kein Fahrrad. Ich und einige andere konnten ja nicht mal fahren! Wir trafen uns zum Spielen oder gingen baden. Auf jeden Fall unternahmen wir gemeinsam etwas.
Mir fehlte es an nichts. Gut, ich fand es ja auch völlig normal, dass beim Essen, wenn es zum Beispiel Königsberger Klopse gab, die Mutti einen Klops nahm und Elke und ich je zwei bekamen. Was ich wirklich schätzte: dass wir zu Hause sehr wenig helfen mussten. In meiner Klasse gab es ein Mädchen, das musste daheim den ganzen Haushalt schmeißen. Wir halfen ihr manchmal dabei. Einmal fiel mir beim Abwaschen ein Teller runter. Sie bekam dafür von ihrer Mutter eine Ohrfeige. In diesem Moment begann ich Muttis Handlungen, die ich bis dahin immer als selbstverständlich angesehen hatte, zu schätzen.
Mutti in jenen Tagen
Wie unbeschwert ich alles mitnahm! Wir spielten sehr viel auf der Straße, eigentlich ständig. Besonders beliebt war Völkerball. Das funktionierte, weil so gut wie nie ein Auto vorbeifuhr. Auch Gummihopse spielten wir und Kreiseln. Letzteres mit einem kleinen Kreisel aus Holz, den wir mit einer Peitsche antrieben. Wir rollten den Kreisel in das Peitschenband ein, entrollten dieses mit Schwung und peitschten, dass er lustig tanzte. Das waren Freuden! Auch das Murmeln war beliebt, besonders bei demjenigen, der am Ende die meisten Glasbugger sein Eigen nannte. Das waren echte Besitztümer! Unser Springseil war ständig dabei, und wir hatten alle diese kunstvollen Figuren drauf.
Da wir um die Ecke vom Schweriner Schloss wohnten, ging es mit Puppenwagen, Kind und Kegel unter das Schloss, in die Katakomben. Dort hatten wir unsere vielen »Zimmer« und konnten herrlich Vater, Mutter, Kind spielen.
Um das Fahrradfahren zu üben, fuhr ich einmal zusammen mit einer Freundin nach Zippendorf. Auf dem Weg dorthin hielt meine Freundin im Wald ihr Rad fest. Ich stieg auf, die Pedale bewegten sich – ich fuhr, allerdings nur mit Festhalten. Da riefen ein paar Jungens durch den Wald: »Guckt mal, die lernt fahren!«, und alle lachten mich aus. Das war es dann für lange Zeit mit dem Radfahrenlernen …
Aber schwimmen konnte ich, dazu brauchte man schließlich nur sich selbst. In Zippendorf befand sich das Schweriner Strandbad. Auch die Seen um Schwerin und, wenngleich es verboten war, selbst der Schlossteich waren unser! Für Wasserratten wie mich war Schwerin ideal.
Unsere Nachbarin Frau Geik hatte ein Radio, das Westsender empfangen konnte. Wir Kinder durften manchmal bei ihr Kalle Blomquist – Meisterdetektiv hören. Die Erkennungsmelodie habe ich noch heute im Ohr. Das war wirklich nett, obwohl die Nachbarin ansonsten nicht nett war. Sie mochte keine Katzen! Wir hatten eine …
Sie war schwarz, mit weißem Medaillon. Ich taufte sie Teddy. Als sie Junge bekam, war mein Glück vollkommen. Wir schauten bei der Geburt zu, unvergessen! Dann zu sehen, wie die Katzenmutter ihre Kinder erzog, war ein unbeschreiblich schönes Erlebnis. Ein Sonnenstrahl fällt auf den Teppich – sofort werden alle Kätzchen von der Mama dorthin getragen. Unermüdlich griff sich Teddy die flüchtenden Kleinen. Sie packte sie am Genick und brachte sie auf den Sonnenstrahlfleck zurück. Manchmal langte es ihr, dann ging es: batsch, batsch, schon hatten die Kleinen ein paar Ohrfeigen sitzen. Ein Kätzchen wehrte sich. Es fauchte die Mama an. Das strengte das Kleine derart an, dass es schließlich umfiel.
Die Jungen wurden verschenkt, bis auf eines. Es fand sich niemand. Also blieb der kleine Kater bei uns. Ich nannte ihn Conny. Ein Typ, den ich toll fand, hieß so. Mein Conny war der ideale Kinderkater. Er ließ alles mit sich machen, war unser Spielgefährte, eine lebendige Puppe. Wir zogen ihm Puppenkleider an, fuhren ihn im Puppenwagen spazieren und lehrten ihn, auf zwei Beinen zu tanzen. Teddy war für uns abgemeldet. Um sie kümmerte sich zum Glück die Mutti.
Unser Haus, das ich mit seinen zweieinhalb Stockwerken fast für ein Hochhaus hielt, hatte ein begehbares Dach. Dort wurde die Wäsche aufgehängt, dort sonnten wir uns und beobachteten die Sterne für den Astronomie-Unterricht.
Teddy trieb sich ebenfalls oft auf dem Dach herum, manchmal kam sie uns dann auf der Straße entgegen. Irgendwann muss auch Conny versucht haben, vom Dach zu springen. Bei ihm ging es schief, er brach sich das Genick.
Mein süßer kleiner Spielgefährte, er hatte keine sieben Leben, nur ein einziges kurzes, kleines. Er hatte noch nicht gelernt, zu fallen. Lange Zeit war ich untröstlich.
Auf dem Dach: Elke und ich, 1959
Wie fast alle Mädchen meiner Klasse war auch ich in unseren Sport-, Chemie- und Physiklehrer Herrn Heckler verliebt. Der Grund war simpel: Hatten wir unser Pensum absolviert, setzte er sich auf den Tisch, schnappte seine Gitarre und sang Lieder wie: »Rote Lippen soll man küssen« oder »Es hängt ein Pferdehalfter an der Wand«. Wir schmolzen dahin. Nicht nur ich kaufte mir eine Gitarre. Fünf Griffe – und mitgemacht! Unterrichtete unser Lieblingslehrer eine andere Klasse, hingen wir am Schlüsselloch, um ihn zu sehen.
Das erste Verliebtsein erlebte ich also gemeinsam mit zehn anderen Mädels. Dass wir so viele waren, störte nicht, im Gegenteil: Das schweißte zusammen!
Natürlich ging auch ich in den Leichtathletik-Kurs, den er leitete. Ich war anfangs total unsportlich, rannte im Sportunterricht gegen den Bock und dergleichen mehr. Aber doch nicht, wenn Lehrer Heckler dort stand! Diese Blamage! Das Wunder geschah, ich hatte Freude am Sport und feierte Erfolge.
Manchmal, wenn ich abends vom Leichtathletik-Training nach Hause kam und alle schon schliefen, dachte ich nicht daran, mir die dreckigen Füße zu waschen. Immerhin zog ich Socken über meine schwarzen Füße, um das Laken nicht schmutzig zu machen. Ich bin eben ein Fuchs …
Physik und Chemie waren, genau wie Mathe, nicht so mein Ding, aber ich konnte mich doch nicht vor ihm blamieren! Außerdem wollte ich nicht schuld daran sein, wenn am Ende der Stunde keine Zeit mehr blieb, dass er Gitarre spielte.
Ich war keine Leuchte, aber ich setzte mich auf den Hosenboden. Irgendwann war es dennoch mit dem Musizieren vorbei, der Direktor hatte es verboten.
Zu unser aller Entsetzen teilte uns unser Schwarm eines Tages mit, dass er heiraten wird. Wie konnte er nur! Wir sammelten und kauften einen Blumenstrauß. Gemeinsam gingen wir zu seiner Wohnung, legten den Strauß vor die Tür, klingelten und liefen davon. Ganz langsam. So holte er uns ein, nahm uns mit zurück und versorgte uns mit Kuchen.
Heute weiß ich, dass dieser Lehrer frisch vom Studium gekommen war. Ein totaler Gegensatz zu den Kriegsheimkehrern, außerdem war er nur acht Jahre älter als wir. Ein großartiger Lehrer! Wir lernten nicht fürs Leben, sondern für ihn. Seine Mittel heiligten den Zweck.
Als ich vierzig Jahre später endlich einmal zum Klassentreffen kam, fragte ich ihn, ob er wusste, dass wir alle in ihn verliebt gewesen waren. Seine Antwort: »Natürlich.«
Eine Klassenfahrt führte uns nach Berlin, zu den Hochhäusern in der Stalinallee. Wir waren tief beeindruckt von dieser großen, modernen Stadt. Das Hochhaus an der Weberwiese war das Ereignis für uns. In Vorbereitung auf die Fahrt nach Berlin hatten wir im Schulchor »Die Spatzen vom Alex« gesungen. Es handelt von ebendiesem Hochhaus und lief in unserem Liederbuch unter »Pionierlieder«:
»Es wächst in Berlin, in Berlin an der Spree
ein Riese aus Stein in der Stalinallee.
Es ist ja kein Luftschloss, das kann es nicht sein
und wächst doch bis hoch in den Himmel hinein.«
Der Text stammt von Erika Engel, die Musik von Emil Poletzky. Ich kann alle vier Strophen dieses Liedes noch heute singen. Und nun waren wir hier, im großen Berlin und bestaunten die hohen Häuser, vor allem natürlich das von uns besungene, welches bis in den Himmel ragte. Na ja, ich fand ja schon mein zweistöckiges Wohnhaus sehr hoch. Morgens um 7.00 Uhr klingelten wir beglückt an den Gegensprechanlagen der Häuser. So eine tolle, moderne Erfindung! Doofe Berliner, keiner antwortete uns …
Elke und ich waren selbstverständlich im Schulchor. Wir sangen sogar Solo, also im Duett, zweistimmig: »Unsre Heimat, das sind nicht nur die Städte und Dörfer …«
Außerdem mischte ich im Spielkreis der Jungen Gemeinde mit. An die Stücke, die wir spielten, kann ich mich nicht mehr entsinnen. Es waren auf jeden Fall nicht nur Krippenspiele. Wir gingen sogar auf »Tournee« in benachbarte Gemeinden. Ich spielte in einem Stück eine junge Braut, mein Mann hieß außerhalb der Bühne Peter.
Ich bewunderte ihn. Peter ging schon auf die Oberschule und war so ein lässiger Typ. Ich hätte mich in ihn verlieben können, aber ich wusste, er hatte eine Freundin, die ihn manchmal abholte. Eine, die schon einen Busen hatte. Keine Chance.
Viele Jahre später traf ich ihn im Casino des Fernsehfunks in Adlershof. Peter war unterdessen ein bekannter Grafiker und Karikaturist. Für eine meiner »Tele-Lotto«-Sendungen hatte er die Karikaturen gezeichnet. Wir tranken Kaffee, erzählten von damals. Als ich ihm anvertraute, dass ich mächtig in ihn verliebt gewesen war, er aber gar nichts davon bemerkt hatte, meinte er nur: »Können wir das nicht nachholen?« Witzig war er früher schon.
Ich war in der FDJ und im Gruppenrat unserer Klasse für die Kultur zuständig. Für Radio Schwerin arbeitete ich als Schülerkorrespondentin, später auch als Sprecherkind.
Mein »Chef« dort, Horst-Dieter Hofmann, war Leiter des Arbeitertheaters »Kolonne Links«. Was lag also näher, als dass ich auch dort mitspielte!
Ich glaube, es war 1957, als ich in der 7. Klasse eine zweite Schwester bekam. Erika, eine meiner Freundinnen, fehlte eines Tages in der Schule. Auf meine Frage hin erfuhr ich, dass ihre Mutti verstorben ist. Mit drei anderen Mädels ging ich nach Schulschluss zu ihr. Ihr Opa öffnete uns und wir versuchten, Erika irgendwie zu trösten.
Zu Hause belagerte ich meine Mutti. Ich erzählte, was passiert war, und forderte: »Mutti, Erika kommt in ein Heim, das geht doch nicht. Dann ist sie weg, sie ist doch meine beste Freundin. Bitte, lass sie bei uns wohnen, bitte, bitte!«
Erika zog bei uns ein, und für mich begann eine unvorstellbare Zeit. Mutti schlief jetzt unten, im Wohnzimmer, Elke zog in die kleine Kammer, das Schlafzimmer gehörte fortan Erika und mir. Wir machten alles, wirklich alles, gemeinsam. Natürlich saßen wir in der Klasse nebeneinander. Das allerdings fand irgendwann sein Ende. Man setzte uns auseinander, weil wir auch in der Schulstunde nicht aufhörten zu quatschen.
Verrückt war, dass Erika und ich eigentlich völlig unterschiedliche Interessen hatten. Erika war sportlich, spielte Hockey, war ein Mathe-Ass. Besonders Letzteres war ja bei mir so gar nicht der Fall, aber was soll’s. Schwestern teilen nun mal alles. Erika und ich lebten das Leben von Zwillingen, keine war mehr ohne die andere anzutreffen. Wir benutzten nur eine Schultasche, die wir abwechselnd trugen. Sooft es ging, erledigte Erika meine Mathe-Aufgaben. Ich schrieb dafür ihre Aufsätze.
Das ging nicht immer gut, vor allem, wenn wir zu Arbeiten und später ganz auseinandergesetzt wurden. Wir lebten diese gemeinsame Schulzeit mit so viel Freude in vollen Zügen.
Meine »Schwester« Erika und ich
Gemeinsam begeistert waren wir von der Tanzschule. Ich sehe uns noch: Alle Mädchen saßen in einer Reihe. Uns gegenüber die Jungens. Dann hieß es: »Bitte auffordern!«
Die Jungens standen auf, verbeugten sich vor jeweils einem Mädchen und der Tanz begann. Ich zitterte jedes Mal, dass auch ich aufgefordert werde. Es waren zu viele Mädels, zu wenig Jungens. Ich hatte immer Glück, blieb nicht sitzen. Musste nicht mit einem Mädchen vorliebnehmen.
Zum Tanzstundenball wurden Erika und ich von unseren »Herren« von zu Hause abgeholt, ich bekam ein Veilchensträußchen. Erika und ich trugen wie so häufig das Gleiche. Ein herrliches, weißes Tüllkleid, mit Schärpe. Ich habe die schönsten Erinnerungen daran. Auch an diesen ersten Ball, bei dem natürlich auch die Mutti und Erikas Opa dabei waren.
Gemeinsam gingen wir auch zum »Rollschuh-Tanz«, das war eine Arbeitsgemeinschaft, die die Rollschuhe, die wir zum Üben brauchten, zur Verfügung stellte. Ich glaube, dort waren wir nicht sehr lange, denn ich erinnere mich mehr daran, dass wir im Tanzkursus für Fortgeschrittene landeten und bei gelegentlichen Auftritten auch den »Lipsi« vorführten.
Unser Tanzstunden-Abschlussball, Erika (2. v. r.) und ich (3. v. r.) mit unseren »Herren«
Elke war bereits seit zwei Jahren in Berlin und studierte Opernregie. Nach Beendigung der 10. Klasse ging Erika nach Meißen zum Ingenieurstudium. Der Zufall wollte es, dass auch Erika nach dem Studium in Berlin Arbeit fand. Sie heiratete, bekam zwei Söhne und natürlich hielten wir weiter den Kontakt. Sie konnte sich allerdings nie mit meiner Art zu leben anfreunden. Selbständig und in Unsicherheit, das war nichts für sie. Aber unsere Vertrautheit blieb immer bestehen. Erika hatte schon als Kind Schilddrüsenkrebs. Der kam leider zurück. Kurz vor ihrem Tod besuchte sie mich und brachte mir ein Kleid wieder, das sie für mich geändert hatte. Es war mir zu groß gewesen, sie hatte es passend gemacht. Darin hatte sie echt was drauf.
Ich hatte ihr im Gegenzug einige Bücher mitgegeben. Lieblingsbücher, die ich immer anderen aufdrängle. Jenes Kleid ist mir schon lange zu eng geworden. Aber ich hebe es auf. Ich bringe es einfach nicht übers Herz, es wegzugeben.
Anders als Erika und Elke blieb ich weiter in Schwerin und spielte nach wie vor im Arbeitertheater »Kolonne Links«. Unser Repertoire war weitgefächert. Wir brachten Stücke von Bertolt Brecht bis Hans Sachs zur Aufführung. Hans Sachs’ Schwänke und Jahrmarktstücke spielten wir auf einem alten Planwagen. Aber wir inszenierten auch Anne Frank.
Unser Planwagen von »Kolonne Links«, ich als Kammerzofe (l. u.)
Pause am Fenster
Wir waren eine verschworene Truppe und ich erinnere mich, dass wir im Sommer 1961 zu sechst gemeinsam Urlaub an der Ostsee machten. Wir fuhren nach Bad Doberan, wo wir, wie ich es einst im Kinderheim erlebt hatte, auf einem herrlichen Heuboden nächtigten. Ich zählte jeden Morgen die Spinnen an der Decke. Stimmte ihre Anzahl, war alles okay. Wenn nicht, hätte ich wirklich das gesamte Heu nach ihnen abgesucht? Ich hatte Glück, meine Spinnen waren brav.
Mitten in unserem Urlaub erreichte uns am 13. August die Nachricht, dass in Berlin eine Mauer gebaut worden war. Wir sollten umgehend nach Schwerin zurückkehren. Das machten wir, und am nächsten Tag gingen wir mit einem Agitprop-Programm auf die Straße. Wir sangen: »Willy Brandt, wohlbekannt, wurde weiß, wie ’ne Wand. Sagte Schockschwerenot, Klappe zu, Affe tot. Da sprach der alte Häuptling der Indianer, wild ist der Westen, schwer ist der Beruf.«
Berlin war so weit weg – was da so richtig passiert war, wir hatten keine Ahnung davon.
Über das Arbeitertheater hatte ich mich an der Leipziger Theaterhochschule beworben. Dort war allerdings gerade Aufnahmestopp, ich wurde auf das nächste Studienjahr vertröstet.
Also blieb ich in Schwerin und absolvierte mein »praktisches Jahr« im VEB »Vorwärts«, einer großen Autoreparaturwerkstatt. Ich hatte keine Ahnung von Autos, aber neugierig und wissbegierig, wie ich nun mal bin, schnappte ich schnell einiges auf und konnte den Kunden bei der Annahme behilflich sein. Na ja, wie man’s so nimmt …
Nachdem ich einmal gehört hatte, wie ein Kollege zu einem Kunden sagte: »Das wird das Chassis sein«, übernahm ich diese Redewendung prompt. Chassis – dieses Wort gefiel mir außerordentlich. Wenn nun ein Kunde kam und meinte: »Da klappert was«, nickte ich nur wissend und sagte: »Das wird das Chassis sein, kommen Sie mit, ich bringe Sie zum Meister.« Ich fand mich toll.
Mutti hatte eine Anstellung in Kleinmachnow bei Berlin angenommen. Da ich noch in Schwerin blieb, hatte Mutti mit der Glaserfamilie Bolze alles abgesprochen. Sie wurden quasi meine Pflegeeltern. Ich war siebzehn, also sollte es schon noch jemanden geben, der »erziehungsberechtigt« war.
Ich bewohnte eine Kammer oben in unserem Haus. Das Bad befand sich wie zuvor in der Wohnung der Familie Bolze. Kost und Logis hatte ich ebenfalls bei ihnen. Ich fühlte mich wohl. An Mutti wurde ich bei einem Mittagessen erinnert. Es gab Königsberger Klopse. Da stand eine große Terrine auf dem Tisch und ich bekam eine Kelle mit Klopsen auf den Teller geschüttet: Fünf Klopse, fast kein Platz mehr für eine Kartoffel. Ach Mutti, danke für die zwei Klopse, während du verzichtet hast …
In meiner Dachkammer hatte ich Mitbewohner. Es waren Mäuse, und ich sprach zu ihnen: »Ihr könnt hier machen, was ihr wollt, aber nicht in mein Bett kommen!«
Sie wohnten hinter der Tapete, waren auf dem Schrank oder im Papierkorb, den ich morgens in den Flur stellte. So war mindestens eine Familie Maus weniger in der Kammer. Sie knabberten alle Papiere an. Wenn ich meine Kemenate betrat, klatschte ich zuerst in die Hände. Keine Maus war zu sehen. Den Rat, eine Falle zu kaufen und aufzustellen, befolgte ich nicht. Ich hätte die ganze Nacht auf das Klacken und Quietschen gewartet. Nein, ich freundete mich lieber mit ihnen an. Wenn die langen, nackigen Schwänze nicht wären, könnte ich diese possierlichen Tierchen echt liebhaben.
Ich weiß noch, dass ich in »meiner« Werkstatt viel Zeit auf der Toilette verbrachte – um zu schlafen. Am Abend hatten wir im Arbeitertheater Probe, nachts bauten wir Kulissen, so kam es eben manchmal zu zehnminütigen Toilettenbesuchen.
Nachdem mein Praktikum im VEB »Vorwärts« beendet war, brach ich meine Zelte in Schwerin ab und zog zu meiner Mutti nach Kleinmachnow bei Berlin.
Wieder ein Abschied, jetzt von meinen Freunden aus dem Arbeitertheater, der mir sehr schwerfiel. In Berlin wollte ich mich an der Hochschule für Schauspielkunst bewerben.