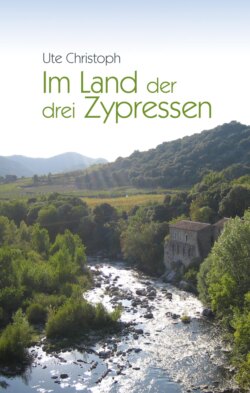Читать книгу Im Land der drei Zypressen - Ute Christoph - Страница 7
ОглавлениеIn den Wäldern zwischen Bédarieux und Olargues, 11. April 1850
Der schmale Weg durch den Wald war uneben und holprig. Die schlecht gefederte Kutsche schlingerte gefährlich zur Seite, und Vivienne war jedes Mal überrascht, wenn das Gefährt wieder auf allen vier Rädern über die Straße rumpelte. Dichte Baumkronen schluckten das Mondlicht. Tief hängende Zweige schlugen gegen die Fensterscheiben. Es war gespenstig da draußen.
„Diese Fahrt ist unerträglich. Ich halte das nicht eine Minute länger aus“, sagte die kleine Frau, die Vivienne gegenübersaß, und wischte sich mit einem fleckigen Tuch das rote Gesicht.
Die Füße der dicklichen Reisegefährtin berührten kaum den Boden und Vivienne, die sich in der rumpelnden Kutsche nicht nur an der ledernen Handschlaufe festklammerte, sondern auch die Füße fest in den Boden stemmte, empfand Mitleid.
„Uns wird kaum etwas anderes übrig bleiben, bis wir unser Ziel erreicht haben, Liebes“, sagte der Mann neben ihr.
Im Gegensatz zu seiner Frau war er schlank, ja, fast dürr. Auf dem Schoß hielt er ein etwa dreijähriges Mädchen. Er strich der Kleinen über das blonde, strähnige Haar und legte dann seine Hand beruhigend auf die in ihren Schoß gebetteten Hände seiner Frau.
„Denk an unser neues Leben“, redete er weiter. „Wir werden es besser haben als jemals zuvor. Ein eigenes kleines Haus, Tiere und Felder, die wir bestellen. Wir werden genug zu Essen und zu Trinken haben. Unserem Kind wird es gut gehen. Und vielleicht bekommt es noch Bruder oder Schwester.“
Die Frau kicherte verlegen und zwickte ihren Mann in die Daumenwurzel.
Vivienne schmunzelte.
„Wir haben etwas gespart und wollen uns jetzt im Dorf meines Schwagers niederlassen“, erklärte die Frau.
Vivienne nickte und verlagerte das Gewicht auf ihren rechten Fuß.
„Ach, wie froh werde ich sein, wenn wir endlich da sind“, klagte die Frau.
Vivienne blickte aus dem Fenster. Angesichts der undurchdringlichen Finsternis fröstelte sie und zog ihren schweren Umhang enger um sich.
Der Mann neben ihr hielt die Augen geschlossen. Vivienne beneidete den Mann. Wie gern hätte auch sie diese unruhige Fahrt verschlafen. Sie bemühte sich, beim Schaukeln der Kutsche nicht gegen ihn zu stoßen, um ihn nicht zu wecken. Sie gähnte hinter vorgehaltener Hand und sehnte sich nach einem Bett.
„Wohin wollt Ihr?“ fragte die dicke Frau.
Vivienne schluckte. Sie hatte von Anfang an gewusst, dass ihr auf ihrer Reise jemand diese Frage stellen würde und sich eine Geschichte ausgedacht.
Niemals hätte sie die Wahrheit sagen können! Niemand vermochte zu verstehen, warum sie den Mann, den ihre Eltern für sie ausgewählt hatten, nicht heiraten konnte. Die gute Partie, um die sie all ihre Freundinnen beneideten. Er war reich, besaß ein großes Haus mit Bediensteten, die ihm auch den nur kleinsten Wunsch von den Augen ablasen, eine weit über die Region hinaus bekannte Pferdezucht und unzählige Weinberge mit Trauben von exzellentem Ruf.
Vivienne hingegen sah nicht seinen Wohlstand und den Besitz. Auch nicht all die kleinen und großen Annehmlichkeiten, die eine Ehe mit diesem Mann mit sich gebracht hätte. Sie sah den Ausgewählten selbst. Er war hässlich, grobschlächtig und sein Benehmen ekelte sie. Mit seinen vierzig Lebensjahren war er darüber hinaus mehr als doppelt so alt wie sie selbst.
Viviennes jüngster Bruder hatte ihr Leid nicht mit ansehen können und ihr bei den Vorbereitungen ihrer Flucht geholfen. An dem Abend, bevor sie für immer gegangen war, hatte er ihr Geld gegeben und gesagt: „Das reicht fürs Erste. In der Stadt bist Du weit genug von hier entfernt. Niemand wird Dich dort suchen.“
In ihrer Fantasie sah sie sich als Kindermädchen. Doch es wäre nicht einfach, ohne Referenzen eine passende Anstellung zu bekommen. Würden die Menschen nicht rasch bemerken, dass sie bar jeder Erfahrung war? War es möglich, sich darauf zu verlassen, mit ihrer eigenen guten Erziehung die Aufgaben eines Kindermädchens zu meistern? Sie hatte Angst, aber jedes Los schien ihr erträglicher, als ihr ganzes Leben an einen Mann gebunden zu sein, den sie nicht achten, geschweige denn lieben konnte.
„Ich besuche die Schwester meiner Mutter. Sie lebt mit ihrer Familie in der Stadt“, log Vivienne mit fester Stimme. „Meine Tante kommt bald mit dem vierten Kind nieder und benötigt dringend Hilfe.“
„Wie reizend von Euch“, bemerkte die dicke Frau. Die Kutsche fuhr durch ein tiefes Schlagloch, und sie stieß unsanft gegen ihren Mann. Das Kind auf seinem Schoß verzog die Mundwinkel.
„Nein, nicht weinen“, beschwichtigte es der Vater.
Der Mann neben Vivienne gab leise Schnarchgeräusche von sich.
Die junge Frau gähnte abermals und rieb sich die großen dunkelbraunen Augen. Die Kopfhaut unter ihrer Haube kribbelte unangenehm. Zu Hause hätte sie schon lange Zeit in ihrem weichen Bett gelegen, die Ruhe der Nacht in ihrem schützenden Elternhaus genossen und sich in dieser Geborgenheit Schlaf und Träumen hingegeben. Vivienne atmete tief ein und seufzte.
Diese Zeiten sind vorbei, dachte sie traurig. Das alles gibt es nun für mich nicht mehr. Keine Eltern, nicht die Gesellschaft der Brüder und Schwestern, auch nicht die der geliebten Freundinnen. Das alles habe ich vor drei Tagen für immer hinter mir gelassen. Ich muss nach vorn schauen.
„Hee, Kutscher, anhalten!“
Vivienne schrak zusammen. Das kleine Mädchen begann zu weinen.
Der Mann neben ihr schien plötzlich hellwach.
„Sorg dafür, dass das Balg still ist, sonst erledige ich das“, fuhr er den Vater an.
Der Vater stammelte ein beruhigendes „Tsch, tsch“. Auf seiner Stirn bildeten sich zahlreiche kleine Schweißperlen. Seine Frau schnappte aufgeregt nach Luft. Die Knöchel ihrer ineinander verschränkten Hände traten weiß hervor.
Bedächtig drehte Vivienne den Kopf zu dem Mann neben sich. Er hielt eine Pistole auf das Kind gerichtet und beobachtete aufmerksam die Reaktionen seiner Geiseln. Die Kutsche kam zum Stehen, die Tür wurde aufgerissen. Ein dreckfleckiges Gesicht und eine schmutzige Hand mit einem Dolch schoben sich in Viviennes Blickfeld. Sie spürte, wie ihr Magen krampfte, und kämpfte gegen das aufkommende Gefühl, sich übergeben zu müssen.
„Los, steigt aus!“ befahl eine Stimme außerhalb des Gefährts.
Vivienne setzte ihre Füße vorsichtig voreinander und verließ die Kutsche. Die Familie folgte ihr, während der Mann, der die ganze Zeit vorgegeben hatte zu schlafen, die Pistole von hinten auf sie gerichtet hielt. Verstohlen wanderte Viviennes Blick zum Kutschbock. Der Kutscher lag in unnatürlich gekrümmter Haltung auf der Bank. Seine Augen starrten leblos in die Nacht. Aus seinem Hals lief gleichmäßig ein dunkles Rinnsal – Blut.
„Oh, mein Gott“, entfuhr es Vivienne.
„Das ist ein Überfall.“ Ihr ehemaliger Reisegefährte grinste schief. „Nun gebt mir all’ Eure Habseligkeiten.“ Er wandte sich an seinen Komplizen: „Wir machen heut’ Nacht gute Beute. Die junge Mademoiselle reist zu ihrer Tante und hat bestimmt viel Geld dabei. Und die hier“, er richtete die Waffe in seiner Hand auf das zitternde Paar, das seine lautlos weinende Tochter zwischen sich gepresst hielt, „die haben was gespart. Ein neues Leben wollten sie anfangen.“
Der Mann mit dem Messer lachte und drängte Vivienne von der Familie fort, bevor er sich umdrehte und mit dem Messer über die Brust der dicken Frau strich.
Ich muss fort von hier, dachte Vivienne und presste die Arme eng an ihren Körper, um ein Zittern zu unterdrücken. Ich muss einen klaren Kopf bewahren.
„Jetzt leert endlich Eure Taschen, los!“ Der Anführer spielte mit der Pistole an Viviennes Umhang. „Du zuerst.“
Ohne zu zögern reichte sie dem Anführer mit unsicheren Händen ihren Beutel. Sie spürte, wie sich dabei Schweißtropfen unter ihren Achseln lösten und langsam an ihren Seiten herunterrannen, bis sie im Kleiderstoff versickerten.
Ich muss fort von hier, dachte sie wieder.
Der Mann mit der Pistole riss den Beutel an sich, öffnete ihn und holte das Münztäschchen hervor. Als er sah, wie viel Geld er in den Händen hielt, weiteten sich seine Augen gierig.
„Jetzt zu Euch, Siedler“, lachte der Anführer und drehte sich um.
Er lässt mich aus den Augen, dachte sie. Ich bin keine Gefahr für ihn!
Natürlich nicht! Sie war unbewaffnet, und er hatte ihr Geld, ihr ganzes Geld. Sollte er es haben, ihr kleines Vermögen, wenn ihr bloß das Leben blieb.
Es war stockdunkel und der Wald tiefstes Dickicht. War die Finsternis ihr noch bis vor wenigen Minuten unheimlich gewesen, so war sie jetzt dankbar dafür, zutiefst dankbar. Vivienne traute sich kaum zu atmen. Ihre Muskeln waren fest angespannt und das Kribbeln auf der Kopfhaut unter der Haube unerträglich. Sie machte einen Schritt rückwärts, kaum merklich. Es gelang ihr nahezu lautlos. Sie widerstand dem Impuls, sich umzudrehen und zu laufen, einfach loszulaufen. Wenn sie sich langsam bewegte, langsam und vorsichtig, bis sie ganz und gar mit der Dunkelheit verschmolzen wäre, dann konnte sie laufen. Aber erst dann!
Sie tastete sich vorsichtig rückwärts, Schritt für Schritt, die Muskeln bis zum Zerreißen gespannt. Trockene Zweige zerbrachen leise unter dem Gewicht ihres Körpers. Die Konzentration auf die nahezu unmerkliche Bewegung ihrer Füße erforderte ihre vollkommene Aufmerksamkeit.
Noch ein Stück!
Und nur nicht stolpern, hoffte sie.
Die Konturen von Familie und Räuber verschmolzen mit der Nacht.
Wenn ich sie nicht mehr sehen kann, können sie mich auch nicht mehr sehen.
Der Gedanke in ihrem Kopf gewann mehr und mehr an Klarheit.
Jetzt konnte sie es wagen. Ihr Herzschlag dröhnte ihr in den Ohren.
Jetzt! Meine Beine – hoffentlich versagen sie mir nicht den Dienst.
Die Gedanken in ihrem Kopf schlugen Purzelbäume. Jetzt!
Vivienne drehte sich um und rannte ins Nichts. Sie stolperte über Äste und Wurzelreste. Dornen rissen an ihrem Mantel und ihrer Haube, ein Ast schlug unsanft gegen ihre Schulter. Aber sie spürte nichts. Sie lief um ihr Leben.
„Die Kleine ist weg“, hörte sie jemanden rufen.
„Lass sie laufen. Die kommt hier nicht weit“, antwortete eine andere Stimme.
Der Anführer? Der Mann mit dem Messer? In ihrer Angst war es ihr unmöglich, die Stimmen zu unterscheiden.
Drei Schüsse.
Vivienne stockte kurz der Atem.
Ich muss laufen! Ich muss weg!
Sie spürte weder körperliche Pein noch Müdigkeit – nur Angst, Todesangst.
Eine Ewigkeit schien vergangen, als sie kraftlos und nach Luft ringend auf die Knie sank. Vivienne vermochte nicht zu sagen, wie lange sie durch den dunklen Wald gelaufen war – Minuten, Stunden? Ihre Muskeln entspannten sich, die Hammerschläge des Herzens in ihren Ohren wurden erträglicher, und sie erbrach sich.
Sie kroch auf allen Vieren fort von dem Erbrochenen und holte tief Luft. Beine und Füße waren schwer und schmerzten. Die Waden krampften.
Vivienne tastete blind um sich, bis sie einen Busch fand. Sie schob das Gestrüpp auseinander, brach Zweige ab, zog die Kapuze ihres Umhangs über den Kopf und legte sich in den Busch. Sie rollte sich zusammen, einsam und wund, innerlich wie äußerlich. Sie war durstig. Sie war allein. Allein in einem dunklen Wald mit wilden Tieren. Doch noch bevor ihr die Situation, in der sie sich befand, in ihrer ganzen Tragweite bewusst zu werden drohte, schlief sie ein.
Sie schlief einen unruhigen, traumlosen Schlaf. Das Gehölz war dicht und so konnte ihr zumindest der einsetzende Regen nichts anhaben.
Als die Nacht dem Morgengrauen wich, erwachte sie. Ihr Gesicht spannte. Sie befühlte es vorsichtig und ertastete einige Schwellungen und eine Risswunde, die quer über die linke Wange verlief. Auch ihre Stirn war blutverkrustet. Jeder Muskel ihres Körpers tat unsäglich weh. Mutterseelenallein befand sie sich inmitten eines unbekannten Waldes. Ihr Herz war schwer. Aber sie konnte nicht weinen.
Vorsichtig sah sie sich um. Nichts! Nichts außer Bäumen, Büschen und Dornen.
In welche Richtung sollte sie gehen? Wo würde sie Menschen finden?
Sie zog den vom Morgentau feuchten Umhang aus und glättete das zerknitterte Kleid.
In welche Richtung war sie geflüchtet? Hatte sie bei ihrer Flucht überhaupt eine Richtung eingehalten oder war sie wie von Sinnen kreuz und quer durch das Dickicht gelaufen? Sie musste raus aus dem Wald.
Es ist gleichgültig, in welche Richtung ich gehe, dachte sie, irgendwann müssen Felder kommen, ein Dorf, Menschen und – Wasser.
Die dichten Baumkronen schützten sie vor der Hitze der erbarmungslos brennenden Sonne. Stumm dankte sie Gott dafür, denn Hunger und Durst waren Plage genug. Das letzte Mahl hatte sie kurz vor der Kutschfahrt zu sich genommen. Das war gestern Mittag gewesen. Dann fiel ihr ein, dass sie sich nach der Flucht vor den Räubern übergeben hatte. Vivienne war übel vor Hunger. Aber der Durst war noch viel schlimmer. Ihre Zunge klebte wie ein trockener Schwamm am Gaumen, die Lippen bluteten. Jedes Schlucken reizte die wunde Kehle.
Der leichte Regen der letzten Nacht war restlos im trockenen Waldboden versickert.
Wenn ich doch nur Wasser fände, dachte sie. Doch sie fand nicht einmal ein paar Beeren.
Stundenlang schlug sie sich durch den tiefen, endlos scheinenden Wald. Wenn die Beine ihr den Dienst zu versagen drohten, lehnte sie sich gegen einen Baum. Würde sie sich nur einmal setzen, stünde sie nie wieder auf.
Als die Sonne unterging und die Dunkelheit sich wie ein schwarzes Tuch über den Wald legte, suchte sie wie in der Nacht zuvor einen Busch, in dessen Schutz sie schlafen konnte. In der letzten Nacht hatte sie keine Angst vor den wilden Tieren verspürt. Die Erschöpfung war viel zu groß gewesen. Die furchterregenden Gedanken versuchten, sich nun in ihrem Kopf ausbreiteten, doch Vivienne schob sie einfach beiseite. Sie hatte nichts mehr, außer ihrem Leben und den Kleidern am Leib. Und ohne Wasser würde sie den nächsten Tag nicht überstehen.
Mit von Dornen aufgerissenen, schmerzenden Händen zog sie Schuhe und Strümpfe aus. An den Füßen, die langes Gehen nicht gewohnt waren, hatten sich dicke Blasen gebildet. Vivienne hatte darauf keine Rücksicht genommen und war mit zusammengebissenen Zähnen weitergegangen. Die Blasen waren aufgeplatzt. Jetzt kräuselte sich die Haut am Wundrand. Sie betrachtete das offene, schutzlose Fleisch.
Morgen werde ich auf Menschen treffen. Ja, morgen ganz bestimmt.
Der neue Tag begann wie der alte geendet hatte. Mühsam schleppte sie sich vorwärts, fand kein Wasser, und die Hoffnung, endlich den Wald hinter sich zu lassen, wurde von Stunde zu Stunde schwächer und schwächer. Hände und Füße bluteten und die Wunden in ihrem geschwollenen Gesicht taten höllisch weh.
Ach, würde ich doch nur einen Stein finden, dachte sie. Den könnte ich lutschen, um den Speichelfluss anzuregen.
Doch sie fand keinen Stein.
Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr, jammerte sie stumm. Und das Verlangen nach Wasser wurde übermächtig, das Denken immer schwerer und langsamer.
Dann, am späten Nachmittag, in einem Augenblick größter Verzweiflung, öffneten sich ganz plötzlich die Bäume und sie trat, mit über die Augen gelegten Händen vorsichtig in die Sonne blinzelnd, hinaus auf ein Feld. Ihr Herz setzte vor Freunde einen Schlag lang aus.
Endlich! Ich bin gerettet! Ich darf leben!
Doch die Freude währte nur kurz. Weit und breit sah sie keine Menschenseele, keine Bauern oder Knechte, keine Tiere. Nichts!
Mit ihrem durch die lange Stille des Waldes geschärften Gehör lauschte sie auf das Geräusch von Wasser, das Fließen eines Baches. Nichts!
Der Horizont flimmerte im Licht der heißen Sonne. Vivienne kniff die Augen fest zusammen, bis sie scharf sah, und suchte in der Ferne nach Menschen, nach Wasser, nach Leben. Nichts!
Als sie sich gerade am Feldrand niederlassen und endlich weinen wollte, sah sie ihn – einen Hang mit drei Zypressen, deren Spitzen sich majestätisch dem Himmel entgegenstreckten. Wo Zypressen stehen, ist Wasser. Der Gedanke traf sie wie ein Blitz. Sie fühlte Kraft. Jegliche Müdigkeit schien mit einem Mal verflogen. Sie musste um jeden Preis zu den drei Zypressen, denn dort war Wasser. Danach würde sie sich auf die Suche nach Menschen begeben.
Vivienne warf den warmen Umhang ab und begann zu laufen.
Sie hatte den Wald hinter sich gelassen, doch zwischen ihr und den Zypressen lag noch ein sehr weiter Weg. Die plötzliche Stärke und Zuversicht wichen erneut dem Gefühl von Schwäche, Einsamkeit, Angst und dem tiefen Wunsch, endlich anzukommen. Sie verlangsamte ihre Schritte.
Ich werde es schaffen! Ich werde nicht aufgeben!
Immer wieder und wieder sprach sie sich stumm Mut zu und setzte schleppend einen Fuß vor den anderen.
Jäh stand sie vollkommen erschöpft vor dem Hang. Sie sah die Zypressen nicht mehr. Die Sonne stand hoch am Himmel und verbrannte ihr ungeschütztes, verletztes Gesicht.
Sie kämpfte mit Tränen und dem Bedürfnis, sich zu setzen und sich einfach ihrem Schicksal zu überlassen. Doch Vivienne wollte leben. Sie durfte jetzt nicht aufgeben. Sie hatte sich der ungewollten Ehe mit der Flucht aus ihrem Elternhaus widersetzt, sich dem mörderischen Zugriff der Räuber entzogen und war einsam und allein durch den Wald geirrt. Sie war so weit gekommen.
Sie grub die abgebrochenen Nägel in die zerschundenen Handflächen, bis es schmerzte.
Jetzt nicht aufgeben, weitergehen, nicht an die Müdigkeit und die Schmerzen denken, befahl sie sich und stolperte den Hang hinauf.
Auf unsicheren Beinen kämpfte sie sich durch Büsche und Dornen, die ihr weitere Wunden in Gesicht und Arme rissen. Vivienne sank auf die Knie und schleppte sich auf allen Vieren mühsam vorwärts. Ihr Herz raste, sie schwitzte und das Atmen fiel ihr schwer.
Nach einer Zeit, die sich wie eine Ewigkeit anfühlte, gelangte sie auf eine Ebene. Sie stand auf und rieb sich die erdigen, blutenden Hände an ihrem zerfetzten Kleid. Vor sich sah sie einen mit Kies bedeckten Weg, flankiert von gepflegten Rotbuchen, und am Ende der Allee ein wunderschönes großes Bruchsteinhaus mit einer breiten Treppe. Am Ende dieses Weges gab es Wasser!
Das vertraute Geräusch von Kies unter ihren Füßen, wie auf dem elterlichen Gut, ein kurzer Gedanke an Zuhause. Sie torkelte traumverloren zwischen den vor ihren Augen unscharf flimmernden Bäumen vorwärts. Ihr war unerträglich heiß und gleichzeitig liefen ihr eiskalte Schauer über Rücken und Arme. Sie fieberte. Den Durst, die Erschöpfung, ihren gepeinigten Körper – das alles spürte Vivienne nicht mehr.
Sie erreichte das Ende der Straße und warf noch einen kurzen Blick auf die vor dem Haus gepflanzten drei Zypressen.
Die Zypressen! Ich habe es geschafft! Ich bin am Ziel, dachte sie müde.
„Das arme Kind. Sebastian, bring mir Wasser, schnell, schnell“, hörte sie, bevor sie in den Armen einer herbeieilenden Frau zusammenbrach.
Dann senkte sich bleierne Schwärze auf sie herab. Vivienne verlor das Bewusstsein.
Auziale, 18. April 1850
Sie konnte die Augen nicht öffnen. Ein zentnerschweres Gewicht lastete auf ihren Lidern. Ihr Herz begann, schneller zu schlagen. Ein Funken Panik entstand tief in ihrer Mitte, wuchs, machte sich breit und erreichte ihr Bewusstsein.
„Was ist mit meinen Augen?“
Ihre Stimme klang merkwürdig fremd in ihren Ohren. Instinktiv griff sie sich ins Gesicht, das ein feuchtes Tuch bedeckte und nur Mund und Nase frei ließ. Vivienne stöhnte, zog mühsam die Last von ihren Augen und hob die Lider.
„Ihr seid krank und hattet bisweilen sehr hohe Temperatur“, sagte eine Frauenstimme freundlich.
Angestrengt versuchte Vivienne, sich zu orientieren. Sie befand sich in einem fremden Bett. Vorhänge aus schwerem Brokat verdunkelten die Fenster.
Trotz des gedämpften Lichts fühlte Vivienne sich gelbendet und jeder Lidschlag bereitete ihr unerträgliche Qual. Ihre Kehle war rau und trocken.
Die freundliche Frau schien ihre Gedanken lesen zu können, denn sie hielt Vivienne ein Glas an die rissigen, geschwollenen Lippen. Dabei beugte sich ein Gesicht über sie, das ihr seltsam bekannt vorkam.
Sie hatte ihr Zuhause verlassen oder etwa nicht? Und sie lag in einem fremden Zimmer, das sie noch nie zuvor gesehen hatte. Sie konnte nicht zu Hause sein! Dann, ganz langsam und bruchstückhaft, kam die Erinnerung zurück – der Überfall, die Angst zu sterben, der Irrweg durch den Wald, die drei Zypressen, der qualvolle Weg den Hügel hinauf, die Allee mit den Rotbuchen. Und dann war sie in den Armen dieser Frau ohnmächtig geworden.
„Danke“, flüsterte sie, als das Glas behutsam von ihren Lippen abgesetzt wurde. „Wo bin ich und….“
Ein plötzlicher Hustenanfall schüttelte sie. Sie legte die Hand auf die Brust, wie um sie vor dem Zerbersten zu schützen.
„Schont Eure Kräfte“, sagte die Frau warm. „Ihr seid noch sehr schwach.“
Vivienne schloss die Augen und spürte, wie ihr erneut das feuchte Tuch über Stirn und Augen gelegt wurde. Es duftete nach Kräutern. Sie fühlte sich geborgen und fiel in einen traumlosen, heilsamen Schlaf.
Auziale, 10. Mai 1850
Als sie wieder erwachte, war sie allein.
Vivienne tastete nach ihren Lippen. Sie waren verheilt. Behutsam öffnete und schloss sie ihre Augen. Der Schmerz war fort. Sie räusperte sich umständlich und stellte beruhigt fest, dass auch ihr Brustkorb nicht länger wehtat.
Wie lange hatte sie geschlafen?
Langsam setzte sie sich auf und sah sich in dem geräumigen, angenehm nach Rosmarin duftenden Zimmer um.
Sie befand sich in einem riesigen Bett, bedeckt mit kostbarstem Damast. Neben dem Bett stand ein schwarzes Holztischchen und darauf eine zur Hälfte mit Wasser gefüllte Karaffe, ein Glas und ein Fläschchen mit einer Flüssigkeit, die wie Medizin aussah. Gegenüber dem Bett befand sich ein Schrank, dessen Türen nur angelehnt waren.
Der Raum verfügte über zwei große, immer noch von den schweren Vorhängen verdeckte Fenster. Zwischen den Fenstern befand sich eine Truhe. Auf dem Boden lagen bunte Teppiche, die ihr sehr wertvoll schienen. Vivienne seufzte. Wohin das Schicksal sie auch geführt haben mochte, es war gut.
Sie ließ sich in die warmen, weichen Kissen zurücksinken und schlief ein.
Die Tür öffnete sich leise. Vivienne sah auf und erkannte die Frau mit der freundlichen Stimme, die nun den Raum betrat. Sie war klein, hatte ein rundliches Gesicht und blickte sie aus aufmerksamen, grünen Augen an. „Mir scheint, Ihr seid genesen. Eure Temperatur ist normal und die Wunden sind verheilt. Wie fühlt Ihr Euch?“
Vivienne lächelte: „Ich glaube, mir geht es gut.“
„Mögt Ihr aufstehen? Selbstverständlich müsst Ihr Euch noch schonen. Aber Ihr solltet Euch an die frische Luft begeben. Ich lasse Euch einen Sessel in den Garten bringen. Luft und Sonne werden Euch gut tun“, sagte die Frau.
„Wie lange bin ich jetzt hier?“ fragte Vivienne.
„Oh, drei Wochen sind es, fast auf den Tag genau. Ja, gestern vor drei Wochen kamt Ihr zu uns.“
„Drei Wochen? Seit drei Wochen bin ich hier? Ihr pflegtet mich gesund, ich verdanke Euch mein Leben – und Ihr kennt nicht einmal meinen Namen. Darf ich mich Euch vorstellen? Ich bin Vivienne Sésérac.“
„Ein sehr schöner Name! Mich nennt man Agnès. Ich bin die Köchin und beaufsichtige das Mädchen“, lachte Agnès. Und von Zeit zu Zeit pflege ich sterbenskranke, junge Frauen wieder gesund“, fügte sie dann hinzu.
„Wo bin ich hier?“ wollte Vivienne wissen.
„Ihr befindet Euch auf Auziale, auf dem Gut der Héraults“, antwortete Agnès. „La Patrone ist Madame Ludivine. Sie lebt hier zusammen mit ihren drei Söhnen Daniel, Philippe und Claude. Daniel und Claude sind verheiratet – mit Christine und Claire.“
Agnès stemmte die Hände in ihre kräftigen Seiten.
„Ich schicke Euch jetzt Francine, das Mädchen. Sie wird Euch beim Ankleiden behilflich sein.“
„Danke. Ich danke Euch für alles“, sagte Vivienne, „Ihr habt so viel für mich getan.“
„Ach, das habe ich doch gern gemacht, meine Liebe“, antwortete Agnès und verließ das Zimmer.
Vivienne streckte die Beine aus dem Bett und fuhr sich mit den Fingern durch das glatte, braune Haar. Es fühlte sich sauber und geschmeidig an. Jemand hatte es gewaschen, während sie geschlafen hatte. Sie empfand eine starke Dankbarkeit für die Fürsorge, die ihr zuteil geworden war.
Die Tür öffnete sich erneut, dieses Mal ein wenig schwungvoller. Ein ganz in Grau gekleidetes Mädchen ihres Alters stand im Raum. Das musste Francine sein. Sie knickste höflich und machte sich dann an den angelehnten Türen des Schranks zu schaffen. „Madame hat Euch Kleider bringen lassen. Euer eigenes hing Euch in Fetzen vom Leib. Ihr ward lange krank. Aber nun scheint es Euch besser zu gehen“, sprudelte sie.
Ich habe großes Glück im Unglück gehabt, dachte Vivienne. Das Schicksal hat mich zu einer wahrhaft gastfreundlichen und guten Familie geführt.
Das Gefühl von Dankbarkeit wuchs, während sie in dem eigens für sie in den Garten gebrachten und mit einer Unzahl von Kissen ausstaffierten, schweren Sessel saß.
Es war warm, doch Agnès hatte eine leichte Decke über sie gebreitet. Und sie hatte Sorge dafür getragen, dass Francine gelegentlich nach ihr sah, um sich nach ihrem Befinden zu erkundigen und zu fragen, ob sie hungrig oder durstig war. „Wenn Mademoiselle etwas braucht, bringst Du es ihr. Am besten wäre es, wenn Du ihr die Wünsche von den Augen abliest“, hatte Agnès das Mädchen bestimmt wissen lassen.
Männer und Frauen, Jungen und Mädchen eilten geschäftig den Weg vor den kleinen Häusern am Ende des Gartens auf und ab. Sie trugen etwas aus den Häusern, das aussah wie aufgerollte braune Matten, verschwanden aus Viviennes Blickfeld und kamen mit großen Flechtkörben zurück. Neugierig warfen sie der fremden Frau im Garten verstohlene Blicke zu.
„Ich heiße Euch herzlich bei uns willkommen.“
Vivienne vernahm die klare, dunkle Stimme, bevor sie den Mann sah, dem sie gehörte und der jetzt mit einem Holzstuhl in der Hand vor ihr stand.
„Darf ich?“
Ohne ihre Antwort abzuwarten, platzierte er den Stuhl vor sie und setzte sich rittlings darauf.
Angesichts der direkten Art des Mannes errötete sie.
„Vivienne Sésérac“, sagte sie ein wenig verschüchtert und reichte ihm ihre schmale Hand.
Er nahm sie sanft und deutete galant den Kuss eines wohlerzogenen Mannes knapp unter der Wurzel ihres Mittelfingers an.
„Philippe Hérault“, stellte er sich vor, „der Zweitgeborene in dieser Familie.“
Seine türkisfarbenen Augen leuchteten in dem braungebrannten Gesicht und blickten sie offen und ehrlich an, während er den Stuhl näher rückte.
Vivienne hatte gelernt, Konversation mit Fremden zu machen, doch angesichts der fröhlichen, direkten Art des Mannes war sie sprachlos.
„Es scheint Euch sehr viel besser zu gehen“, bemerkte Philippe. „Maman hat sich sehr um Euch gesorgt. Sie ließ Agnès den Arzt rufen und hieß sie, sich Tag und Nacht um Euch zu kümmern.“
„Ich bin sehr froh, dass Eure Familie sich meiner so fürsorglich angenommen hat“, sagte Vivienne und schüttelte einen Grashüpfer von ihrer Hand.
„Glaubt Ihr, dass Ihr heute Abend bereits in der Lage seid, gemeinsam mit uns zu essen? Ich glaube, Maman würde sich freuen. Und der Rest der Familie ebenfalls.“
„Ja, sehr gern. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich bei Ihrer Mutter für die Freundlichkeit zu bedanken, mit der mir hier begegnet wurde … und wird“, fügte sie hinzu.
„Das wird Maman glücklich machen“, lachte Philippe, „sie liebt das.“ Er stand auf. „Ich gehe jetzt wieder zurück an die Arbeit. Das liebt Maman auch.“
Er nickte ihr zu, griff den Stuhl bei der Lehne und ging.
Vivienne fingerte nach dem Glas mit Wasser, das Francine aus dem Gartenbrunnen geschöpft und auf das Tischchen neben ihr gestellt hatte, trank und spürte, wie sich das kühle Nass in ihr ausbreitete und einen kleinen See in ihrem Magen bildete. Die Wärme und das kurze Gespräch mit Philippe hatten sie ermüdet. Sie schloss die Augen und nahm mit den verbleibenden Sinnen wahr. Sie sog den Duft der Landschaft in sich auf: Lavendel, Rosmarin und Wildblumen. Ein zielloser Wind streichelte ihr Gesicht und spielte mit den braunen Strähnen, die sich aus dem aufgesteckten Haar gelöst hatten.
Vivienne hörte das Lachen der Menschen auf dem Gut und freundlich gerufene Befehle. Die lebendigen Geräusche verschmolzen mit den zarten Düften und bildeten einen Raum um sie, in dem ihr nur der Wind Gesellschaft leistete.
Sie verbrachte den ganzen Tag in ihrem Sessel im Garten. Bis auf die Begegnung mit Philippe und das gelegentliche Erscheinen von Francine, die sich im immer selben freundlichen Tonfall nach ihren Wünschen erkundigte, blieb sie allein.
Als die Sonne hinter den Bergen versank, die Menschen auf dem Gut die Arbeit niederlegten und ihre Häuser aufsuchten, verließ sie den Sessel und kehrte zurück auf ihr Zimmer.
Sie legte die Kleider ab und stand jetzt vor dem großen Porzellantisch. Die Waschschüssel war mit warmem Wasser gefüllt, ein Schwamm, Seife, mehrere Leinentücher und eine große Bürste bereit gelegt worden.
Vivienne tauchte den Schwamm in die Schüssel, wrang ihn aus und presste ihn auf ihr Gesicht. Die warme Feuchtigkeit war so beruhigend.
Sie blickte in den blanken Spiegel über dem Porzellantisch und fuhr mit den Zeigefingern die Ränder unter ihren Augen nach. Sie würden verblassen, wenn sie erst wieder vollständig genesen und zu Kräften gekommen war. Die tiefen Risse auf Wange und Stirn hatten nur zwei haarfeine Linien hinterlassen.
Vivienne nahm sich Zeit, sich sorgfältig zu waschen. Anschließend warf sie einen Blick in den Schrank, in dem ihre neuen Kleider hingen. Madame Hérault hatte es sehr gut mit ihr gemeint. Sechs Kleider, mit dem beigefarbenen, das sie tagsüber getragen hatte, waren es sieben – eines für jeden Tag der Woche. Im Schrank hing auch ein wärmender Umhang mit Kapuze, auf einem Brett lagen zwei Häubchen und Unterzeug.
Vivienne wählte ein olivgrünes Gewand mit feiner Spitze über den Brüsten und an den Handgelenken. Sie nahm die Nadeln aus ihrem Haar, das ihr glatt und dunkel bis auf die schmalen Hüften fiel, und kämmte es mit langen Bürstenstrichen.
Derart versunken fuhr Vivienne erschrocken zusammen, als es an der Zimmertür klopfte.
„Ja?“ fragte sie.
„Ich bin es, Philippe, ich möchte Euch zum Abendessen begleiten.“
„Oh, einen Moment bitte“, antwortete Vivienne und steckte sich eilig das Haar auf.
Sie öffnete die Zimmertür. Philippe lehnte mit verschränkten Armen am Treppengeländer und machte große Augen. „Ihr seht bezaubernd aus. Man glaubt kaum, dass Ihr kürzlich noch so krank ward“, staunte er.
Obwohl sie männliche Komplimente und Schmeicheleien gewöhnt war, errötete Vivienne verlegen und murmelte einen schüchternen Dank.
Philippe reichte ihr einen Arm und führte sie über die breite, geschwungene Holztreppe hinunter in die Eingangshalle des Hauses. Aus dem gegenüber der Treppe liegenden Zimmer hörten sie Stimmen.
Viviennes Begleiter nickte in diese Richtung.
„Das ist der Speiseraum.“
Die Flügeltüren zu dem mit Kerzen erleuchteten Raum standen weit offen. An einem großen Holztisch in der Mitte des Zimmers saßen sich zwei Paare gegenüber. Neben den Frauen war jeweils ein eingedeckter Platz noch unbesetzt. Am Kopf des Tisches befand sich ein weiteres Gedeck, der Stuhl davor war ebenfalls noch leer.
„Darf ich Euch unseren Gast vorstellen – Vivienne Sésérac“, sagte Philippe, „und das“, er ging mit ihr zu einem der Männer, „das sind mein älterer Bruder Daniel und seine Frau Christine.“
Daniel stand auf und küsste Viviennes Hand auf dieselbe galante Art wie sein Bruder Philippe wenige Stunden zuvor, als er sie im Garten aufgesucht hatte.
Christine lächelte ihr fröhlich zu. Sie war klein und zierlich, hatte ein herzförmiges Gesicht mit einer winzigen Nase und einem kleinen, schön geformten Mund. Sie lächelte und an den Außenrändern ihrer grauen Augen bildeten sich Tausende winziger Fältchen. Sie trug das geflochtene, goldbraune Haar um den Kopf gewunden.
„Wir freuen uns über Eure Gesellschaft heute Abend“, sagte sie mit einer klaren, für ihre Erscheinung außergewöhnlich tiefen Stimme.
Philippe führte Vivienne auf die andere Seite des Tisches. „Mein jüngerer Bruder Claude“, Claude küsste ihre Hand, „und seine Frau Claire.“
„Angesichts der Anwesenheit unseres Gastes schlage ich vor, die Tischordnung zu ändern“, sagte Christine. „Wir Frauen nehmen auf der einen Seite des Tisches Platz, die Männer auf der anderen.“
Claire hob die Schultern und rückte ihren Stuhl geräuschvoll zurück.
Daniel stand ebenfalls auf und ging um den Tisch herum.
Philippe half Vivienne, neben Christine Platz zu nehmen.
Im selben Augenblick betrat eine schlanke Frau den Raum.
„Maman“, rief Claude.
Er sprang auf und zog geflissentlich den Stuhl am Kopf der Tafel zurück.
„Danke, meine Lieber“, antwortete die Frau.
Das war Ludivine Hérault. Vivienne erhob sich.
„Ich heiße Euch auf das Allerherzlichste bei uns willkommen“, sagte Ludivine und nahm Viviennes Hand.
Ihr Händedruck war fest.
„Ich schaute während Eurer Krankheit des Öfteren nach Euch. Leider schlieft Ihr immer tief und fest. Wie ich hörte, verbrachtet Ihr den heutigen Tag im Garten?“
Vivienne nickte.
„Wie gern hätte ich Euch begrüßt. Die Geschäfte erforderten allerdings meine Anwesenheit in St. Pons.“
„Ich danke Euch für die Gastfreundschaft, Madame. Ich bin zutiefst dankbar für alles, was Ihr für mich getan habt“, sagte Vivienne.
„Fühlt Euch bei uns zuhause. Und bleibt, solange Ihr mögt beziehungsweise es einrichten könnt.“
Ludivine nahm Platz.
„Ah, Ihr habt die Plätze getauscht. Sehr rücksichtsvoll gegenüber unserem Gast.“
Sie klatschte in die Hände, und die Tür zum angrenzenden Raum öffnete sich. Agnès und Francine traten ein. Agnès schloss die große Doppeltür des Salons. Dann füllte sie die Gläser auf dem Tisch mit Wasser und Wein, während Francine eine große, dampfende Schüssel auf den Tisch stellte und begann, mit einer Kelle Suppe in die Teller zu schöpfen. Sie war jetzt schwarz gekleidet und trug ein weißes Häubchen über dem strengen Haarknoten.
Ludivine faltete eine Serviette auseinander und legte sie in ihren Schoß.
„Guten Appetit“, wünschte sie.
Während sie die schmackhafte Suppe kostete, betrachtete Vivienne Ludivine unauffällig aus den Augenwinkeln. Das hatte sie bei den zahlreichen Gesellschaften, die ihre Eltern gegeben hatten, gelernt und im Laufe der Jahre perfektioniert.
Ludivine hatte kluge grüne Augen, die unter schweren Lidern immer noch leuchteten und weißes, kurzes Haar über einem runden Gesicht mit tiefen Grübchen. Ihre Haut war gebräunt, was darauf schließen ließ, dass sie sich nicht wie andere Damen ihres Standes außerhalb des Hauses in den Schutz eines Sonnenschirms begab. Die schlanke Frau war klein, im Gegensatz zu ihren drei Söhnen, die hoch gewachsen waren.
Alle drei Männer hatten türkisfarbene Augen. Während Daniel und Claude ihr tiefschwarzes, glattes Haar kurz trugen, schienen Philippes pechschwarze Locken ein trotziges, unbändiges Eigenleben auf seinem Kopf zu führen.
Philippe und Daniel besaßen ovale Gesichter mit schönen geraden, langen Nasen. Claude hatte das runde Gesicht seiner Mutter und ihre feine kurze Nase geerbt.
Vivienne fragte sich, wie wohl Ludivines Ehemann aussehen mochte und wo er sich aufhielt.
Sie blickte von ihrem Teller auf und wurde des Kamins gewahr, der sich neben der Tür zur Küche befand. In ihm prasselte ein kleines Feuer. Jetzt im Frühjahr waren die Tage schon sehr warm, doch abends sanken die Temperaturen beträchtlich.
Mit der ihr eigenen, geübten Unauffälligkeit studierte Vivienne das mit einem goldenen Rahmen verzierte Ölgemälde über dem Kamin. Es zeigte einen etwa vierzigjährigen Mann mit hellblauen Augen. Sein lockiges Haar umrahmte ein sehr schmales Gesicht mit einer langen, geraden Nase über vollen Lippen. Er hatte große Ähnlichkeit mit Philippe. War das der Vater der drei Männer? Ludivines Ehemann?
„War die Suppe nach Eurem Geschmack?“ erkundigte sich ihre Gastgeberin und legte den Löffel auf ihren Teller.
„Wunderbar, danke. Ich erinnere mich kaum an eine so köstliche Mahlzeit“, antwortete Vivienne unbedacht und errötete.
Sie war fest entschlossen, weder zu sagen, woher sie kam, noch wohin sie wollte, und sie beschlich eine leise Angst, sich durch unbedachte Äußerungen zu verraten.
Aber Ludivine sah sie ohne Argwohn warmherzig an: „Dann werdet Ihr beim Hauptgericht Augen machen“, sagte sie verheißungsvoll, während Francine die leeren Suppenteller abräumte.
Agnès betrat den Salon und stellte eine Platte mit Fleisch auf den Tisch.
„Heute Abend gibt es kleine, gefüllte Wachteln mit Kartoffeln. Und ich hoffe, Ihr mögt unseren Salat. Christine pflanzt im Gemüsegarten alles an, was hier wächst und gedeiht. Und das scheint mir eine ganze Menge zu sein.“ Ludivine schenkte ihrer Schwiegertochter einen liebevollen Blick und zog bewundernd eine Augenbraue hoch. „Ihr werdet doch noch eine Weile bei uns bleiben, oder?“ fragte sie dann freundlich.
„Wenn es Euch genehm ist, sehr gerne“, antwortete Vivienne zaghaft.
„Darf ich Euch in diesem Fall eine Aufgabe anvertrauen?“
„Selbstverständlich.“
„Würdet Ihr nach dem Frühstück mit Agnès den Speiseplan für den Abend zusammenstellen?“ Ludivine machte eine kurze Pause. „Natürlich nur, wenn Ihr Euch schon dazu in der Lage fühlt.“
„Oh“, machte Vivienne, „es wäre mir eine große Ehre und eine ebensolche Freude.“
„Philippe“, sagte Ludivine, „und vielleicht hast Du kurzfristig Gelegenheit, unserem Gast zu zeigen, was wir hier tun.“
„Das werde ich“, sagte Philippe und sah seine Mutter mit dem Blick des den Eltern gegenüber üblichen Gehorsams an.
Vivienne betrachtete ihn kurz. Den Bruchteil eines Lidschlags lang beschlich sie das Gefühl, als verberge sich hinter seiner Zusage, den Wunsch seiner Mutter zu erfüllen, auch Freude, dass sie ihm diese Aufgabe angetragen hatte. Im selben Augenblick schämte sich Vivienne dieses Gedankens und schob den flüchtigen Eindruck auf das fast leere Glas Wein, das sie zügig geleert hatte. Die Wirkung des Weines hatte sich nach der langen Abstinenz infolge ihrer Krankheit umso schneller eingestellt. Um weiteren derart schamlosen Gedanken vorzubeugen, betupfte sie ihren Mund mit der in ihrem Schoß liegenden Serviette und nahm einen großen Schluck Wasser in der Hoffnung, sich weiterer ähnlicher Gefühle schnellstmöglich erwehren zu können.
Als Vivienne später in die weichen Kissen ihres geräumigen Bettes sank, fühlte sie sich so wohl wie schon seit langem nicht mehr. Alles war so weit entfernt: der für sie ausgesuchte ungeliebte Ehemann, der Beginn ihrer Reise, der Überfall, die Angst zu sterben, die Flucht vor den Räubern, das übermäßige Verlangen nach Wasser und Nahrung und die körperliche Pein, die sie während ihrer Irrungen durch den Wald und der unendlichen Einsamkeit erdulden musste.
Sie fühlte sich wohl auf Auziale.
Am nächsten Morgen suchte Vivienne gleich nach dem Frühstück Agnès in der Küche zur Planung der Speisenfolge am Abend auf. Während Agnès, die fleischigen Hände in die Seiten gestemmt, schmunzelnd auf Viviennes Vorschläge wartete, zog diese angestrengt die Brauen zusammen.
„Was haben wir an Fleisch vorrätig?“ fragte sie und wunderte sich, wie leicht ihr das ‚wir’ über die Lippen kam. Andererseits: Agnès hatte sie gesund gepflegt und warmherzig mit ihr gesprochen, als Vivienne zum ersten Mal aus tiefem Schlaf erwacht war. Die Köchin schien ihr angenehm vertraut.
„Sebastian hat in der letzten Woche ein Wildschein erlegt“, antwortete Agnès, „dazu servieren wir eine Apfelsauce und Salat von unseren Gartentomaten“, half Agnès weiter.
„Und als Vorspeise Suppe?“ fragte die junge Frau und legte den Kopf schief.
„Nein, nein, Francine geht heute ins Backhaus. Deshalb schlage ich zur Vorspeise Brot mit Butter und zur Nachspeise Käse vor.“
Vivienne lächelte die Köchin an. „Wenn Ihr mich jeden Tag so freundlich unterstützt, wird es mir wohl kaum möglich sein, Fehler bei meiner neuen Aufgabe zu machen“, sagte sie dann.
„Das werden wir in jedem Fall zu vermeiden wissen. Morgen reite ich mit Sebastian auf den Markt in St. Pons. Was haltet Ihr von Fisch?“
„Fisch wäre köstlich“, sagte Vivienne.
„Dazu reichen wir frischen grünen Salat mit meiner ganz speziellen Kräutersauce. Für weitere Speisen lasse ich mich auf dem Markt inspirieren.“
Vivienne nickte, verließ die Küche und ging vor das Haus. Die Morgensonne spielte mit den Nadeln der drei Zypressen. Die Baumspitzen bogen sich leicht im schwachen Frühlingswind.
Sie haben mir den Weg hierher gewiesen, dachte Vivienne, in das heimelige Zuhause der Héraults.
„Mein Mann hat sie gepflanzt“, hörte sie.
Die junge Frau fuhr erschrocken herum. Ludivine war hinter sie getreten und legte jetzt ihre Hand beruhigend auf Viviennes Rücken. Ihr Blick wanderte angelegentlich zwischen den Spitzen der Zypressen hin und her.
„Als wir heirateten, versprach er mir, für jedes Kind, das ich ihm schenke, eine Zypresse zu pflanzen. Und er hielt sein Wort. Jedes Mal, wenn ich ihm ein Kind gebar, setzte er – nur einen oder zwei Tage später – eine Zypresse“, sagte Ludivine.
„Warum Zypressen?“ fragte Vivienne.
„Nun, sie schienen ihm ein schönes Sinnbild. Diese einfachen Gewächse weisen Menschen den Weg zum lebensnotwendigen Wasser. Sie sind stark und biegsam. Und für unsere Kinder hatte er ebensolche Wünsche. Sie sollten starke Menschen werden, aber bewegt, wenn andere in Not gerieten. Mir gefiel dieses Sinnbild.“ Ludivine schüttelte den Kopf, wie um einen plötzlichen, lästigen Gedanken zu verscheuchen, und sah Vivienne in die Augen. „Philippe wird gleich bei Euch sein. Er wird Euch auf Auziale herumführen und Euch zeigen, was wir tun. Wenn es seine Arbeit erlaubt und Ihr schon kräftig genug dafür seid, reitet er auch mit Euch in den Weinberg. Guten Tag, meine Liebe.“
Vivienne erwiderte den Wunsch und sah der gedankenverloren ins Haus zurückkehrenden Ludivine nach.
Philippe ließ nicht lange auf sich warten. Plötzlich stand er vor ihr und funkelte sie unternehmungslustig an. „Ich habe nun die Pflicht und unzweifelhaft auch das Vergnügen, Euch das Gut zu zeigen. Wir bauen Wein an“, erklärte er, „aber das macht den geringeren Teil an Arbeit und Erträgen aus. Vornehmlich beschäftigen wir uns mit der Seidenraupenzucht. Kennt Ihr Euch damit aus?“
Vivienne schüttelte den Kopf.
Philippe fasste sanft, aber fest ihren Ellbogen und führte sie auf einem schmalen Kiesweg hinter das Haus. Der Kies knirschte angenehm unter ihren langsamen Schritten. Vivienne atmete tief den Duft des Gartens ein.
„Darf ich Euch davon erzählen?“ fragte Philippe, „von der Seidenraupenzucht, meine ich.“
Die junge Frau nickte.
„Die Zucht von Seidenraupen muss sehr sorgfältig vorbereitet und begleitet werden“, begann Philipp. „Seht Ihr? Dort hinten stehen unsere Maulbeerbäume.“ Er wies auf eine große Ansammlung kraftvoller Bäume. „Mit den Blättern dieser Bäume füttern wir die Raupen. Im Frühling, kurz bevor die Maulbeerbäume grün werden, legen wir die Grains, die Eier, zur Ausbrütung in Zimmern aus.“
Philippe zeigte mit der Hand auf die Häuser jenseits des Gartens. „Die Temperatur in den Zimmern erhöhen wir jeden Tag um ein bis drei Grad. Wir fangen bei Null Grad an und hören bei 18 bis 20 Grad auf.“
Er blieb stehen, ließ Vivienne los und strich sich mit den Fingern eine Locke aus der Stirn. Seine Augen leuchteten. „Wir müssen die Grains mit großer Achtsamkeit behandeln. Sie sind sehr empfindlich.“
Philippe schien sich der Aufgabe, mit der die Héraults ihren Lebensunterhalt bestritten, mit einer besonders ambitionierten Leidenschaft zu widmen. Eine solche Passion war ihr fremd. Weder ihr Vater noch ihre Brüder oder der Mann, dem sie versprochen gewesen war, hatten jemals so enthusiastisch von ihrer Arbeit gesprochen. Sie hatten über gute oder exzellente Ernten und Erlöse disputiert und sich in Gesprächen zu übertrumpfen gesucht, wer die besseren Geschäfte machte. Aber nie hatte Vivienne sie so begeistert über ihre Arbeit reden hören wie jetzt Philippe.
„Es ist auch möglich, die Grains in Brutöfen aufzuziehen. Aber wir züchten noch nach der konventionellen Methode. Nach zehn bis 15 Tagen schlüpfen die Raupen. Wir heben sie vorsichtig mit jungen Maulbeerblättern auf und betten sie auf Hürden im Aufzuchtlokal. Sowohl die Hürden als auch das Aufzuchtlokal müssen zuvor äußerst penibel gereinigt werden.“
Während Philippe erklärte, beobachtete er aufmerksam das Gesicht der jungen Frau und suchte vergeblich nach Anzeichen gelangweilter Müdigkeit. Sie war interessiert, stellte Philippe erstaunt fest. Er fuhr fort: „Nun müssen die Raupen Tag und Nacht alle drei Stunden mit frischen Maulbeerblättern gefüttert werden. Nur in den Häutungsperioden unterbrechen wir die Fütterung.“
Philippe nahm erneut Viviennes Arm und schlenderte mit ihr an den Gebäuden vorbei, in denen die Seidenraupen gezüchtet wurden. Daneben lagen drei zweistöckige Häuser.
„Hier leben unsere Arbeiter.“ Der junge Mann blieb wieder stehen. „Ihr müsst Euch noch schonen. Bitte setzt Euch. Ich hole Euch Wasser aus dem Brunnen.“ Er bedeutete Vivienne, auf der Bank am Weg Platz zu nehmen.
Entspannt lehnte sie sich zurück und entdeckte einen kleinen Jungen, der vor der Tür eines der Wohnhäuser hockte und aufmerksam den Boden betrachtete.
„Was tust Du da?“ fragte Vivienne.
Der Kleine schaute mit scheuem Blick zu ihr auf. „Ich beobachte die Ameisen“, antwortete er leise, „und Ihr?“
„Ich ruhe mich einen Moment aus.“
„Seid Ihr die Frau, die so lange krank gewesen ist?“
Der Junge machte einige Schritte auf Vivienne zu.
„Ja, ich war sehr lange sehr krank. Aber jetzt geht es mir wieder recht gut. Wie heißt Du?“
„Michel“, antwortete der Junge, „Und Ihr?“
Vivienne nannte ihren Namen, „Wie alt bist Du?“
„Ich bin schon sechs. Aber sie lassen mich noch nicht mitarbeiten. Sie sagen, ich bin noch zu klein. Wenn ich sieben bin, darf ich helfen, sagt meine Maman. Dann bin ich groß genug, um die Betten zu wechseln.“
„Wie das?“ fragte Vivienne erstaunt, „wie willst Du die schweren Damastüberzüge denn von dem noch schwereren Bettzeug nehmen?“
Michel freute sich augenscheinlich, mehr zu wissen als die Erwachsene. „Nein, nein, ich spreche von den Betten der Raupen.“
„Ach so“, machte Vivienne, „das meinst Du“, und verstand überhaupt nicht.
Philippe setzte sich neben sie und reichte Vivienne ein Glas Wasser. „Das erkläre ich Euch später“, flüsterte er. An Michel gerichtet, sagte er: „Du darfst mit Mademoiselle Sésérac noch nicht allzu lang reden. Sie muss noch sehr auf sich achten. Sie ist gerade erst genesen.“
Vivienne schmunzelte, wurde jedoch sofort wieder ernst, denn Michel errötete bis zum Haaransatz. Verlegen zupfte er an seinem Ohrläppchen und trat von einem Bein aufs andere.
„Mein lieber, kleiner Michel“, sagte sie sanft, „es war sehr schön, Dich kennenzulernen. Ich hoffe, dass wir unsere Unterhaltung bald fortsetzen.“ Sie nahm einen Schluck Wasser und rieb sich die Schläfen. „Philippe, ich bin ein wenig erschöpft. Und ich benötige etwas Abkühlung. Macht es Euch etwas aus, mich zum Haus zu begleiten?“
„Selbstverständlich nicht.“
Philippe sprang auf und reichte Vivienne seinen Arm. „Es tut mir leid. Seid Ihr unpässlich?“
Vivienne machte eine abwehrende Handbewegung. „Nein, ich bin nur etwas müde. Salut, Michel.“ Vivienne hob die Hand und winkte dem Jungen zum Abschied.
Philippe führte sie in den Salon, der sich gegenüber dem Speisezimmer befand. Vivienne nahm auf dem ausladenden Sofa Platz, das mit smaragdgrünem Samt bezogen war. Philippe holte einen dazu passenden Beinhocker, den Vivienne gern, wenn auch verwirrt, in Anspruch nahm. Es stand – so hatte man sie gelehrt – nur Herren zu, einen Beinhocker zu benutzen, während die Damen ihre Füße sittsam auf dem Boden beließen. Doch im Hause der Héraults schien man auf Konventionen zwar großen Wert zu legen, doch keine Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Privilegien für Männer und Frauen zu machen.
„Habe ich Euch zu viel zugemutet?“ fragte Philippe, und Vivienne bemerkte aufrichtige Besorgnis in seiner Stimme.
„Aber nein, Euer Bericht hat mich sehr interessiert. Ich möchte mehr über Eure Arbeit erfahren. Es ist nur: Die Hitze und das ungewohnte Gehen, nachdem ich so lange liegen musste – das hat mich schnell geschwächt“, antwortete Vivienne und hob entschuldigend die Hände.
„Ihr möchtet mehr wissen?“ Philippes Augen blitzten auf. „Ich freue mich darauf, Euch alles zu erzählen, alles zu zeigen.“
„Bitte“, fragte Vivienne und beugte sich vor, „was hat es mit dem Bettenwechseln auf sich? Ich war unehrlich gegenüber Michel. Ich gab vor zu wissen, was es bedeutet, aber…“ Sie hob die Schultern.
„Das habt Ihr gestern unwissentlich beobachtet. Ihr saht, wie Männer, Frauen und Kinder Körbe in die Häuser brachten, die uns als Aufzuchtlokale dienen. Darin befanden sich Blätter und löchriges Papier Und sie kamen mit braunen Matten heraus. Nach der ersten Häutung der Raupen müssen wir die alten Lager mit den Exkrementen und Blattresten fortbringen. Erst werden löchriges Papier und frische Blätter auf die Raupen gelegt. Die Raupen kriechen darunter hervor, und wir übertragen sie auf neue Hürden. Die alten Lager rollen wir auf und schaffen sie weg. Das nennt man Bettenwechseln.“
Philippe zog die Stirn in Falten und sah ein wenig hilflos aus.
„Ja, jetzt habe ich verstanden – wirklich“, sagte Vivienne. „Und was passiert als nächstes?“
„Als nächstes? Nun, nach etwa 30 bis 35 Tagen hören die Raupen auf zu fressen. Dann stellen wir Spinnhütten auf.“
Philippe machte ein fragendes Gesicht.
„Ihr vermutet richtig“, gab Vivienne zu, „ich weiß nicht, was Spinnhütten sind.“
„Es handelt sich dabei um lose Bündel aus Stroh. Sie werden zwischen zwei Hürden aufgestellt. Die Raupen kriechen in diese Bündel“, erklärte Philippe. „Nachdem sich alle Raupen in die Spinnhütten zurückgezogen haben, warten wir acht Tage. In dieser Zeit verpuppen sie sich. Nun zerlegen wir die Spinnhütten und sammeln die Kokons ein. Anschließend wird sortiert. Schwache oder fleckige Kokons verwenden wir nicht.“
„Und was geschieht mit den Kokons, die nicht schwach oder fleckig sind?“
„Die kommen in besondere Öfen.“
Vivienne verzog das Gesicht. „Der letzte Teil behagt mir nicht sonderlich“, sagte sie.
Philippe lachte. „Ich stimme Euch zu. Als ich noch ein Junge war, habe ich jedes Jahr, wenn die Kokons in die Öfen kamen, bitterlich geweint. Aber im Laufe der Jahre habe ich mich offensichtlich daran gewöhnt.“
„Ach, hier finde ich Euch.“ Claire lehnte sich gegen den Türrahmen und verschränkte die Arme vor der Brust. Philippe und Vivienne, ganz vertieft in ihr Gespräch, sahen überrascht auf. Sie hatten sie nicht kommen hören.
„Maman sucht Dich. Sie ist mit den Büchern befasst und möchte einige Positionen mit Dir besprechen.“
Philippe erhob sich. „Ihr entschuldigt mich?“
„Selbstverständlich“, antwortete Vivienne.
„Aber geht bitte nicht fort. Ich komme wieder.“ Philippe zwängte sich an seiner Schwägerin vorbei.
Claire schloss die Tür hinter ihm. „Gefällt es Euch bei uns?“ fragte sie dann.
„Oh ja“, antwortete Vivienne und lächelte warmherzig. „Sogar sehr. Ihr seid eine sehr gastfreundliche Familie.“
„Mhmm“, machte Claire und nagte an ihrer Unterlippe.
„Euer Schwager war so freundlich, mir die Seidenraupenzucht zu erklären.“
„Aber Ihr hattet, so hoffe ich, dennoch Gelegenheit, Euch um die Speisenfolge für den heutigen Abend zu kümmern?“
Vivienne nickte.
„Nun, ich muss Euch leider verlassen. Es gibt viel zu tun auf einem so großen Gut wie Auziale. Wir sehen uns spätestens beim Abendessen.“ Claire setzte ein schiefes Lächeln auf und verließ den Raum.
Vivienne atmete tief ein. In Claires alleiniger Anwesenheit hatte sie sich plötzlich unwohl gefühlt. Hatte sie mit der Aussage, auf Auziale gäbe es viel zu tun, Kritik an ihrem Müßiggang und Philippes Arbeitsmoral geübt? Weil er sie heute auf einem Rundgang über das Gut begleitet hatte? Aus welchem Grund hatte Claire sie getadelt?
Das ist absurd, schalt sie sich und schüttelte die entstandene Beklommenheit ab.
Als Philippe in den Salon zurückkehrte, hatte sie die Begebenheit und das damit zusammenhängende Gefühl bereits als empfindliche Fantasie abgetan.
„Ich hoffe, dass Ihr so lange bei uns bleibt, bis wir mit den Kokons nach Lyon reisen.“
„Werden Sie dort verarbeitet?“ fragte Vivienne interessiert.
„Ja, ja“, bestätigte Philippe, „Ich glaube, wir könnten es einrichten, dass Ihr uns begleitet.“
Eine derart lange Reise hatte Vivienne noch nie getan. Natürlich wäre es aufregend, die große Stadt kennenzulernen, die alles, was sie jemals gesehen hatte, übertreffen würde. Andererseits fröstelte es sie bei dem Gedanken an die vielen anstrengenden Tage in einer Kutsche, die auf unbefestigten Wegen in die Ungewissheit fuhr. Zu frisch waren die Erinnerungen an die erst kürzlich erlebten Ereignisse im Wald.
„Oder Ihr erzählt mir, was dort passiert“, sagte sie fröhlich und sah Philippe fest in die Augen.
„Wenn Ihr uns bis dahin verlassen müsst, ...“ Der junge Mann rieb sich mit dem Zeigefinger nachdenklich über die Oberlippe, „dann erzähle ich es Euch.“
Vivienne glaubte, in seiner Stimme ein gewisses Bedauern auszumachen.
„Glaubt Ihr, schon wieder reiten zu können?“ fragte er dann.
Vivienne nickte.
„Dann zeige ich Euch morgen unseren Weinberg.“
Aber weder am nächsten noch am übernächsten Tag war es Philippe möglich, sich die Zeit für einen Ritt in den Weinberg zu nehmen. Wichtige Aufgaben auf dem Gut machten seine Anwesenheit unabdingbar. Vivienne verbrachte diese Tage in Christines Gemüsebeeten, jätete Unkraut, erntete Salat, unternahm kurze Spaziergänge mit Ludivine und erledigte gemeinsam mit den Frauen notwendige Handarbeiten.
Die Sonne brannte auf Auziale herab, während Philippe und Vivienne zwei Tage später über die baumbesäumte Allee ritten. Die Blätter der Rotbuchen bewegten sich leicht im Wind, der Vivienne und Philippe ein wenig Kühlung verschaffte. Philippe schwieg. Er hatte sie kurz mit einem strahlenden Lächeln begrüßt, ihr galant auf das Pferd geholfen und lenkte jetzt stumm sein Ross neben dem ihren.
Vivienne blickte ihn an. Er hatte ein schönes Profil mit markanten Wangenknochen. Seine widerspenstigen Locken wippten mit dem Schritt seines Pferdes auf und ab.
Er drehte sich zu ihr und strich sich eine Locke aus der Stirn. Seine türkisfarbenen Augen leuchteten geheimnisvoll, aber warm im Licht der durch die Baumkronen gefilterten Sonne.
Am Ende der Allee wand sich rechter Hand ein Pfad in den Berg. Philippe lenkte sein Ross auf den leicht ansteigenden Weg, und Vivienne tat es ihm gleich. Der Pfad war gesäumt von knorrigen Montpelliereichen, deren Blätter im Licht wie Smaragde glühten.
Sie passierten aus Bruchstein errichtete Terrassen, auf denen sich kräftige Maronenbäume in den Himmel reckten. Vivienne fragte sich, wie viel Zeit und wie vieler Hände Arbeit es bedurft hatte, eine einzige Terrasse fertigzustellen. Die großen, schweren Steine lagen gleichmäßig aufeinander geschichtet, die Zwischenräume waren sorgsam mit Erde gefüllt. Auf einigen Terrassen entdeckte Vivienne kleine Häuser aus demselben Stein, die sich fast unsichtbar in ihre Umgebung fügten.
„Sie bestehen meist nur aus zwei Zimmern“, erklärte Philippe, als eine Kate abermals Viviennes Blick fesselte. „In dem unteren Raum leben Mensch und Tier, oben wird Heu gelagert.“
„Sind sie noch bewohnt?“ fragte Vivienne und fuhr sich mit dem Handrücken über die Stirn, auf der sich winzige Schweißperlen gebildet hatten.
„Einige von ihnen“, antwortete Philippe. „Es gibt immer noch Menschen, die sich von Maronen ernähren. Aber mit Beginn der Seidenindustrie zog es immer mehr Familien in die Städte. Unsere Mazets im Weinberg sind ein wenig größer als diese Häuser.“
Sie kannte Mazets, die kleinen Herbergen, die den bei der Traubenlese von Weinberg zu Weinberg ziehenden Tagelöhnern Schutz und Unterkunft boten. Hier verbrachten die Arbeiter die Nacht, bevor sie mit Anbruch des neuen Tages die reifen, süßen Trauben pflückten oder zum nächsten Berg weiterzogen.
Der Pfad bog sich ein letztes Mal und endete ganz plötzlich vor einem Feld voller sprießender Rebstöcke – so weit das Auge blicken konnte. Arbeiter waren mit der sorgfältigen Pflege des Berges beschäftigt, entfernten Unkraut und schnitten trockene Triebe aus den Weinstöcken.
„Wir reiten zur Quelle“, schlug Philippe vor. „Unsere Pferde sind durstig, und uns würde eine kleine Erfrischung ebenfalls gut tun.“
Sie ritten an den Arbeitern vorbei, die neugierig aufsahen, an ihre Mützen tippend grüßten, um sich dann wieder mit gebeugten Rücken den Reben zu widmen.
Klares, kaltes Wasser sprudelte aus dem Berg in ein Becken, schwappte über den Rand und versickerte lautlos in der Erde.
Sie saßen ab. Philippe nahm zwei Holzbecher aus einer am Sattelknauf seines Tieres befestigten Tasche und füllte sie mit Wasser. Vivienne trank gierig ihren Becher leer.
„Mhmm, das tut gut“, sagte sie und füllte den Becher erneut. Das kalte Wasser perlte glitzernd über ihre warme Hand, in den Tropfen die Farben des Regenbogens.
Ihr Begleiter lächelte und strich sich eine Locke aus der Stirn. „Ich habe uns Proviant einpacken lassen. Das Reiten hat Euch hoffentlich ein wenig Appetit gemacht?“
„Sehr verlockend“, antwortete Vivienne, während Philippe sich wieder der Satteltasche zuwandte. „Da haben wir Brot, Käse, kaltes Fleisch, Obst und etwas, auf dem wir uns niederlassen können.“
Er breitete die Decke aus, an die Agnès ebenfalls gedacht hatte. Während Philippe Brot in Scheiben schnitt und Obst in mundgerechte Stücke zerkleinerte, redete er über die vom Frühling bis in den Winter nötigen Arbeiten im Weinberg. Und Vivienne gefiel es ungeheuer, seinen begeisterten Erzählungen zu lauschen. War er auf dem Weg zur Plantage noch irgendwelchen trüb wirkenden Gedanken nachgegangen und fast stumm neben oder vor Vivienne her geritten, unterbrach er sich jetzt nur, um sich ein Stück Obst in den Mund zu schieben oder von dem Brot zu kosten.
„Jetzt habt Ihr einen doch sehr umfänglichen Eindruck von allem, was wir hier auf Auziale tun.“ Philippe stand auf und ließ abermals Wasser in die Holzbecher fließen. „Und Ihr erfüllt die Aufgabe, die Euch Maman angetragen hat, auch ganz hervorragend.“
Vivienne lachte. „Meine Aufgabe? Eurer Mutter war sich gewiss, dass Agnès die Speisepläne zusammenstellt. Ich muss nur nicken und freundlich dabei lächeln. Um mich nicht ganz unnütz zu fühlen, helfe ich Christine im Garten und bei den Handarbeiten.“
Philippe schmunzelte.
„Auf dem Weg hierher ward Ihr sehr schweigsam. Ich hoffe, der Ausflug hält Euch nicht von wichtigen Angelegenheiten ab?“
Philippe legte die Stirn in Falten. „Es war unumgänglich, heute in den Weinberg zu reiten, um mir vom Fortschritt der Arbeiten an den Rebstöcken ein genaues Bild zu machen. Ich ging in Gedanken nur einige Positionen in den Büchern durch, über die ich mit Maman gesprochen habe. Ihr erinnert Euch?“
Vivienne nickte.
„Es tut mir leid, wenn ich Euch mit meiner Sprachlosigkeit langweilte“, fuhr er fort. „Das war sehr unhöflich von mir.“
„Oh, keineswegs. Entschuldigt bitte meine direkte Art der Frage.“
„Es ist keine Entschuldigung notwendig. Ich freue mich über Euer Interesse an unserem Leben und unserer Arbeit. Ihr schient nicht gelangweilt, als ich Euch im Detail die Aufzucht der Seidenraupen erklärte.“
„Ihr geht mit einer derart mitreißenden Begeisterung Eurer Arbeit nach, dass es eine Freude ist, Euch zuzuhören. Und Auziale ist wunderschön.“
„Es ehrt mich, dass Ihr Euch wohl bei uns fühlt.“
Ja, ich fühle mich hier sehr wohl, dachte sie.
Verlegen senkte Vivienne den Blick.
Auziale, 10. Juni 1850
Sie wälzte sich unruhig hin und her, zog die Bettdecke glatt oder starrte mit unter dem Kopf verschränkten Armen in die Dunkelheit des Zimmers. Sie fand keinen Schlaf. Seit ihrer Genesung waren vier Wochen vergangen. Und sie war noch immer auf Auziale.
Alle behandelten sie wie ein Familienmitglied und beteiligten sie an den täglichen Aufgaben.
Vivienne fühlte sich wohl – zu wohl.
Denn sie konnte nicht bleiben. Es gab keinen Grund zu bleiben. Sie gehörte nicht zu den Héraults, nicht zur Familie, nicht in ihr Leben, nicht auf dieses Gut. Sie gehörte nirgendwo hin. Sie war ganz allein auf der Welt.
Sie dachte an ihr ursprüngliches Vorhaben, in der Stadt ein neues Leben als Kindermädchen zu beginnen.
Es war Zeit zu gehen. Morgen früh würde sie den Héraults ihre Absicht kundtun. Ihre Augen füllten sich mit Tränen.
Du dummes, kleines Mädchen, schalt sie sich und wischte sich die Tränen energisch von ihren Wangen. Du hast doch gewusst, dass Dein Aufenthalt hier endlich ist, dass Du nach Wiedererlangen Deiner Kräfte gehen musst, auch wenn es schwer fällt.
Und es fiel ihr schwer. Sie hatte sich an die Familie, an ihr Leben mit den Héraults gewöhnt. Sie fühlte sich auf Auziale Zuhause. Wieder allein zu sein, einsam zu sein, war ein unerträglicher Gedanke. Einsam und allein in einer fremden Stadt.
Doch Vivienne hatte den Gedanken kaum zu Ende gedacht, als sie sich eingestand, dass sie nicht völlig ehrlich mit sich war. Natürlich genoss sie das Leben in dieser Familie, die Arbeiten im Garten oder gemeinsam mit den Frauen Wäsche auszubessern. Sie liebte die Gespräche mit der warmherzigen Ludivine und der gemütlichen Agnès. Sie freute sich über das erfrischende Lachen der Kinder auf dem Gut. Aber wenn sie nicht allein gehen müsste, wenn nur jemand mitginge, könnte sie das Gut leichteren Herzens verlassen. Und dieser Jemand war Philippe.
In Gedanken sah sie das Glühen seiner türkisfarbenen Augen, seine braun gebrannten Hände, seinen schönen, vollen Mund. Sie hörte seine Stimme, erinnerte sich seiner Hilfsbereitschaft, seiner freundlichen, charmanten Art und der vertraut und lieb gewordenen Geste, mit der er sein Haar aus der Stirn strich.
Ich liebe ihn, dachte Vivienne erschrocken, ich liebe ihn.
Und das ist der wichtigste Grund, schnellstmöglich aufzubrechen, sagte eine innere Stimme. Auziale ist nicht Dein Zuhause. Und Du darfst Philippe nicht lieben. Du musst Deinen Weg gehen und der führt weg von Auziale, weg von Philippe.
Morgen beim Frühstück werde ich es ihnen sagen und übermorgen reise ich ab.
Jetzt waren die Tränen nicht mehr aufzuhalten.
Vivienne betrachtete das zerwühlte Laken. Sie hatte unruhig geschlafen. An die schlechten Träume erinnerte sie sich nur schemenhaft. Als sie den Speiseraum betrat, saß die Familie bereits beim Frühstück. Philippe stand auf und half ihr, Platz zu nehmen.
„Ich danke Euch“, begann sie und räusperte sich umständlich. „Ich danke Euch für alles, was Ihr für mich getan habt. Ihr habt mich gesund gepflegt, habt mich aufgenommen und mich wie ein Familienmitglied behandelt. Doch jetzt bin ich kräftig genug, um meinen Weg fortzusetzen.“ Vivienne schlug die Augenlider nieder und schluckte. „Ich werde morgen abreisen“, fuhr sie mit fester Stimme fort.
Ludivine legte ihr Messer neben den Teller. „Ich bedaure sehr, dass Du gehen willst, aber wir können Dich nicht aufhalten.“
Könnt Ihr doch, hätte Vivienne am liebsten laut gefleht. Stattdessen biss sie in das Stück Weißbrot, das sie mit Butter und Honig bestrichen hatte, und nahm einen Schluck starken Kaffee.
„Die Kutsche verlässt Olargues morgen Mittag“, erklärte Claire.
Christine drückte sanft Viviennes Hand.
„Schade, dass Du gehst. Du bist mir eine liebe Schwester geworden“, sagte sie leise.
„Das bist Du auch für mich“, antwortete Vivienne und streichelte Christines leicht gewölbten Bauch. Wie gerne hätte sie die Geburt des ersten Kindes von Christine und Daniel miterlebt, Ludivines erstem Enkelkind.
Aber es gab keinen Grund für sie zu bleiben. Sie zwang sich zu lächeln. Sie wollte ihren letzten Tag auf Auziale von Herzen genießen, auch wenn in jedem Augenblick die Wehmut ihr trister Begleiter war.
Der Abschiedsschmerz ließ Vivienne nicht zur Ruhe kommen. Unruhig warf sie sich in ihrem Bett von einer Seite auf die andere. Morgen würde sie sich verabschieden, anschließend von Sebastian nach Olargues begleitet, dort die Kutsche besteigen und dann, ja, dann…
Die junge Frau schlug die Bettdecke zurück, setzte die Füße auf den kalten Boden und sah zum offenen Fenster. Ein zunehmender Mond stand am sternenklaren, schwarzsamtenen Himmel. Die Luft war kühl und roch würzig. Eine Nachtigall in einem Baum sang ihr einsames Lied.
Neben der Tür stand ihr Koffer. Nach dem Abendessen waren Ludivine und Vivienne allein im Speiseraum zurückgeblieben. Die ältere Frau hatte ihre Hand genommen.
„Die Kleider in Deinem Schrank nimmst Du als Geschenk von mir mit auf Deine Reise“, hatte sie dann gesagt.
„Das kann ich nicht annehmen. Ihr habt schon so viel für mich getan.“
„Oh doch, das kannst Du, und das wirst Du.“ Ludivines Ton war sanft, aber bestimmt. „Meine Gedanken werden Dich Dein Leben lang begleiten, und ich wünsche Dir alles Glück der Welt, mein Kind.“
Vivienne hatte dankend den Kopf gesenkt, die ältere Frau auf die Wangen geküsst und sich auf ihr Zimmer zurückgezogen.
Wenig später war Christine mit dem Koffer gekommen, und Vivienne hatte mit einem dicken Kloß im Hals die Garderobe sorgfältig im Koffer verstaut, bis auf den Umhang, eine Haube und das Kleid, das sie auf ihrer Reise tragen wollte.
Sie starrte auf das Gepäckstück und blickte sich dann im Zimmer um. All das würde sie morgen verlassen. Ihre letzte Nacht in diesem Haus. Ihre letzte Nacht auf Auziale. Die Wände des Raums schienen sich auf sie zu zu bewegen und sie wie Mühlsteine zerdrücken zu wollen. Vivienne rang nach Atem.
Sie wollte aus dem Haus, noch einmal in den Garten gehen, in dem sie so gern gearbeitet hatte. Sie wollte zwischen den Maulbeerbäumen tief den mit Lavendel und Rosmarin geschwängerten Duft der warmen Nacht einatmen, den fordernden Wind auf ihrem Gesicht spüren, während sie an den Häusern der Familien vorbeiging, und noch ein letztes Mal am Brunnen stehen. Sie wollte alles in sich aufnehmen, in ihre Seele brennen, damit sie immer und überall die Erinnerung an diese glückliche Zeit mühelos heraufbeschwören könnte. Sie würde das alles sehr vermissen. Sie würde die Héraults vermissen – und vor allem Philippe.
Vivienne schlüpfte in den Umhang, öffnete leise die Tür und betrat den dunklen Korridor.
Die Holztreppen knarrten behaglich unter ihren Schritten. Im Salon brannte Licht. Vivienne hielt inne. Wer außer ihr war um diese Zeit noch wach? Sie hörte zwei Stimmen, die sich in normaler Lautstärke unterhielten. Plötzlich fiel ihr Name. Vivienne lauschte angestrengt.
„Philippe“, sagte Ludivine, „es ist Deine Entscheidung, ganz allein Deine Entscheidung. Und egal, wie sie ausfallen mag, ich werde sie respektieren. Wir wissen nicht, woher sie kommt. Sie hat es uns nicht gesagt, und auch das respektiere ich. Die Wahrheit ist: Vivienne genoss eine gute Erziehung. Sie beherrscht alle Regeln, auf die wir Wert legen, und noch einige darüber hinaus. Sie ist jung und hübsch und liebt es, sich nützlich zu machen.“
„Ja, so ist sie.“ Philippe sprach leise.
„Wenn Du sie liebst, dann sprich mit ihr. Wenn sie uns morgen verlässt, wirst Du sie nie wieder sehen.“
Vivienne hielt den Atem an. Wenn Du sie liebst, dann sprich mit ihr. Philippe liebte sie? Sie schlich am Salon vorbei, öffnete das Eingangportal und schlüpfte hinaus. Vivienne schloss die Tür geräuschlos und setzte sich auf die Holzbank neben der Tür. Ihr Herz schlug wie Trommelstöcke, und sie schluckte schwer. Sie hatte wieder einen Kloß im Hals, aber dieses Mal war er nicht unangenehm. Im Gegenteil! Der Kloß, den sie beim Packen ihres Koffers gespürt hatte, war geboren aus tiefster Angst, aus Unsicherheit vor der Zukunft, aus dem Leid, den Mann zu verlassen, den sie liebte, und in die Einsamkeit zu ziehen. Der Kloß, der nun in ihrem Hals steckte, hatte seinen Ursprung in verzückter Aufregung über das, was Ludivine im Salon gesagt hatte. Sie war Zeuge einer Liebeserklärung geworden, Philippes Liebeserklärung an sie.
Vivienne legte den Kopf in den Nacken und blickte in den Himmel. Sie sah das strahlende Leuchten der Venus über den Zypressen, die sie mit ihren Spitzen zu berühren schienen. Die Tür zum Haus öffnete sich. Vivienne blickte zur Seite. Philippe!
„Vivienne!“ rief er überrascht.
„Ich konnte nicht schlafen“, antwortete sie entschuldigend und zog ihren Umhang enger um sich.
„Darf ich?“ fragte er und deutete auf den Platz neben ihr.
Vivienne nickte stumm.
Philippe setzte sich. Er wirkte befangen. Vivienne erinnerte sich an ihre erste Begegnung, bei der er so forsch auf sie zugegangen war. Wie anders war er jetzt!
„Hast Du Reisefieber?“ unterbrach er das Schweigen.
Die junge Frau schüttelte den Kopf. „Nein, das ist es nicht“, sagte sie dann.
„Siehst Du die Milchstraße?“ fragte Philippe.
Vivienne nickte.
Sie befand sich direkt über der Allee, die zum Haus führte.
„Ich genieße diesen Anblick seit meiner Kindheit. Und ich kann mich einfach nicht satt daran sehen. Sie ist immer wieder ein Wunder für mich.“
Wieder nickte Vivienne stumm in die Nacht.
„Und dort über den Zypressen ist die Venus. Sie ist der hellste Stern.“
Philippe räusperte sich, dann fragte er mit klarer Stimme: „Musst Du gehen oder willst Du gehen? Und wohin?“
Während sie nach den richtigen Worten suchte, wandte sie ihm ihr Gesicht zu und tauchte in seine geheimnisvollen, türkisfarbenen Augen, in denen sich die Sterne widerspiegelten. Der Nachtwind spielte mit ihrem Haar. Philippe schob behutsam eine Strähne aus ihrer Stirn und streifte dabei ihre Haut. Bei seiner Berührung richteten sich die Härchen ihres Körpers auf und ein angenehmes Zittern durchlief sie.
Aus der Ferne vernahmen sie den Lockruf eines Käutzchens. Ein zweites antwortete.
„Vivienne, ich will nicht, dass Du gehst.“ Der junge Mann seufzte. „Ich will, dass Du bleibst – für immer.“
Sie versank in seinen Augen. Philippe war ihr so nah, dass sie ihn riechen konnte. Er duftete nach Philippe, nach würzigem Holz und frischem Wasser. Sein Geruch mischte sich mit den Düften der Nacht und verwirrte sie nun vollends. Ihre Augen füllten sich langsam mit Tränen – ein Lidschlag, und sie liefen unaufhaltsam über ihr Gesicht.
„Jetzt habe ich Dich in Verlegenheit gebracht. Es tut mir so leid! Entschuldige! Ich lasse Dich allein.“
Er sprang auf und machte Anstalten, ins Haus zurückzugehen.
„Nein, bitte geh nicht“, flüsterte Vivienne.
Philippe starrte sie wortlos an.
Vivienne räusperte sich. Dann sagte sie: „Du hast mich nicht in Verlegenheit gebracht. Das sind … Freudentränen.“
Er kniete sich vor sie und nahm zärtlich ihre Hände. „Freudentränen? – Heißt das, Du könntest Dir vorstellen, hier zu bleiben? Hier bei mir? Als meine Frau?“
Vivienne schluchzte.
„Ja, ja. Immer wieder ja.“
Er umfasste ihr Gesicht und rieb mit schwieligen Daumen die Tränenspuren von ihren Wangen. Sie sahen sich tief in die Augen. Vivienne versank in den türkisfarbenen Seen und schloss die Lider.
Kurz darauf fühlte sie seine Lippen, warm und weich. Liebkosend küsste er ihre geschlossenen Augen, ließ seinen Mund sanft über ihre Wange gleiten, bis er ihren Mund unter dem seinen spürte.
Vivienne öffnete ihre Lippen und gab sich dem schönsten Gefühl hin, das sie je erlebt hatte. Der Umhang rutschte von ihren Schultern. Seine Küsse wurden fordernder, während seine Hände ihren Körper streichelten. Sie genoss die Wärme seiner Hände, die den Kleiderstoff durchdrang.
Sie grub ihre Hände in seine vollen, widerspenstigen Locken. Ihr wurde schwindelig, und sie spürte ein unbekanntes Sehnen in ihrem Unterleib. Sie erschrak darüber und zuckte leicht zusammen.
Philippe schob sie ein wenig von sich, nur so weit, dass sie einander in die Augen sahen. Sein Mund war leicht geöffnet.
„Ich liebe Dich, Vivienne, ich liebe Dich für immer.“
Dann zog er sie wieder in seine Arme und hielt sie fest, als wollte er sie nie wieder loslassen.