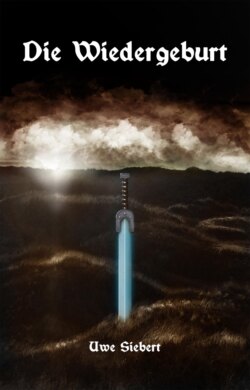Читать книгу Die Wiedergeburt - Uwe Siebert - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 1 – Die weite Steppe
ОглавлениеDer Nordwind trieb leichte Wellen über die Oberfläche des Kharasees, und sein Pfeifen übertönte das Geschnatter der Enten, die am Ufer entlang watschelten. Das Blut eines Mannes, dessen Leichnam mit Gesicht und Brust im zähen Schlamm lag und das klare Wasser rot färbte, störte sie nicht.
Von weit her mochte der Wind kommen, doch in der unendlichen Steppe verharrte er in allgegenwärtiger Erhabenheit. Er schien das Land Majunay, im Osten der Welt, Heimat zu nennen und mit zornigem Zepter zu beherrschen.
Wie vertraut war diese Umgebung noch gestern für den Nomaden Larkyen gewesen. Zu gern hatte er sich in den Weiten des Kharasees verloren, in dem sich an hellen Tagen der Himmel spiegelte und wie das Tor zu einer anderen Welt erschien.
Dieser Tag jedoch hatte alles verändert.
Larkyen kniete mit am Rücken gebundenen Händen auf dem kalten Boden. Die Kälte drang durch das Leder seiner Hose und die Fellstiefel, während der Schurwollstoff seines Hemdes noch immer schweißdurchtränkt war.
Das schulterlange dunkle Haar hing ihm in Strähnen über das Gesicht. Verzweifelt rüttelte er an seinen Fesseln, bis seine Handgelenke wund waren, doch die Stricke ließen sich weder lockern noch lösen.
Zwanzig Winter waren seit seiner Geburt vergangen, und er wünschte sich nichts sehnlicher, als das Kämpfen erlernt zu haben. Als Krieger wäre er zumindest imstande gewesen, den Banditen, die ihn und die anderen dreißig Nomaden des Stammes der Yesugei überfallen hatten, Gegenwehr zu leisten.
Die kreisförmig angelegten Jurtenunterkünfte, die wie Pilze im Gras aufragten, waren schon von weitem unübersehbar gewesen und hatten die Banditen auf eine leicht zu erlegende Beute hingewiesen. Wahrscheinlich hatten sie die Nomaden schon seit Tagen beobachtet und ihren Tagesablauf im Lager studiert.
Die Banditen entstammten dem Land des ewigen Eises im hohen Norden, das Kedanien genannt wurde. Es waren Barbaren von riesenhaftem und muskulösem Wuchs, mit Haut so hell wie der Schnee ihrer Heimat. Sie kämpften mit einer Schnelligkeit und gnadenlosen Brutalität, der kein Nomade gewachsen war.
Larkyen konnte die Erinnerung an ihre Gräuel keinen Augenblick lang verdrängen.
Mit der Morgendämmerung waren sie auf ihren Pferden gekommen – hochgezüchteten, kräftigen Rössern, ihren Herren angemessen – um unaufhaltsam wie eine Lawine zuzuschlagen. Die ersten Warnrufe der Schafhirten wurden durch eine Reihe kedanischer Bogenschüsse erstickt. Und als die Nordmänner zwischen den Jurten hindurch ritten, trampelten ihre Pferde die flüchtenden Nomaden nieder wie Steppengras. Nicht einmal Frauen und Kinder blieben verschont.
Larkyens Adoptivfamilie – die Frau, die er Mutter nannte, den Mann, den er Vater nannte, sowie ihr älterer Sohn – sie alle waren tot. Auch Larkyens Weib Kara, die ihn im nächsten Frühling ein Kind geschenkt hätte, war den Klingen der Banditen nicht entkommen. Und nun neigte sich auch Larkyens Leben dem unvermeidlichen Ende zu. Als einem von vier Gefangenen, die übrig geblieben waren, trennten ihn nur noch einige Atemzüge vom Tod.
Hatte er sich anfangs noch gefragt, weshalb die Banditen überhaupt jemanden am Leben gelassen hatten, war ihm der Grund nun völlig klar.
Schon seit einer Weile beobachtete er, wie sie sich daran ergötzten, die Überlebenden nacheinander öffentlich zu quälen und abzuschlachten. Ein neuer Schwertstreich durchschnitt die Luft, und mit einem dumpfen Laut kullerte ein weiterer Schädel über die Erde – Nase und Ohren waren abgeschnitten, sie dienten den Mördern als Trophäe.
Neben dem Gestank von menschlichem Blut, der die Luft so schwängerte, dass Übelkeit in Larkyen hochstieg, drang auch der Geruch von gekochtem Schaffleisch an seine Nase, das in einem Topf über dem Feuer garte.
Das klagende Blöken der durch das Lager streifenden Schafe deutete darauf hin, dass sie den Tod eines Artgenossen ebenfalls riechen konnten.
Larkyen hörte schwere Schritte, die auf ihn zukamen, dann spürte er einen Schlag gegen seinen Kopf, der ihm beinahe das Bewusstsein raubte. Er sackte mit brummendem Schädel zur Seite. Im nächsten Moment sah er über sich den in Felle gekleideten, kahlköpfigen Banditen, aus dessen stoppelbärtigem Gesicht gelbe Zähne grinsten.
„Du gehörst nicht zu ihnen“, zischte der Glatzkopf. „Deine Augen sind rund, und deine Haut ist hell.“
Er beugte sich zu Larkyen hinab. Seine Hand, an der noch getrocknetes Blut klebte, legte sich um Larkyens Kehle. Lange sah ihm der Bandit ins Gesicht. Larkyen konnte durch sein Äußeres nicht verleugnen, das er aus einem anderen Land stammte als Majunay. Denn während die Haut der Nomadenvölker rötlich und die bernsteinfarbenen Augen in ihren breitwangigen Gesichtern schmal waren, war Larkyens Haut weiß, und seine Augen grün und groß. Die hohen Wangenknochen in seinem schmalen Gesicht verliehen ihm scharfe kantige Züge.
„Wärst du größer und stärker, könntest du glatt von uns abstammen. Doch woher stammst du? Und was hast du bei den Nomaden verloren?“
Der Bandit grinste flüchtig, denn er vermutete, Larkyen müsse irgendwo aus dem Westen stammen.
„Ich bin Kentare!“, sagte Larkyen.
Der Glatzkopf schien beeindruckt.
„Du stammst wirklich aus Kentar? Der Heimat der Wölfe des Westens? Das ist doch der Name, der deinem Volk gegeben wurde, nicht wahr? Warum lässt sich ein Kentare mit diesem schlitzäugigen Majunayvolk ein? Hinter dir liegt mit Sicherheit ein interessantes Leben, aber heute wird es sein Ende nehmen, verlass dich drauf.“
Nach diesen Worten packte der Kedanier Larkyen an den Fesseln und riss ihn auf die Beine. Plötzlich hielt er inne.
„Was ist das?“ flüsterte er, den Blick auf Larkyens linken Handrücken gerichtet. „Du trägst ein Mal.“
Larkyen zuckte zusammen. Das seltsame Zeichen auf seiner Haut war nicht zu übersehen. Es war pechschwarz und hatte die Form einer lodernden Sonne.
Weder er noch die Nomaden und seine Adoptiveltern hatten je erfahren können, was es bedeutete.
„Taloy! Bring den Gefangenen zu unserem Herrn! Na, wird’s bald!“ befahl ein Bandit, der in eine mit Nieten übersäte Lederrüstung gekleidet war. Sein Gesicht zeugte von seiner nordischen Abstammung, und im langen dunkelblonden Haar zeigten sich erste graue Strähnen. Zweifellos war er einer der Ältesten unter den Nordmännern, doch unter Kedaniern ging Alter keinesfalls mit Gebrechen einher, sondern zeugte allenfalls von Erfahrenheit im Kampf.
„Warum dauert es so lange?“ fragte der Kedanier erzürnt. „Unser Herr wartet begierig auf den Nächsten! Oder willst etwa du der Nächste sein?“
„Nein, Wargulf!“ stotterte der Glatzkopf. „Mir ist nur dieser Mann aus dem Westen aufgefallen. Er sagt, er sei Kentare, und er trägt ein merkwürdiges Mal. Sieh doch!“
Wargulf stieß den Glatzkopf zurück und warf einen kurzen Blick auf das schwarze Mal.
„Ich war lange im Westen unterwegs“, sagte er schließlich. „und dieses Zeichen hat ganz sicher eine Bedeutung. Unser Herr sollte sich, nachdem er seinen Durst gestillt hat, den Kentaren mal genauer ansehen.“
Er packte Larkyen an der Kehle.
„Du bleibst am Leben. Jedenfalls fürs erste.“
Ehe er zurück zu den anderen Kedaniern ging, befahl Wargulf dem Glatzkopf: „Du bringst jetzt den nächsten Gefangenen zu unserem Herrn!“
Der Glatzkopf nickte.
„Du kannst dich glücklich schätzen!“ grummelte er, zu Larkyen gewandt.
„Wer ist euer Herr?“ fragte Larkyen. „Wer ist dieser feige Hund, der für all das Morden die Verantwortung trägt?“
Als der Glatzkopf das hörte, schlug er Larkyen sofort zu Boden.
„Wie kannst du es wagen“, schnaubte er und trat Larkyen in den Bauch.
Weitere schmerzhafte Tritte folgten, mit denen Larkyen so lange vor seinem Peiniger hergetrieben wurde, bis er blutüberströmt an einem Felsen liegen blieb und sich prustend übergab.
Der Bandit aus Kedanien spuckte ihn verächtlich an und ging zu den anderen drei Gefangenen, von denen keiner es gewagt hatte, seinen Blick oder gar seine Stimme zu erheben. Machtlos sah Larkyen zu, wie der Glatzkopf zwei weitere Gefangene wegführte.
Der letzte von ihnen war Larkyens gleichaltriger Freund Endrit. Larkyen hörte ihn schluchzen.
„Endrit“, flüsterte er. Der Freund sah kurz zu ihm auf, und Larkyen las in seinen Augen, dass Endrit jeglichen Lebenswillen verloren hatte. Es schmerzte ihn, seinen Kameraden, auf dessen Gesicht sonst stets ein Lächeln spielte, so sehen zu müssen.
Trotzdem verspürte Larkyen Hoffnung – für sie beide. Der Fels, vor dem er lag, war spitz und kantig. Zumindest eine seiner Ecken war scharf genug, um den Strick zerschneiden zu können. Er wollte Endrit soeben von seiner Entdeckung berichten, als der Glatzkopf zurückkehrte.
Diesmal zerrte er Endrit auf die Beine und schob ihn vor sich her, bis eine Reihe eng zusammenstehender Jurten die Sicht auf ihn versperrten. Dahinter ertönte lautes Grölen und Jubeln. Larkyen hörte Endrit um Gnade flehen, darauf folgte das höhnische Gelächter mehrerer Männer.
Nun gab es nur noch ihn, und er musste den Moment nutzen, um fliehen zu können. Larkyen presste seinen Rücken gegen den Felsen. Panisch darauf hoffend, dass ihm genug Zeit blieb, begann er seine Fesseln zu reiben. Sein Herz hämmerte wie wild.
Endlich lockerte sich der Strick, und Larkyen streifte die Fesseln ab.
Im selben Augenblick kam der Glatzkopf zurück. Larkyen behielt die Hände hinter dem Rücken.
„Gleich bist du an der Reihe, unserem Herren gegenüberzutreten“, verkündete der Bandit mit hässlichem Grinsen, während er sich zu Larkyen herabbeugte.
Hinter seinem Rücken tasteten Larkyens Finger nach einem Stein, und er bekam einen faustgroßen Brocken zu fassen. Mit einer raschen Bewegung fuhr seine rechte Hand nach vorn und schmetterte dem Banditen den Stein gegen die Schläfe.
Lautlos fiel der Glatzkopf vornüber. Mit einem Ausdruck von Überraschung und Schmerz sah er zu Larkyen auf. Larkyen hob den Stein und schlug erneut zu, immer und immer wieder, bis das Gesicht des Banditen zu einer blutigen Masse verschmolz.
Larkyen war außer Atem, und sein Herz raste. Er blickte panisch um sich, doch zu seiner Beruhigung hatte ihn niemand gesehen. Nie zuvor hatte er einen Menschen getötet, dennoch verspürte er einen Hauch von Genugtuung.
Nun aber musste er so schnell wie möglich verschwinden. Er wollte leben, um alles in der Welt.
Geduckt schlich er zwischen den Jurten und mehreren Schafen hindurch zu den Pferden, die an ihrer Tränke am Seeufer standen. Die großen kedanischen Rösser boten ihm gute Deckung. Nicht nur, dass sie größer waren als die Steppenpferde der Nomaden, sie schienen auch die Aggressivität ihrer Herren angenommen zu haben. Schnaubend drängten sie mit ihren langen Hälsen die kleineren Artgenossen von der Wasserstelle.
Die Banditen, die sich anscheinend in Sicherheit wähnten, hatten es nicht für nötig gehalten, Wachposten aufzustellen. Während der eine oder andere von ihnen die Leichen fledderte oder die Jurten noch immer nach wertvollen Gegenständen durchsuchte, hatten sich die meisten um das Lagerfeuer und Endrit versammelt.
Larkyen konnte einen Blick aus nächster Nähe auf sie erhaschen. Es mochten fünfundzwanzig Mann sein. Die bauschigen Schafsfelle, die sie über die Schultern trugen, um sich vor dem kalten Wind zu schützen, konnten ihre kräftige Statur nicht verbergen. Ihre straffen Muskeln zeichneten sich sichtbar unter der Kleidung ab, und die Narben auf ihren Gesichtern zeugten von ihren zahlreichen Kämpfen. Der arme Endrit war diesen Wilden ausgeliefert. Sein geschundener Körper war längst blutüberströmt. Die Banditen aus Kedanien schubsten ihn zwischen sich herum, und sobald er zu Boden ging, schlugen oder traten sie auf ihn ein.
Larkyen hätte ihm gerne geholfen, doch was konnte er als einfacher Nomade gegen diese Horde ausrichten?
Plötzlich sah Endrit zu ihm hinüber. Als sich ihre Blicke trafen, glaubte Larkyen, Hass darin zu erkennen. Dieser Hass galt ihm, weil er sich befreit und eine Möglichkeit zur Flucht gefunden hatte, während andere dem Tod geweiht waren. Der flinke Streich einer Schwertklinge enthauptete Endrit.
Die Banditen jubelten und lachten. Auf einmal jedoch verstummten sie.
Ein Mann von erschreckender Leibeshöhe trat zwischen ihnen hervor. Er überragte alle Kedanier, und angesichts seiner gewaltigen Muskeln schien sich keiner unter den Barbaren des Nordens mit ihm messen zu können. Sein schwarzes Haar trug er im Nacken zu einem dicken Zopf geflochten. Sein linkes Auge verschwand unter einer hässlichen Narbe. Die schwere Kettenrüstung, die er über seiner Fellkleidung trug, rasselte bei jedem seiner Schritte. Dieser Hüne ergriff Endrits Haupt am Schopf, hielt es demonstrativ über sich in die Luft, und ließ das herabtropfende Blut in seinen offenen Mund fließen.
Larkyen erschrak, und eine lähmende Furcht überkam ihn.
Der Einäugige war kein Geringerer als Boldar die Bestie, der aus den Weiten der kedanischen Taiga im hohen Norden stammte. Larkyens Adoptivvater Godan hatte abends am Lagerfeuer die grausigen Geschichten von Boldar und seinen Banditen erzählt, wie sie weit durch die Steppen zogen, um zu rauben und zu morden. Von Boldar jedoch hieß es, dass er nicht nur der Beute halber tötete, sondern auch wegen des Blutes seiner Opfer, das er trank, um sich deren Kraft zu bemächtigen. So war er zum stärksten aller Kedanier geworden, und nur ein perfekt ausgebildeter Krieger konnte es mit ihm aufnehmen.
Damals, wenn Larkyen gespannt den Erzählungen seines Adoptivvaters gelauscht hatte, hätte er nie geglaubt, der Bestie eines Tages selbst zu begegnen. Nun aber stand sie direkt vor ihm.
Nachdem der Einäugige genügend Blut getrunken hatte, ließ er den abgetrennten Kopf zu Boden sinken. Dann hob er triumphierend ein langes, prächtiges Schwert in die Luft, dessen Klinge in kühlem Eisblau erstrahlte. Mit donnernder Stimme brüllte er: „Nordar! Heil dem Kriegsgott unseres Volkes.“ Die anderen Kedanier stimmten in den Ruf ein.
Larkyen schwang sich auf den Rücken eines Steppenpferdes. Beruhigend strich er der Stute durch die buschige Mähne und redete ihr gut zu. Dann ritt er geradewegs los.
Er war ein ebenso guter Reiter, wie auch die anderen Nomaden es gewesen waren, denen das Reiten von Kindesbeinen an im Blut lag. Er hatte sich bereits einen guten Vorsprung erarbeitet, als die Banditen seine Flucht bemerkten. Während der kalte Wind seine Ohren peitschte, sich aber auch lindernd über den heißen Schmerz seiner Wunden legte, blickte er zurück.
Acht Reiter folgten ihm. Sie mochten die weiten Grasebenen ebenso gut kennen wie Larkyen, dennoch hoffte er, dass sie sich nicht allzu lange von ihren Gefährten entfernen würden.
In der Ferne ragten die Ausläufer des Altoryagebirges als graue, leicht bewaldete Hügel auf. Dahinter erkannte er bereits die gezackten Berge, die sich beinahe schwarz vor dem Himmel abzeichneten. Spätestens im Gebirge würden die Banditen seine Spur verlieren.
Ein paar Pfeile sausten erschreckend nahe an Larkyens Kopf vorbei.
Wieder drehte er sich um, und abermals schoss einer der Banditen während des Galopps mit seinem Bogen. Da spürte Larkyen einen kräftigen Ruck in seiner linken Schulter, ein stechender Schmerz folgte und raubte ihm fast den Atem. Die Wucht des Pfeils hatte seinen Leib durchschlagen, und dicht neben seinem Kinn ragte die metallene Spitze hervor. Der weiße Stoff seines Hemdes sog sich voll mit Blut. Larkyens linker Arm baumelte herab, und während der Schmerz bis in seinen Oberarm hinab kroch, breitete sich in Unterarm und Fingerspitzen Taubheit aus.
Benommen und mit nur einer Hand an den Zügeln, wurde es für Larkyen immer schwieriger, das Pferd bei vollem Galopp im Zaum zu halten. Der Weg wurde steiler, der Boden immer fester und steiniger.
Nun stellte Larkyen zu seiner Erleichterung fest, das die Banditen die Verfolgung eingestellt hatten und zurück zum Kharasee ritten, der nur noch als großer glänzender Fleck im Tal zu erkennen war.
Rauch stieg von dort auf. Wahrscheinlich brannten die Banditen die Jurten nieder. Dort unten lagen sie, seine Familie, seine Freunde, und mit ihnen alles, was ihm so vertraut gewesen war. Er fragte sich, ob er je über diesen Verlust hinweg kommen würde.
Langsam ritt Larkyen weiter, und je mehr Blut er verlor, umso erschöpfter fühlte er sich. Er ließ das Pferd entscheiden, wohin der Weg führen sollte; er war zu schwach, um noch die Kontrolle behalten zu können. Fest krallte er sich in die Mähne des stämmigen Pferdehalses und ließ schließlich den Kopf sinken, während ihn tiefe Bewusstlosigkeit umfing.