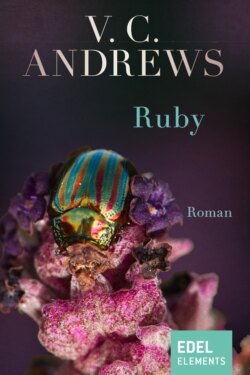Читать книгу Ruby - V.C. Andrews - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5 Wer ist das kleine Mädchen, wenn ich es nicht bin?
ОглавлениеDie Wochen vor dem Sommer und dem Ende des Schuljahrs zogen sich endlos dahin. Mir graute vor jedem einzelnen Tag, an dem ich die Schule besuchen mußte, weil ich wußte, daß ich irgendwann im Lauf des Tages Paul sehen würde oder er mich. In den ersten Tagen, die auf unser furchtbares Gespräch folgten, funkelte er mich jedesmal, wenn er mich sah, wutentbrannt an. Seine einst so schönen sanften blauen Augen, die mich früher so viele Male voller Liebe angeschaut hatten, waren jetzt so kalt wie Granit und voller Hohn und Verachtung. Als wir einander das zweite Mal im Korridor begegneten, versuchte ich, ihn anzusprechen.
»Paul«, sagte ich, »ich möchte mit dir reden, einfach nur, um ...«
Er benahm sich, als hätte er mich weder gehört noch gesehen – er lief einfach weiter. Ich wollte ihm zu verstehen geben, daß ich mich nicht nebenher noch mit einem anderen Jungen traf. Ich fühlte mich schrecklich und verbrachte den größten Teil meines Schultages mit einem bleischweren Herzen in der Brust.
Die Zeit heilte meine Wunden nicht, und je länger wir nicht miteinander redeten, desto härter und kälter schien Paul zu werden. Ich wünschte, ich hätte eines Tages einfach auf ihn zustürzen und mit der Wahrheit herausplatzen können, damit er verstand, warum ich diese Dinge gesagt hatte, die ich ihm hatte sagen müssen, als er an unseren Straßenstand gekommen war, doch jedesmal, wenn ich beschloß, genau das zu tun, fielen mir Grandmère Catherines gewichtige Worte wieder ein: »Willst du diejenige sein, die Feindseligkeit in seinem Herzen sät und ihn dazu bringt, seinen eigenen Vater zu verabscheuen?« Sie hatte recht. Er hätte mich dann nur noch mehr gehaßt, sagte ich mir. Und daher blieben meine Lippen versiegelt, und die Wahrheit blieb auf dem Grund eines Ozeans von heimlichen Tränen verborgen.
Wie oft war ich wütend auf Grandmère Catherine oder auf Grandpère Jack gewesen, weil sie die Geheimnisse nicht preisgaben, die sie in ihren Herzen trugen, und weil sie die Geschichte meiner Familie in ein Mysterium hüllten, das sie in meinem Alter für mich nicht mehr hätte sein sollen. Jetzt war ich kein bißchen besser als sie, denn ich enthielt Paul die Wahrheit vor, aber daran ließ sich absolut nichts ändern. Das Schlimmste von allem war, daß ich tatenlos dastehen und mit ansehen mußte, wie er sich in ein anderes Mädchen verliebte.
Ich wußte schon immer, daß Suzzette Daisy, ein Mädchen in meiner Klasse, für Paul schwärmte. Sie wartete nicht lange, bis sie sich an ihn ranmachte, aber ironischerweise war ich auch erleichtert, als Paul anfing, immer mehr Zeit mit Suzzette Daisy zu verbringen. Jetzt würde er mehr Energie auf seine Zuneigung verwenden statt darauf, mich zu hassen, dachte ich. Ich beobachtete vom anderen Ende des Raumes aus, wie er in der Mittagspause neben ihr saß, und schon bald sah ich, daß sie einander an den Händen hielten, wenn sie durch die Schulkorridore liefen. Natürlich war ich irgendwo in meinem Innern eifersüchtig, und ein Teil von mir wütete über diese Ungerechtigkeit und weinte, wenn ich die beiden miteinander lachen und kichern sah. Dann hörte ich, daß er ihr seinen Ring geschenkt hatte, den sie stolz an einer goldenen Kette um den Hals trug, und eine Nacht lang tränkte ich mein Kissen mit salzigen Tränen.
Die meisten Mädchen, die früher neidisch auf die Zuneigung gewesen waren, die Paul mir entgegengebracht hatte, waren jetzt schadenfroh. Marianne Bruster wandte sich an einem Juninachmittag im Vorraum der Mädchentoilette tatsächlich an mich und platzte mit der Bemerkung heraus: »Jetzt kannst du dich wohl kaum noch für etwas Besonderes halten, nachdem du wegen Suzzette Daisy sitzengelassen worden bist.«
Die anderen Mädchen lächelten und warteten meine Reaktion ab.
»Ich habe mich nie für etwas Besonderes gehalten, Marianne«, sagte ich. »Aber es freut mich, daß du mich dafür hältst«, fügte ich hinzu.
Einen Moment lang war sie fassungslos. Ihr Mund ging auf und schloß sich wieder. Ich wollte an ihr vorbei zur Tür gehen, doch sie wirbelte zu mir herum, warf sich das Haar erst ins Gesicht und dann wieder zurück und in alle Richtungen, damit es sich um sie ausbreitete, als sie mich breit angrinste.
»Also, das sieht dir mal wieder ähnlich«, sagte sie und stemmte die Arme in die Hüften. Sie warf den Kopf beim Reden von einer Seite auf die andere. »Und wie dir das ähnlich sieht, jetzt auch noch geistreich zu sein. Ich weiß nicht, wie du dazu kommst, so rotzfrech zu sein«, fuhr sie fort, und jetzt steigerten sich ihr Zorn und ihre Frustration. »Du bist bestimmt nicht besser als der Rest von uns.«
»Das habe ich auch nie behauptet, Marianne.«
»Wenn überhaupt, dann bist du schlechter als der Rest von uns. Du bist ein uneheliches Kind, genau das bist du«, warf sie mir vor. Die anderen nickten. Das ermutigte sie, meinen Arm zu packen und fortzufahren. »Paul Tate hat endlich einen Funken von gesundem Menschenverstand bewiesen. Er gehört zu jemandem wie Suzzette und ganz bestimmt nicht zu einem Cajun-Mädchen aus der untersten Schicht, zu einer Landry«, schloß sie.
Ich riß mich los und wischte mir die Tränen aus dem Gesicht, als ich aus der Mädchentoilette eilte. Es war nur zu wahr – alle fanden, daß Paul zu jemandem wie Suzzette Daisy gehörte und daß die beiden ein ideales Paar waren. Sie war ein hübsches Mädchen mit langem hellbraunem Haar und vornehmen Gesichtszügen, aber, was noch wichtiger war, ihr Vater war ein reicher Ölhändler. Ich war sicher, daß Pauls Eltern überglücklich über die Wahl seiner neuen Freundin waren. Sie würden ihm keinerlei Schwierigkeiten machen und ihm jederzeit den Wagen geben, wenn er mit Suzzette tanzen gehen wollte.
Obwohl er mit seiner neuen Freundin anscheinend glücklich war, entdeckte ich unwillkürlich immer wieder einen sehnsüchtigen Ausdruck in seinen Augen, wenn er mich gelegentlich sah, vor allem in der Kirche. Da er sich mit Suzzette angefreundet hatte und seit unserem Bruch miteinander mehr Zeit verstrichen war, begann er sich endlich wieder zu beruhigen. Ich hatte sogar den Eindruck, er stünde dicht davor, wieder mit mir zu reden, aber jedesmal, wenn er auf mich zukam, hielt ihn irgend etwas zurück, und er wandte sich wieder ab.
Endlich war zum Glück das Schuljahr vorbei, und damit rissen meine täglichen Kontakte zu Paul ab, wenn sie auch noch so oberflächlich gewesen sein mochten. Außerhalb der Schule lebten er und ich wahrhaft in zwei verschiedenen Welten. Er hatte keinen Grund mehr, zu mir rauszufahren. Natürlich sah ich ihn weiterhin sonntags in der Kirche, aber in Gesellschaft seiner Eltern und seiner Schwestern sah er nicht in meine Richtung. Gelegentlich hörte ich Geräusche, die nach seinem Motorroller klangen, und dann rannte ich zur Tür und schaute voller Vorfreude und in der Hoffnung hinaus, er würde wie früher so oft vor unserem Haus anhalten. Aber es stellte sich jedesmal heraus, daß ein anderer Motorradfahrer oder jemand in einem alten Wagen vorbeifuhr.
Es waren finstere Zeiten für mich, Zeiten, in denen ich so traurig und so müde war, daß es mich jeden Morgen einen Kampf kostete, überhaupt aus dem Bett aufzustehen. Noch schlimmer und härter erschien alles durch die Intensität, mit der die Hitze und die Feuchtigkeit in jenem Sommer das Bayou trafen. Die Temperaturen lagen täglich knapp unter vierzig Grad, und die Luftfeuchtigkeit lag bei etwa achtundneunzig Prozent. Tag für Tag lagen die Sümpfe ruhig und still da, und noch nicht einmal der kleinste Hauch einer Brise schlängelte sich vom Golf herauf, um uns Linderung zu verschaffen.
Die Hitze forderte Grandmère Catherine viel ab. Mehr denn je erdrückte sie die schwüle. Luft. Es war mir verhaßt, wenn sie irgendwo hinlaufen mußte, um jemanden zu behandeln, weil er von einer Giftspinne gebissen worden war oder entsetzliche Kopfschmerzen hatte. Meistens kam sie dann erschöpft und ausgelaugt zurück; ihr Kleid war klatschnaß, das Haar klebte an ihrer Stirn, und ihre Wangen waren dunkelrot. Doch diese Ausflüge und das, was sie dabei leistete, sicherten uns ein geringes Einkommen oder geschenkte Lebensmittel, und da der Handel mit den Touristen in den Sommermonaten praktisch auf Null schrumpfte, kam ansonsten nicht viel dazu.
Grandpère Jack war uns keine Hilfe. Er stellte sogar seine seltenen Beiträge zu unserem Auskommen ein. Ich hörte, daß er mit Männern aus New Orleans Jagd auf Alligatoren machte, weil sie die Häute verkaufen wollten, um daraus Handtaschen, Brieftaschen und alles mögliche herstellen zu lassen. Ich bekam nicht viel von ihm zu sehen, aber jedesmal, wenn ich ihn sah, kam er in seinem Kanu oder seinem Dingi vorbeigetrieben und schluckte schwarz gebrannten Apfelwein oder Whiskey, denn sein größtes Vergnügen war es, das Geld, das er bei der Jagd auf Alligatoren eingenommen hatte, in eine Flasche nach der anderen zu stecken.
An einem späten Nachmittag kehrte Grandmère Catherine noch erschöpfter als sonst von einer ihrer Behandlungen zurück. Sie brachte kaum noch ein Wort heraus. Ich mußte ins Freie eilen, um ihr die Stufen hochzuhelfen. Sie brach regelrecht auf ihrem Bett zusammen.
»Grandmère, deine Beine zittern ja«, rief ich aus, als ich ihr half, die Mokassins auszuziehen. Ihre Füße hatten Blasen und waren geschwollen, vor allem an den Knöcheln.
»Das wird schon wieder gut«, murmelte sie. »Das wird schon wieder gut. Hol mir nur ein kaltes Tuch für meine Stirn, Ruby, Schätzchen.«
Ich lief los, um das Tuch zu holen.
»Ich werde einfach eine Weile liegenbleiben, bis mein Herz wieder langsamer schlägt«, sagte sie zu mir und rang sich ein Lächeln ab.
»O Grandmère, du darfst diese langen Wege nicht mehr zurücklegen. Es ist zu heiß dafür, und du bist zu alt dafür geworden.«
Sie schüttelte den Kopf.
»Ich muß es tun«, sagte sie. »Dafür hat der liebe Gott mich hergeschickt.«
Ich wartete, bis sie eingeschlafen war, und dann verließ ich das Haus und stakte unsere Piroge zu Grandpères Hütte. All meine Traurigkeit und die tagelange Melancholie, die ich in den letzten eineinhalb Monaten hatte ertragen müssen, schlugen in Wut und Zorn um und richteten sich gegen Grandpère. Er wußte, wie schwer wir es in den Sommermonaten hatten. Statt allwöchentlich das Geld zu vertrinken, das er übrighatte, hätte er an uns denken und öfter vorbeikommen sollen, fand ich. Ich beschloß, nicht mit Grandmère Catherine darüber zu reden, denn sie hätte nicht eingestehen wollen, daß ich recht hatte, und sie hätte ihn um keinen Penny bitten wollen.
Im Sommer war der Sumpf ganz anders. Abgesehen davon, daß die Alligatoren, die sich Fett angefressen und ihren Winterschlaf gehalten hatten, erwacht waren, gab es Dutzende und Aberdutzende von Schlangen, die sich zu Klumpen zusammengeschlungen hatten oder wie grüne und braune Fäden das Wasser zerschnitten. Natürlich hingen dichte Wolken von Moskitos und anderen Insekten in der Luft, Chöre von fetten Ochsenfröschen mit vorquellenden Augen und dicken Hälsen krächzten, und Familien von Nutrias und Bisamratten huschten durch die Gegend und hielten nur inne, um mich mißtrauisch zu beäugen. Die Insekten und sonstigen Tiere veränderten den Sumpf beständig. Sie quartierten sich so ein, daß er an Stellen, an denen vorher nichts gewesen war, fast überzuquellen schien, und ihre Netze verbanden Pflanzen und Geäst miteinander. Dadurch schien alles lebendig zu sein, als sei der Sumpf selbst ein einziges großes Tier, das sich bei jedem Jahreszeitenwechsel umformte.
Ich wußte, daß Grandmère Catherine sich darüber aufgeregt hätte, daß ich so spät an einem Sommertag allein durch den Sumpf stakte, aber sie hätte sich auch darüber aufgeregt, daß ich Grandpère Jack besuchen wollte. Doch meine Wut hatte ihren Höhepunkt erreicht und mich aus dem Haus stürzen lassen, und ich war über den Sumpf geeilt und stakte die Piroge schneller denn je. Es dauerte nicht lange, bis ich um eine Biegung kam und Grandpères Hütte vor mir sehen konnte. Als ich näher kam, verlangsamte ich das Tempo jedoch, weil ein schreckenerregender Radau aus dem Haus drang.
Ich hörte Töpfe klappern und Möbelstücke ächzen, dann hörte ich auch Grandpères Brüllen und Fluchen. Ein kleiner Stuhl kam aus der Tür geflogen, und spritzte Schlamm auf, ehe er im Sumpf versank. Ihm folgte ein Topf und dann noch einer. Ich hielt mein Kanu an und wartete. Wenige Momente später tauchte Grandpère auf der Veranda auf. Er war splitternackt, sein Haar war wüst zerzaust, und er hielt eine Peitsche in der Hand. Selbst auf diese Entfernung konnte ich sehen, daß seine Augen blutunterlaufen waren. Sein Körper war mit Schmutz und Schlamm überzogen, und auf den Beinen und im Kreuz hatte er lange, dünne Kratzer.
Er ließ die Peitsche knallen und hieb damit auf etwas in der Luft vor sich ein, und dann schrie er, ehe er noch einmal mit der Peitsche ausholte. Mir wurde klar, daß er sich irgendein Geschöpf einbildete, das gar nicht da war, und ich begriff, daß er sturzbetrunken und unzurechnungsfähig war. Grandmère Catherine hatte mir einen der Anfälle geschildert, die er im Suff manchmal hatte, aber ich hatte es bisher noch nie selbst erlebt. Sie sagte, der Alkohol hätte seinen Verstand so sehr durchtränkt, daß er Wahnvorstellungen und Alpträume hatte, sogar bei Tag. Mehr als einmal hatte er einen dieser Anfälle im Haus gehabt und die guten Sachen, die sie besessen hatten, kaputtgemacht.
»Ich mußte aus dem Haus rennen und abwarten, bis er erschöpft und eingeschlafen war«, berichtete sie mir. »Andernfalls hätte er mir wohl etwas angetan, ohne es selbst zu merken.«
Da ich mich an diese Worte erinnerte, stakte ich mein Kanu in einen kleinen Nebenarm zurück, damit er nicht sehen konnte, daß ich ihn beobachtete. Er ließ die Peitsche immer wieder niedersausen und schrie so laut, daß die Adern auf seinem Hals heraustraten. Dann verfing sich die Peitsche in den Fallen, die er für die Bisamratten aufstellte, und sie verhedderte sich so sehr darin, daß er sie nicht mehr herausziehen konnte. Er legte es so aus, daß das Ungeheuer ihm die Peitsche wegschnappen wollte. Das versetzte ihn in neuerliche Hysterie, und er jammerte und schwenkte die Arme so schnell durch die Luft, daß er von dort aus, wo ich stand, wie eine Kreuzung aus einem Menschen und einer Spinne wirkte. Endlich setzte die Erschöpfung ein, die Grandmère Catherine mir geschildert hatte, und er brach auf dem Fußboden der Veranda zusammen.
Ich wartete eine Zeitlang. Alles war still und blieb still. Als ich mich vergewissert hatte, daß er bewußtlos war, stakte ich zur Veranda, schaute über das Geländer und sah ihn gekrümmt daliegen und schlafen. Die Moskitos, die sich an seiner nackten Haut labten, nahm er nicht wahr.
Ich band das Kanu fest und trat auf die Veranda. Er machte kaum noch den Eindruck, am Leben zu sein, und seine Brust hob und senkte sich nur mit größter Mühe. Ich wußte, daß ich ihn nicht hochheben und hineintragen konnte, und daher ging ich in die Hütte und suchte eine Decke, womit ich ihn zudecken konnte.
Dann holte ich tief und furchtsam Atem und gab ihm einen Stoß, doch seine Lider flatterten noch nicht einmal. Er schnarchte schon. Mir wurde innerlich kalt. Alle Hoffnungen, die ich gehegt hatte, wurden von seinem Anblick und dem Gestank, der von ihm aufstieg, erstickt. Er roch, als hätte er in dem billigen Whiskey gebadet.
»Das also erwartet mich, wenn ich zu dir komme, weil ich Hilfe brauche, Grandpère«, sagte ich erbost. »Es ist eine Schande.« Da er bewußtlos war, konnte ich meine Wut hemmungslos an ihm auslassen. »Was bist du bloß für ein Mensch? Wie kannst du zulassen, daß wir uns abkämpfen und mühsam um das Nötigste ringen? Du weißt doch, wie müde Grandmère Catherine ist. Besitzt du denn gar keine Selbstachtung?
Es ist mir verhaßt, daß ich Landry-Blut in den Adern habe. Es ist mir verhaßt!« schrie ich und schlug mir mit den Fäusten auf die Hüften. Meine Stimme hallte durch den Sumpf. Ein Reiher flog augenblicklich auf, und drei Meter weiter hob ein Alligator den Kopf aus dem Wasser und sah in meine Richtung. Bleib doch hier, bleib doch im Sumpf und schluck deinen Whiskey, bis du daran stirbst. Mir ist das egal«, schrie ich. Tränen strömten über meine Wangen, heiße Tränen der Wut und der Frustration. Mein Herz hämmerte heftig.
Ich schnappte nach Luft und starrte ihn an. Er stöhnte, aber er schlug die Augen nicht auf. Angewidert stieg ich wieder in die Piroge und setzte sie in Bewegung. Dabei fühlte ich mich verzagter und niedergeschlagener denn je.
Da das Geschäft mit den Touristen so gut wie gar nicht existierte und das Schuljahr vorbei war, hatte ich mehr Zeit für meine künstlerische Arbeit. Grandmère Catherine war die erste, der auffiel, daß meine Bilder sich bemerkenswert verändert hatten. Da ich im allgemeinen in einer melancholischen Stimmung war, wenn ich begann, neigte ich jetzt dazu, dunklere Farben zu verwenden und den Sumpf im Zwielicht oder bei Nacht abzubilden, wenn das blasse weiße Licht des Halb- oder Vollmonds durch das gekrümmte Geäst von Mangroven und Zypressen fiel. Tiere starrten mit glänzenden Augen heraus, und Schlangen rollten sich zusammen und nahmen eine Angriffshaltung an, um jeden unerwünschten Eindringling zu töten. Das Wasser war tintig schwarz, und das spanische Moos baumelte wie ein Netz darüber, das dort bereitlag, um den unachtsamen Reisenden einzufangen. Sogar die Spinnennetze, die früher bei mir wie Edelsteine gefunkelt hatten, erschienen jetzt eher wie die Fallen, als die sie ursprünglich gedacht waren. Der Sumpf war ein gespenstischer, unwirtlicher und deprimierender Ort, und wenn ich meinen geheimnisvollen Vater in ein Bild hineinmalte, lag sein Gesicht im Schatten verborgen.
»Ich glaube, den meisten Leuten würde dieses Bild nicht gefallen, Ruby«, sagte Grandmère eines Tages zu mir, als sie hinter mir stand und zusah, wie ich einen weiteren Alptraum in einem Bild einfing. Das ist kein Bild, das die Stimmung hebt und das die Leute in New Orleans sich in ihre Wohnzimmer und Salons hängen wollen.«
»Aber so fühle ich mich im Moment, und so sehe ich die Dinge jetzt, Grandmère. Ich kann nichts dafür«, sagte ich zu ihr.
Sie schüttelte betrübt den Kopf und seufzte, ehe sie sich wieder auf ihren Schaukelstuhl aus Eiche setzte. Ich stellte fest, daß sie immer mehr Zeit dort verbrachte und häufig im Sitzen auf dem Stuhl einschlief. Selbst an bewölkten Tagen, an denen es draußen etwas kühler war, hatte sie keine Freude mehr daran, Spaziergänge an den Kanälen zu machen. Sie hatte keine Lust, wildwachsende Blumen zu suchen, und sie besuchte ihre Freundinnen auch nicht mehr so häufig wie früher. Einladungen zum Mittagessen lehnte sie ab. Sie machte Ausflüchte und behauptete, dies oder jenes zu tun zu haben. Aber im allgemeinen endete es damit, daß sie auf einem Stuhl oder auf dem Sofa einschlief.
Wenn sie nicht wußte, daß ich sie beobachtete, ertappte ich sie dabei, wie sie tief Atem holte und sich die Handfläche auf den Busen preßte. Jede körperliche Anstrengung, sei es das Wäschewaschen, das Putzen oder das Polieren der Möbel und sogar das Kochen, erschöpfte sie schnell. Sie mußte sich häufig zwischendurch ausruhen und um Atem ringen.
Aber wenn ich sie danach fragte, hatte sie immer einen Vorwand parat. Sie war müde, weil sie am Vorabend zu lange aufgeblieben war; sie hatte einen leichten Hexenschuß, sie war zu schnell aufgestanden, alles Erdenkliche brachte sie vor, nur nicht die Wahrheit – daß es ihr jetzt schon seit einer ganzen Weile nicht mehr gutging.
Am dritten Sonntag im August war es dann schließlich soweit, daß ich aufstand, mich ankleidete, nach unten ging und mich wunderte, daß ich vor ihr fertig war, und das auch noch an einem Sonntag, an dem wir zur Kirche gingen. Als sie endlich auftauchte, sah sie blaß und sehr alt aus. Beim Laufen verzog sie das Gesicht und preßte sich eine Hand in die Seite.
»Ich weiß selbst nicht, was über mich gekommen ist«, bemerkte sie. »Seit Jahren habe ich nicht mehr so lange geschlafen.«
»Vielleicht kannst du dich nicht selbst heilen, Grandmère. Vielleicht wirken deine Kräuter und Getränke bei dir nicht, und du solltest einen Arzt in der Stadt aufsuchen«, schlug ich vor.
»Unsinn. Ich habe einfach nur noch nicht das passende Mittel gefunden, aber ich bin auf der richtigen Spur. In ein der zwei Tagen bin ich wieder ganz die alte«, gelobte sie, aber zwei Tage vergingen, und ihr Zustand besserte sich nicht. In einem Moment redete sie noch mit mir, und im nächsten war sie mit weit offenem Mund auf ihrem Stuhl eingeschlafen, und ihre Brust hob und senkte sich, als kostete sie das Atem große Mühe.
Nur zwei Vorfälle gaben ihr die alte Energie zurück, die ich von früher an ihr kannte. Zu dem ersten kam es, als Grandpère Jack zu uns kam und uns tatsächlich um Geld bat. Ich saß mit Grandmère nach dem Abendessen auf der Veranda, und wir waren dankbar für das bißchen Kühle, das das Zwielicht ins Bayou brachte. Der Kopf wurde auf ihren Schultern immer schwerer, bis ihr das Kinn auf die Brust sank, aber in dem Moment, in dem Grandpère Jacks Schritte zu vernehmen waren, riß sie den Kopf hoch. Sie kniff die Augen zu argwöhnischen Schlitzen zusammen.
»Weshalb kommt er her?« fragte sie und starrte in die Dunkelheit hinaus, aus der er wie eine Geistererscheinung aus dem Sumpf kam: Das lange Haar hüpfte in seinem Nacken, die schmutzigen grauen Bartstoppeln, die dichter als gewöhnlich waren, ließen sein Gesicht fahl wirken, und seine Kleider waren so zerknittert und so schmutzig, als hätte er sich tagelang darin herumgewälzt. Seine Stiefel überzog eine dicke Schlammschicht.
»Komm bloß nicht näher«, fauchte Grandmère. »Wir haben gerade zu Abend gegessen, und bei dem Gestank dreht sich uns der Magen um.«
»Ach, Frau«, sagte er, aber er blieb etwa zwei Meter vor der Veranda stehen. Er zog den Hut und hielt ihn in den Händen. Angelhaken baumelten an der Krempe. »Ein wohltätiger Zweck führt mich her«, sagte er.
»Wohltätig? Wohltätig für wen?« fragte Grandmère.
»Für mich«, erwiderte er. Das hätte sie fast zum Lachen gebracht. Sie schaukelte ein wenig auf ihrem Stuhl und schüttelte den Kopf.
»Du bist gekommen, weil du um Vergebung bitten willst?« fragte sie.
»Ich bin gekommen, um mir Geld zu borgen«, sagte er.
»Was?« Sie war so sprachlos, daß sie aufhörte zu schaukeln.
»Der Motor meines Dingis ist im Eimer, und Charlie McDermott will mir keinen Kredit mehr geben, damit ich ihm einen gebrauchten abkaufen kann. Ich benötige dringend einen Motor, weil ich sonst kein Geld verdienen kann. Ich kann sonst nicht mit Männern jagen, keine Austern sammeln und überhaupt nichts machen«, sagte er. »Ich weiß, daß ihr etwas zur Seite gelegt habt, und ich schwöre ...«
»Was taugt dein Eid, Jack Landry? Du bist verflucht, zum Untergang verdammt, ein Mann, für dessen Seele bereits einer der besten Plätze in der Hölle reserviert ist«, sagte sie mit soviel Nachdruck und Energie zu ihm wie seit Tagen nicht mehr. Einen Moment lang erwiderte Grandpère nichts darauf.
»Wenn ich Geld verdienen kann, kann ich euch das Geld und noch mehr schon bald zurückgeben«, sagte er. Grandmère schnaubte.
»Wenn ich dir die letzten Pennys gäbe, die wir haben, würdest du sofort von hier verschwinden und dir so schnell wie möglich eine Flasche Rum besorgen, um dich wieder einmal bewußtlos zu trinken«, sagte sie zu ihm. »Außerdem haben wir nichts. Du weißt selbst, wie schwer wir es im Sommer im Bayou haben. Aber das macht dir ja nichts aus«, fügte sie hinzu.
»Ich tue, was ich kann«, protestierte er.
»Ja, für dich und deinen abscheulichen Durst«, schoß sie zurück.
Ich ließ meinen Blick von Grandmère zu Grandpère wandern. Er machte wirklich einen verzweifelten und reuevollen Eindruck. Grandmère Catherine wußte, daß ich das Geld für meine Bilder zurückgelegt hatte. Ich hätte es ihm leihen können, dachte ich, wenn er wirklich in der Patsche saß, aber ich fürchtete mich davor, es laut zu sagen.
»Du würdest einen Mann hier draußen im Sumpf verhungern und von Geiern erbeuten lassen«, klagte er.
Sie stand langsam auf und erhob sich zu ihrer vollen Größe von einem Meter sechzig, als sei sie in Wirklichkeit einen Meter achtzig groß, reckte den Kopf in die Luft und zog die Schultern zurück, und dann hob sie den linken Arm und deutete mit dem Zeigefinger auf ihn. Ich sah, wie seine Augen vor Schreck hervortraten, als er einen Schritt zurückwich.
»Du bist bereits tot, Jack Landry«, verkündete sie mit der Autorität eines Bischofs, »und du bist bereits Beute für die Geier. Geh wieder auf deinen Friedhof, und laß uns in Ruhe«, befahl sie ihm.
»Du bist mir eine schöne Christin«, rief er aus, doch er wich weiterhin zurück. »Das nennst du Barmherzigkeit. Du bist nicht besser als ich, Catherine. Du bist kein bißchen besser als ich«, rief er und wandte sich ab, um sich so schnell von der Dunkelheit schlucken zu lassen, wie er aus ihr aufgetaucht war. Grandmère starrte ihm noch eine Zeitlang nach, als er schon längst gegangen war, dann setzte sie sich wieder hin.
»Wir hätten ihm das Geld geben können, das ich für meine Bilder bekommen habe, Grandmère«, sagte ich. Sie schüttelte heftig den Kopf.
»Dieses Geld wird er nicht anrühren«, sagte sie entschieden. »Du wirst es eines Tages brauchen, Ruby, und außerdem«, fügte sie hinzu, »täte er damit ja doch nur, was ich gesagt habe. Er würde sich billigen Whiskey kaufen.
Eine solche Dreistigkeit«, fuhr sie mehr zu sich selbst als an mich gewandt fort. »Einfach herzukommen und mich zu fragen, ob ich ihm Geld leihe. So eine Unverschämtheit...«
Ich sah zu, wie sie sich abregte, bis sie wieder auf ihrem Stuhl zusammengesackt war, und ich überlegte mir, wie fürchterlich es doch war, daß zwei Menschen, die einander früher einmal geküßt und umarmt hatten, die einander geliebt hatten und zusammensein wollten, jetzt wie zwei streunende Kater waren, die sich in der Nacht anfauchten und mit den Krallen aufeinander losgingen.
Die Auseinandersetzung mit meinem Großvater hatte Grandmère ausgelaugt. Sie war derart erschöpft, daß ich ihr ins Bett helfen mußte. Ich blieb noch eine Zeitlang bei ihr sitzen und beobachtete sie im Schlaf. Ihre Wangen waren gerötet, und auf ihrer Stirn standen Schweißperlen. Ihr Busen hob und senkte sich so mühsam, daß ich glaubte, ihr Herz würde vor Anstrengung zerspringen.
An jenem Abend legte ich mich beklommen schlafen und fürchtete, wenn ich wach wurde, müßte ich feststellen, daß Grandmère Catherine nicht mehr aufgewacht war. Aber zum Glück gab der Schlaf ihr neue Kraft, und am nächsten Morgen erwachte ich von ihren Schritten auf der Treppe, als sie in die Küche ging, um das Frühstück zu machen und anschließend einen weiteren Arbeitstag in der Webstube zu beginnen.
Trotz der ausbleibenden Kunden führten wir in den Sommermonaten unsere Webereien und unsere Handarbeiten weiter, um einen Vorrat von Waren zu schaffen, die wir ausstellen konnten, wenn die Touristensaison wieder begann.
Grandmère betrieb Tauschhandel mit Baumwollpflanzern und Farmern, die die Palmwedel ernteten, aus denen wir die Hüte und die Fächer machten. Sie tauschte ihr Gumbo gegen Eichengeflecht ein, damit wir die Körbe flechten konnten. Immer wenn es dazu kam, daß wir völlig abgebrannt waren und keinen Gegenwert für unser Handwerksmaterial anbieten konnten, griff Grandmère tief in ihre Schatztruhe und holte etwas Wertvolles heraus, was sie entweder vor Jahren schon als Bezahlung für ihre Heildienste bekommen hatte oder eigens für solche Zeiten aufbewahrt hatte.
In diesen harten Zeiten ereignete sich der zweite Vorfall, der ihren Schritten und Worten Schwung und Kraft verlieh. Der Postbote überbrachte einen hellblauen Umschlag mit Spitzenmuster an den Rändern, der an mich adressiert war. Er kam aus New Orleans, und der Absender lautete schlicht und einfach: Dominique’s.
»Grandmère, ich habe einen Brief von der Galerie in New Orleans bekommen«, rief ich laut und rannte ins Haus. Sie nickte und hielt den Atem an, und ihre Augen leuchteten vor Aufregung.
»Mach schon, reiß ihn auf«, sagte sie und ließ sich auf einen Stuhl sinken. Ich setzte mich an den Küchentisch, riß den Umschlag auf und holte einen Bankscheck über zweihundertfünfzig Dollar heraus. Es lag auch ein Begleitschreiben bei.
Ich gratuliere Ihnen zum Verkauf eines Ihrer Bilder. Auch an den anderen besteht Interesse, und ich werde mich in naher Zukunft mit Ihnen in Verbindung setzen, um mir anzusehen, was Sie seit meinem Besuch gemalt haben.
Hochachtungsvoll
Dominique
Grandmère Catherine und ich sahen einander einen Moment lang einfach nur an. Dann hellte das breiteste und strahlendste Lächeln, das ich seit Monaten an ihr gesehen hatte, ihr Gesicht auf. Sie schloß die Augen und sprach ein kurzes Dankgebet. Ich starrte weiterhin ungläubig den Bankscheck an.
»Grandmère, kann das wahr sein? Zweihundertfünfzig Dollar! Für eins meiner Gemälde!«
»Ich habe dir doch gesagt, daß es so kommen wird. Ich habe es dir doch schon immer gesagt«, sagte sie. »Ich frage mich, wer es wohl gekauft hat. Steht das nicht in dem Brief?«
Ich sah noch einmal hin und schüttelte den Kopf.
»Das macht nichts«, sagte sie. »Viele Leute werden es jetzt zu sehen bekommen, und andere wohlhabende Cajuns werden zu Dominique’s kommen, um sich deine Arbeiten anzusehen, und er wird ihnen sagen, wer du bist; er wird ihnen sagen, daß die Künstlerin Ruby Landry heißt«, fügte sie hinzu und nickte.
»Jetzt hör mir mal zu, Grandmère«, sagte ich mit fester Stimme. »Wir werden dieses Geld für unseren Lebensunterhalt verwenden und es nicht für irgend etwas, was ich in Zukunft brauchen könnte, in deiner Truhe vergraben.«
»Vielleicht einen Teil davon«, willigte sie ein, »aber das meiste muß für dich weggelegt werden. Eines Tages wirst du hübschere Kleider und Schuhe und andere Dinge brauchen, und du wirst auch Geld brauchen, um zu reisen«, sagte sie mit Bestimmtheit.
»Wohin reise ich denn, Grandmère?« fragte ich.
»Fort von hier. Fort von hier«, murmelte sie. »Aber jetzt laß uns erst einmal feiern. Laß uns ein Krabbengumbo und einen ganz besonderen Nachtisch machen. Ich weiß schon, was«, sagte sie, »wir backen einen Königskuchen.« Das war eine meiner Lieblingssüßspeisen: ein Hefekuchenring mit vielfarbigem Zuckerguß. »Ich werde Mrs. Thibodeau und Mrs. Livaudis zum Abendessen einladen, damit ich mit meiner Enkelin prahlen kann, bis sie vor Neid platzen. Aber vorher gehen wir noch zur Bank und lösen deinen Scheck ein«, sagte sie.
Grandmères Aufregung und ihr Glück erfüllten mich mit einer Freude, wie ich sie seit Monaten nicht mehr verspürt hatte. Ich wünschte, es gäbe einen bestimmten Menschen, mit dem ich feiern könnte, und ich dachte an Paul. Den ganzen Sommer über hatte ich ihn außer in der Kirche nur ein einziges Mal in der Stadt gesehen, als ich Lebensmittel eingekauft hatte. Als ich aus dem Laden kam, sah ich ihn im Wagen seines Vaters sitzen und darauf warten, daß sein Vater aus der Bank kam. Er schaute in meine Richtung, und ich hatte den Eindruck, daß er lächelte, aber in dem Moment erschien sein Vater, und er riß den Kopf schnell herum und sah starr vor sich hin. Enttäuscht sah ich ihnen nach, als sie losfuhren, aber er wandte sich kein einziges Mal nach mir um.
Grandmère und ich gingen zu Fuß in die Stadt, um meinen Scheck einzulösen. Auf dem Weg schauten wir bei Mrs. Thibodeau und Mrs. Livaudis vorbei, um sie beide zu unserem festlichen Abendessen einzuladen. Dann fing Grandmère an zu kochen und zu backen, wie sie es seit langem nicht mehr getan hatte. Ich half ihr bei den Vorbereitungen und deckte dann den Tisch. Sie beschloß, das Bündel nagelneuer Zwanzigdollarscheine mit einem Gummiring zusammenzuhalten und mitten auf den Tisch zu legen, um ihre alten Freundinnen zu beeindrucken. Als ihre Blicke darauf fielen und sie hörten, wie ich an das Geld gekommen war, waren sie erstaunt. Manche Leute im Bayou arbeiteten für dieses Geld einen ganzen Monat.
»Also, mich wundert das nicht«, sagte Grandmère. »Ich wußte schon immer, daß sie eines Tages eine berühmte Künstlerin werden wird.«
»O Grandmère«, sagte ich, denn all diese Aufmerksamkeit machte mich verlegen. »Ich bin bei weitem keine berühmte Künstlerin.«
»Im Moment noch nicht, aber eines Tages wirst du berühmt sein. Warte es nur ab. Du wirst es ja selbst sehen«, prophezeite Grandmère. Wir servierten das Gumbo, und die Frauen begannen ein Gespräch über die verschiedensten Rezepte.
Im Bayou gab es so viele Gumborezepte wie Cajuns, dachte ich. Es amüsierte mich, Grandmère Catherine und ihren Freundinnen zuzuhören, wie sie darüber stritten, welche Zutaten das beste Gericht ergaben und woraus sich der beste Roux machen ließ. Das angeregte Gespräch wurde noch lebhafter, als Grandmère beschloß, unseren selbstgekelterten Wein herauszuholen, etwas, was sie nur zu ganz besonderen Anlässen tat. Ein einziges Glas davon stieg mir sofort in den Kopf. Ich spürte, wie mein Gesicht dunkelrot wurde, aber Grandmère und ihre beiden Freundinnen schenkten sich ein Glas nach dem anderen ein, als handelte es sich um pures Wasser.
Das gute Essen, der Wein und das Gelächter erinnerten mich an glücklichere Zeiten, in denen Grandmère und ich Gemeindefeiern und Veranstaltungen besucht hatten. Zu meinen liebsten Feiern hatte immer die gehört, zu der jede der Frauen einem frischvermählten Mädchen ein Huhn mitbrachte, das ihr zu einem guten Start verhelfen sollte. Bei diesen Festen gab es immer viel zu essen und zu trinken, und es wurde viel Musik gemacht und viel getanzt. Grandmère Catherine war als Heilerin immer ein gerngesehener Ehrengast gewesen.
Nachdem wir den Kuchen und die Tassen mit dem aromatischen starken Cajun-Kaffee serviert hatten, forderte ich Grandmère auf, mit Mrs. Thibodeau und Mrs. Livaudis auf die Veranda zu gehen und es mir zu überlassen, den Tisch abzuräumen und das Geschirr zu spülen.
»Wir sollten nicht derjenigen, der zu Ehren wir hier feiern, die ganze Arbeit überlassen«, sagte Mrs. Thibodeau, aber ich beharrte darauf. Nachdem ich den Tisch abgeräumt hatte, bemerkte ich, daß der Packen Geld noch immer auf dem Tisch lag. Ich ging zu Grandmère, um sie zu fragen, wohin ich das Geld tun sollte.
»Lauf rauf, und tu es in meine Truhe, Ruby, Liebes«, sagte sie. Ich war überrascht. Grandmère Catherine hatte mir bisher noch nie erlaubt, ihre Truhe zu öffnen oder darin herumzustöbern. Gelegentlich sah ich ihr über die Schulter, wenn sie sie öffnete, und dann sah ich die edlen Leinenservietten, die Silberkelche und die Perlenschnüre. Ich erinnerte mich, daß ich schon immer gern einmal all diese Andenken hatte ansehen wollen, aber diese Truhe war Grandmère Catherine heilig. Ich hätte nicht gewagt, sie ohne ihre Erlaubnis auch nur anzurühren.
Ich lief eilig los, um mein neuerworbenes Vermögen zu verstecken. Aber als ich die Truhe öffnete, sah ich, wie leer sie inzwischen war. Die edlen Leinenservietten und die Silberkelche waren fort bis auf ein einziges silbernes Trinkgefäß. Grandmère hatte viel mehr eingetauscht und verpfändet, als ich vermutet hatte. Es brach mir das Herz, jetzt zu sehen, wie viele ihrer persönlichen Schätze nicht mehr da waren. Ich wußte, daß jeder einzelne Gegenstand für sie über den materiellen Wert hinaus einen ganz bestimmten Wert besessen hatte. Ich kniete mich hin und schaute auf das, was ihr noch geblieben war: eine einzige Perlenkette, ein Armband, ein paar bestickte Schals und ein Packen von Dokumenten und Bildern, die mit Gummiringen zusammengehalten wurden. Unter den Dokumenten waren meine Impfscheine, aber auch Grandmère Catherines Schulabgangszeugnis und ein paar alte Briefe, deren Tinte so ausgeblichen war, daß man sie kaum noch lesen konnte.
Ich sah mir ein paar von den Bildern an. Sie bewahrte immer noch Fotografien von Grandpère Jack als jungem Mann auf. Wie gut er doch als junger Mann von Anfang Zwanzig ausgesehen hatte, groß und dunkelhaarig, mit breiten Schultern und schmalen Hüften. Ein charmantes Lächeln strahlte mir von dem Foto entgegen, und er stand so stolz und aufrecht da. Man konnte leicht verstehen, wie Grandmère Catherine sich in einen solchen Mann hatte verlieben können. Ich fand die anderen Bilder von ihrer Mutter und ihrem Vater, alte und verblichene bräunliche Sepiadrucke, aber es war noch genug darauf zu erkennen, um zu sehen, daß Grandmère Catherines Mutter, meine Urgroßmutter, eine hübsche Frau mit einem süßen, sanften Lächeln und zart geschnittenen Gesichtszügen gewesen war. Ihr Vater wirkte würdig und streng, schmallippig und ernst.
Ich legte die Dokumente und alten Familienfotos zurück, doch als ich mein Geld in der Truhe verstaute, sah ich eine Ecke eines weiteren Fotos aus Grandmère Catherines alter, in Leder gebundener Bibel herausschauen. Langsam nahm ich sie zur Hand, behandelte den brüchigen Einband sorgsam und schlug sachte die spröden Seiten auf, die an den Ecken abblättern wollten. Mein Blick fiel auf die alte Fotografie.
Es war ein Bild von einem sehr gutaussehenden jungen Mann, der vor einem Haus aufgenommen worden war, bei dem es sich um eine große Villa zu handeln schien. Er hielt ein kleines Mädchen an der Hand, das sehr viel Ähnlichkeit mit mir in diesem Alter hatte. Ich schaute mir das Foto genauer an. Das kleine Mädchen sah mir so ähnlich, daß es war, als sähe ich mich selbst in diesen jungen Jahren an. Die Ähnlichkeit war tatsächlich so bemerkenswert, daß ich in mein Zimmer gehen und ein Foto von mir selbst als kleines Mädchen suchen mußte. Ich legte die beiden Bilder nebeneinander und betrachtete sie dann noch einmal.
Ich war es, glaubte ich. Ich war es wirklich. Aber wer war dieser Mann, und wo war ich gewesen, als dieses Bild aufgenommen wurde? Ich mußte alt genug gewesen sein, um mich an ein solches Haus zu erinnern, fand ich. Zu dem Zeitpunkt konnte ich nicht viel jünger als sechs oder sieben Jahre alt gewesen sein. Ich drehte das Bild um und sah, daß ganz unten etwas auf die Rückseite geschrieben worden war.
Liebe Gabrielle,
ich dachte mir, du würdest sie sicher gern an ihrem siebenten Geburtstag sehen. Ihr Haar ist ganz so wie deines, und sie ist all das geworden, was ich mir von ihr erträumt habe.
Alles Liebe
Pierre
Pierre? Wer war Pierre? Und dieses Bild, war es an meine Mutter geschickt worden? War das mein Vater? War ich irgendwo mit ihm gewesen? Aber weshalb hätte er meiner Mutter etwas über mich berichten sollen? Sie war längst tot. Konnte es sein, daß er das zu dem Zeitpunkt noch nicht gewußt hatte? Nein, das was unsinnig, denn wie hätte er auch nur kurze Zeit mit mir zusammensein und nicht wissen können, daß meine Mutter tot war? Und wie konnte es sein, daß ich bei ihm gewesen war und mich nicht daran erinnerte?
Dieses Rätsel schwirrte in mir herum wie ein Bienenschwarm, und ich nahm ein Surren und Prickeln wahr, das mich mit seltsamen Vorahnungen und Ängsten erfüllte. Ich sah das kleine Mädchen noch einmal an und verglich unsere Gesichter miteinander. Die Ähnlichkeit ließ sich nicht leugnen. Ich war mit diesem Mann zusammengewesen.
Ich holte tief Atem und bemühte mich, wieder ruhiger zu werden, damit Grandmère und ihre Freundinnen, wenn ich wieder nach unten ging und sie mich sahen, nicht bemerkten, daß mich etwas erschüttert und mein Herz und meine Seele aufgewühlt hatte. Ich wußte, wie schwer, wenn nicht gar unmöglich es für mich war, etwas vor Grandmère Catherine zu verbergen, aber zum Glück war sie derart in eine Auseinandersetzung über ein Krebsfleischgericht vertieft, daß ihr entging, wie aufgewühlt ich war.
Schließlich wurden ihre Freundinnen müde und beschlossen aufzubrechen. Noch einmal beglückwünschten, küßten und umarmten sie mich, während Grandmère stolz zusah. Wir schauten ihnen nach, bis sie gegangen waren, und dann gingen wir ins Haus.
»Soviel Spaß habe ich schon seit ewigen Zeiten nicht mehr gehabt«, sagte Grandmère seufzend. »Und wie wunderbar du aufgeräumt hast. Meine Ruby«, sagte sie und drehte sich zu mir um, »ich bin ja so stolz auf dich, mein Liebes, und ...«
Sie kniff ihre Augen zusammen. Der Wein und die hitzigen Diskussionen hatten sie aufgeregt, aber ihre spirituellen Kräfte schlummerten nicht. Sie spürte augenblicklich, daß etwas nicht stimmte, und sie trat vor mich hin.
»Was ist los, Ruby?« fragte sie. »Was hat dich derart erschüttert?«
»Grandmère«, setzte ich an, »du hast mich nach oben geschickt, damit ich das Geld in deine Truhe lege.«
»Ja«, sagte sie, und gleich darauf schnappte sie nach Luft. Sie trat einen Schritt zurück und preßte sich die Hand aufs Herz. »Du hast in meinen Sachen herumgestöbert?«
»Ich wollte nicht schnüffeln, Grandmère, aber mich haben die alten Fotos von dir und Grandpère Jack und von deinen Eltern interessiert. Dann habe ich gesehen, daß etwas aus deiner alten Bibel herausgeschaut hat, und ich habe das hier gefunden«, sagte ich und hielt ihr das Foto hin. Sie schaute es an, als schaute sie dem Tod und dem Verderben ins Gesicht. Sie nahm mir das Bild aus der Hand, setzte sich langsam und nickte dabei vor sich hin.
»Wer ist dieser Mann, Grandmère? Und das kleine Mädchen, das bin doch ich, oder nicht?« fragte ich.
»Nein, Ruby«, sagte sie. »Das bist du nicht.«
»Aber es sieht genauso aus wie ich, Grandmère. Hier«, sagte ich und legte das Bild von mir mit etwa sieben Jahren neben das von Pierre und dem kleinen Mädchen. »Sieh doch nur.«
Grandmère nickte.
»Ja, es ist dein Gesicht«, sagte sie und sah die beiden Fotos an, »aber du bist es nicht.«
»Wer ist es dann, Grandmère, und wer ist der Mann auf dem Foto?«
Sie zögerte. Ich wartete geduldig, aber mir wurde immer flauer in der Magengrube, und die Unruhe setzte sich bis in mein Herz fort. Ich hielt den Atem an.
»Ich habe nicht daran gedacht, als ich dich nach oben geschickt habe«, begann sie, »aber vielleicht wollte mir die Vorsehung damit zu verstehen geben, es sei an der Zeit.«
»An der Zeit, Grandmère?«
»Daß du alles erfährst«, sagte sie und lehnte sich zurück, als sei sie erschlagen, und der inzwischen allzu vertraute Ausdruck der Erschöpfung trat wieder auf ihr Gesicht. »Damit du weißt, warum ich deinen Grandpère aus dem Haus und in den Sumpf vertrieben habe, damit er dort wie das Tier lebt, das er ist.« Sie schloß die Augen und murmelte tonlos vor sich hin, doch mir ging die Geduld aus.
»Wer ist das kleine Mädchen, wenn ich es nicht bin, Grandmère?« fragte ich barsch. Grandmère heftete den Blick starr auf mich, und die Röte ihrer Wangen wurde von einer Blässe abgelöst, die die Farbe von Weizenmehl hatte.
»Es ist deine Schwester«, sagte sie.
»Meine Schwester?«
Sie nickte. Sie schloß die Augen und hielt sie so lange
geschlossen, daß ich schon glaubte, sie würde nicht weiterreden.
»Und der Mann, der sie an der Hand hält...«, fügte sie
schließlich hinzu.
Sie brauchte es nicht erst auszusprechen. Die Worte standen für mich bereits fest.
»...ist dein richtiger Vater.«