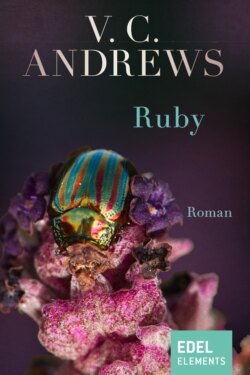Читать книгу Ruby - V.C. Andrews - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 Kein Zutritt für Landrys
ОглавлениеEine köstliche Duftmischung stieg aus der Küche auf, wehte in mein Zimmer und bewirkte, daß ich die Augen aufschlug und mein Magen vor Vorfreude in Aufruhr geriet. Ich konnte den aromatischen Cajun-Kaffee riechen, der auf dem Herd sprudelte, und die Mischung aus Krabben und Hühnergumbo, die Grandmère Catherine in ihren schwarzen gußeisernen Töpfen vorbereitete, um sie an unserem Straßenstand zu verkaufen. Ich setzte mich auf und atmete die herrlichen Gerüche tief ein.
Die Sonne wob sich einen Weg durch die Sumpfzypressen, und das Laub der Mangroven, von denen das Haus umgeben war, wurde durch den Stoff vor meinem Fenster gefiltert und warf einen warmen, hellen Schein in mein kleines Schlafzimmer, in dem gerade genug Platz für mein weißgestrichenes Bett, einen kleinen Nachttisch für die Lampe nah an meinem Kopfkissen und eine große Truhe für meine Kleidung war. Ein Chor von Reisvögeln setzte zu seiner rituellen Symphonie an, zirpte und sang und drängte mich aufzustehen, mich zu waschen und mich anzukleiden, damit ich mich ihnen bei der feierlichen Begrüßung eines neuen Tages anschließen konnte.
Ganz gleich, wie sehr ich mich bemühte, ich schaffte es nie, vor Grandmère Catherine aus dem Bett zu kommen und vor ihr in der Küche zu sein. Nur selten hatte ich Gelegenheit, sie mit einer Kanne frisch gebrühtem Kaffee, mit heißen Biskuits und Eiern zu überraschen. Gewöhnlich stand sie mit den ersten Sonnenstrahlen auf, die die Decke der Dunkelheit wegzuschieben begannen, und sie bewegte sich so leise und geschmeidig durch das Haus, daß ich ihre Schritte im Korridor oder auf der Treppe, die im allgemeinen laut knarrte, wenn ich die Stufen hinunterstieg, nicht hörte. An den Wochenenden stand Grandmère Catherine morgens besonders früh auf, um alles für unseren Straßenstand vorzubereiten.
Ich eilte nach unten, um mich zu ihr zu gesellen.
»Warum hast du mich nicht geweckt?« fragte ich.
»Ich hätte dich dann geweckt, wenn ich dich brauche, falls du bis dahin nicht von allein aufgestanden wärst, Ruby«, sagte sie und gab mir damit dieselbe Antwort wie immer. Aber ich wußte, daß sie sich lieber zusätzliche Arbeit aufgebürdet hätte, als mich wachzurütteln und aus den Armen des Schlafs zu reißen.
»Ich falte unsere neuen Decken zusammen und mache sie soweit fertig, daß wir sie raustragen können«, sagte ich.
»Jetzt wirst du erst einmal frühstücken. Wir haben noch genug Zeit, die Sachen aus dem Haus zu schaffen. Du weißt doch selbst, daß die Touristen so bald noch nicht vorbeikommen. Die einzigen, die so früh am Morgen aufstehen, sind die Fischer, und die interessieren sich nicht für die Dinge, die wir anzubieten haben. Jetzt mach schon, setz dich hin«, ordnete Grandmère Catherine an.
Wir hatten einen einfachen Tisch, der aus den breiten Zypressenbrettern getischlert war, aus denen auch die Wände unseres Hauses und die Stühle mit ihren geriffelten Stuhlbeinen bestanden. Das Möbelstück, das Grandmères größter Stolz war, war ihr Kleiderschrank aus Eiche. Ihr Vater hatte ihn gezimmert. Alles andere, was wir hatten, war gewöhnlich und unterschied sich nicht von der Einrichtung aller anderen Cajun-Familien, die im Bayou lebten.
»Mr. Rodrigues hat heute morgen diesen Korb mit frischen Eiern gebracht, sagte Grandmère Catherine und wies mit einer Kopfbewegung auf den Korb, der auf der Anrichte unter dem Fenster stand. »Ich finde es sehr nett von ihm, daß er in Zeiten an uns denkt, in denen er selbst so viele Sorgen hat«.
Sie erwartete nie mehr als ein schlichtes Dankeschön für die Wunder, die sie wirkte. Sie sah ihre Kräfte nicht als etwas an, was ihr gehörte; sie sah darin etwas, was den Gajuns schlechthin gehörte. Sie glaubte daran, daß sie auf dieser Erde den Zweck zu erfüllen hatte, denen zu dienen und zu helfen, die weniger glücklich dran waren, und die Freude, die es ihr bereitete, anderen zu helfen, war ihr Lohn genug.
Sie schlug zwei Eier für mich in die Pfanne.
»Vergiß nicht, deine neuesten Bilder heute draußen hinzustellen. Ich finde das ganz großartig, auf dem der Reiher aus dem Wasser kommt, sagte sie lächelnd
»Wenn du es großartig findest, Grandmère, dann sollte ich es nicht verkaufen. Ich sollte es dir schenken«.
»Unsinn, Kind. Ich will, daß alle deine Bilder zu sehen bekommen, vor allem Leute in New Orleans«, erklärte sie. Das hatte sie schon oft gesagt und jedesmal mit demselben Nachdruck.
»Warum? Warum sind diese Leute denn so wichtig?« fragte ich.
»Dort gibt es Dutzende und Aberdutzende von Kunstgalerien und auch berühmte Künstler, die deine Arbeiten sehen und deinen Namen in Umlauf bringen werden, und dann wollen alle reichen Kreolen eins deiner Gemälde bei sich zu Hause hängen haben«, erklärte sie.
Ich schüttelte den Kopf. Es sah ihr gar nicht ähnlich, sich zu wünschen, daß Bekanntheit und Ruhm über unser einfaches kleines Häuschen im Bayou hereinbrächen. Wenn wir an den Wochenenden unsere Handarbeiten und sonstigen Waren vor das Haus trugen, dann taten wir das für unseren Unterhalt, aber ich wußte, daß Grandmère Catherine all die Fremden, die vorbeikamen, eigentlich gar nicht behagten, obwohl manche unter ihnen sich für ihr Essen begeisterten und sie mit Komplimenten überschütteten. Es steckte etwas anderes dahinter, wenn Grandmère Catherine mich drängte, meine Werke auszustellen, ein geheimnisvoller Grund.
Das Bild mit dem Reiher war auch für mich etwas ganz Besonderes. Ich hatte eines Tages im Zwielicht am Ufer des Teichs hinter unserem Haus geständen, als ich diesen Kernbeißer sah, einen Nachtreiher, wie er so plötzlich und unerwartet vom Wasser aufflog, daß es schien, als käme er aus dem Wasser. Auf seinen breiten dunkelvioletten Schwingen schwebte er davon und erhob sich über die Zypressen. Ich nahm in seinen Bewegungen etwas Poetisches und Wunderschönes wahr und konnte es kaum erwarten, einen Teil dessen in einem Gemälde einzufangen. Später, als Grandmère Catherine das fertige Werk zu sehen bekam, war sie einen Moment lang sprachlos. Tränen glitzerten in ihren Augen, und sie gestand, daß meine Mutter den blauen Reiher allen anderen Sumpfvögeln vorgezogen hatte.
»Das ist noch ein Grund mehr dafür, daß wir das Bild behalten sollten«, sagte ich.
Aber Grandmère Catherine war nicht meiner Meinung und sagte: »Das ist erst recht ein Grund dafür, alles zu tun, damit es nach New Orleans gebracht wird.« Es war fast so, als wollte sie durch mein Werk jemandem in New Orleans eine hintergründige Botschaft zukommen lassen.
Nachdem ich gefrühstückt hatte, begann ich, die Handarbeiten und die Waren, die wir an diesem Tag gern verkaufen wollten, aus dem Haus zu tragen, während Grandmère Catherine noch die Saucen ihrer Gerichte band. Ein Roux gehörte zu den ersten Dingen, die ein junges Cajun-Mädchen herzustellen lernte. Dabei handelte es sich um nichts anderes als Mehl, das in Butter, Öl oder tierisches Fett eingerührt werden und eine nußbraune Färbung annehmen soll, aber nicht so heiß werden darf, daß es schwarz wird. Nachdem man diese Mehlschwitze zubereitet hatte, wurden Meeresfrüchte oder Huhn, manchmal auch Ente, Gans oder Perlhuhnfleisch, ab und zu gar Wild mit Wurst oder Muscheln hineingerührt, um das Gumbo herzustellen. Zur Fastenzeit bereitete Grandmère ein grünes Gumbo zu, in das nur Gemüse und kein Fleisch gerührt wurde.
Grandmère hatte recht gehabt. Viel früher als sonst trafen die ersten Kunden ein. Manche der Leute, die vorbeischauten, waren Freunde von ihr oder andere Cajuns, die von dem Couche mal erfahren hatten und sich die Geschichte von ihr selbst erzählen lassen wollten. Einige ihrer älteren Freundinnen saßen da und riefen sich vergleichbare Geschichten ins Gedächtnis zurück, die sie von ihren Eltern und Großeltern gehört hatten.
Kurz vor der Mittagszeit sahen wir zu unserem Erstaunen eine lange und schicke silbergraue Limousine vorbeifahren. Plötzlich hielt sie an und setzte dann in hohem Tempo zurück, bis sie direkt vor unserem Stand anhielt. Die hintere Tür wurde aufgerissen, und ein großer, schlaksiger Mann mit graubraunem Haar und einem leicht olivfarbenen Teint stieg aus. Das Lachen einer Frau drang hinter ihm aus der Limousine.
»Jetzt sei schon ruhig«, sagte er, und dann drehte er sich um und lächelte mich an.
Eine attraktive blonde Dame mit stark geschminkten Augen, dick aufgetragenem Wangenrouge und Lippenstift streckte den Kopf durch die offene Tür. Eine lange Perlenkette baumelte an ihrem Hals. Sie trug eine Bluse aus grellrosa Seide. Die obersten Knöpfe standen offen, und daher konnte ich nicht umhin zu bemerken, daß ihre Brüste weitgehend entblößt waren.
»Beeil dich, Dominique. Ich will heute abend unbedingt bei Arnaud’s essen«, quengelte sie.
»Reg dich nicht auf. Wir haben jede Menge Zeit«, sagte er, ohne sich zu ihr umzuwenden. Seine Aufmerksamkeit galt ausschließlich meinen Gemälden. »Von wem sind die?« fragte er.
»Von mir, Sir«, sagte ich. Er trug ein kostspieliges weißes Hemd aus der schneeweißesten und weichsten Baumwolle, die ich je gesehen hatte, und einen anthrazitfarbenen Anzug.
»Wirklich?«
Ich nickte; und er trat näher, um das Bild mit dem Reiher hochzuheben. Er hielt es auf Armeslänge von sich und nickte. »Du besitzt Instinkt«, sagte er. »Noch primitiv, aber schon recht bemerkenswert. Hast du Unterricht genommen?«
»Nur in der Schule ein bißchen, und manches habe ich beim Lesen alter Kunstzeitschriften gelernt«, erwiderte ich.
»Bemerkenswert.«
»Dominique!«
»Sei so nett, und halt mal die Luft an.« Er grinste mich an, als wollte er damit sagen: »Stör dich nicht an ihr«, und dann sah er sich zwei weitere meiner Gemälde an. Ich hatte fünf zum Verkauf ausgestellt. »Wieviel verlangst du für deine Gemälde?« fragte er.
Ich sah Grandmère Catherine an, die mit Mrs. Thibodeau dastand und, seit die Limousine vorgefahren war, das Gespräch abgebrochen hatte. In Grandmère Catherines Augen stand ein merkwürdiger Ausdruck. Es schien, als schaute sie tief in diesen gutaussehenden, wohlhabenden Fremden hinein und suchte nach etwas, was ihr sagte, daß er nicht nur einer dieser einfältigen Touristen war, die sich über das Lokalkolorit amüsierten.
»Ich verlange fünf Dollar pro Stück«, sagte ich.
»Fünf Dollar!« Er lachte. »Erstens einmal solltest du nicht für jedes Bild denselben Preis verlangen«, belehrte er mich. »In diesem hier mit dem Reiher steckt eindeutig mehr Arbeit drin als in den anderen«, erklärte er selbstsicher und sah Grandmère Catherine und Mrs. Thibodeau an, als seien sie seine Schülerinnen. Dann wandte er sich wieder an mich. »Du brauchst dir doch nur die Feinheiten anzusehen... wie du das Wasser und die Bewegung in den Schwingen des Reihers eingefangen hast.« Er kniff die Augen zusammen und schürzte die Lippen, als er die Gemälde ansah, und dann nickte er, als wollte er sich selbst bestätigen. »Ich gebe dir als Anzahlung für alle fünf fünfzig Dollar«, verkündete er.
»Fünfzig Dollar. Aber...«
»Was soll das heißen, als Anzahlung?« fragte Grandmère Catherine und trat näher.
»Entschuldigen Sie bitte«, sagte der Gentleman. »Ich hätte mich vorstellen sollen, wie es sich gehört. Ich heiße Dominique LeGrand. Ich besitze eine Kunstgalerie im Französischen Viertel, die schlicht und einfach Dominique’s heißt. Hier«, sagte er, griff in eine Hosentasche und holte eine Visitenkarte heraus. Grandmère nahm die Karte zwischen ihre kleinen Finger, um sie sich anzusehen.
»Und was hat es mit dieser... Anzahlung auf sich?«
»Ich glaube, daß ich für diese Gemälde weit mehr erzielen kann. Normalerweise stelle ich die Arbeiten eines Künstlers in meiner Galerie aus, ohne vorher etwas zu bezahlen, aber ich möchte in irgendeiner Form ausdrücken, wie sehr ich die Arbeiten dieses jungen Mädchens schätze. Ist das Ihre Enkelin?« erkundigte sich Dominique.
»Ja«, sagte Grandmère Catherine. »Ruby Landry. Werden Sie auch bestimmt dafür sorgen, daß ihr Name in Verbindung mit den Bildern genannt wird?« fragte sie zu meinem Erstaunen.
»Selbstverständlich«, sagte Dominique LeGrand lächelnd. »Wie ich sehe, hat sie ihre Initialen unten rechts stehen«, sagte er und wandte sich dann an mich. »Schreib aber in Zukunft deinen vollen Namen hin«, wies er mich an. »Und ich glaube wirklich, daß dir eine Zukunft bevorsteht, Mademoiselle Ruby.«
Er zog einen Packen Geld aus der Tasche und zählte davon fünfzig Dollar ab, mehr Geld, als ich bisher mit dem Verkauf all meiner Gemälde eingenommen hatte. Ich sah zu Grandmère Catherine, die nickte, und dann nahm ich das Geld an.
»Dominique!« rief seine Begleiterin wieder.
»Ich komme schon, ich komme schon. Philip«, rief er, und der Chauffeur kam um den Wagen herum, um meine Gemälde im Kofferraum der Limousine zu verstauen. »Gehen Sie behutsam damit um«, sagte er zu ihm. Dann schrieb er sich unsere Adresse auf. »Sie hören von mir«, sagte er, als er wieder in seine Limousine stieg. Grandmère Catherine und ich standen nebeneinander und sahen dem Wagen nach, als er losfuhr, bis er um die erste Biegung verschwand.
»Fünfzig Dollar, Grandmère!« sagte ich und schwenkte das Geld durch die Luft. Mrs. Thibodeau war reichlich beeindruckt, aber meine Großmutter wirkte eher nachdenklich als glücklich. Ich hatte sogar den Eindruck, daß sie ein wenig traurig zu sein schien.
»Das war der Anfang«, sagte sie mit einer Stimme, die kaum mehr als ein Flüstern war, und ihre Augen sahen starr in die Richtung, die die Limousine eingeschlagen hatte.
»Der Anfang wovon, Grandmère?«
»Der Anfang deiner Zukunft, Ruby. Diese fünfzig Dollar sind erst der Anfang. Achte bloß darauf, kein Wort darüber zu verlieren, falls dein Grandpère Jack angewankt kommen sollte«, wies sie mich an. Dann wandte sie sich Mrs. Thibodeau zu, um die Diskussion über Couchemals und andere böse Geister, die arglosen Leuten auflauern, wiederaufzunehmen.
Ich konnte meine Aufregung jedoch nicht unterdrücken. Den restlichen Tag über war ich schrecklich ungeduldig und konnte kaum erwarten, daß er schnell vorüberging und Paul kam. Ich war versessen darauf, es ihm zu erzählen, und ich lachte bei dem Gedanken in mich hinein, daß ich ihm heute abend das Eisgetränk ausgeben konnte, statt es mir von ihm spendieren zu lassen. Ich wußte jedoch auch, daß er mich nicht bezahlen lassen würde. Dazu war er zu stolz.
Das einzige, was verhinderte, daß ich vor Ungeduld explodierte, war, daß wir so gute Geschäfte machten. Wir verkauften all unsere Decken, unser Bettzeug, unsere Handtücher, und Grandmère verkaufte ein halbes Dutzend Gläser von ihren Kräuterheilmitteln. Wir verkauften sogar einen in Spiritus eingelegten Frosch. Grandmère Catherines Gumbo wurde restlos verspeist. Sie mußte für unser beider Abendessen sogar noch eine kleine Portion zubereiten. Schließlich sank die Sonne hinter die Bäume, und Grandmère erklärte unseren Tag am Straßenstand für beendet. Sie war sehr zufrieden und sang, während sie unser Abendessen kochte.
»Ich möchte, daß du mein Geld nimmst, Grandmère«, sagte ich zu ihr.
»Wir haben heute genug Geld eingenommen. Ich brauche dir das Geld für deine Bilder nicht wegzunehmen, Ruby.« Dann sah sie mich aus zusammengekniffenen Augen an. »Aber gib es mir, damit ich es verstecken kann. Ich weiß, daß dieser Sumpflandstreicher dir eines Tages leid tun wird, und dann würdest du ihm einen Teil davon, wenn nicht gar alles geben. Ich lege das Geld in meine Truhe, damit es sicher ist. Er würde es nicht wagen, dort nachzuschauen«, sagte sie.
Grandmères Eichentruhe war der heiligste Gegenstand im ganzen Haus. Sie brauchte nicht verschlossen und verriegelt zu werden. Grandpère Jack hätte es nie gewagt, sie anzurühren, ganz gleich, wie betrunken er auch sein mochte, wenn er herkam. Selbst ich hätte mich nicht getraut, den Deckel zu öffnen und in den Dingen herumzuwühlen, die darin aufbewahrt wurden, denn es war ihre kostbarste und persönlichste Habe, und es waren auch Dinge darunter, die meiner Mutter gehört hatten, als sie ein kleines Mädchen war. Grandmère hatte mir versprochen, daß alles, was sie darin aufbewahrte, eines Tages mir gehören würde.
Nachdem wir gegessen und das Geschirr gespült hatten, setzte sich Grandmère auf ihren Schaukelstuhl auf der Veranda, und ich setzte mich neben sie auf die Stufen. Es war nicht so schwül und heiß wie in der vergangenen Nacht, weil kühle Brise wehte. Am Himmel standen nur ein paar vereinzelte Wolken, und daher war das Bayou vom gelblich weißen Licht des Mondes hell erleuchtet. Es ließ die Äste der Bäume im Sumpf wie Knochen wirken und das stille Wasser wie Glas funkeln. In einer solchen Nacht breiteten sich Geräusche über dem Bayou schnell und mühelos aus. Wir konnten die fröhlichen Klänge von Mr. Butes Akkordeon hören und auch das Gelächter seiner Frau und seiner Kinder, die sich alle auf der Veranda vor dem Haus versammelt hatten. Irgendwo in weiter Ferne, in der Nähe der Stadt, erklang die Hupe eines Wagens, und hinter uns krächzten die Frösche im Sumpf. Ich hatte Grandmère Catherine noch nicht gesagt, daß Paul kommen würde, aber sie ahnte es.
»Du machst heute abend den Eindruck, als säßest du auf heißen Kohlen, Ruby. Wartest du auf etwas?«
Ehe ich darauf antworten konnte, hörten wir das leise Schnurren von Pauls Motorroller.
»Die Antwort hat sich erübrigt«, sagte Grandmère. Kurz darauf sahen wir das kleine Licht seines Motorrollers, und Paul fuhr vor unserem Haus vor.
»Guten Abend, Mrs. Landry«, sagte er und kam auf uns zu. »Hallo, Ruby.«
»Hallo«, sagte Grandmère Catherine und beäugte ihn mißtrauisch.
»Heute abend brauchen wir ausnahmsweise nicht unter der Hitze und der Schwüle zu leiden«, sagte er, und sie nickte. »Wie war dein Tag?« fragte er mich.
»Wunderbar! Ich habe all meine fünf Gemälde verkauft«, sprudelte ich heraus.
»Alle? Das ist ja wunderbar. Das muß mit Eiscremesodas gefeiert werden. Wenn es Ihnen recht ist, Mrs. Landry, würde ich gern mit Ruby in die Stadt fahren«, sagte er und wandte sich an Grandmère Catherine. Ich sah, daß seine Bitte sie bedrückte. Sie zog die Augenbrauen hoch und lehnte sich auf ihrem Schaukelstuhl zurück. Als sie zögerte, fügte Paul noch hinzu: »Wir bleiben auch nicht lange.«
»Ich will nicht, daß sie auf diesem wackligen Dingsda mitfährt«, sagte Grandmère und wies mit einer Kopfbewegung auf den Motorroller. Paul lachte.
»An einem solchen Abend würde ich ohnehin lieber laufen, du nicht auch, Ruby?«
»Doch. Ist es dir recht, Grandmère?«
»Ja, ich denke schon. Aber geht nur in die Stadt, und kommt gleich wieder zurück, und redet nicht mit Fremden«, ermahnte sie uns.
»Ja, Grandmère.
»Machen Sie sich keine Sorgen. Ich passe schon auf, daß ihr nichts zustößt«, versicherte Paul Grandmère. Pauls Beteuerung schien ihre Sorge nicht zu mildern, aber wir machten uns trotzdem auf den Weg in die Stadt, und der Mond leuchtete uns den Weg. Er nahm mich erst an der Hand, als wir nicht mehr gesehen werden konnten.
»Deine Grandmère macht sich so viele Sorgen um dich«, sagte Paul.
Sie hat schon viele traurige und harte Zeiten durchgemacht. Aber wir hatten heute einen guten Tag am Straßenstand.«
»Und du hast all deine Gemälde verkauft. Das ist einfach toll.«
»Eigentlich habe ich sie nicht wirklich verkauft, sondern einer Galerie in New Orleans zum Ausstellen gegeben«, sagte ich und erzählte ihm alles, was passiert war und was Dominique LeGrand gesagt hatte.
Paul schwieg lange. Dann drehte er sich zu mir um, und sein Gesicht war auf eine seltsame Art traurig. »Eines Tages wirst du eine berühmte Künstlerin sein und aus dem Bayou fortziehen. Du wirst in einem großen Haus in New Orleans leben und uns Cajuns alle vergessen.«
»O Paul, wie kannst du nur so etwas Furchtbares sagen? Natürlich wäre ich gern eine berühmte Künstlerin; aber ich würde meinem Volk nie den Rücken zukehren und... dich nie vergessen. Niemals«, bekräftigte ich.
»Ist das dein Ernst, Ruby?«
Ich warf mir das Haar über die Schulter und legte mir die Hand aufs Herz. Dann schloß ich die Augen und sagte: »Ich schwöre es beim heiligen Medad. Und außerdem«, fuhr ich fort und riß die Augen auf, »wirst du wahrscheinlich derjenige sein, der aus dem Bayou fortgeht, um ein vornehmes College zu besuchen und dort reiche Mädchen kennenzulernen.«
»O nein«, protestierte er. »Ich will keine anderen Mädchen kennenlernen. Du bist das einzige Mädchen, aus dem ich mir etwas mache.«
»Das sagst du jetzt, Paul Marcus Tate, aber mit der Zeit ändert sich einiges ganz von selbst. Sieh dir nur meine Großeltern an. Früher waren sie einmal ineinander verliebt.«
»Das ist etwas ganz anderes. Mein Vater sagt, mit deinem Großvater könnte es niemand aushalten.«
»Grandmère hat es früher einmal mit ihm ausgehalten«, sagte ich. »Und dann sind Veränderungen eingetreten, mit denen sie nie gerechnet hätte.«
»Bei mir wird sich nichts ändern«, brüstete sich Paul. Er blieb stehen, kam näher und nahm wieder meine Hand. »Hast du deine Großmutter gefragt, ob du mit mir zum Fais Dodo gehen darfst?«
»Ja«, sagte ich. »Kannst du morgen zum Abendessen zu uns kommen? Ich finde, sie sollte Gelegenheit haben, dich besser kennenzulernen. Läßt sich das machen?«
Er schwieg lange.
»Deine Eltern erlauben es nicht«, schlußfolgerte ich.
»Ich werde kommen«, sagte er. »Meine Eltern werden sich eben mit der Vorstellung anfreunden müssen, daß es dich und mich gibt«, fügte er hinzu und lächelte. Wir sahen einander fest in die Augen, dann beugte er sich vor, und wir küßten uns im Mondschein. Die Geräusche eines herannahenden Automobils brachten uns auseinander, und wir liefen zur Stadt und zum Café.
Auf der Straße schien heute mehr los zu sein als sonst. Viele der hiesigen Krabbenfischer waren mit ihren Familien in die Stadt gekommen, um sich an dem Festmahl im Cajun Queen zu laben, einem Restaurant, das damit warb, man könnte dort für einen festgesetzten Einheitspreis unbegrenzte Mengen von Schalentieren und Kartoffeln essen und dazu krügeweise frisch gezapftes Bier trinken. Dort herrschte tatsächlich eine richtig festliche Atmosphäre, und das Cajun Swamp Trio spielte an der Kreuzung vor dem Cajun Queen Akkordeon, Fiedel und Waschbrett. Hausierer standen auf den Straßen, und Leute saßen auf Bänken aus Zypressenholz und beobachteten die Menschenscharen, die vorbeizogen. Manche aßen Beignets und tranken Kaffee, und andere labten sich an getrockneten Krabben, die manchmal auch Cajun-Erdnüsse genannt wurden.
Paul und ich begaben uns in die Konditorei und setzten uns an den Tresen, um unsere Eiscremesodas zu trinken. Als Paul dem Besitzer, Mr. Clements, erzählte, was wir feierten, krönte er unsere Sodas mit einem Löffel Schlagsahne und Kirschen. Ich konnte mich nicht erinnern, je ein Eiscremesoda getrunken zu haben, das so gut schmeckte. Wir fühlten uns so wohl, daß wir fast den Tumult draußen überhört hätten, aber andere Leute im Laden eilten an die Tür weil sie sehen wollten, was vorging, und schon bald folgten wir ihnen.
Mir sank das Herz, als ich sah, was los war: Grandpère Jack wurde aus dem Cajun Queen geworfen. Obwohl man ihn zur Tür begleitet hatte, blieb er auf der Treppe stehen, schwenkte die Faust und beschwerte sich lauthals über diese Ungerechtigkeit.
»Ich versuche am besten, ihn zu überreden, nach Hause zu gehen und sich zu beruhigen«, murmelte ich und eilte hinaus. Paul folgte mir. Die Menschenmenge begann sich zu zerstreuen, denn niemand interessierte sich jetzt noch für einen Betrunkenen, der auf der Treppe vor sich hin lallte. Ich zog am Ärmel seiner Jacke.
»Grandpère, Grandpère...«
Wa...wer...« Er drehte sich heftig um, und Whiskey rann aus seinem Mundwinkel und über die stoppelige Oberfläche seines unrasierten Kinns. Einen Moment lang schwankte er, während er versuchte, mich mit festem Blick anzusehen. Die Strähnen seines trockenen Haars, das verkrustet wirkte, standen nach allen Seiten ab. Seine Kleidung war von Schlamm und Essensresten verdreckt. Er brachte sein Gesicht dicht vor meines. »Gabrielle?« sagte er.
»Nein, Grandpère, ich bin es, Ruby. Ruby. Komm mit, Grandpère. Du mußt nach Hause gehen. Komm mit«, sagte ich. Es war nicht das erste Mal, daß ich ihn volltrunken vorfand und ihn drängen mußte, nach Hause zu gehen. Und es war auch nicht das erste Mal, daß er mich aus glasigen Augen angesehen und beim Namen meiner Mutter genannt hatte.
Wa...« Er sah von mir zu Paul und schaute dann mich wieder an. »Ruby?«
»Ja, Grandpère. Du mußt nach Hause gehen und schlafen.«
»Schlafen? Schlafen? Ja«, sagte er und drehte sich wieder zum Cajun Queen um. »Die taugen nichts... die nehmen einem das Geld ab, und wenn man dann seine Meinung äußert... Hier ist es nicht mehr so wie früher, das steht fest, das steht teuflisch fest.«
»Komm, Grandpère.« Ich zog an seiner Hand, und er kam die Stufen herunter, und dabei wäre er fast gestolpert und aufs Gesicht gefallen. Paul kam eilig näher und nahm seinen anderen Arm.
»Mein Boot«, murmelte Grandpère. »An der Anlegestelle.« Dann drehte er sich um, entriß mir seine Hand und schwenkte sie noch einmal drohend in Richtung Cajun Queen. »Ihr wißt ja überhaupt nichts. Keiner von euch erinnert sich mehr daran, wie dieser Sumpf war, ehe diese verfluchten Ölleute hergekommen sind. Habt ihr mich gehört?«
»Sie haben dich gehört, Grandpère. Aber jetzt ist es Zeit, nach Hause zu gehen.«
»Nach Hause? Ich kann nicht nach Hause gehen«, murrte er. »Sie läßt mich ja doch nicht rein.«
Ich schaute Paul an, der meinetwegen sehr besorgt zu sein schien.
»Komm schon, Grandpère«, drängte ich ihn noch einmal, und er wankte, als wir ihn zur Anlegestelle brachten.
»Er wird sein Boot nicht allein steuern können« bemerkte Paul. »Vielleicht sollte ich ihn einfach hinbringen, und du gehst nach Hause, Ruby.«
»O nein, ich komme mit. Ich kenne den Weg durch den Sumpf besser als du, Paul«, beharrte ich.
Wir beförderten Grandpère in sein Dingi und setzten ihn hin. Er fiel augenblicklich über die Bank. Paul half ihm dabei, es sich bequem zu machen, dann ließ er den Motor an, und wir legten vom Anlegesteg ab, während uns einige Leute nachschauten und die Köpfe schüttelten. Grandmère Catherine würde schon bald davon zu hören bekommen, dachte ich, und dann würde sie einfach nur nicken und sagen, daß sie das nicht weiter verwunderte.
Wenige Minuten, nachdem wir abgelegt hatten, schnarchte Grandpère Jack. Ich stopfte ihm einen zusammengerollten Sack unter den Kopf, damit er es bequemer hatte. Er ächzte und murrte etwas Zusammenhangloses, ehe er wieder einschlief und weiterschnarchte. Dann ging ich zu Paul.
»Es tut mir leid«, sagte ich.
»Was denn?«
»Ich bin sicher, daß deine Eltern morgen schon davon hören und wütend werden.«
»Das macht nichts«, versicherte er mir, aber ich erinnerte nicht daran, wie dunkel Grandmère Catherines Augen geworden waren, als sie mich gefragt hatte, was seine Eltern davon hielten, daß wir uns trafen. Bestimmt würden sie diesen Vorfall dazu nutzen, ihn zu überzeugen, daß man sich von den Landrys fernhalten sollte. Was war, wenn überall wieder Schilder aufzutauchen begannen, auf denen stand: »Kein Zutritt für Landrys«, genau wie Grandmère Catherine es von früher geschildert hatte? Vielleicht würde ich eines Tages wirklich aus dem Bayou fliehen müssen, um jemanden zu finden, der mich liebte und zu seiner Frau machte. Vielleicht war es das, was Grandmère Catherine gemeint hatte.
Der Mond erhellte uns den Weg durch die Fahrrinnen, aber als wir tiefer in den Sumpf hineinkamen, nahmen uns die traurigen Schleier des spanischen Mooses und die dichten, ineinandergreifenden Nadeln der Sumpfzypressen das helle Licht und erschwerten die Orientierung auf dem Wasserweg. Wir mußten langsamer fahren, um den Baumstümpfen auszuweichen. Wenn der Mondschein zwischendurch doch durch eine Lichtung fiel, ließ er die Rücken der Alligatoren glitzern. Einer peitschte mit dem Schwanz und spritzte Wasser in unsere Richtung, als wollte er damit sagen: Ihr habt hier nichts zu suchen. Ein Stück weiter sahen wir die Augen eines Sumpfhirschs, die im Mondschein leuchteten. Wir sahen, wie die Silhouette seines Körpers sich umwandte und in den dunkleren Schatten verschwand.
Endlich kam Grandpères Hütte in Sicht. Auf seiner Veranda türmten sich die Netze zum Austernfang, ein Berg spanisches Moos, das er zusammengetragen hatte, um es an die Möbelfabrikanten zu verkaufen, die es als Füllung ihrer Polstermöbel benutzten, sein Schaukelstuhl mit dem Akkordeon darauf, leere Bierflaschen und eine Whiskeyflasche neben dem Stuhl und eine verkrustete Gumboschale. Einige seiner Bisamrattenfallen hingen vom Dach der Veranda, und ein paar Felle waren über das Geländer gehängt. Sein Kanu mit dem Pfahl, mit dem er durch die Sümpfe stakte, um spanisches Moos zu sammeln, war an seinem kleinen Anlegesteg festgebunden. Paul manövrierte uns geschickt daneben und schaltete den Motor des Dingis aus. Dann machten wir uns an die schwierige Aufgabe, Grandpère aus dem Boot zu schaffen. Er unterstützte uns dabei wenig und hätte es beinah fertiggebracht, daß wir alle drei in den Sumpf gefallen wären.
Paul überraschte mich mit seiner Kraft. Er trug Grandpère regelrecht über die Veranda in die Hütte. Als ich eine Butangaslampe anmachte, wünschte ich sogleich, ich hätte es nicht getan. Überall waren Kleidungsstücke verstreut, und seine leeren und zum Teil geleerten Flaschen mit billigem Whiskey standen überall herum. Sein Bett war nicht gemacht, und der größte Teil der Decke schleifte auf dem Boden. Auf seinem Eßtisch häuften sich schmutziges Geschirr und verkrustete Schalen und Gläser, aber auch dreckiges Besteck. Pauls Gesichtsausdruck konnte ich deutlich entnehmen, daß er von dem Schmutz und dem Durcheinander überwältigt war.
»Er wäre besser dran, wenn er gleich mitten im Sumpf schläft«, murmelte er. Ich richtete das Bett soweit her, daß er Grandpère Jack hinlegen konnte. Dann machten wir uns beide daran, ihm die Stiefel auszuziehen, die bis zu den Oberschenkeln reichten. »Das kann ich schon machen«, sagte Paul. Ich nickte und trat an den Tisch, um ihn abzuräumen und die Teller und die Schalen in das Spülbecken zu packen, das ich bereits mit weiterem schmutzigem Geschirr angefüllt vorfand. Während ich alles abspülte, lief Paul durch die Hütte und sammelte die leeren Dosen und Flaschen auf.
»Es wird immer schlimmer mit ihm«, stöhnte ich und wischte mir die Tränen aus den Augen. Paul drückte sachte meinen Arm.
»Ich hole frisches Wasser aus der Tonne« sagte er. Während er fort war, begann Grandpère zu stöhnen. Ich trocknete mir die Hände und ging zu ihm. Seine Augen waren noch geschlossen, aber er murmelte tonlos vor sich hin.
»Es ist ungerecht, mir die Schuld zuzuschieben... wirklich ungerecht. Sie war verliebt, oder etwa nicht? Was ändert das dann noch? Sag mir das. Mach schon, sag es mir«, sagte er.
»Wer war verliebt, Grandpère?« fragte ich.
»Mach schon, sag mir, was das noch ändert. Du hast wohl was gegen Geld, stimmt’s? Na? Jetzt sag schon.«
»Wer war verliebt, Grandpère? Welches Geld?«
Er ächzte und warf sich auf die andere Seite.
»Was ist los?« sagte Paul, der mit dem Wasser zurückkam.
»Er redet im Schlaf, aber er redet unsinniges Zeug«, sagte ich.
»Das glaube ich ohne weiteres.«
»Ich glaube...es hatte etwas damit zu tun, warum er und Grandmère Catherine immer so wütend aufeinander sind.«
»Ich glaube nicht, daß ein großes Geheimnis dahintersteckt, Ruby. Sieh dich doch um; sieh dir nur an, was aus ihm geworden ist. Weshalb sollte sie ihn im Haus haben wollen?« sagte Paul.
»Nein, Paul. Es muß mehr dahinterstecken. Ich wünschte, er würde es mir sagen«, sagte ich und kniete mich neben seine Pritsche. »Grandpère«, sagte ich und rüttelte ihn an der Schulter
»Diese verdammten Ölfirmen«, murmelte er. »Die haben die Sümpfe ausgebaggert und das echte Sumpfgras ausgemerzt... bringen die Bisamratten um... für die gibt’s nichts mehr zu fressen.«
»Grandpère, wer war verliebt? Welches Geld?« fragte ich. Er stöhnte und fing an zu schnarchen.
»Es ist zwecklos, mit ihm zu reden, wenn er in diesem Zustand ist, Ruby«, sagte Paul.
Ich schüttelte den Kopf.
»Nur dann würde er mir vielleicht die Wahrheit sagen, Paul.« Ich stand auf und sah immer noch auf ihn herunter »Zu keinem anderen Zeitpunkt ist er bereit, darüber zu reden, und Grandmère Catherine will mir auch nichts sagen.«
Paul stellte sich neben mich.
»Ich habe draußen ein paar Sachen aufgesammelt, aber es würde Tage dauern, dieses Haus wieder in Ordnung zu bringen«, bemerkte er.
»Ich weiß. Wir sollten uns jetzt besser auf den Rückweg machen. Wir werden das Boot in der Nähe von Grandmères Haus anbinden. Dann stakt er morgen mit der Piroge hin und findet es dort vor.«
»Der wird morgen etwas ganz anderes vorfinden«, sagte Paul. »Er wird feststellen, daß er eine Blechtrommel im Kopf hat.«
Wir verließen die Hütte und stiegen in das Dingi. Keiner von uns beiden sagte auf dem Rückweg viel. Ich saß neben Paul. Er legte den Arm um mich, und ich schmiegte meinen Kopf an seine Schulter. Eulen schrien, Schlangen und Alligatoren glitten durch den Schlamm und durch das Wasser, Frösche krächzten, aber ich hatte nur Grandpère Jacks trunkene Worte im Ohr und hörte und sah nichts anderes, bis ich Pauls Lippen auf meiner Stirn spürte. Er hatte den Motor ausgeschaltet, und wir trieben langsam ans Ufer.
»Ruby«, flüsterte er. »Du fühlst dich so gut in meinen Armen an. Ich wünschte, ich könnte dich immer im Arm halten oder wenigstens immer dann, wenn ich es will.«
»Das kannst du, Paul«, erwiderte ich leise und wandte ihm das Gesicht zu, damit sein Mund sich auf meine Lippen legen konnte. Es war ein zarter, aber langer Kuß. Wir spürten, wie das Boot ans Ufer stieß und dort liegen blieb, aber keiner von uns beiden unternahm einen Versuch aufzustehen. Statt dessen schlang Paul seine Arme noch enger um mich und ließ sich neben mir auf der Bank tiefer gleiten, und jetzt bewegten sich seine Lippen über meine Wangen und kosten sachte meine geschlossenen Augen.
»Ich gehe jeden Abend mit deinem Kuß auf meinen Lippen schlafen«, sagte Paul.
»Ich auch, Paul.«
Sein linker Arm preßte sich seitlich sachte an meine Brust. Ich spürte ein Prickeln und wartete aufgeregt und voller Vorfreude. Er zog den Arm langsam zurück, bis eine Hand sich sanft auf meine Brust legte und sein Finger über meine pochende, aufgestellte Brustwarze unter der dünnen Baumwollbluse und dem BH glitt, um die obersten Knöpfe meiner Bluse zu öffnen. Ich wollte von ihm berührt werden; ich verzehrte mich sogar danach, aber in dem Moment, in dem er es tat, folgte auf die elektrisierende Spannung, die ich gerade noch empfunden hatte, ein Strom kalter Furcht, denn ich spürte, wie sehr ich wollte, daß er mehr tat und noch weiterging, mich an Stellen küßte, die so intim waren, daß nur ich selbst sie bisher berührt oder gesehen hatte. Wenn er auch noch so sanft mit mir umging und seine tiefe Liebe ausdrückte, dann konnte ich doch nicht an der Warnung von Grandmère Catherines dunklen Augen vorbei, die ich noch gut im Gedächtnis hatte.
»Warte, Paul«, sagte ich widerstrebend. »Das geht mir alles zu schnell.«
»Entschuldige«, sagte Paul eilig und wich zurück. »Ich wollte es eigentlich selbst nicht. Mich hat nur...«
»Es ist schon in Ordnung. Wenn du jetzt nicht aufhörst, werde ich dich in ein paar Minuten nicht mehr bitten aufzuhören, und ich weiß nicht, was wir dann noch alles tun«, erklärte ich. Paul nickte und stand auf. Er half mir von der Bank, und ich strich mir den Rock und die Bluse glatt und schloß die beiden obersten Knöpfe wieder. Er half mir aus dem Boot und zog es dann ans Ufer, damit es nicht fortgeschwemmt wurde, wenn die Flut vom Golf her den Wasserspiegel im Bayou hebt. Ich nahm seine Hand, und wir machten uns langsam auf den Rückweg zum Haus. Grandmère Catherine war ins Haus gegangen. Wir konnten sie in der Küche hantieren hören, als sie die Vorbereitungen für die Biskuits abschloß, die sie am nächsten Morgen in die Kirche bringen würde. »Es tut mir leid, daß unsere Feier so ausgegangen ist«, sagte ich und fragte mich, wie oft ich mich wohl noch für Grandpère Jack entschuldigen würde.
»Ich möchte nicht einen einzigen Moment davon hergeben«, sagte Paul. »Solange ich nur mit dir zusammen war, Ruby«.
»Geht deine Familie morgen früh zur Kirche?« Er nickte.
»Und du kommst trotz allem morgen zum Abendessen?«
»Selbstverständlich.«
Ich lächelte, und wir küßten uns noch einmal, ehe ich mich abwandte und die Treppe zur Veranda hinaufstieg. Paul wartete, bis ich ins Haus gegangen war, und erst dann ging er zu seinem Motorroller und fuhr los. In dem Moment, in dem Grandmère Catherine sich umdrehte, um mich zu begrüßen, wußte ich, daß sie schon von Grandpère Jack gehört hatte. Eine ihrer guten Freundinnen hatte es nicht erwarten können, ihr die Neuigkeit als erste zu übermitteln, da war ich ganz sicher.
»Warum hast du ihn nicht einfach von der Polizei ins Gefängnis karren lassen? Da gehört er nämlich hin, wenn er vor anständigen Leuten ein solches Spektakel veranstaltet, und noch dazu, wenn so viele Kinder in der Stadt sind«, sagte sie kopfschüttelnd. »Aber was habt ihr mit ihm angefangen, du und Paul?«
»Wir haben ihn in seine Hütte zurückgebracht, Grandmère, und wenn du gesehen hättest, wie es da ausgesehen hat...«
»Das brauche ich nicht selbst zu sehen. Ich weiß, wie es in einem Schweinestall aussieht«, sagte sie und wandte sich wieder ihren Biskuits zu.
»Im ersten Moment, als er mich gesehen hat, hat er Gabrielle zu mir gesagt«, sagte ich.
»Das wundert mich kein bißchen. Wahrscheinlich hat er seinen eigenen Namen auch vergessen.«
»In der Hütte hat er dann viel vor sich hin gemurmelt.« »Ach?« Sie wandte sich wieder zu mir um.
»Er sprach von jemand, der verliebt war, und davon, was das Geld schon ändern sollte. Was hat das alles zu bedeuten, Grandmère ?«
Sie wandte sich wieder ab. Ich mochte nicht, wie ihre Augen sich schuldbewußt davonstahlen, wenn ich versuchte, ihre Blicke einzufangen. In meiner tiefsten Seele rußte ich, daß sie etwas vor mir verbarg.
»Ich wüßte gar nicht, wo ich anfangen sollte, das Kauderwelsch zu entwirren, das dieser versoffene Verstand hervorbringt. Da wäre es noch leichter, ein Spinnennetz aufzutrennen, ohne es zu zerreißen«, sagte sie.
»Wer war verliebt, Grandmère? Hat er von meiner Mutter gesprochen?«
Sie schwieg.
»Hat er ihr Geld verspielt? Oder dein Geld?« bohrte ich weiter.
»Versuch nicht, dir auf dummes Zeug einen Reim machen zu wollen, Ruby. Es ist schon spät. Du solltest ins Bett gehen. Wir gehen zur Frühmesse, und ich muß dir sagen, es gefällt mir gar nicht, daß ihr beide diesen Mann in den Sumpf geschafft habt. Der Sumpf ist nicht der rechte Ort für dich. Aus der Ferne sieht er wunderschön aus, aber der Teufel haust dort, und es wimmelt nur so von Gefahren, die du dir nicht im entferntesten ausmalen kannst. Ich bin enttäuscht von Paul, weil er dich dorthin mitgenommen hat«, schloß sie.
»O nein, Großmutter. Paul wollte nicht, daß ich mitkomme. Er wollte ihn allein nach Hause bringen, aber ich habe darauf bestanden mitzukommen.«
»Trotzdem hätte er es nicht tun sollen«, sagte sie und wandte sich mir mit finsteren Augen zu. »Du solltest nicht ständig denselben Jungen sehen. Du bist noch zu jung.«
»Ich bin fünfzehn, Grandmère. Manche Cajun-Mädchen sind mit fünfzehn Jahren schon verheiratet, und einige haben sogar bereits Kinder.«
»Genau das wird dir nicht passieren. Du wirst einmal besser dran sein und deine Sache besser machen«, sagte sie erbost.
»Ja, Grandmère. Es tut mir leid. Wir wollten nicht...«
»Schon gut«, sagte sie. »Es ist nun mal passiert, und wir wollen uns den ansonsten außergewöhnlichen Tag nicht damit verderben, daß wir noch länger über deinen Grandpère reden. Geh jetzt schlafen, Ruby. Geh schon«, befahl sie mir. »Nach der Kirche wirst du mir helfen, unser Sonntagsessen zuzubereiten. Schließlich haben wir morgen einen Gast, oder nicht?« fragte sie, und ihre Augen waren voller Zweifel.
»Ja, Grandmère. Er kommt.«
Ich ging, und mir schwirrte der Kopf. Der Tag war mit so vielen schönen und unschönen Erlebnissen angefüllt gewesen Vielleicht hatte Grandmère recht; vielleicht war es wirklich besser, wenn ich nicht versuchte, die dunklen Dinge zu ergründen. Sie hatten es an sich, klares Wasser zu trüben und zu verunreinigen und das, was frisch und strahlend schön war, verfaulen und verderben zu lassen. Es war besser, an die glücklichen Momente zu denken
Es war besser, wenn ich daran dachte, daß meine Gemälde in einer Galerie in New Orleans hängen würden... mich daran erinnerte, wie Pauls Lippen sich auf meinen angefühlt hatten und wie er meinen Körper hatte vibrieren lassen... von einer vollkommenen Zukunft träumte, in der ich in meinem eigenen Atelier in unserem großen Haus am Bayou malte. Bestimmt hatten die guten Dinge es an sich, die schlechten zu überwiegen, denn andernfalls wären wir alle wie Grandpère Jack, in einem Sumpf verloren, den wir uns selbst erschufen, und wir wären nicht nur bemüht, die Vergangenheit zu vergessen, sondern auch die Zukunft.