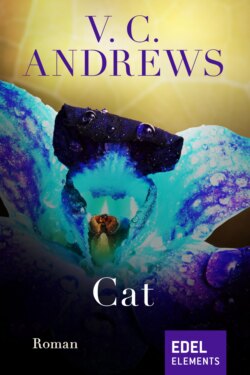Читать книгу Cat - V.C. Andrews - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKAPITEL EINS
Weil mein Daddy so früh zur Arbeit ging, lag die Verantwortung immer bei meiner Mutter, mich zu wecken, wenn ich nicht von alleine aufstand, um zur Schule zu gehen. Normalerweise weckte sie mich, indem sie vor meiner Tür besonders viel Lärm machte. Kaum einmal klopfte sie an die Tür, und fast nie öffnete sie sie. Ich konnte an den Fingern einer Hand abzählen, wie oft meine Mutter gleichzeitig mit mir in meinem Zimmer gewesen war, besonders während der letzten fünf Jahre.
Stattdessen wartete sie, bis ich zur Schule gegangen war, dann erst betrat sie das Zimmer wie ein Zimmermädchen im Hotel, das erst hereinkam, wenn die Gäste den Raum verlassen hatten, machte sauber und räumte nach ihren Vorstellungen auf. Ich war nie ordentlich genug, um sie zufrieden zu stellen. Als ich noch jünger war und es wagte, Unterwäsche auf einem Stuhl oder auf der Frisierkommode liegen zu lassen, schimpfte sie heftig und sah aus wie die böse Hexe im Zauberer von Oz. »Deine Sachen sind etwas ganz Privates und nicht für die Augen anderer bestimmt«, herrschte sie mich an, packte mich und schüttelte mich. »Verstehst du, Cathy? Verstehst du das, Cathy?«
Ich nickte dann rasch, fragte mich aber, welche anderen sie meinte. Meine Mutter konnte die Freunde und Geschäftspartner meines Vaters nicht leiden, und selbst hatte sie keine Freunde. Sie schätzte ihre Einsamkeit. Nur selten, wenn überhaupt, besuchte uns jemand zum Essen, und niemand kam je in mein Zimmer. Falls jemals irgendjemand nach oben käme, könnte er nichts sehen, weil meine Mutter darauf bestand, dass ich meine Tür stets geschlossen hielt. Das brachte sie mir in dem Augenblick bei, als ich sie selbst schließen konnte.
Trotzdem geriet sie völlig außer sich, wenn ich meine Seife und Cremes nicht in den Badezimmerschrank zurückstellte. Als ich einmal ein Unterhöschen auf dem Schreibtischstuhl liegen gelassen hatte, zerschnitt sie es und verteilte die Fetzen auf meinem Kopfkissen, um ihren Standpunkt unmissverständlich klar zu machen.
Heute Morgen war sie besonders laut. Ich hörte, wie sie den Eimer unsanft auf den Boden stellte, ja ihn hinknallte. Sie putzte früher als üblich. Der Schrubber prallte gegen meine Tür, fuhr über den Holzboden in der Diele und krachte dann wieder gegen die Tür. Ich schaute auf die kleine Uhr aus klarem dänischem Kristall auf meinem Nachttisch. Die Uhr war ein Geburtstagsgeschenk meiner Großmutter, der Mutter meiner Mutter, das sie mir nur wenige Wochen, bevor sie an Lungenkrebs starb, überreicht hatte. Mein Großvater war zwölf Jahre älter als sie und starb zwei Jahre später an einem Herzinfarkt. Genau wie ich war meine Mutter ein Einzelkind. Vor nicht allzu langer Zeit fand ich heraus, dass das nicht so geplant war, aber das ist eine andere Geschichte, eine vielleicht noch grässlichere Geschichte als das, was mir vor kurzem passiert ist. Eines war jedenfalls gewiss: Wir hatten keine große Familie. Unser Truthahn zu Thanksgiving war immer klein. Meine Mutter mochte keine Reste. Daddy brummelte dann immer vor sich hin, dass sie genug wegwarf, um eine ganze Familie davon zu ernähren. Aber er murmelte nie laut genug, dass Mutter das hören konnte.
Ein Grund für unsere kleinen Thanksgiving- und Weihnachtsfeiern war, dass die Eltern meines Vaters nichts mit ihm oder uns zu tun haben wollten. Auch seine Schwester Agatha und sein jüngerer Bruder Nigel besuchten uns nie. Mein Vater hatte mir erzählt, dass seine Familienmitglieder sich untereinander nicht leiden konnten und es daher das Beste für alle war, einander aus dem Weg zu gehen. Es dauerte Jahre, bis ich herausfand warum. Es war, wie Stücke eines Puzzles zu finden und sie zusammenzusetzen, um eine Erklärung für diese Verwirrung zu finden.
Als meine Mutter erneut mit dem Schrubber gegen die Tür knallte, wusste ich, dass es Zeit war aufzustehen, aber ich zögerte es noch weiter hinaus. Heute war mein Tag bei Dr. Marlowes Gruppentherapiesitzung. Die drei anderen Mädchen, Misty, Star und Jade, hatten ihre Geschichten erzählt, und jetzt wollten sie meine hören. Ich wusste, dass sie Angst hatten, ich würde nicht auftauchen. Für sie wäre das eine Art Verrat. Sie waren aufrichtig bis zur Schmerzgrenze gewesen; ich hatte zugehört und ihre höchst intimen Geschichten erfahren. Ich weiß, dass sie glaubten, sich damit das Recht erworben zu haben, meine zu hören. Ich war durchaus ihrer Meinung, wusste aber nicht, ob ich genug Mut aufbringen konnte, ihnen meine Geschichte zu erzählen.
Mutter drängte mich nicht dazu. Ärzte und Psychologen hatten ihr gesagt, dass es sehr wichtig für mich sei, eine Therapie zu machen, aber meine Mutter vertraute Ärzten nicht. Sie war sechsundvierzig und hatte, wenn ich es richtig verstanden hatte, seit über dreißig Jahren keinen Arzt mehr aufgesucht. Sie musste nicht zum Arzt gehen, um mich auf die Welt zu bringen. Ich bin adoptiert worden. Das erfuhr ich erst … erst hinterher, aber es ergab einen Sinn. Es war ungefähr das Einzige, das einen Sinn ergab.
Ich hörte auf zu frösteln und stand langsam auf. Meine dunkle Ahornfrisierkommode mit dem ovalen Spiegel stand meinem Bett fast direkt gegenüber, so dass ich morgens, wenn ich aufstand, als Erstes mich selbst sah. Es war stets eine Überraschung festzustellen, dass ich mich im Laufe der Nacht nicht verändert hatte, dass mein Gesicht immer noch die gleiche Form hatte (zu rund und voller Babyspeck), meine Augen immer noch haselnussbraun waren und mein Haar noch immer von einem stumpfen Dunkelbraun. In Träumen hatte sich mein Fleisch von meinen Knochen gelöst, sich verflüssigt und war in den Boden versickert. Nur ein Skelett war übrig geblieben. Das machte, glaube ich, meinen Wunsch deutlich, völlig zu verschwinden. Zumindest legte Dr. Marlowe das bei einer früheren Sitzung so aus.
Ich schlief sogar im Sommer in einem ziemlich dicken Baumwollnachthemd. Mutter erlaubte mir nicht, etwas Dünnes zu tragen und schon gar nicht etwas Durchsichtiges. Daddy versuchte mir ein paar weiblichere Schlafanzüge zu kaufen und schenkte mir sogar einen zum Geburtstag, aber meine Mutter ruinierte ihn aus Versehen in der Waschmaschine. Ich weinte deswegen.
»Warum«, fragte sie immer, »muss ein junges Mädchen oder eine unverheiratete Frau attraktiv aussehen, wenn sie schlafen geht?« Schließlich handelte es sich nicht um ein gesellschaftliches Ereignis. Hübsche Sachen sind dafür nicht wichtig; praktische Sachen sind wichtig; und Geld auszugeben für lächerliche, rüschenbesetzte Kleidungsstücke, um darin zu schlafen, ist Geldverschwendung.
»Außerdem ist es schlecht für den Schlaf«, beharrte sie, »sich mit narzisstischen Gedanken aufzureizen. Du solltest nicht über dein Aussehen nachdenken, wenn du zu Bett gehst.«
Wenn mein Daddy so etwas hörte, lachte er nur und schüttelte den Kopf, aber ein Blick von ihr reichte und er floh in die Sicherheit und Stille seiner Bücher und Zeitschriften, von denen sie viele nicht billigte.
Als ich ein kleines Mädchen war, saß ich oft da und beobachtete, wie sie in Zeitschriften blätterte, den Kopf schüttelte und Anzeigen, die sie für zu anzüglich oder sexy hielt, mit einem dicken schwarzen Marker durchstrich. Sie war eine strenge Zensorin, die alles gedruckte Material durchforstete, Fernsehprogramme kontrollierte und selbst meine Schulbücher durchging, um sicherzugehen, dass sie nichts Provokatives enthielten. Einmal schnitt sie sogar Illustrationen aus einem Schulbuch heraus. Häufig rief sie in der Schule an und führte wütende Gespräche mit meinen Lehrern. Der Schulleitung schrieb sie empörte Briefe. Mir war das immer peinlich, aber ich wagte nie, etwas zu sagen.
Ich gähnte und räkelte mich, als glitte ich in meinen Körper, schlüpfte mit den Füßen in meine pelzgefütterten Pantoffeln und ging ins Badezimmer, um mich zu duschen. Ich wusste, dass ich mich viel langsamer bewegte als sonst. Ein Teil von mir wollte dieses Zimmer nicht verlassen, aber einer der Gründe, warum ich Dr. Marlowe aufsuchte, war mein Drang, mich zurückzuziehen und noch introvertierter zu werden als zuvor … bevor das alles passiert war oder, um genauer zu sein, bevor alles enthüllt wurde. Wenn du dich selbst belügst, kannst du dich hinter einer Maske verstecken und in die Welt hinaus gehen. Du fühlst dich weder nackt noch zur Schau gestellt.
Ich war mir nicht sicher, was ich heute tragen sollte. Da es heute mein Tag war, an dem ich im Mittelpunkt des Interesses stand, fand ich, ich sollte besser gekleidet sein. Misty hatte sich zwar für ihren Tag oder irgendeinen Tag danach nicht besonders angezogen, aber ich würde mich vermutlich ein wenig wohler in meiner Haut fühlen, wenn ich mich entsprechend anzog. Unglücklicherweise war mir mein Lieblingskleid um Schultern und Brust zu eng. Der einzige Grund, warum meine Mutter es noch nicht zu Lumpen zerschnitten hatte, war, dass sie mich schon länger nicht darin gesehen hatte. Stattdessen wählte ich ein dunkelbraunes Baumwollkleid mit einer Empiretaille. Es war mein neuestes Kleid und stand mir am besten, obwohl meine Mutter es absichtlich eine Nummer zu groß gekauft hatte. Manchmal glaube ich, wenn sie ein Loch in ein Laken schneiden und es um mich drapieren könnte, wäre sie am glücklichsten. Ich weiß warum, und ich kann nichts dagegen tun, außer meine Brüste verkleinern zu lassen, die meiner Mutter ständig peinlich sind.
»Sieh zu, dass du auf die Zeitung trittst«, warnte meine Mutter mich, als ich meine Tür öffnete, um zum Frühstück hinunter zugehen. »Der Boden ist noch nass.«
Ein Weg aus alten Zeitungsseiten führte zur obersten Treppenstufe, wo sie mit dem Eimer in einer, den Schrubber wie die Lanze eines Ritters in der anderen Hand auf mich wartete. Sie drehte sich um und stieg vor mir hinab, ihr kleiner Kopf ruckte bei jedem Schritt nach unten auf ihrem ziemlich langen, starren Hals auf und ab.
Der Geruch nach einem starken Desinfektionsmittel stieg von den Holzdielen auf und stach mir in die Nase. Dadurch verging mir das bisschen Appetit, das ich aufzubringen vermochte. Ich hielt die Luft an und folgte ihr. In der Küche standen meine Müslischale, ein Glas mit Orangensaft und ein Teller für eine Scheibe Vollkorntoast mit ihrer selbst gemachten Konfitüre. Mutter holte den Krug mit Milch heraus und stellte ihn auf den Tisch. Dann schaute sie mich mit ihren großen runden, dunklen, kritischen Augen an und nahm meinen Anblick von Kopf bis Fuß in sich auf. Bestimmt sah ich schrecklich blass und müde aus. Ich wünschte, ich könnte ein wenig Make-up auflegen, besonders nachdem ich wusste, wie die anderen Mädchen aussahen. Selbst wenn ich welches besäße, würde meine Mutter verlangen, dass ich es wieder abwischte. Sie war grundsätzlich gegen Make-up, aber besonders kritisch stand sie jeder gegenüber, die es tagsüber benutzte.
Sie sagte nichts, was bedeutete, dass sie mein Aussehen billigte. Schweigen bedeutete in diesem Haus Zustimmung, und schon oft hatte ich es willkommen geheißen.
Ich schüttete mir Cornflakes aus der Packung in die Schale, fügte Blaubeeren und Milch hinzu. Sie beobachtete, wie ich den Orangensaft trank, den Löffel in die Cornflakes tauchte und umrührte. Ich spürte, wie sie über mir lauerte wie ein Falke. Ihr Blick glitt zu dem Stuhl, auf dem mein Vater morgens immer saß, sie bombardierte ihn mit ihren Blicken, als säße er noch immer darauf. Er las seine Zeitung, murmelte etwas und trank dann seinen Kaffee. Manchmal wenn ich aufschaute, stellte ich fest, dass er mich mit einem kleinen Lächeln auf den Lippen anstarrte. Dann warf er meiner Mutter einen Blick zu und wandte seine Aufmerksamkeit schnell wieder der Zeitung zu wie ein Schuljunge, der dabei erwischt worden ist, in die Klassenarbeit eines anderen geschaut zu haben. »Heute ist also dein Tag?«, fragte Mutter. Sie wusste es.
»Ja.«
»Was wirst du ihnen erzählen?«
»Ich weiß es nicht«, erwiderte ich und kaute mechanisch. Die Cornflakes fühlten sich an, als blieben sie mir im Halse stecken.
»Vermutlich wirst du mir die Schuld geben«, sagte sie. Das hatte sie schon oft gesagt.
»Nein, das werde ich nicht.«
»Diese Ärztin hätte es gerne, wenn du das tätest: mir die Schuld in die Schuhe schieben. Das ist bequem. Es macht ihre Arbeit einfacher, einen Sündenbock zu finden.«
»Das tut sie nicht«, widersprach ich.
»Ich sehe nicht ein, welchen Wert es haben soll, deine privaten Probleme Fremden zu enthüllen. Ich sehe überhaupt nicht ein, welchen Wert das haben soll«, maulte sie kopfschüttelnd. »Dr. Marlowe findet, es sei gut für uns, am Schicksal der anderen teilzuhaben«, erklärte ich ihr.
Ich wusste, dass meine Mutter Dr. Marlowe nicht mochte, aber ich wusste ebenfalls, dass sie auch keinen anderen Psychiater gemocht hätte. Mutter lebte nach dem Motto: »Wasch nie deine schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit.« Öffentlichkeit war für Mutter jeder außerhalb dieses Hauses. Sie selbst musste auch mit Dr. Marlowe ein Gespräch führen, weil es Bestandteil meiner Therapie war, und sie hatte jeden Augenblick gehasst. Sie beklagte sich über die neugierigen Fragen und sogar die Art und Weise, wie Dr. Marlowe sie anschaute – Mutter nannte es einen verurteilenden Blick. Dr. Marlowe verstand es sehr gut, ein völlig ausdrucksloses Gesicht zu machen, daher wusste ich, dass meine Mutter, was immer sie in Dr. Marlowes Ausdruck sah, es selbst dort hineininterpretiert hatte.
Dr. Marlowe meinte, es sei nur natürlich, wenn meine Mutter sich selbst die Schuld gebe oder glaubte, andere gäben ihr die Schuld. Ich gab ihr die Schuld, hatte das aber nie ausgesprochen und fragte mich, ob ich es je würde.
»Denk daran, dass Leute Tratsch lieben«, fuhr meine Mutter fort. »Gib ihnen keinen Anlass zum Tratschen, hörst du, Cathy? Achte darauf, dass du über alles nachdenkst, bevor du sprichst. Sobald etwas ausgesprochen ist, kannst du es nicht zurückholen. Du musst dir deine Gedanken wie kostbare, seltene Vögel vorstellen, die hier in einem Käfig sitzen«, sagte sie und deutete auf ihre Schläfe. »Am besten und sichersten Platz überhaupt, in deinem eigenen Kopf. Wenn sie versucht, dich dazu zu bringen, etwas zu erzählen, das du nicht erzählen möchtest, stehst du einfach auf und rufst mich an, damit ich dich abhole, hörst du?«
Sie machte eine Pause und reckte ihren langen Hals wie ein Vogel, um mich genau anzuschauen und zu überprüfen, ob ich ihr auch meine volle Aufmerksamkeit schenkte. Ihre Händen ruhten auf den Hüften. Die spitz vorstehenden, wie zwei Topfgriffe wirkenden Hüftknochen wurden sichtbar, wenn sie die Hände in die Seiten stemmte. Sie hatte nie besonders viel gewogen, aber von all dem war sie krank geworden und hatte Gewicht verloren, bis ihre Wangen eingefallen wirkten wie nasse Taschentücher, die schlaff auf ihren Knochen hingen. »Ja, Mutter«, stimmte ich gehorsam zu, ohne zu ihr aufzuschauen. Wenn sie so war, bereitete es mir Schwierigkeiten, sie direkt anzuschauen. Sie hatte einen Blick, der die Mauern um meine geheimsten Gedanken durchdringen konnte. Als ihr Gesicht dünner geworden war, wirkten ihre Augen noch größer, noch stechender und erfassten das geringste Zögern, um dadurch eine Lüge aufzuspüren.
Und dennoch war es ihr nicht gelungen, dies bei Daddy zu tun. Warum nicht?
»Gut«, bestätigte sie nickend. »Gut.«
Sie schob die Lippen einen Augenblick vor und blähte die Nasenflügel. All ihre Gesichtszüge waren zart. Ich erinnere mich daran, dass mein Vater sie einmal beschrieb als eine Frau mit den Knochen eines Spatzes. Aber obwohl sie so zierlich war, hatte sie nichts wirklich Zerbrechliches an sich, selbst jetzt nicht bei ihrem düsteren Gemütszustand und ihrem gequälten Verhalten. Unsere Familienprobleme hatten sie stark und hart wie eine alte Rosine gemacht, wie jemand, der seine Blütezeit hinter sich hatte, obwohl sie nicht alt wirkte. In ihrem Gesicht war kaum eine Falte zu sehen. Sie wies oft daraufhin, um die Vorteile eines guten sauberen Lebens zu betonen. Und darum sollte ich mich nicht von anderen Mädchen in der Schule oder Dingen, die ich im Fernsehen oder in Zeitschriften sah, beeinflussen lassen.
Ich lachte in mich hinein, wenn ich an Mistys Mutter und ihre Besessenheit dachte, jünger auszusehen, schönheitschirurgische Eingriffe vornehmen zu lassen, Kosmetikcremes zu benutzen und Pflanzenpackungen anzuwenden. Mutter ließ nur Ivoryseife und warmes Wasser an ihre Haut. Sie rauchte nie, besonders nach dem, was mit ihrer Mutter passiert war. Sie trank nie Bier oder Wein oder Whiskey, und sie blieb nie zu lange in der Sonne.
Mein Vater rauchte und trank, aber er rauchte nie im Haus. Trotzdem machte sie immer ein großes Theater um den Gestank in seiner Kleidung und hängte die Anzüge auf die Wäscheleine im Garten, bevor sie zuließ, dass sie in den Kleiderschrank zurückgehängt wurden. Sonst würden sie noch die anderen Kleidungsstücke kontaminieren und: »Wer weiß? Vielleicht ist der Geruch von Rauch für unsere Gesundheit ebenso gefährlich.«
Während ich frühstückte, ging Mutter ihrer Arbeit nach und spülte das Geschirr von ihrem eigenen Frühstück. Dann stürzte sie sich auf mein geleertes Orangensaftglas, packte es mit ihren langen knochigen Fingern, als könnte es sich vom Tisch stehlen und in einer Ecke verstecken.
»Geh nach oben und putz dir die Zähne«, kommandierte sie, »während ich hier unten alles in Ordnung bringe. Danach fahren wir los. Etwas sagt mir, ich sollte dich heute nicht dorthin bringen, aber wir werden sehen«, prophezeite sie. »Wir werden sehen.«
Sie ließ das Wasser laufen, bis es fast zu heiß war, um es zu berühren, dann spülte sie meine Cornflakesschale aus. Oft vermittelte sie mir das Gefühl, der Überträger einer endlosen Zahl von Keimen zu sein. Wenn sie alles auskochen könnte, das ich oder mein Vater berührten, würde sie es tun.
Ich ging nach oben, putzte mir die Zähne, fuhr mir ein paar Mal mit der Bürste durchs Haar und stand schließlich da und starrte mich selbst im Badezimmerspiegel an. Trotz allem, was jedes der Mädchen mir und den anderen über sich erzählt hatte, fragte ich mich, ob ich über mein Leben mit der gleichen Offenheit reden konnte. Bis jetzt kannten nur Dr. Marlowe, der Richter und ein Vertreter der Jugendfürsorge meine Geschichte.
Ich spürte das Zittern in meinen Waden. Es bewegte sich in meinen Beinen aufwärts, bis es in meinen Magen eindrang. Mir drehte sich der Magen um, das Zittern schoss bis in mein Herz, das anfing zu rasen.
»Nun mach schon, wenn du gehen willst«, rief meine Mutter von unten. »Ich habe heute noch etwas zu tun.«
Mein Magen revoltierte, ich musste mich vor die Toilette knien und erbrechen. Ich versuchte, das so leise wie möglich zu tun, damit sie nichts merkte. Schließlich fühlte ich mich besser und wusch mir rasch das Gesicht.
Mutter hatte ihren hellgrauen kurzen Tweedmantel über ihren Kittel gezogen und stand ungeduldig an der Haustür. Sie trug ihre schwarzen Schuhe mit den klobigen Absätzen und dicke Nylonstrümpfe, die fast bis zum Knie reichten. Heute Morgen hatte sie sich entschlossen, einen hellbraunen Schal um den Hals zu binden. Ihr Haar hatte die Farbe angelaufener Silbermünzen und war wie üblich mit einem dicken Gummiband am Hinterkopf zu einem Knoten gebunden.
Trotz ihres strengen Aussehens hatte meine Mutter wunderschöne himmelblaue Augen. Manchmal hielt ich sie für Gefangene, weil sie oft das Licht einfingen und funkelten, obwohl der Rest des Gesichtes niedergeschlagen wirkte. Sie sahen aus, als gehörten sie in einen viel jüngeren Frauenkopf, einen Kopf, der sich nach Spaß und Gelächter sehnte. Diese Augen sehnten sich danach zu lächeln. Früher glaubte ich immer, ihre Augen hätten meinen Vater angezogen, aber das war, bevor ich erfuhr, dass sie mit einundzwanzig ein Treuhandvermögen erbte.
Wenn meine Mutter meinen Vater beschuldigte, sie wegen ihres Geldes geheiratet zu haben, leugnete er das nicht. Stattdessen senkte er die Zeitung und sagte: »So? Mittlerweile ist es zehnmal so viel wert wie damals, oder? Du solltest mir danken.«
Verstand er den entscheidenden Punkt absichtlich nicht oder war das der entscheidende Punkt, fragte ich mich.
Ich wusste, dass wir viel Geld hatten. Mein Vater war Börsenmakler, und es stimmte, er hatte durch seine Investitionen Wunder gewirkt und ein Portfolio zusammengestellt, das uns ein behagliches sorgenfreies Leben garantierte. Weder mir noch meiner Mutter war klar, wie wichtig das noch einmal werden würde.
Mutter und ich gingen zum Auto hinaus, das in der Auffahrt stand. Meine Mutter hatte es schon früh am Morgen aus der Garage zurückgesetzt, die Windschutzscheibe geputzt sowie Boden und Sitze gesaugt. Das Auto war nicht das neueste Modell, aber so, wie sie es pflegte, und so wenig, wie sie damit fuhr, wirkte es fast wie neu.
»Du bist blass«, stellte sie fest. »Vielleicht solltest du anrufen und Bescheid sagen, dass du krank bist.«
»Mir geht es gut«, versicherte ich. Ich konnte förmlich hören, wie sie alle sagten: »Wir wussten es. Wir wussten, dass sie nicht kommen würde.« Natürlich würden sie wütend sein.
»Mir gefällt das nicht«, murmelte Mutter.
Jedes Mal, wenn sie sich beklagte, schreckte sie damit die kleinen Frösche in meinem Magen auf und brachte sie dazu, gegen meine Rippen zu springen. Ich stieg schnell ins Auto. Sie saß am Steuer und starrte das Garagentor an. In der Ecke befand sich eine kleine Delle, wo mein Vater eines Nachts mit dem Auto dagegen gefahren war, als er mit alten Freunden ein wenig zu viel getrunken hatte. Er reparierte es nie, und jedes Mal, wenn meine Mutter es anschaute, wusste ich, dass sie an ihn dachte. Das brachte die Wut in ihrem Herzen zum Brodeln.
»Ich frage mich, wo er an einem so schönen Morgen ist«, sagte sie, als sie den Motor anließ. »Ich hoffe, er schmort in der Hölle.«
Wir fuhren rückwärts die Auffahrt hinunter und machten uns auf den Weg. Meine Mutter fuhr sehr langsam, immer unterhalb der Geschwindigkeitsbegrenzung, was dazu führte, dass die Fahrer hinter uns ständig auf die Hupe drückten und uns mit frustriert zusammengebissenen Zähnen verfluchten.
Bevor mein Vater uns verlassen hatte, half er mir, meinen Führerschein zu machen, aber Mutter mochte es nicht, wenn ich fuhr. Sie fand, das Alter zum Autofahren sollte auf einundzwanzig heraufgesetzt werden, und selbst das hielt sie heutzutage für zu niedrig.
»Die Menschen sind heute nicht so reif, wie sie es waren, als ich jünger war«, erzählte sie mir. »Es dauert Jahre, erwachsen zu werden, und Autofahren ist eine große Verantwortung. Ich weiß, warum dein Vater dich das hat machen lassen«, fügte sie mit knirschenden Zähnen hinzu. Sie machte das so oft, dass es an ein Wunder grenzte, dass sie keine Zahnprobleme hatte. »Bestechung«, stieß sie hervor. »Selbst die Hölle ist noch zu gut für ihn.«
»Es war nicht einfach Bestechung, Mutter. Ich bin eine vorsichtige Fahrerin«, versicherte ich ihr. Sie hatte mir ihr Auto noch nie geliehen und war nur zweimal im Auto meines Vaters gewesen, als ich es gefahren hatte. Dabei hatte sie sich jedes Mal die ganze Zeit beschwert.
»Man kann nie vorsichtig genug sei«, erwiderte sie. Die Ausdrücke und Gedanken kamen praktisch automatisch. Ich stellte mir immer vor, meine Mutter hätte winzige Knöpfe in ihrem Gehirn, die gedrückt werden, wenn jemand etwas sagt, und damit bereits vorformulierte Sätze, die bereit sind, durch ihren Mund geschickt zu werden, auslösen. Jedem Knopf war ein bestimmter Gedanke oder eine tiefsinnig-philosophische Feststellung zugeteilt.
Heute Morgen war es besonders bewölkt und viel feuchter als in den letzten Tagen. Der Wettermann hatte für den späten Nachmittag mögliche Gewitter vorhergesagt. Ich sah einige bedrohlich wirkende Wolken, die im Westen über dem Ozean hingen und wie eine sich sammelnde Armee warteten, um einen Angriff zu starten.
»Ich bin den ganzen Tag zu Hause«, informierte Mutter mich, als wir dahinfuhren. »Wenn du mich brauchst, zögere nicht, mich anzurufen, hörst du?«
»In Ordnung«, sagte ich.
»Die Lebensmittel habe ich schon alle eingekauft. Ich muss an unseren Büchern arbeiten.«
Sie meinte unsere Finanzen. Meine Mutter hatte die Kontrolle über den Großteil ihres Vermögens erlangt und war stolz darauf, wie gut sie unsere Konten führte. Sie ging die Sache mit der gleichen Effizienz an wie alles andere. In ihrem Gehirn war auch ein Knopf mit der Aufschrift »Spare in der Zeit, so hast du in der Not«.
Als Dr. Marlowes Haus in Sicht kam, schnalzte meine Mutter mit der Zunge und schüttelte den Kopf.
»Mir gefällt das nicht«, sagte sie. »Ich sehe nicht ein, wie hierbei etwas Gutes herauskommen soll.«
Ich sagte nichts. Zögernd bog sie in die Einfahrt und fuhr vor, gerade als Jades Limousine davonfuhr.
»Wer ist dieses verwöhnte Mädchen?«, fragte sie und kniff die Augen zusammen, als die Limousine verschwand. Sie zog die Schultern hoch und sah aus, als würde sie sich auf meine Antwort stürzen wie eine streunende Katze.
»Sie heißt Jade«, erklärte ich. »Ihr Vater ist ein bedeutender Architekt, und ihre Mutter ist Verkaufsleiterin einer großen Kosmetikfirma.«
»Verwöhnt«, erklärte sie erneut mit der felsenfesten Überzeugung eines Arztes, der jemanden für tot erklärt. Sie nickte und zog die Augenbrauen hoch. »Was man sät, muss man auch ernten.«
Sie hielt das Auto an und schaute mich mit einem Blick an, der mir immer die ganze Schuld in die Schuhe schob, so sehr sie auch meinen Vater verfluchen mochte.
»Wann ist das vorbei?«, wollte sie wissen und warf einen so wütenden Blick zum Haus, dass ich dachte, sie bringt es vor unseren Augen zum Einstürzen.
»Vermutlich um die gleiche Zeit wie gestern und vorgestern«, teilte ich ihr mit.
»Hm«, machte sie. Sie überlegte einen Augenblick und drehte sich dann abrupt zu mir um. »Denk daran, lass nicht zu, dass diese Frau dich dazu bringt, etwas zu sagen, das du nicht sagen willst«, warnte sie mich.
»Das werde ich nicht.«
Sie nickte, ihre Augen leuchteten, immer noch von Wut geschürt, weiter wie zwei Weihnachtsbäume. Sie presste die Lippen zusammen und sprach durch zusammengebissene Zähne. »Ich hoffe, er schmort in der Hölle«, verfluchte sie ihn.
Ich fragte mich, warum ich das nicht tat.
Ich sollte es. Ich sollte ihn mehr hassen, als sie es tat.
Ich warf einen Blick auf die Eingangstür von Dr. Marlowes Haus.
Vielleicht heute, vielleicht würde ich heute entdecken, warum das alles so war.
Das verlieh mir die Stärke, die Tür zu öffnen und auszusteigen. Mutter schaute mich an, schüttelte den Kopf und fuhr davon, so halsstarrig wie eh und je. Ich beobachtete, wie sie am Ende der Auffahrt anhielt, dann in die Straße einbog und sich auf den Weg nach Hause machte.
Ich holte ganz tief Luft, presste meine zusammengeballten Hände gegen den Magen und ging zur Eingangstür, um zu klingeln. Als Dr. Marlowes Hausmädchen Sophie öffnete, stellte ich überrascht fest, dass alle drei hinter ihr standen, Misty, Star und Jade, und lächelten oder, besser gesagt, mich angrinsten.
»Wir beschlossen, keine Zeit in Dr. Marlowes Praxisraum zu verschwenden. Wenn du nicht rechtzeitig gekommen wärst, wären wir alle nach Hause gefahren«, sagte Jade, zog dabei den rechten Mundwinkel hoch und sprach mit ihrer hochnäsigsten, arrogantesten Stimme.
»Ich bin froh, dass du gekommen bist«, sagte Misty mit ihrem wie üblich temperamentvollen Lächeln.
»Lasst uns anfangen«, meinte Star. Sie stemmte die Hände in die Hüften und beugte sich zu mir vor. »Nun komm schon. Steh nicht den ganzen Tag da draußen und starr uns nicht wie eine Schaufensterpuppe an. Dr. Marlowe wartet auf dich.«
Ich trat ein. Misty sprang vor Sophie zur Tür und schloss sie. »Ich hab dich«, sagte sie und lachte.
Sie scharten sich um mich, um mit mir zu Dr. Marlowes Behandlungszimmer zu marschieren. Ein paar Augenblicke lang hatte ich das Gefühl, zu meiner eigenen Hinrichtung zu gehen.
Es gab vieles bei mir, das ich sterben sehen wollte. Vielleicht war die Zeit dazu gekommen.