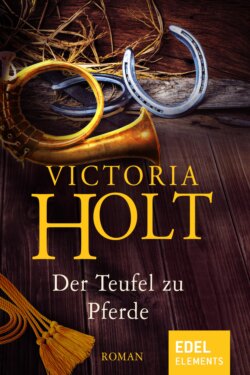Читать книгу Der Teufel zu Pferde - Victoria Holt - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеDie Aufregung im Schulhaus hielt an. Meine Mutter wanderte mit abwesendem Blick umher, ein zufriedenes Lächeln auf den Lippen.
Ich wußte sehr wohl, was in ihrem Kopf vorging, und ihr Übermut erschreckte mich ein wenig.
Tatsache war doch, daß Freundlichkeit zu Joel Derringhams Charakter gehörte. Ich war achtzehn Jahre alt und schien trotz mangelnder Welterfahrung recht reif und gebildet. Vermutlich verdankte ich das meinem Naturell, da ich ernsthafter veranlagt war als die Derringham-Töchter – und ganz gewiß ernsthafter als Margot. Es war mir stets nahegelegt worden, daß ich die bestmögliche Bildung erhalten mußte, da ich durch sie meinen Unterhalt zu verdienen hätte. Dies hatte mir meine Mutter seit dem Tod meines Vaters dermaßen eingeschärft, daß ich es als selbstverständlich für mein Leben akzeptiert hatte. Ich hatte eifrig alles gelesen, was mir in die Hand kam. Ich hatte es für meine Pflicht gehalten, über jedes Thema, das angeschnitten werden mochte, etwas zu wissen, und dies war es zweifellos, weshalb Joel mich für anders als die übrigen Mädchen hielt. Seit unserer ersten Begegnung hatte er meine Nähe gesucht. Begab ich mich auf meinen bevorzugten Spaziergang über die Weiden, so fand ich ihn auf einem Zaungatter sitzend, das ich durchqueren mußte, und dann begleitete er mich auf meinem Weg. Er ritt häufig am Schulhaus vorbei und schaute auch gelegentlich herein. Meine Mutter empfing ihn wohlwollend, doch ohne Aufhebens, und nur die Blässe ihrer Wangen verriet mir ihre innere Erregung. Sie war entzückt. Diese prosaischste aller Frauen war nur dort empfindlich, wo es ihre Tochter betraf, und es wurde auf geradezu peinliche Weise offensichtlich, daß sie es sich in den Kopf gesetzt hatte, Joel Derringham solle mich heiraten. Statt im Schulhaus sollte sich meine Zukunft auf Gut Derringham abspielen.
Dies war ein höchst gewagter Traum; denn selbst wenn Joel es in Erwägung zöge, würde seine Familie es niemals gestatten. Doch wir waren innerhalb einer Woche zu guten Freunden geworden. Ich genoß unsere Zusammenkünfte, die nie verabredet waren, sondern sich wie von selbst zu ergeben schienen, obschon ich den Verdacht hegte, daß er sie absichtlich herbeiführte. Erstaunlich, wie oft ich ausging und ihn traf. Ich ritt auf Jenny, unserem kleinen Pferd, das den Einspänner, unser einziges Beförderungsmittel, zu ziehen pflegte. Sie war nicht mehr jung, aber fügsam, und meine Mutter hatte darauf geachtet, daß ich gut ritt. Wenn ich mit Jenny unterwegs war, begegnete ich hin und wieder Joel auf einem der edlen Jagdpferde aus den Derringhamschen Stallungen. Dann ritt er neben mir her, und es traf sich jedesmal, daß der Weg, den ich einschlug, zufällig auch der seine war. Er war ebenso gütig und charmant wie anregend, und ich fand seine Gesellschaft interessant. Ich fühlte mich auch geschmeichelt, weil er meine Nähe suchte.
Margot erzählte mir, ihre Eltern hätten England wegen der Zustände in Frankreich verlassen. Sie selbst schien nicht sonderlich verstört, war vielmehr entzückt, allein in England zurückbleiben zu können. Zwar wunderte ich mich insgeheim über Margot, welche an einem Tag äußerst fröhlich und von übertriebener Lustigkeit sein konnte, am anderen dagegen ernst und niedergeschlagen. Ihre Stimmungsumschwünge waren nie vorhersehbar, doch da ich in meine eigenen Angelegenheiten vertieft war, schrieb ich das alles ihrem gallischen Temperament zu und dachte nicht weiter über Margot nach.
Joel klärte mich über den Grund der plötzlichen Abreise des Comte auf. Ich war auf Jenny ausgeritten, da ich sie gewöhnlich am späten Nachmittag nach der Schule auszureiten pflegte. Meistens wurde es jedoch Abend, bis ich endlich Zeit fand auszureiten. Unweigerlich sah ich die hohe Gestalt zwischen den Bäumen auf mich zukommen, und häufig ertappte ich mich dabei, daß ich geradezu darauf wartete.
Joel machte ein sehr ernstes Gesicht, während er über die Abreise des Comte sprach.
»Am französischen Hofe braut sich ein großer Skandal zusammen«, berichtete er. »Mehrere Mitglieder des Hochadels scheinen darin verwickelt zu sein, und der Comte hielt es für klug, unverzüglich zurückzukehren. Es handelt sich unter anderem um ein Diamantenhalsband, welches die Königin mit Hilfe eines Kardinals erworben haben soll, und es geht das Gerücht, daß er als Gegenleistung für seine Dienste hofft, ihr Liebhaber zu werden ..., es vielleicht gar schon geworden ist. Natürlich bestreitet die Königin dies, und der Kardinal de Rohan ist mitsamt seinen Komplizen verhaftet worden. Es scheint daraus eine cause célèbre zu entstehen.«
»Und betrifft diese auch den Comte Fontaine Delibes?«
»Alle Anzeichen sprechen dafür, daß sie ganz Frankreich betreffen könnte. Die königliche Familie kann sich zu diesem Zeitpunkt keinen Skandal leisten. Vielleicht irre ich mich ..., das hoffe ich sehr. Mein Vater meint, daß ich übertreibe; aber wie ich Ihnen schon sagte, spürte ich eine wachsende Unruhe im Lande, als ich dort war. Es gibt so viel Verschwendung dort. Die Reichen sind so reich, und die Armen sind so arm.«
»Ist das nicht überall der Fall?«
»Ja, ich denke schon, doch in Frankreich scheint sich jetzt der Verdruß überall auszubreiten. Ich glaube, der Comte ist darüber genauestens informiert. Aus diesem Grunde entschloß er sich, unverzüglich zurückzukehren. Noch am Abend der Soiree begann er mit den Vorbereitungen für die Rückreise.«
Ich dachte über seine überstürzte Abreise nach und vermutete, daß er mich deswegen keines weiteren Gedankens gewürdigt hätte. Jener Abend, so sprach ich zu mir selbst, war wohl die letzte Gelegenheit, bei der ich diesen vornehmen Herrn zu Gesicht bekommen hatte, und das sei nicht einmal so schlecht. Irgend etwas sagte mir, daß seine Bekanntschaft mir nichts Gutes bringen würde. Ich mußte ihn mir aus dem Kopf schlagen. Das durfte mir nicht schwerfallen, genoß ich doch zur Zeit die sehr angenehme Freundschaft des begehrtesten jungen Mannes der Umgebung.
Danach sprachen wir nicht mehr viel über den Comte. Joel nahm an den Vorgängen im eigenen Lande lebhaften Anteil und hoffte, eines Tages ins Parlament einzuziehen. Seine Eltern waren davon keineswegs angetan. »Sie finden, daß ich als der einzige Sohn mich den Gütern widmen sollte.«
»Und Sie haben ganz andere Vorstellungen.«
»Oh, ich interessiere mich durchaus für unsere Güter, aber das reicht doch nicht, um das Leben eines Mannes auszufüllen. Diese Aufgaben kann man den Verwaltern überlassen. Warum sollte ein Mann nicht fortgehen, um sich für die Geschicke des Landes einzusetzen?«
»Man kann wohl sagen, daß Mr. Pitt aufgrund seiner Laufbahn als Parlamentarier vollauf beschäftigt ist.«
»Er ist ja auch Premierminister.«
»Sie streben doch gewiß ebenfalls das höchste Amt an.«
»Vielleicht.«
»Und Sie wollen die Gutsgeschäfte mehr und mehr Ihren Verwaltern überlassen?«
»Möglicherweise. Oh, ich liebe das Land. Die Aufgaben, die es bietet, interessieren mich durchaus, doch wir leben in schwierigen und gefahrvollen Zeiten, Fräulein Maddox. Wenn es jenseits des Kanals zum Aufruhr kommt ...«
»Was für ein Aufruhr?« fragte ich schnell.
»Sie erinnern sich doch, daß ich jene ›Generalprobe‹ erwähnte. Wie, wenn das tatsächlich eine Generalprobe für eine kommende Vorstellung mit voller Besetzung gewesen war?«
»Sie meinen eine Art Bürgerkrieg?«
»Ich meine, daß sich die Bedürftigen gegen die Wohlhabenden erheben könnten ..., die Hungernden gegen die Verschwender. Ich halte das immerhin für möglich.«
Ich erschauerte, als ich mir den Comte stolz in seinem Château vorstellte. Und der Pöbel marschierte ..., der blutrünstige Pöbel ...
Meine Mutter meinte immer, ich ließe meiner Phantasie zu freien Lauf. »Die Phantasie ist wie das Feuer«, pflegte sie zu sagen. »Ein guter Freund, aber auch ein unerbittlicher Feind. Du mußt lernen, sie so zu lenken, wie sie dir am besten dienen kann.«
Ich fragte mich, wieso es mich eigentlich kümmerte, was mit jenem Mann geschah. Ich war überzeugt, daß es ihm recht geschähe, wenn ihn ein böses Schicksal ereilte, aber ich konnte mir vorstellen, daß kein übles Los ihm je etwas anhaben würde. Er würde stets Sieger bleiben.
Joel fuhr fort: »Mein Vater tadelt mich jedesmal, wenn ich von diesen Dingen rede. Er glaubt, daß es sich zum größten Teil um unbedeutende Spekulationen handelt. Vermutlich hat er recht. Aber der Comte hielt es immerhin für angebracht zurückzukehren.«
»Hat es etwas zu bedeuten, daß er seine Tochter hier zurückließ?«
»Nicht im geringsten. Ihm kommt es nur auf ihren Englisch-Unterricht an. Er sagt, seit sie Ihre Schule besucht, spricht sie viel besser Englisch als er. Er wünscht, daß sie es vervollkommnet. Sie können noch ein weiteres Jahr mit ihr rechnen.«
»Meine Mutter wird erfreut sein.«
»Und Sie?« fragte er.
»Ich habe eine Schwäche für Margot. Sie ist sehr amüsant.«
»Sie ist sehr ... jung ...«
»Sie wächst schnell heran.«
» ...und leichtsinnig«, fügte er hinzu.
Das konnte man von Joel kaum behaupten, sinnierte ich. Er nahm das Leben ausgesprochen ernst. Er liebte es, mit mir über Politik zu reden, da ich über die Vorgänge im Lande Bescheid wußte. Meine Mutter und ich lasen jede Zeitung, deren wir habhaft werden konnten. Joel hegte eine warme Bewunderung für Mr. Pitt, unseren jüngsten Premier, und er sprach begeistert von dessen Klugheit. Nie sei das Land besser regiert worden, fand er. Joel glaubte, daß der von Pitt gegründete Sinking Fund unsere nationale Verschuldung allmählich reduzieren würde.
Als ein Anschlag auf das Leben des Königs verübt wurde, kam Joel wahrhaftig zum Schulhaus, um uns davon zu berichten. Meine Mutter war entzückt, ihn zu sehen, und holte eine Flasche ihres selbstgemachten Weines, den sie für besondere Anlässe aufbewahrte, sowie etwas von dem Weingebäck, auf das sie besonders stolz war.
Sie schnurrte nahezu, als wir uns am Tisch in unserer guten Stube niederließen, und Joel erzählte uns von der wahnsinnigen Alten, die unter dem Vorwand, eine Petition überreichen zu wollen, auf den König gewartet hatte, als er am Gartentor von St. James aus seiner Kutsche stieg. Und dann hatte sie versucht, ihm ein Messer, das sie verborgen gehalten hatte, in die Brust zu stoßen.
»Gottlob«, sagte Joel, »gelang es den Wachen Seiner Majestät, ihr rechtzeitig in den Arm zu fallen. Der König betrug sich genau so, wie man es von ihm erwartet. Seine Sorge galt der armen Frau. ›Ich bin nicht verletzte rief er, ›man kümmere sich um sie.‹ Er sagte, sie sei verrückt und daher für ihr Tun nicht verantwortlich.«
»Ich habe sagen hören«, warf meine Mutter ein, »daß Seine Majestät von natürlichem Mitleid für die dermaßen Heimgesuchten beseelt ist.«
»Oh, ich möchte schwören, Sie haben Gerüchte über seinen eigenen Gesundheitszustand gehört«, sagte Joel.
»Sicher ist Ihnen bekannt«, erwiderte meine Mutter, »ob etwas Wahres daran ist.«
»Ich weiß von den Gerüchten, doch die Wahrheit steht auf einem anderen Blatt.«
»Glauben Sie, die Frau handelte aus eigenem Antrieb, oder gehörte sie einer Bande an, welche dem König Schaden zuzufügen beabsichtigte?« fragte ich.
»Man kann fast als sicher annehmen, daß ersteres der Fall ist.« Joel nippte an seinem Wein, machte meiner Mutter ein Kompliment darüber und über ihr Gebäck und bezauberte uns dann mit Anekdoten vom Hofe, uns, deren Leben sich so weit davon entfernt abspielte.
Es war ein angenehmer Besuch, und nachdem er gegangen war, glühte meine Mutter vor Stolz. Mit ihrer zärtlichen, unmelodischen Stimme hörte ich sie »Heart of Oak« singen, und da sie dies immer tat, wenn sie mit dem Leben besonders zufrieden war, wußte ich, was sich in ihrem Kopfe abspielte.
Im September hatte ich Geburtstag – in jenem Jahr, 1786, wurde ich neunzehn –, und als ich zu unserem kleinen Anbau, der als Stall diente, hinausging, um Jenny zu satteln, erwartete mich dort eine bildschöne Fuchsstute. Ich erstarrte vor Staunen. Dann vernahm ich eine Bewegung hinter mir. Ich drehte mich um und erblickte meine Mutter. Seit mein Vater tot war, hatte ich sie noch nie so glücklich strahlen sehen.
»Nun«, sagte sie, »wenn du jetzt mit Joel Derringham ausreitest, siehst du wenigstens anständig aus.«
Ich warf mich in ihre Arme, und wir liebkosten uns. Sie hatte Tränen in den Augen, als sie mich losließ.
»Wie hast du das nur ermöglichen können?« fragte ich.
»Ach!« Sie nickte weise. »So etwas fragt man nicht, wenn man ein Geschenk bekommt.«
Dann dämmerte mir die Wahrheit. »Die Mitgift!« rief ich entsetzt. Meine Mutter hatte, wie sie sich ausdrückte, »für Notzeiten« gespart, und das Geld wurde in einer alten Aussteuertruhe aus der Tudorzeit aufbewahrt, die sich seit vielen Jahren im Besitz der Familie befand. Diese Ersparnisse nannten wir »die Mitgift«.
»Nun, ich dachte, ein Pferd im Stall wäre besser als ein paar Goldstücke im Beutel. Du hast noch nicht alles gesehen. Komm mit nach oben.«
Stolz führte sie mich in ihr Schlafzimmer, und dort lag eine komplette Reitgarderobe auf dem Bett – dunkelblauer Rock mit Jacke, dazu ein hoher Hut von der gleichen Farbe.
Ich konnte es nicht erwarten, alles anzuprobieren, und natürlich paßte es perfekt.
»Wie gut es dir steht«, murmelte meine Mutter. »Dein Vater wäre so stolz gewesen. Jetzt schaust du aus, als gehörtest du wirklich zu ...«
»Gehören! Zu wem?«
»Du siehst in jeder Hinsicht genauso herrschaftlich aus wie die Gäste drüben im Gutshaus.«
Ich verspürte einen Anflug von Beklemmung. Ich begriff vollkommen, wohin ihre Gedanken strebten. Meine Freundschaft mit Joel Derringham hatte ihr den Verstand geraubt. Für sie stand es unzweifelhaft fest, daß er mich heiraten würde, und aus diesem Grunde war sie bereit, Geld aus der Aussteuertruhe zu nehmen, das ihr, soweit ich zurückdenken konnte, nahezu heilig gewesen war. Ich konnte mir vorstellen, wie sie sich einredete, daß Pferd und Ausstattung keine Verschwendung seien. Sie verkündeten der Welt, daß ihre Tochter würdig war, in die Reihen des Adels aufzusteigen.
Ich sagte nichts, aber die Freude an meinem neuen Pferd und den Kleidern war beträchtlich getrübt.
Als ich ausritt, beobachtete sie mich aus dem Fenster des Obergeschosses, und ich empfand eine große Welle der Zärtlichkeit für sie, doch gleichzeitig war ich ziemlich sicher, daß sie enttäuscht werden würde.
Ein paar Wochen lang ging das Leben weiter wie bisher. Es wurde Oktober. Die Schule war weniger stark besucht als letztes Jahr um diese Zeit. Meine Mutter war stets beunruhigt, wenn Schülerinnen ausblieben. Sybil und Maria kamen natürlich nach wie vor, und mit ihnen Margot, aber selbstverständlich würde Margot eines Tages zu ihren Eltern zurückkehren, und Sybil und Maria würden wahrscheinlich mit ihr gehen, um eine Schule in der Nähe von Paris zu besuchen, die ihnen den letzten Schliff verleihen sollte.
Trotz aller Widrigkeiten konnte ich nicht umhin, Vergnügen an meiner neuen Stute zu empfinden. Die arme Jenny war endlich von mir entlastet; und die Stute, welche ich Dower, Mitgift, genannt hatte, brauchte viel Bewegung; also ritt ich häufig aus. Und immer kam Joel mir entgegen. Samstags und sonntags, wenn kein Unterricht stattfand, unternahmen wir ausgedehnte Spazierritte.
Wir sprachen über Politik, über die Sterne, über das Landleben und über andere beliebige Themen, und von allem schien er eine Menge zu wissen. Er war von einem stillen Enthusiasmus beseelt, den ich liebenswert fand, aber obwohl ich ihn sehr gerne mochte, fühlte ich mich durch seine Gesellschaft nicht besonders erregt. Dies wäre mir wohl nie aufgefallen, wenn meine Begegnung mit dem Comte nicht stattgefunden hätte. Selbst nachdem soviel Zeit vergangen war, ließ die Erinnerung an seine Küsse mich erschaudern. Ich hatte angefangen, von ihm zu träumen, und obwohl diese Träume ziemlich erschreckend sein konnten, erwachte ich stets voller Bedauern und wünschte, ich könnte mich in sie zurückversetzen. Ich träumte, daß ich mich in einer peinlichen Situation befand, und immer war der Comte da und beobachtete mich mit rätselhaftem Blick, so daß ich nie sicher sein konnte, was er tun würde.
Das war höchst närrisch und lächerlich, und eine ernsthafte junge Dame meines Alters hätte nicht so naiv sein dürfen. Ich suchte vor mir selbst nach Entschuldigungen. Ich hatte ein wohlbehütetes Leben geführt und war nie in die Welt hinausgekommen. Manchmal kam es mir vor, als teilte meine Mutter meine Naivität. Wie hätte sie sonst glauben können, daß Joel Derringham mich heiraten würde?
Ich war so in meine eigenen Angelegenheiten vertieft, daß ich nur am Rande wahrnahm, welche Veränderung mit Margot vorging. Ihre Überschwenglichkeit hatte nachgelassen. Gelegentlich war sie sogar regelrecht bedrückt. Daß sie ein launenhaftes Geschöpf war, hatte ich immer gewußt, doch nie war es so stark zum Ausdruck gekommen wie jetzt. Zeitweise war sie von fast hysterischer Fröhlichkeit, und ein anderes Mal konnte sie beinahe morbid sein.
Sie war unaufmerksam im Unterricht, und ich wartete, bis wir einmal allein waren, um ihr Vorwürfe zu machen.
»Englische Verben!« rief sie aus, indem sie die Hände zusammenschlug. »Wie langweilig! Wem macht es schon etwas aus, ob ich Englisch spreche wie du oder wie ich ..., solange man mich versteht.«
»Mir macht es etwas aus«, hielt ich ihr vor. »Meiner Mutter macht es etwas aus, und deiner Familie auch
»Denen ist es doch einerlei. Sie würden den Unterschied ohnehin nicht merken.«
»Dein Vater hat dir erlaubt hierzubleiben, weil er von deinen Fortschritten angetan war.«
»Er hat mir erlaubt hierzubleiben, weil man mich nicht im Weg haben wollte.«
»Solch einen Unsinn glaube ich nicht.«
»Minelle, du bist ..., wie sagt man ..., eine Heuchlerin. Du tust so, als seist du weiß Gott wie gut. Du hast all deine Verben gelernt, das bezweifle ich nicht ... und doppelt so schnell wie alle anderen. Und jetzt reitest du auf deinem neuen Pferd ... in deinen eleganten Kleidern ..., und wer wartet in den Wäldern auf dich? Sag es mir!«
»Ich habe dich hierher gebeten, um ernsthaft mit dir zu reden, Margot.«
»Gibt es etwas Ernsteres als das hier, hm? Joel mag dich, Minelle. Er hat dich sehr gern. Ich bin froh, weil ... – soll ich dir etwas sagen? Sie hatten ihn für mich bestimmt. Oh, das überrascht dich, ja? Mein Vater und Sir John haben darüber gesprochen. Ich weiß es, weil ich gelauscht habe ..., am Schlüsselloch. Oh, wie ungezogen! Mein Vater sähe es gern, wenn ich in England ansässig würde. Er glaubt, daß Frankreich vorläufig nicht sicher ist. Wenn ich Joel heiraten würde ..., sein Besitz ... und sein Titel ..., das ist durchaus zu erwägen. Er stammt natürlich nicht aus einer so alten Familie wie wir ..., aber wir sind bereit, darüber hinwegzusehen. Und jetzt kommst du mit deinem neuen Pferd daher, mit deinen eleganten Reitkleidern, und Joel scheint mich überhaupt nicht mehr zu bemerken. Er hat nur Augen für dich.«
»Ich habe nie jemanden solchen Unsinn reden hören wie dich, wenn du schlechter Laune bist.«
»Angefangen hat es, nicht wahr, als du zum Tee kamst. Du hast ihn auf dem Rasen bei der Sonnenuhr getroffen. Du sahst sehr anziehend aus, als du da standest. Wie schön dein Haar in der Sonne aussieht, dachte ich. Und er dachte das gleiche. Bist du in ihn verliebt, Minelle?«
»Margot, ich wünsche, daß du deinen Lektionen mehr Aufmerksamkeit widmest.«
»Und ich wünsche, daß du mir deine Aufmerksamkeit widmest! Aber das tust du ja. Du bist ganz schön rot geworden, als die Rede auf Joel Derringham kam. Du kannst dich mir getrost anvertrauen, denn du weißt ...«
»Da gibt es nichts anzuvertrauen. Also Margot, du mußt intensiver an deinem Englisch arbeiten, andernfalls hat es gar keinen Sinn, daß du hier bist. Dann könntest du ebensogut auf dem Château deines Vaters weilen.«
»Ich bin nicht wie du, Minelle. Ich verstelle mich nicht.«
»Wir diskutieren nicht über die Verschiedenheit unserer Charaktere, sondern über die Notwendigkeit zu arbeiten.«
»Oh, Minelle, du machst einen ganz krank! Ich möchte nur wissen, warum Joel dich mag.«
»Wer sagt, daß er mich mag?«
»Ich. Marie sagt es, und Sybil. Und ich nehme an, alle anderen sagen es auch. Du kannst nicht so häufig mit einem jungen Mann ausreiten, ohne daß es den Leuten auffällt. Und sie ziehen ihre Schlüsse daraus.«
»Das ist sehr niederträchtig von ihnen!«
»Man wird nicht zulassen, daß er dich heiratet, Minelle.«
Mir wurde kalt vor Angst – und ich dachte dabei nicht an Joel oder gar an mich, sondern an meine Mutter.
»Es ist wirklich komisch ...«
Sie fing zu lachen an. Bei einer solchen Gelegenheit war es, daß mir erstmals bange um sie wurde. Sie verlor die Kontrolle über ihr Gelächter, und als ich sie bei den Schultern packte, begann sie zu weinen. Sie lehnte sich an mich und umklammerte mich, während ihr schlanker Körper von Schluchzen geschüttelt wurde.
»Margot, Margot«, rief ich. »Was fehlt dir?«
Aber ich konnte nichts aus ihr herausbekommen.
Im November schneite es. Es war einer der kältesten Novembermonate, an die ich mich erinnerte, Maria und Sybil konnten nicht vom Gutshaus zur Schule kommen, und unsere Klassen waren sehr klein geworden. Wir gaben uns alle Mühe, das Haus warm zu halten, doch obwohl in jedem Zimmer ein Holzfeuer brannte, schien der bitterkalte Ostwind durch jede Ritze einzudringen. Meine Mutter bekam »eine von ihren Erkältungen«, wie sie sich ausdrückte. Sie hatte jeden Winter darunter zu leiden, deshalb schenkten wir auch dieser anfangs kaum Beachtung. Aber sie hielt an, und ich bestand darauf, daß meine Mutter das Bett hütete, während ich die Schule weiterführte. Das war nicht sonderlich schwierig, da so viele Schülerinnen fortblieben.
Meine Mutter fing an, nachts zu husten, und als es schlimmer wurde, hielt ich es für angebracht, einen Arzt zu holen; aber sie wollte nichts davon hören. Es würde zuviel kosten, meinte sie. »Aber es muß sein«, beharrte ich. »Wir haben doch die Mitgift.« Sie schüttelte den Kopf. Ich zögerte noch ein paar Tage, aber als sie im Fieber irre zu reden begann, bat ich den Arzt zu kommen. Sie hätte eine Lungenblutung, stellte er fest.
Das war eine ernsthafte Krankheit – keineswegs nur eine winterliche Erkältung. Ich machte die Schule zu und widmete mich von da an ganz der Pflege meiner Mutter.
Dies waren wohl die unglücklichsten Tage, die ich je erlebt hatte. Sie dort liegen zu sehen, auf Kissen gestützt, ihre Haut heiß und trocken, mit glasigen Augen, die mich mit fiebrigglänzendem Blick betrachteten – das alles erfüllte mich mit Jammer. Ich hatte die schreckliche Vermutung, daß ihre Genesungschancen gering waren.
»Liebste Mama«, rief ich, »sag mir, was ich tun soll! Ich will alles tun ..., alles ..., wenn es dir nur besser gehen sollte!«
»Bist du es, Minella?« hauchte sie.
Ich kniete neben ihrem Bett und ergriff ihre Hände. »Ich bin hier, Liebste. Ich habe dich nicht verlassen, seit du krank bist. Ich werde immer bei dir bleiben ...«
»Minella, ich gehe zu deinem Vater. Ich habe letzte Nacht von ihm geträumt. Er stand am Bug seines Schiffes und streckte mir seine Hände entgegen. Ich sagte zu ihm: ›Ich komme zu dir.‹ Da hat er gelächelt und mir zugenickt. Ich sagte: ›Ich muß unsere kleine Tochter zurücklassen‹; und er antwortete: ›Für sie ist gesorgt, das weißt du doch.‹ Dann überkam mich ein tiefer Friede; und ich wußte, daß alles gut werden würde.«
»Nichts wird gut sein, wenn du nicht hier bist.«
»Aber ja doch, mein Liebes. Du wirst dein eigenes Leben leben. Er ist ein guter Mensch. Ich habe oft davon geträumt ...« Ihre Stimme wurde fast unhörbar. »Er ist gütig ..., wie sein Vater ... Er wird gut zu dir sein. Und du wirst zu ihm passen, daran ist nicht zu zweifeln. Du bist ebensogut wie einer von ihnen. Nein, sogar besser ... Denke daran, mein Kind ...«
»Oh, liebste Mama, ich möchte nur, daß du gesund wirst. Alles andere ist mir gleichgültig.«
Sie schüttelte den Kopf. »Für jeden von uns kommt einmal die Zeit, Minella. Für mich ist sie jetzt gekommen. Aber ich gehe ... glücklich ..., denn du hast ja ihn.«
»Hör zu«, bedrängte ich sie, »du wirst wieder gesund werden. Dann schließen wir die Schule für einen Monat. Wir gehen zusammen fort ..., nur wir zwei. Wir werden die Aussteuertruhe plündern.«
Ihre Lippen verzogen sich. Sie schüttelte den Kopf. »Gut angelegt«, murmelte sie. »Es war gut angelegtes Geld.«
»Sprich nicht, Liebste. Du mußt dich schonen.«
Sie nickte und lächelte mich an, in ihren Augen einen solchen Reichtum an Liebe, daß ich meine Tränen kaum zurückhalten konnte.
Sie schloß die Augen, und nach einer Weile begann sie leise zu murmeln.
Ich beugte mich vor, um zu lauschen. »Sie ist es wert«, flüsterte sie. »Mein Kind ..., warum nicht? Sie ist so gut wie eine von ihnen ... Sie wird es schaffen, ihren Platz unter ihnen einzunehmen. Wie ich es immer gewünscht habe. Wie die Erhörung eines Gebetes ... Gott, ich danke dir. Jetzt kann ich glücklich gehen ...«
Ich saß am Bett, voller Verständnis für ihre Gedanken, die, wie immer seit dem Tod meines Vaters, nur mir galten. Sie würde sterben, das wußte ich, und keine Selbsttäuschung konnte mich darüber hinwegtrösten. Doch sie war glücklich; glaubte sie doch, daß Joel Derringham mich liebte und um meine Hand anhalten würde.
O geliebte, törichte Mutter! Wie weltfremd sie doch war! Selbst ich, die ich ein solch wohlbehütetes Leben hatte, wußte mehr vom Laufe der Welt als sie. Vielleicht war sie auch blind vor Liebe. Sie sah ihre Tochter als einen Schwan unter Gänsen ..., auserkoren, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Für eines jedenfalls konnte ich dankbar sein: Sie starb glücklich ..., sie glaubte, meine Zukunft sei gesichert.
Sie wurde an einem bitterkalten Dezembertag auf dem Kirchhof von Derringham begraben – zwei Wochen vor Weihnachten. Während ich in dem kalten Wind stand und die Erdklumpen auf den Sarg meiner Mutter fallen hörte, fühlte ich mich von Verlassenheit überwältigt. Sir John hatte seinen Butler geschickt, um ihn zu vertreten – einen sehr würdevollen Mann, hochgeschätzt von allen, die für die Derringhams arbeiteten. Mrs. Callan, die Wirtschafterin, war ebenfalls gekommen. Es waren noch ein oder zwei weitere Trauergäste vom Gut anwesend, aber außer meiner Trauer nahm ich kaum etwas wahr.
Beim Verlassen des Kirchhofes sah ich Joel. Er stand am Tor, den Hut in der Hand. Er sprach kein Wort. Er nahm einfach meine Hand und hielt sie einen Augenblick. Ich entzog sie ihm, ich konnte jetzt mit niemandem sprechen. Ich wollte nur allein sein. Im Schulhaus war es totenstill. Ich konnte den Geruch des eichenen Sarges noch spüren, der bis zu diesem Morgen auf Böcken in unserer Wohnstube gestanden hatte. Jetzt wirkte das Zimmer leer. Überall war nichts als Leere ..., im Haus und erst recht in meinem Herzen.
Ich ging in mein Schlafzimmer, legte mich auf das Bett und dachte an sie, wie wir zusammen gelacht und Pläne geschmiedet hatten, und welche Erleichterung es für sie war, daß ich nach ihrem Ableben die Schule haben würde – bis sie sich später in den Kopf setzte, daß Joel Derringham mich heiraten sollte, und sie sich in Betrachtungen über meine glanzvolle und sichere Zukunft erging.
Ich blieb den ganzen restlichen Tag dort liegen, allein mit meinem Jammer.
Ich hatte eine Weile geschlafen, denn ich war sehr erschöpft gewesen; und als ich am nächsten Tage aufstand, fühlte ich mich ein wenig erholt. Die Zukunft starrte mir leer ins Gesicht – ohne meine Mutter konnte ich sie mir nicht vorstellen. Ich würde wohl mit der Schule fortfahren, so wie sie es immer beabsichtigt hatte, bis ...
Jeden Gedanken an Joel Derringham verscheuchte ich. Natürlich hatte ich ihn gern, doch selbst wenn er mich gebeten hätte, ihn zu heiraten – ich war nicht sicher, ob ich es wollte. Was mich an meiner Freundschaft mit Joel so beunruhigte war allein das Wissen, daß es meiner Mutter das Herz gebrochen hätte, wenn sie einsehen müßte, daß ich ihn nicht heiraten konnte.
Die Derringhams würden die Heirat niemals zulassen, selbst wenn Joel und ich es wünschten. Margot hatte mir erzählt, daß er ihr zugedacht war, und dies wäre auch eine standesgemäße Verbindung. Diese Enttäuschung mußte meine Mutter wenigstens nicht erleben.
Was sollte ich nur tun? Mein Leben mußte weitergehen. Deshalb hielt ich es für geraten, mit der Schule fortzufahren. Außerdem besaß ich den Inhalt der Aussteuertruhe, die im Schlafzimmer meiner Mutter stand. Diese Truhe hatte ihrer Urururgroßmutter gehört und war jeweils auf die älteste Tochter der Familie vererbt worden. Vom Tage der Geburt eines Mädchens an wurde Geld dort hineingelegt, und bis sie heiratsfähig war, würde sich eine stattliche Summe angesammelt haben. Der Schlüssel wurde an einer Kette aufbewahrt, die meine Mutter um die Taille getragen hatte, und dieses Chatelaine war, zusammen mit der Truhe, an die weiblichen Familienmitglieder weitergegeben worden.
Ich nahm den Schlüssel und öffnete die Truhe. Es befanden sich lediglich fünf Guineen darin.
Ich war bestürzt, denn ich hatte damit gerechnet, mindestens hundert vorzufinden. Das Pferd und die Reitkleidung mußten weit mehr gekostet haben, als ich angenommen hatte.
Später fand ich auch noch Stoffbahnen im Kleiderschrank meiner Mutter, und als Jilly Barton mit einer Samtrobe zu mir kam, die sie für mich angefertigt hatte, wußte ich, was geschehen war. Die Mitgift war zur Anschaffung von Kleidern für mich verwendet worden, auf daß ich mich als würdige Gefährtin von Joel Derringham erweisen möge.
Am ersten Weihnachtstag erwachte ich, ganz allein, mit einem Gefühl großer Verlassenheit. Ich lag im Bett und erinnerte mich an all die anderen Weihnachtsfeste. Meine Mutter war, mit geheimnisvollen Päckchen beladen, in mein Zimmer gekommen und hatte »Fröhliche Weihnachten, mein Liebling!« gerufen, und ich hatte meine Geschenke für sie hervorgekramt. Welch einen Spaß hatten wir gehabt, als wir das Einwickelpapier über das ganze Bett verstreuten und überraschte Schreie ausstießen (die häufig gespielt waren, weil stets praktisches Denken die Wahl unserer Geschenke bestimmte). Doch wenn wir; wie es häufig geschah, erklärten: »Das ist genau das, was ich mir gewünscht habe«, dann entsprach dies durchaus der Wahrheit, wußte doch jeder von uns genau, was dem anderen fehlte. Und jetzt war ich allein. Es war zu plötzlich gekommen. Wäre sie eine geraume Zeit krank gewesen, so hätte ich mich langsam an die Erkenntnis gewöhnen können, daß ich sie verlieren mußte, und das hätte die Härte des Schlages vielleicht gemildert. Sie war noch nicht alt gewesen. Ich haderte mit dem grausamen Schicksal, das mich des einzigen geliebten Menschens beraubt hatte.
Dann war mir, als hörte ich ihre mahnende Stimme. Ich mußte weiterleben. Ich mußte mein Dasein erfolgreich gestalten, und das würde mir nie gelingen, wenn ich mich der Bitterkeit hingab. Gerade an Festtagen ist Trauer besonders schwer zu ertragen. Der Grund dafür ist Selbstmitleid. So würde meine Mutter argumentiert haben. Man dürfe sich nicht elend fühlen, nur weil andere Menschen ihr Leben genossen.
Ich stand auf und kleidete mich an. Die Mansers, welche einen Teil der Derringhamschen Güter bewirtschafteten, hatten mich eingeladen, den Tag bei ihnen zu verbringen. Meine Mutter und ich hatten jahrelang mit ihnen zusammen Weihnachten gefeiert, und wir waren gute Freunde. Alle sechs Töchter von ihnen hatten die Schule besucht – die beiden jüngsten kamen auch jetzt noch: zwei großgewachsene, dralle Mädchen, zu Ehefrauen von Landwirten wie geboren. Die Mansers hatten auch einen Sohn. Jim, ein paar Jahre älter als ich, war bereits die rechte Hand seines Vaters. Der Hof der Mansers war uns stets als Stätte des Wohlstandes erschienen. Sie schickten uns häufig Lamm und Schweinefleisch, und meine Mutter pflegte zu sagen, sie ernährten uns mit Milch und Butter. Mrs. Mansers Dankbarkeit für die Ausbildung ihrer Töchter kannte keine Grenzen. Es hätte die Mittel dieser Familie weit überstiegen, die Kinder auf eine entfernte Schule zu schicken – und sie gehörten nicht zu den Kreisen, die eine Gouvernante beschäftigen –, und als meine Mutter in umittelbarer Nähe ihre Schule eröffnete, meinten die Mansers, dies sei wie eine Erhörung ihrer Gebete gewesen. Einige andere Familien empfanden das ebenso, und aus diesem Grunde hatten wir genug Schülerinnen, um die Schule zu unter halten.
Ich ritt auf Dower zu den Mansers und wurde von allen mit besonders rührender Herzlichkeit empfangen. Ich bemühte mich, meinen Kummer nicht zu zeigen und so lebhaft zu sein, wie es mir unter diesen Umständen nur möglich war. Von dem Gänsebraten, den Mrs. Manser mit solch liebevoller Sorgfalt zubereitet hatte, konnte ich kaum etwas essen, doch ich tat mein Bestes, um an diesem Tag keine Schwermut aufkommen zu lassen. Nach dem Essen beteiligte ich mich an den Spielen, und Mrs. Manser wußte es zu bewerkstelligen, daß mir Jim als Partner zugeteilt wurde. Ich merkte, was in ihrem Kopf vorging. Wäre ich nicht in solch trauriger Stimmung gewesen, so hätte mich die Beobachtung amüsiert, wie eifrig sich die Menschen, denen etwas an mir lag, bemühten, mich versorgt zu sehen.
Ich glaubte nicht, daß ich mich zur Landfrau eignete, doch immerhin mochten sich Mrs. Mansers Absichten eher verwirklichen lassen als die hochfliegenden Träume, denen meine Mutter sich hingegeben hatte.
Am späten Nachmittag des folgenden Tages kam ich nach Hause. Zu Beginn der kommenden Woche sollte der Unterricht wieder aufgenommen werden, und ich mußte den Lehrplan ausarbeiten. Die Stille im Haus, der leere Sessel meiner Mutter, die leeren Räume waren fast nicht zu ertragen. Ich wünschte sehnlichst, gleich wieder fortzugehen.
Ich war noch keine Stunde daheim, als Joel kam.
Er ergriff meine Hände und blickte mir mit solch tiefem Mitleid ins Gesicht, daß ich meinen Kummer kaum zurückhalten konnte.
»Ich weiß nicht, was ich Ihnen sagen soll, Minella.«
Ich antwortete: »Bitte, sagen Sie am besten gar nichts. Sprechen Sie ..., sprechen Sie über alles, aber nicht ...«
Er nickte und ließ meine Hände los. Er erzählte mir, er sei am Weihnachtsmorgen herübergekommen und habe mich nicht angetroffen. Ich erklärte, wo ich gewesen war, und berichtete ihm, wie liebevoll sich die Mansers um mich bemüht hatten. Er zog ein Kästchen aus seiner Tasche und sagte, er habe ein kleines Geschenk für mich. Ich öffnete es. Auf schwarzem Samt lag eine Brosche – ein Saphir, von rosa Diamanten umgeben. »Der Saphir hatte es mir angetan«, sagte er. »Ich finde, die Farbe paßt zu Ihren Augen.«
Ich war von Bewegung übermannt. Die Brosche war wunderschön.
»Wie lieb von Ihnen, an mich zu denken«, sagte ich. »Ich habe sehr viel an Sie gedacht ..., die ganze Zeit ... seit ...«
Ich nickte und wandte mich ab. Dann nahm ich die Brosche heraus, und er sah zu, wie ich sie an mein Kleid steckte. »Danke«, sagte ich. »Ich werde sie stets in Ehren halten.«
»Minella, ich möchte mit Ihnen sprechen.«
Seine Stimme klang weich und ein wenig verlegen. Vor meinem geistigen Auge erschien das Lächeln in den Augen meiner Mutter, der fröhliche Schwung ihrer Lippen. Konnte es wirklich wahr sein?
Panischer Schrecken ergriff mich. Ich brauchte Zeit, um nachzudenken ..., um mich an meine Einsamkeit, an mein Unglück zu gewöhnen.
»Ein andermal«, begann ich. Er sagte: »Ich komme morgen wieder. Vielleicht können wir zusammen ausreiten.«
»Ja«, erwiderte ich, »bitte.«
Er ging, und ich saß lange Zeit da und starrte vor mich hin.
Es lag eine Heiterkeit im Hause, fast, als ob meine Mutter anwesend wäre.
Während einer schlaflosen Nacht überlegte ich, was ich sagen sollte, wenn Joel mich bat, seine Frau zu werden. Die Brosche sollte wahrscheinlich seine Absichten symbolisieren, welche, dessen war ich sicher, ehrenhafter Natur waren.
Ich schien die Stimme meiner Mutter zu hören, die mich dringend mahnte, nicht zu zögern, denn das wäre eine Torheit. Ich bildete mir ein, sie wäre bei mir, und wir besprächen die Angelegenheit gemeinsam. »Ich liebe ihn nicht so, wie man einen Mann, den man heiratet, lieben sollte.« Ich konnte sehen, wie sie den Mund spitzte, was ich sie so oft hatte tun sehen, wenn sie ihre Verachtung über eine Ansicht ausdrückte. »Du weißt nichts von Liebe, mein Kind. Das kommt noch. Er ist ein guter Mensch. Er kann dir alles geben, was ich mir immer für dich gewünscht habe. Komfort, Sicherheit und genug Liebe für euch beide ... für den Anfang. Du wirst einen solchen Mann ganz von selbst lieben lernen. Ich sehe eure Kleinen schon auf dem Rasen bei der Sonnenuhr spielen, wo ihr euch zum erstenmal nähergekommen seid. Oh, welch eine Freude machen Kinder! Ich hatte nur eines, aber nach dem Tode deines Vaters war es mein ein und alles.«
»Du liebste aller Mütter, bist du auch diesmal, wie so oft, im Recht? Weißt du, was das Beste für mich ist?«
Niemals hätte ich ihr erzählen können, was ich empfand, als der Comte mich an sich gerissen und geküßt hatte. Ich hatte innerlich einen Aufruhr gespürt, der mich erschreckte und dem ich mich doch nicht zu entziehen vermochte. Dies hatte mich zu der Erkenntnis geführt, daß es etwas gab, von dem ich noch nichts wußte, das ich jedoch erfahren mußte, bevor ich in den Ehestand trat. Durch den Comte hatte ich begriffen, daß von Joel niemals eine solche Wirkung ausgehen würde. Das war alles.
Ich konnte das sanfte Lachen meiner Mutter hören. »Der Comte! Ein notorischer Schürzenjäger. Ein höchst unliebenswürdiger und unangenehmer Mensch! Daß er sich so benehmen konnte, ist ein Beweis für seine Bosheit! Und währenddessen schlief seine Gattin nebenan! Denke du lieber an den anständigen Joel, der niemals etwas Unehrenhaftes tun würde und der dir alles geben könnte, was ich mir immer für dich gewünscht habe.«
»Alles, was ich mir immer für dich gewünscht habe« – diese Worte gingen mir nicht aus dem Sinn.