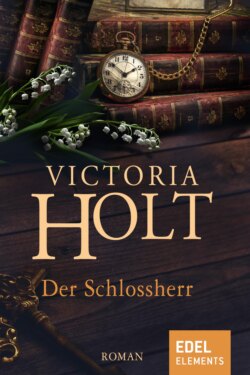Читать книгу Der Schlossherr - Victoria Holt - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 2
ОглавлениеEs war mein zweiter Tag auf Château Gaillard. Ich hatte in der Nacht nicht schlafen können, hauptsächlich, weil die Szene auf dem Friedhof mich so bestürzt hatte, daß es mir nicht gelang, sie aus meinem Denken zu vertreiben.
Ich ging in die Galerie und verbrachte den gesamten Vormittag damit, die Bilder zu untersuchen.
Zum Mittagessen kehrte ich in mein Zimmer zurück und ging anschließend nach draußen. Ich hatte beschlossen, mir heute die Umgebung anzusehen und vielleicht den Ort.
Ringsherum erstreckten sich die Weinberge. Ich schlug einen Feldweg ein, auch wenn er vom Ort wegführte. Ich stellte mir das bunte Treiben während der Weinlese vor und wünschte, ich hätte es noch miterleben können.
Ich war zu einigen Gebäuden gekommen, hinter denen ich ein rotes Backsteinhaus mit grünen Fensterläden erblickte. Nach meiner Schätzung war es ungefähr hundertfünfzig Jahre alt. Ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, es mir anzuschauen. Vor dem Haus stand eine Linde, und als ich näher kam, rief eine helle Stimme: »Hallo, Miß!«
Wer immer da rief, wußte, wer ich war.
»Hallo«, rief ich zurück, doch als ich über das schmiedeeiserne Tor blickte, konnte ich niemanden sehen.
Da hörte ich ein glucksendes Lachen in der Linde über mir und erblickte einen Jungen, der wie ein Affe hin und her schwang. Mit einem Sprung stand er neben mir. »Hallo, Miß. Ich bin Yves Bastide.«
»Guten Tag.«
»Das da ist Margot. Margot, komm herunter!«
Das Mädchen schlängelte sich zwischen Zweigen hindurch und rutschte gefährlich schnell an dem Stamm herunter. Sie war etwas kleiner als der Junge.
»Wir wohnen hier«, erzählte mir Yves.
Das Mädchen nickte und blickte mich neugierig an.
»Es ist ein sehr hübsches Haus.«
»Wir wohnen alle da – wir alle.«
»Das muß sehr lustig für euch alle sein.«
»Yves! Margot!« rief eine Stimme aus dem Haus.
»Wir haben Miß hier, Gran’-mère.«
»Dann ladet sie ein, hereinzukommen, und vergeßt eure guten Manieren nicht.«
»Miß«, sagte Yves mit einer kleinen Verbeugung, »würden Sie bitte hereinkommen und Gran’-mère guten Tag sagen?«
»Aber gern.« Ich lächelte dem Mädchen zu, das einen kleinen Knicks machte.
Der Junge lief voraus, um das Tor aufzumachen.
Ich betrat eine große Halle, und eine Stimme rief aus einer offenen Tür: »Bringt die englische Dame hier herein, Kinder.« In einem Schaukelstuhl saß eine alte Frau. Ihr Gesicht war braun und runzlig, und sie trug Massen weißen Haares hoch auf dem Kopf aufgetürmt Ihre Augen waren blank, beinahe schwarz, und die schweren Lider fielen wie Kapuzen über sie. Die dünnen, venenüberzogenen Hände, die mit braunen Flecken bedeckt waren, hielten die Armlehnen des Schaukelstuhls umfaßt.
Sie lächelte mir so eifrig entgegen, als hätte sie mein Kommen erwartet und freute sich darüber.
»Verzeihen Sie, wenn ich nicht aufstehe, Mademoiselle, aber meine Beine sind so steif, daß ich manchmal den ganzen Vormittag brauche, um aus meinem Stuhl hochzukommen.«
»Bitte, bleiben Sie sitzen!« Ich ergriff die ausgestreckte Hand und schüttelte sie. »Es ist sehr nett von Ihnen, mich hereinzubitten.« Ich lächelte. »Sie scheinen mich zu kennen. Ich fürchte, Sie sind da im Vorteil.«
»Yves, einen Stuhl für Mademoiselle!«
Er sprang sofort, um mir einen zu holen, und stellte ihn sorgsam genau vor den Stuhl der alten Dame.
»Sie werden uns bald kennen, Mademoiselle. Jeder kennt hier die Bastides.«
Ich setzte mich.
»Neuigkeiten machen hier schnell die Runde. Wir hörten, daß Sie angekommen waren, und hofften, Sie würden uns einen Besuch machen. Wissen Sie, wir gehören zum Château. Dieses Haus wurde für einen Bastide gebaut. Seitdem haben immer Bastides in ihm gewohnt, denn die Bastides waren schon immer die Winzer vom Château Gaillard. Man sagt es hätte nie einen Gaillard-Wein gegeben, wenn es die Bastides nicht gegeben hätte.«
»Die Weinberge gehören also Ihnen.«
Die alte Frau lachte laut. »Wie alles hier gehören auch die Weinberge Monsieur le Comte.« Sie wandte sich an die Kinder. »Geht und sucht euren Bruder, Kinder. Und auch eure Schwester und euren Vater. Sagt ihnen, wir hätten Besuch.«
Die Kinder liefen hinaus. Ich sagte, wie reizend sie wären und was für entzückende Manieren sie hätten. Sie nickte sehr erfreut; sie verstand, weshalb ich das gesagt hatte.
»Um diese Tageszeit«, erklärte sie, »ist draußen nicht viel los. Mein Enkel, der jetzt alles übernommen hat, wird im Keller sein. Sein Vater, der seit dem Unfall nicht mehr draußen arbeiten kann, wird ihm helfen, und meine Enkelin Gabrielle wird im Büro arbeiten.«
»Sie haben aber eine große Familie, und alle arbeiten im Weinanbau?«
Sie nickte. »Es ist Familientradition. Wenn sie alt genug sind, werden auch Yves und Margot mithelfen.«
»Wie nett muß das sein. Und die ganze Familie lebt hier zusammen in diesem wunderschönen Haus. Bitte, erzählen Sie mir von Ihren Kindern und Enkeln.«
»Da ist einmal mein Sohn Armand, der Vater der Kinder. Jean-Pierre ist achtundzwanzig und wird bald neunundzwanzig. Er macht jetzt alles. Gabrielle ist neunzehn – also eine Lücke von zehn Jahren zwischen den beiden, wie Sie sehen. Nach einer weiteren Lücke kam dann Yves und danach Margot. Sie sind nur ein Jahr auseinander. Das war zu wenig, und ihre Mutter war zu alt fürs Kinderkriegen.«
»Sie ist ...«
Sie nickte. »Das war eine schlimme Zeit. Die kleine Margot war erst zehn Tage alt.
»Wie furchtbar traurig!«
»Die schlimmen Zeiten gehen vorbei, Mademoiselle. Es ist jetzt acht Jahre her. Aber so ist das Leben, nicht wahr?« Sie lächelte mir zu. »Ich rede zu viel von den Bastides. Ich langweile Sie bestimmt.«
»Aber ganz und gar nicht. Es ist alles so interessant.«
»Ihre Arbeit muß doch viel interessanter sein. Wie gefällt es Ihnen im Château?«
»Ich bin erst kurze Zeit dort.«
»Wird die Arbeit Sie interessieren?«
»Ich weiß noch nicht, ob ich sie überhaupt bekomme. Alles hängt von ...«
»... Monsieur le Comte ab. Natürlich.« Sie sah mich an und schüttelte den Kopf. »Er ist kein einfacher Mann.«
»Ist er unberechenbar?«
»Die erwarteten einen Mann. Wir erwarteten alle einen Mann. Die Dienstboten redeten von dem Engländer, der kommen sollte. Die können in Gaillard keine Geheimnisse bewahren, Mademoiselle ...« Sie richtete sich auf und lauschte. Ich hörte den Hufschlag eines Pferdes. Ein stolzes Lächeln veränderte ihr Gesicht.
»Das«, kündigte sie an, »ist Jean-Pierre.«
Nach wenigen Augenblicken stand er in der Tür. Er war mittelgroß und hatte hellbraunes Haar. Seine dunklen Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen, als er uns zulachte, und sein Gesicht wies eine fast kupferrote Bräune auf. Er wirkte ungeheuer vital.
»Jean-Pierre«, sagte die alte Frau, »dies ist Mademoiselle vom Château.«
Er kam lächelnd auf mich zu, als sei er wie die übrige Familie entzückt, mich kennenzulernen. Er verbeugte sich zeremoniell. »Willkommen in Gaillard, Mademoiselle. Es ist sehr nett von Ihnen, uns einen Besuch zu machen.«
»Es ist eigentlich kein Besuch. Ihre jüngeren Geschwister sahen mich vorbeikommen und baten mich herein.«
Er zog einen Stuhl heran und setzte sich. »Wie finden Sie das Château?«
»Es ist ein schönes Beispiel der Architektur des fünfzehnten Jahrhunderts. Ich habe bisher noch nicht viel Gelegenheit gehabt es mir genau anzusehen, doch ich glaube, es ähnelt in manchem Langeais und Loches.«
Er lachte. »Ich schwöre, Sie wissen mehr über die Kunstschätze unseres Landes als wir selbst.«
»Das glaube ich nicht doch je mehr man lernt, um so deutlicher erkennt man, wieviel mehr es zu lernen gibt. Ich kümmere mich um alte Bilder und Häuser, Sie um den Wein.«
Jean-Pierre lachte. Er hatte ein spontanes Lachen, das anziehend war. »Was für ein Unterschied! Das Geistige und das Materielle. Haben Sie mit der Arbeit im Château schon begonnen, Mademoiselle?«
»So gut wie kaum. Ich bin noch nicht angenommen. Ich muß warten ...«
»Auf die Entscheidung von Monsieur le Comte«, schob Madame Bastide ein.
»Das ist nur natürlich«, sagte Jean-Pierre mit einem sonnigen Lächeln, »da das Château ihm gehört, die Bilder, an denen Mademoiselle arbeiten möchte, ihm gehören, die Trauben ihm gehören ... Auf gewisse Weise gehören wir ihm ja alle. Monsieur Philippe würde es nicht wagen, eine Entscheidung zu treffen, aus Angst, den Grafen zu verärgern.«
»Hat er solche Angst vor seinem Vetter?«
»Mehr als die meisten. Falls der Graf nicht wieder heiratet, könnte Philippe sein Erbe sein, denn die de la Talles halten es wie die alten französischen königlichen Familien. Aber er könnte seinen Vetter natürlich auch zugunsten eines anderen Verwandten übergehen.«
»Ich nehme an, der Graf ist noch jung, zumindest noch nicht alt. Warum sollte er nicht wieder heiraten?«
»Es heißt, der Gedanke sei ihm verhaßt.«
»Ich hätte gedacht, ein Mann mit Familienstolz würde sich einen Sohn wünschen – denn er ist doch zweifellos sehr stolz.«
»Er ist einer der stolzesten Männer von ganz Frankreich.«
In diesem Moment kamen die Kinder mit Gabrielle und Armand an. Gabrielle Bastide war auffallend hübsch. Sie war brünett wie die übrige Familie, doch ihre Augen waren nicht braun, sondern tiefblau, und das machte sie beinahe zu einer Schönheit.
Ich erzählte ihnen gerade, daß meine Mutter Französin gewesen war, als eine Glocke so unvermittelt zu klingeln begann, daß ich zusammenfuhr.
»Das Dienstmädchen, das die Kinder zum goûter ruft«, erklärte Madame Bastide.
»Ich werde jetzt auch gehen«, sagte ich. »Es war sehr nett. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.«
Madame Bastide wollte jedoch nichts davon hören, daß ich ging. Ich müßte noch bleiben und etwas Wein probieren, meinte sie. Für die Kinder wurde mit Schokolade belegtes Brot hereingebracht und für uns Brot und Wein. Die Kinder wurden später zum Spielen hinausgeschickt. Vielleicht war es der Wein, den ich nicht gewohnt war, aber ich wurde gesprächiger, als ich es normalerweise gewesen wäre.
Ich sagte: »Geneviève ist ein eigenartiges Kind. So gar nicht wie Yves und Margot. Vielleicht ist das Schloß keine gute Umgebung für ein Kind.«
»Ein armes Kind!« bemerkte Madame Bastide.
»Ja«, fuhr ich fort, »aber ich glaube, es ist drei Jahre her, daß die Mutter starb, und in der Zwischenzeit müßte sich ein so junger Mensch eigentlich erholt haben.«
Jean-Pierre meinte: »Wenn Sie länger im Château bleiben, werden Sie es ja doch bald erfahren: Die Gräfin starb an einer Überdosis Laudanum.«
Ich dachte an die Friedhofszene und stieß hervor: »Doch nicht –Mord?«
»Sie nannten es Selbstmord«, antwortete Jean-Pierre.
Niemand schien plötzlich mehr bereit zu sein, über dieses Thema zu sprechen.
Als ich mich erhob, erklärte Jean-Pierre, er würde mich zurückbegleiten.
Auf dem Weg fragte ich: »Der Graf – ist er wirklich so furchterregend?«
»Er ist ein Autokrat, einer der alten Aristokraten. Sein Wort ist Gesetz.«
»Er hat eine Tragödie hinter sich.«
»Ich glaube, er tut Ihnen leid. Wenn Sie ihn kennenlernen, werden Sie sehen, daß Mitleid falsch ist.«
»Sie sagten, man hätte den Tod seiner Frau als Selbstmord bezeichnet ...«
Er unterbrach mich schnell: »Wir sprechen nicht von derartigen Dingen.«
»Aber ...«
»Aber«, fügte er hinzu, »wir vergessen sie nicht.«
Das Schloß erhob sich vor uns; es sah gewaltig aus, uneinnehmbar. Ich dachte an all die dunklen Geheimnisse, die es bewahren mochte, und spürte, wie mir ein kalter Schauder über den Rücken lief.
»Bitte machen Sie sich nicht die Mühe, noch weiter mitzukommen«, sagte ich. »Ich halte Sie bestimmt von Ihrer Arbeit ab.«
Er stand einige Schritte von mir entfernt und verbeugte sich. Ich lächelte ihm zu und wandte mich zum Schloß um.
Alles war still im Schloß, als ich am Morgen zur gewohnten Stunde aufwachte. Rasch sprang ich auf und klingelte nach heißem Wasser. Es kam auf der Stelle. Das Dienstmädchen sah anders aus, fand ich.
»Möchten Sie Ihr Frühstück wie gewöhnlich, Mademoiselle?«
Ich machte ein erstauntes Gesicht und erwiderte: »Aber ja, natürlich.«
Vermutlich redeten sie alle über mich und fragten sich, was wohl mein Schicksal sein würde.
Mein Frühstück kam. Ich war zu aufgeregt, um etwas zu essen, doch sollte keiner sagen, ich sei zu verängstigt gewesen, um etwas essen zu können; also trank ich meine üblichen zwei Tassen Kaffee und würgte ein Stück warmes Brot hinunter. Darauf ging ich in die Galerie.
Ich hatte bereits einen Voranschlag aufgestellt, der dem Grafen bei seiner Rückkehr vorgelegt werden sollte. Ich malte mir aus, wie der Graf meine Aufstellung vorgelegt bekam, wie er erfuhr, daß statt eines Mannes eine Frau angekommen war. Meine Phantasie zeigte mir lediglich einen hochmütigen Mann mit weißer Perücke und Krone, ein Bild, das ich entweder von Louis XIV. oder XV. gesehen hatte.
Falls er mich bleiben läßt, tröstete ich mich, werde ich so in meine Arbeit vertieft sein, daß er von mir aus zwanzig Ehefrauen hätte umbringen können.
Ich betrachtete gerade ein Porträt, als ich hinter mir eine Bewegung hörte. Ich fuhr herum und sah, daß ein Mann hereingekommen war und nun dastand und mich beobachtete. Ich fühlte, wie mein Herz wild klopfte und wie meine Beine zitterten, und begriff sofort, daß ich endlich dem Comte de la Talle von Angesicht zu Angesicht gegenüberstand.
»Das ist natürlich Mademoiselle Lawson«, konstatierte er. Seine Stimme war ungewöhnlich tief und kalt.
»Sie sind der Comte de la Talle?«
Er verneigte sich, kam jedoch nicht auf mich zu. Seine Augen musterten mich über die Entfernung der gesamten Galerie hinweg. Sein Benehmen war ebenso kalt wie seine Stimme. Er war groß und auffallend mager. Es bestand eine leichte Ähnlichkeit mit Philippe, doch wirkte dieser Mann männlicher. Er war dunkler als sein Vetter und hatte hohe Wangenknochen, was seinem dreieckig zugespitzten Gesicht ein beinahe satanisches Aussehen verlieh. Seine Augen waren sehr dunkel; sie lagen tief unter schweren Lidern. Die Adlernase verlieh dem Gesicht den hochmütigen Ausdruck, während die Mundpartie sich ständig veränderte. Der arrogante König des Schlosses, von dem mein Schicksal abhing.
»Mein Vetter hat mich von Ihrer Ankunft unterrichtet.«
Er kam auf mich zu. Er ging so, wie ein König durch die Spiegelgalerie geschritten sein mochte.
Sehr schnell hatte ich meine Haltung wiedergewonnen. Nichts veranlaßte mich so, meinen stacheligen Panzer herauszukehren, wie hochmütiges Verhalten.
»Ich bin froh, daß Sie wieder da sind, Monsieur le Comte«, sagte ich, »denn ich habe mehrere Tage hier gewartet, um zu erfahren, ob Sie möchten, daß ich hierbleibe und die Arbeiten ausführe.«
»Es muß lästig für Sie gewesen sein, nicht zu wissen, ob Sie Ihre Zeit vergeuden oder nicht.«
»Ich fand die Galerie so interessant, daß es keine unangenehme Art der Zeitvergeudung war.«
»Ein Jammer, daß Sie uns nicht vom Tod Ihres Vaters informierten. Es hätte allen viel Mühe erspart.«
»Ich war mir nicht klar darüber, daß man in Frankreich so altmodisch ist«, sagte ich mit einem giftigen Unterton. »Ich habe solche Arbeiten oft mit meinem Vater ausgeführt, und es störte niemanden, daß ich eine Frau bin. Da Sie jedoch hier andere Vorstellungen haben, ist nichts mehr zu sagen.«
»Da bin ich nicht Ihrer Ansicht. Sie würden gern die Bilder restaurieren, Mademoiselle Lawson, nicht wahr?«
»Es ist mein Beruf, Bilder zu restaurieren, und je nötiger Bilder Reparaturarbeiten brauchen, um so interessanter wird die Aufgabe.«
»Und Sie finden, daß meine Bilder eine Restaurierung brauchen?«
»Sie müssen doch selber wissen, daß einige der Bilder in sehr schlechtem Zustand sind.«
»Bitte, Mademoiselle Lawson, sehen Sie mich nicht so streng an. Ich bin nicht für den Zustand verantwortlich.«
»Ich nahm an, sie befänden sich seit einiger Zeit in Ihrem Besitz. Die Farben sind verblaßt. Ganz offensichtlich sind sie schlecht behandelt worden.«
Ein Lächeln verzog seinen Mund, und sein Gesichtsausdruck veränderte sich. »Wie vehement Sie sind! Sie sollten eher für die Menschenrechte als für die Erhaltung von Farben auf einem Stück Leinwand kämpfen.«
»Wann möchten Sie, daß ich abreise?«
»Nicht bevor wir uns zumindest unterhalten haben.« Er tat als zögerte er. »Wenn ich, ohne Sie zu kränken ... Ich möchte, daß Sie sich einem kleinen – Test unterziehen. O bitte, Mademoiselle, werfen Sie mir nicht Vorurteile gegen Ihr Geschlecht vor. Ich bin beeindruckt von Ihrer Aufstellung der Beschädigungen und Reparaturkosten von den Bildern.«
Ich fürchtete, meine Augen hatten hoffnungsvoll zu leuchten begonnen. Wenn er merkte, wie brennend ich mir diesen Auftrag wünschte, würde er mich womöglich weiterquälen.
Er hatte es gemerkt. »Ich wollte Ihnen daher gerade vorschlagen ... Aber vielleicht haben Sie sich schon entschieden und ziehen es vor, heute oder morgen abzureisen?«
»Ich bin einen weiten Weg gekommen, Monsieur le Comte. Selbstverständlich ziehe ich es vor, hierzubleiben und die Arbeit zu übernehmen – vorausgesetzt, ich kann sie in einer entsprechenden Atmosphäre ausführen. Was wollten Sie mir gerade vorschlagen?«
»Daß Sie eines der Bilder restaurieren und sich, falls die Arbeit befriedigend ausfällt, die übrigen vornehmen.«
In jenem Augenblick war ich glücklich. Ich hatte allen Grund, erleichtert zu sein, denn von meinem Können war ich überzeugt. Für die unmittelbare Zukunft war gesorgt. Ein unerklärliches Gefühl der Freude, der Erwartung – ich vermochte es nicht zu definieren. Dieser wundervolle alte Besitz würde für viele Monate mein Zuhause sein. Ich würde ihn erkunden können, ebenso gründlich wie seine Kunstschätze. Und würde meine Neugier bezüglich der Bewohner des Schlosses befriedigen können.
»Dieser Vorschlag scheint Ihnen zuzusagen.«
»Es scheint ein gerechter Vorschlag zu sein«, antwortete ich.
»Dann ist es also abgemacht.« Er hielt mir die Hand hin. »Wir werden es mit Handschlag besiegeln. Ein alter englischer Brauch, glaube ich.«
Während er meine Hand hielt, blickte er mir in die Augen, und ich fühlte mich entschieden unbehaglich, unerfahren und weltfremd. Genau das hatte er bestimmt beabsichtigt.
»Welches Bild wollen Sie für den – Test wählen?« fragte ich rasch.
»Wie wäre es mit dem, das Sie sich gerade anschauten, als ich hereinkam?«
»Ausgezeichnet! Es hat eine Restaurierung nötiger als alle anderen Bilder in dieser Galerie.«
Wir gingen zu dem Porträt hinüber und betrachteten es gemeinsam.
»Es ist sehr schlecht behandelt worden«, erklärte ich streng. »Es ist nicht sehr alt, höchstens hundertfünfzig Jahre, und doch ...« »Eine Vorfahrin von mir.«
»Ein Jammer, daß sie einer solchen Behandlung ausgesetzt wurde.«
»Ein großer Jammer. Doch gab es Zeiten in Frankreich, wo Menschen wie sie sogar noch größeren Unannehmlichkeiten ausgesetzt wurden.«
»Ich würde sagen, dieses Bild wurde durch Wind und Wetter beschädigt. Ich kann bei dieser Beleuchtung nicht die richtige Farbe der Steine um den Hals erkennen. Sehen Sie, wie sie gedunkelt sind!«
»Grün«, bemerkte er. »Das kann ich Ihnen verraten. Es sind Smaragde.«
»Restauriert müßte es ein farbenfrohes Bild sein.«
»Es wird interessant sein, es fertig zu sehen.«
»Ich werde sofort anfangen.«
»Haben Sie alles, was Sie dafür brauchen?«
»Für den Anfang, ja. Ich gehe jetzt in mein Zimmer und hole mein Werkzeug.«
»Ich sehe, Sie sind ganz Eifer, und ich halte Sie auf.«
Ich bestritt es nicht, und er trat zur Seite, als ich triumphierend die Galerie verließ. Ich spürte, ich war zufriedenstellend aus meinem ersten Zusammentreffen mit dem Grafen hervorgegangen.
Was für einen glücklichen Vormittag verbrachte ich bei meiner Arbeit in der Galerie!
Als ich mit meinem Handwerkszeug zurückgekommen war, hatten zwei Diener das Bild bereits von der Wand genommen. Sie fragten, ob ich irgend etwas brauchen würde. Ich sagte ihnen, ich würde klingeln. Sie betrachteten mich mit gewissem Respekt. Sie würden in den Dienstbotentrakt zurückkehren und die Neuigkeit verbreiten.
Ich zog meinen braunen Leinenkittel an und machte mich daran, den Zustand der Farbschicht zu studieren. Wieder war ich so in meine Arbeit vertieft, daß ich überrascht war, als ein Mädchen an die Tür klopfte, um mich zu erinnern, daß es Zeit für das Dejeuner war. Ich nahm es wie immer in meinem Zimmer ein, und da es meine Gewohnheit war, nie nach dem Mittagessen zu arbeiten, ging ich anschließend zu den Bastides.
Die alte Frau saß in ihrem Schaukelstuhl und freute sich sehr, mich zu sehen. Die Kinder hätten, erzählte sie mir, Unterricht bei Monsieur le Curé. Armand, Jean-Pierre und Gabrielle arbeiteten. Ich setzte mich neben sie und sagte: »Ich habe den Grafen gesprochen.«
»Ich hörte, er ist wieder da.«
»Ich soll ein Bild restaurieren, und wenn es gut wird, soll ich die ganze Arbeit übernehmen. Ich habe schon angefangen. Es ist ein Porträt von einer seiner Vorfahren, eine Dame in einem roten Kleid mit Edelsteinen, die im Augenblick die Farbe von Schlamm haben. Der Graf sagt, es seien Smaragde.«
»Smaragde«, wiederholte sie. »Es könnten die Gaillard-Smaragde sein.«
»Familienerbstücke?«
»Sie waren es einmal, vor langer Zeit. Vielleicht haben Sie schon die Kapelle gesehen? Sie befindet sich in dem ältesten Teil des Schlosses. Wie Sie feststellen werden, ist die Außenmauer über der Tür beschädigt. Früher stand dort eine Statue der heiligen St. Geneviève hoch über der Tür. Die Revolutionäre hatten vor, die Kapelle zu schänden. Glücklicherweise versuchten sie als erstes, St. Geneviève herunterzuholen. Sie waren betrunken vom Schloßwein. Die Statue war schwerer, als sie gedacht hatten, und fiel auf sie herunter und erschlug drei von ihnen. Sie hielten das für ein böses Omen. Hinterher sagte man, die heilige St. Geneviève hätte Gaillard gerettet.«
»Deshalb heißt Geneviève also so?«
»Es hat immer Genevièves in der Familie gegeben. Der damalige Graf wurde guillotiniert. Sein Sohn war damals noch ein kleines Kind, er übernahm zu gegebener Zeit wieder das Schloß. Es ist eine Geschichte, die wir Bastides gern erzählen. Wir standen auf der Seite des Volkes – waren für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und gegen die Aristokraten –, aber wir behielten den kleinen Grafen hier im Haus und sorgten für ihn, bis alles vorbei war. Mein Schwiegervater pflegte mir davon zu erzählen. Er war ungefähr ein Jahr älter als der kleine Graf.«
»Ihre Familiengeschichte ist also eng mit der des Grafen verknüpft.«
»Sehr eng.«
»Und der jetzige Graf – ist er Euer Freund?«
»Die de la Talles waren niemals Freunde der Bastides«, erwiderte sie stolz. »Nur unsere Herren. Sie ändern sich nicht – und wir uns auch nicht.«
Sie wechselte das Thema, und nach einer Weile verabschiedete ich mich und ging zurück zum Schloß.
Im Laufe des Nachmittags erschien eines der Dienstmädchen in der Galerie, um mir zu sagen, Monsieur le Comte würde sich freuen, wenn ich mit der Familie dinierte. Es würde um acht Uhr serviert, in einem kleineren Speisezimmer. Ich war zu sehr erstaunt, um weiterzuarbeiten.
Ich überlegte, was ich anziehen sollte. Ich besaß nur drei für abends geeignete Kleider, keines von ihnen war neu. Ich entschied mich für das schwarze Samtkleid mit der weißen Spitzenkrause.
Sobald das Tageslicht verblaßte, ging ich auf mein Zimmer, nahm das Kleid heraus und inspizierte es. Samt altert zum Glück nicht, doch der Schnitt entsprach keineswegs der letzten Mode. Ich hielt es mir an und betrachtete mich im Spiegel. Meine Wangen waren leicht gerötet, meine Augen schienen durch den schwarzen Samt dunkel, und eine Haarsträhne hatte sich aus dem zusammengewundenen Kranz gelöst. Verärgert über meine Albernheit legte ich das Kleid hin und richtete gerade mein Haar, als es an der Tür klopfte.
Mademoiselle Dubois kam herein. Sie sah mich ungläubig an und fragte: »Ist es wahr, Mademoiselle Lawson, daß man Sie aufgefordert hat, mit der Familie zu dinieren?«
»Ja. Überrascht Sie das?«
»Mich hat man nie aufgefordert, mit der Familie zu dinieren.«
Ich sah sie an und wunderte mich nicht darüber. »Ich glaube, sie wollen mit mir über die Bilder sprechen. Es redet sich leichter bei Tisch.«
»Ich finde, man sollte Sie warnen: Der Graf hat keinen guten Ruf, was Frauen betrifft.«
Ich starrte sie an. »Er betrachtet mich nicht als Frau«, entgegnete ich. »Ich bin hier, um seine Bilder zu restaurieren.«
»Es heißt, er sei gefühllos, und doch finden einige Frauen ihn unwiderstehlich.«
»Liebe Mademoiselle Dubois, ich habe noch nie irgendeinen Mann unwiderstehlich gefunden und hege nicht die Absicht, jetzt in meinem Alter damit anzufangen.«
Sie sah, daß ich verärgert war, und fuhr hastig tadelnd fort: »Da war diese arme unglückselige Dame – seine Frau. Die Gerüchte, die man hört ... Ziemlich schockierend. Es ist grauenvoll, sich vorzustellen, daß wir unter demselben Dach mit so einem Mann wohnen.«
»Ich glaube, keine von uns beiden braucht da Angst zu haben«, erklärte ich.
Sie trat nahe an mich heran. »Ich schließe nachts meine Tür ab, wenn er hier ist. Sie sollten das auch tun. Und ich an Ihrer Stelle wäre sehr, sehr vorsichtig heute abend. Möglicherweise möchte er sich, während er hier ist, mit jemandem im Haus vergnügen. Man kann nie wissen.«
Ich dachte über sie nach, während ich mich anzog. Träumte sie in der Stille ihres Zimmers erotische Träume? Ich war überzeugt, daß ihr ebensowenig die Gefahr eines derartigen Schicksals drohte wie mir.
Volle zehn Minuten, bevor das Mädchen kam, um mich hinunterzubringen, war ich fertig.
Wir gingen in den jüngsten Teil des Schlosses, der aus dem siebzehnten Jahrhundert stammte, und kamen durch einen großen Raum mit gewölbter Decke, eine Speisehalle, in der bei größeren Gesellschaften gegessen wurde. Wir gingen weiter zu einem kleinen Zimmer, das neben dieser Halle lag. Es war ein gemütliches Zimmer mit mitternachtsblauen Samtvorhängen an den Fenstern. Auf dem marmornen Kaminsims standen zwei große Leuchter mit brennenden Kerzen. Ein ähnlicher Leuchter stand auch in der Mitte des Tisches, der für das Dinner gedeckt war.
Philippe und Geneviève waren schon da. Geneviève hatte ein graues Seidenkleid mit einem Spitzenkragen an; ihr Haar war mit einer rosafarbenen Seidenschleife im Nacken zusammengebunden. Sie sah fast sittsam aus. Philippe im Abendanzug wirkte noch eleganter als bei unserer ersten Begegnung; er schien sich wirklich zu freuen, mich zu sehen.
»Guten Abend, Mademoiselle Lawson.«
Ich erwiderte die Begrüßung, und es war beinahe, als bestünde eine freundschaftliche Verschwörung zwischen uns beiden.
Geneviève machte einen unsicheren Knicks.
»Ich vermute, Sie haben einen arbeitsreichen Tag in der Galerie gehabt«, bemerkte Philippe.
Ich sagte, daß ich mit den Vorbereitungen begonnen hätte, denn man müßte so viele Einzelheiten prüfen, bevor man mit der delikaten Restaurierungsarbeit beginnt.
»Es muß sehr faszinierend sein«, meinte er. »Ich bin sicher, Sie werden Ihre Sache gut machen.«
Ich war überzeugt, daß er es ehrlich meinte, doch merkte ich, wie er die gesamte Zeit, während er mit mir sprach, auf das Erscheinen des Grafen horchte. Dieser kam um Punkt acht. Wir nahmen unsere Plätze um den Tisch ein. Der Graf saß an der Kopfseite, ich zu seiner Rechten, Geneviève zu seiner Linken und Philippe ihm gegenüber. Die Suppe wurde sofort serviert, während der Graf mich fragte, wie ich in der Galerie vorankommen würde.
Ich wiederholte, was ich gerade zu Philippe über den Beginn meiner Arbeit gesagt hätte, doch zeigte der Graf mehr Interesse. Ich erzählte ihm, daß ich mich entschlossen hätte, das Bild erst mit Seifenwasser abzuwaschen. Er betrachtete mich mit einem belustigten Glitzern in den Augen und sagte: »Ich habe davon gehört. Das Wasser muß in einem besonderen Topf stehen und die Seife in einer Neumondnacht angerührt werden.«
»Wir lassen uns nicht mehr von solchem Aberglauben leiten«, erwiderte ich.
»Sie sind also nicht abergläubisch, Mademoiselle?«
»Nicht mehr als die meisten anderen Menschen heutzutage.«
»Das reicht. Ich glaube jedoch, Sie sind zu vernünftig für solche Phantastereien, und das ist nur gut für Ihren Aufenthalt hier bei uns. Wir hatten schon einige« – sein Blick wanderte zu Geneviève, die in ihrem Stuhl zusammenzuschrumpfen schien – »Gouvernanten, die sich weigerten hierzubleiben. Einige erklärten, es spuke im Schloß, andere wiederum gaben keinen Grund an und verschwanden nur stillschweigend. Irgend etwas war ihnen jedenfalls unerträglich, entweder mein Schloß oder meine Tochter.«
Kühle Abneigung lag in seinem Blick, der auf Geneviève ruhte. »Wenn man abergläubisch wäre«, begann ich, überzeugt, Geneviève zu Hilfe kommen zu müssen, »könnten sich die eigenen Phantasievorstellungen an einem Ort wie diesem sehr leicht blühend entwickeln. Ich habe mit meinem Vater in einigen sehr alten Häusern gewohnt, bin jedoch nie einem einzigen Gespenst begegnet.«
»Englische Gespenster sind vielleicht zurückhaltender als französische, oder? Sie würden nicht uneingeladen erscheinen, das heißt, sie würden nur die Ängstlichen heimsuchen. Aber vielleicht irre ich mich da.«
Ich errötete. »Sie würden sich bestimmt nach den Sitten der Zeit, in der sie lebten, richten, und in Frankreich war die Etikette strenger als in England.«
Auf die Suppe folgte ein Fischgericht, und der Graf erhob sein Glas. »Ich hoffe, Sie werden diesen Wein mögen, Mademoiselle Lawson. Er stammt aus unserer eigenen Ernte. Sind Sie ebenso ein Kenner von Weinen wie von Bildern?«
»Es ist ein Gebiet, über das ich sehr wenig weiß.«
»Sie werden während Ihres Aufenthaltes hier eine Menge darüber hören.«
»Es ist immer angenehm, etwas dazuzulernen.«
Philippe fragte zögernd: »Mit welchem Bild fangen Sie an, Mademoiselle Lawson?«
»Mit einem Porträt. Ich datiere es auf 1740.«
»Du siehst lieber Vetter«, sagte der Graf, »Mademoiselle Lawson ist Experte. Sie liebt Bilder. Sie schimpfte mit mir, als wäre ich ein Vater, der seine Pflicht vernachlässigt hat.«
Geneviève blickte verlegen auf ihren Teller. Der Graf wandte sich an sie. »Du solltest von Mademoiselle Lawsons Anwesenheit hier profitieren. Sie sollte dir beibringen, wie man sich für etwas begeistert.«
»Ja, Papa«, sagte Geneviève.
»Reiten Sie, Mademoiselle Lawson?« fragte der Graf.
»Ja, ich reite sehr gern.«
»Es sind einige Pferde im Stall. Einer der Pferdeburschen könnte Ihnen raten, welches für Sie das geeignetste wäre. Geneviève reitet auch, ein bißchen. Sie könnten zusammen ausreiten. Die momentane Gouvernante ist zu ängstlich. Du könntest Mademoiselle Lawson die Umgebung zeigen, Geneviève.«
»Ja, Papa.«
»Unsere Landschaft ist nicht sehr reizvoll, fürchte ich. Wenn Sie jedoch ein wenig weiter wegreiten, finden Sie bestimmt etwas, das Ihnen gefällt.«
»Es ist sehr nett von Ihnen. Ich würde wirklich gern reiten.«
Er winkte mit der Hand ab, und Philippe, der es an der Zeit fand, etwas zur Unterhaltung beizutragen, führte das Gespräch wieder zu den Bildern zurück.
Ich erklärte ein oder zwei Details und ließ sie ziemlich technisch klingen in der Hoffnung, den Grafen zu verwirren. Er hörte ernst zu, doch in seinen Mundwinkeln lag ein leises Lächeln. Der Verdacht, daß er genau wußte, was in meinem Kopf vorging, war mir höchst unbehaglich. Falls das stimmt, würde er auch wissen, daß ich ihn nicht mochte, und dies schien seltsamerweise sein Interesse an mir zu vergrößern.
»Ich bin überzeugt«, erklärte ich, »der Künstler war ein Meister der Farbe, wenn dieses Bild auch weit davon entfernt ist, ein Meisterwerk zu sein. Das kann ich jetzt schon sehen.«
Der Graf sah Philippe an. »Es ist das Bild, auf dem man die Smaragde in ihrer ganzen Pracht sieht. Es wird interessant sein, sie wenigstens auf einem Stück Leinwand zu sehen.«
»Das«, murmelte Philippe, »wird unsere einzige Gelegenheit sein, sie überhaupt zu sehen.«
»Wer weiß?« bemerkte der Graf, und an mich gewandt: »Philippe interessiert sich sehr für unsere Smaragde.«
»Tun wir das nicht alle?« fragte Philippe mit ungewohnter Kühnheit zurück.
»Wir sollten es, wenn eine Chance bestünde, sie wiederzubekommen.«
Geneviève stieß mit hoher, aufgeregter Stimme hervor: »Sie müssen doch irgendwo sein. Nounou sagt, sie seien im Château. Wenn wir sie nur finden könnten! Oh, wäre das nicht aufregend?«
»Deine alte Amme hat sicherlich recht«, antwortete der Graf sarkastisch. »Ganz davon abgesehen, daß diese Entdeckung den Familienbesitz beträchtlich vergrößern würde.«
»Weiß Gott!« stimmte Philippe mit glänzenden Augen zu.
»Glauben Sie, sie befinden sich im Schloß?« fragte ich.
Philippe sagte eifrig: »Sie sind nie woanders entdeckt worden, und Steine wie diese würde man erkennen. Es wäre nicht einfach, sie zu verkaufen.«
»Mein lieber Philippe«, gab der Graf zu bedenken, »du vergißt, was für Zeiten herrschten, als sie verschwanden. Vor hundert Jahren, Mademoiselle Lawson, hätten derartige Steine zerschnitten und einzeln verkauft werden können. Der Markt muß überflutet gewesen sein mit Edelsteinen, die von Leuten, die wenig Ahnung von ihrem Wert hatten, aus den Schlössern Frankreichs gestohlen wurden. Es ist so gut wie sicher, daß dies das Schicksal der Gaillard-Smaragde war.«
Die Wut, die einen Moment in seinen Augen aufgeflammt war, erlosch rasch wieder.
»Wie gut, Mademoiselle Lawson, daß Sie nicht zu jener Zeit lebten. Wie hätten Sie es ertragen, mit ansehen zu müssen, wie berühmte Gemälde aus den Fenstern geworfen wurden, Wind und Wetter ausgesetzt, um – wie nennen Sie es doch? – ›Flaum‹ anzusetzen.«
»Es ist tragisch, daß so viel Schönes verlorenging.« Ich wandte mich an Philippe. »Erzählen Sie mir von den Smaragden.«
»Sie waren seit langer Zeit in der Familie«, sagte er. »Sie hatten etwa den Wert von ... Es ist schwierig zu schätzen, da der Wert des Geldes sich so geändert hat. Sie waren jedenfalls unbezahlbar. Sie wurden in dem feuerfesten Gewölbe des Schlosses aufbewahrt. Während der Revolution verschwanden sie.«
»Von Zeit zu Zeit veranstalten wir eine Schatzsuche«, erzählte der Graf. »Jemand hat eine Idee, und es herrscht große Aufregung. Wir suchen und graben nach und versuchen, Verstecke zu entdecken, die seit Jahren nicht geöffnet worden sind.«
»Papa«, rief Geneviève, »könnten wir nicht wieder eine Schatzsuche machen?«
Der Fasan war hereingebracht worden. Es war vorzüglich, doch aß ich kaum davon. Ich fand die Unterhaltung zu interessant.
»Sie haben meine Tochter so beeindruckt, Mademoiselle Lawson«, bemerkte der Graf, »daß sie glaubt, Sie würden Erfolg haben, wo andere versagten. Du möchtest wieder eine Schatzsuche, Geneviève, weil du glaubst, mit Mademoiselle Lawson könnte es nicht schiefgehen?«
»Nein«, entgegnete Geneviève, »das habe ich nicht gedacht. Ich wollte einfach wieder mal nach den Smaragden suchen.«
»Ich schlage vor, daß du Mademoiselle Lawson das Château zeigst.« Er wandte sich an mich: »Sie haben es sich bestimmt noch nicht angesehen, und mit Ihrer lebhaften und so intelligenten Neugier möchten Sie das sicherlich gern. Wer weiß, vielleicht entdecken Sie das Versteck.«
»Es würde mich sehr interessieren, das Schloß zu besichtigen«, gab ich zu, »und wenn Geneviève es mir zeigen will, bin ich entzückt.«
Geneviève sah mich nicht an. Der Graf runzelte die Stirn.
Rasch sagte ich: »Wir werden eine Zeit verabreden, Geneviève.«
Sie sah erst ihren Vater und dann mich an.
»Morgen vormittag?« fragte sie.
»Vormittags arbeite ich, doch morgen nachmittag komme ich gern mit.
»Sehr gut«, murmelte sie.
»Ich bin sicher, es wird eine sehr nützliche Unternehmung für dich, Geneviève«, sagte der Graf.
Während des Soufflés sprachen wir über die Umgebung, hauptsächlich über den Weinanbau.
Ich fand, ich hatte große Fortschritte gemacht: Ich hatte mit der Familie diniert, etwas, was Mademoiselle Dubois nie erreicht hatte; man hatte mir die Erlaubnis gegeben auszureiten, morgen würde ich durch das Schloß geführt werden; und ich hatte so etwas wie eine Beziehung zum Grafen hergestellt, obgleich ich nicht so recht wußte, welcher Art diese war.
Bevor ich ging, sagte der Graf, es wäre ein Buch in der Bibliothek, das ich mir vielleicht gern ansehen würde.
»Mein Vater holte einen Herrn hierher, um es zu schreiben«, erklärte er. »Der interessierte sich außerordentlich für die Geschichte unserer Familie. Es ist Jahre her, seit ich es las, aber ich glaube, es wird Sie interessieren.«
Ich dankte ihm und sagte, daß ich mich freuen würde, es zu sehen.
»Ich werde es Ihnen hinaufschicken«, versprach er.
Ich verabschiedete mich, als auch Geneviève gute Nacht sagte, und wir verließen die Herren gemeinsam. Sie führte mich zu meinem Zimmer und wünschte mir kühl gute Nacht.
Ich war noch nicht lange in meinem Zimmer, als es an die Tür klopfte und ein Dienstmädchen hereinkam.
»Monsieur le Comte läßt Ihnen dies schicken«, sagte sie.
Sie ging sofort wieder und ließ mich mit dem Buch in der Hand stehen. Es war ein dünner Band, in dem auch einige Strichzeichnungen vom Schloß enthalten waren. Ich wußte, ich würde es hochinteressant finden, doch im Augenblick war mein Denken mit den Ereignissen des Abends vollauf beschäftigt. Ich wollte noch nicht zu Bett gehen, denn ich war viel zu angeregt. Meine Gedanken kreisten um den Grafen. Ich hatte ihn mir als einen ungewöhnlichen Mann vorgestellt, und er war in der Tat ein von Geheimnissen umwitterter Mann, ein Mann, dem es gefiel, wenn seine Umgebung Angst vor ihm hatte, und doch verachtete er sie dafür. Ich fragte mich, wie sein Leben wohl mit jener Frau gewesen war. Hatte sie sich vor seiner Verachtung geduckt? Hatte er sie mißhandelt? Es war nicht einfach, ihn sich bei physischer Gewalttätigkeit vorzustellen ... Doch wie konnte ich irgend etwas mit Sicherheit wissen? Ich kannte ihn ja kaum – bisher.
Um diesen Mann aus meinen Gedanken zu verbannen, versuchte ich an einen anderen zu denken. Wie anders war das offene Gesicht von Jean-Pierre Bastide. Plötzlich mußte ich lächeln. Merkwürdig, daß ich, die ich mich seit der Romanze mit Charles nie für einen Mann interessiert hatte, nun auf zwei Männer gestoßen war, die mein Denken beschäftigten. Wie töricht, schalt ich mich und nahm das Buch, das der Graf mir geschickt hatte, und begann zu lesen.
Das Schloß war im Jahre 1405 erbaut worden. Viel von dem ursprünglichen Bau war erhalten geblieben. Es wurden Vergleiche mit dem königlichen Schloß in Loches gezogen. Die de la Talles herrschten in Gaillard wie Könige. Sie hatten auch ihre Kerker, in denen sie ihre Feinde gefangenhielten. Als der Verfasser des Buches sich die Kerker anschaute, hatte man Verliese ähnlich denen in Loches entdeckt, kleine, in den Stein gehauene Löcher, in denen ein Mensch nicht genug Platz hatte, aufrecht zu stehen.
Ich las fasziniert nicht nur die Beschreibung des Schlosses, sondern ebenso die Geschichte der Familie.
Die Familie hatte im Laufe der Jahrhunderte oft in Fehde mit dem König gelegen; doch im allgemeinen hatten sie auf seiner Seite gestanden. Eine der Frauen war die Geliebte von Ludwig XI. gewesen, bevor sie einen de la Talle geheiratet hatte. Und dieser König hatte ihr ein äußerst wertvolles Smaragdkollier geschenkt. Es galt nicht als Schande, die Geliebte des Königs zu sein, und der de la Talle, der sie heiratete, hatte sich angestrengt, mit der Großzügigkeit des Königs zu wetteifern. Er hatte seiner Frau ein Smaragdarmband aus unbezahlbar kostbaren Steinen passend zu dem Kollier geschenkt. Diesem waren eine Smaragdtiara und zwei Smaragdringe gefolgt, eine Brosche und ein Gürtel, beides mit Smaragden besetzt, als Beweis, daß die de la Talles es mit Königen aufnehmen konnten. Das Buch bestätigte, was ich bereits wußte, nämlich daß die Smaragde während der Revolution verschwunden waren. Bis zu diesem Zeitpunkt waren sie zusammen mit anderen Kostbarkeiten in dem feuerfesten Gewölbe in der Waffengalerie aufbewahrt worden, zu der einzig und allein der Schloßherr den Schlüssel besaß.
Ich war nun bei dem Kapitel Die de la Talles und die Revolution angelangt
Lothair de la Talle, der damalige Graf, ein junger Mann von Dreißig, hatte wenige Jahre vor dem verhängnisvollen Jahr geheiratet. Er wurde zur Einberufung der Generalstände nach Paris gerufen und kehrte nie mehr zurück; er war einer der ersten, deren Blut unter der Guillotine vergossen wurde. Seine Frau, Marie Louise, zweiundzwanzig Jahre alt und schwanger, blieb mit der alten Gräfin, Lothairs Mutter, im Schloß. Ich sah alles vor min die heißen Julitage – die Überbringung der Todesnachricht an die junge Frau, ihre Trauer um ihren Mann, ihre Besorgnis um das in Kürze erwartete Kind.
Nur wenige entkamen dem Terror – und schließlich erreichte er auch Château Gaillard. Eine Bande von Revolutionären marschierte fahnenschwingend und die neuesten Lieder aus dem Süden grölend auf das Schloß los. Die Arbeiter ließen die Weinberge im Stich; aus den kleinen Häusern im Ort kamen die Frauen und Kinder gerannt. Die Zeit der Aristokraten war vorbei.
Ich schauderte, als ich las, wie die junge Gräfin das Schloß verlassen und sich in einem Haus in der Nähe versteckt hatte. Ich wußte, welches Haus das war; ich wußte, welche Familie sie aufgenommen hatte. Trotzdem waren die de la Talles nicht ihre Freunde geworden.
Die damalige Madame Bastide, Jean-Pierres Urgroßmutter, hatte der Gräfin Unterkunft gewährt. Sie hatte ihre Familie so beherrscht, daß sogar die Männer nicht gewagt hatten, sich ihr zu widersetzen. Sie standen auf seiten der Revolutionäre und schickten sich an, das Schloß zu plündern, während sich die Gräfin in ihrem Haus versteckte.
Die alte Gräfin hatte sich geweigert, das Schloß zu verlassen. Hier hatte sie gelebt und hier wollte sie sterben. Sie ging in die Kapelle, um dort den Tod durch die Hände der Rebellen zu erwarten. Sie hieß Geneviève und betete daher zur heiligen St. Geneviève um Hilfe. Sie hörte das wilde Geschrei und rohe Gelächter, als der Mob in das Schloß eindrang.
Und dann kamen sie zur Kapelle. Doch bevor sie in diese einbrachen, wollten sie die Statue der heiligen St. Geneviève herunterholen.
Vor dem Altar betete die alte Gräfin, während das Geschrei immer lauter wurde; jede Sekunde erwartete sie, daß der Pöbel in die Kapelle drang und sie umbrachte. Stricke wurden herangeholt, und die Kerle arbeiteten zu den betrunkenen Klängen der Marseillaise und des Liedes Ça ira. Und dann hörte sie das Krachen, die Schreie – und die grauenvolle Stille.
Das Schloß war außer Gefahr. Die heilige St. Geneviève lag in Trümmern vor der Tür der Kapelle, doch unter ihr lagen die Leichen von drei Männern. Sie hatte das Schloß gerettet. Einige Unverfrorene hatten versucht, den Mob wieder aufzuwiegeln, doch es war sinnlos gewesen. Viele von ihnen stammten aus der Umgebung und hatten ihr Leben lang im Schatten der de la Talles gelebt. Sie fürchteten sie jetzt so wie eh und je und hatten nur den einen Wunsch: Château Gaillard den Rücken zu kehren.
Die alte Gräfin kam aus der Kapelle, als alles still war. Sie blickte auf die zerbrochene Statue, kniete neben ihr nieder und dankte ihrer Schutzheiligen. Dann ging sie ins Schloß und versuchte mit Hilfe der einzigen verbliebenen Magd Ordnung zu schaffen. Mehrere Jahre lebte sie dort allein und sorgte für den kleinen Grafen, der heimlich wieder ins Schloß gebracht worden war. Seine Mutter war bei der Geburt gestorben. Jahrelang lebten sie so im Schloß – die alte Gräfin, das Kind und die Magd, bis die Zeiten sich änderten und das Leben im Schloß wieder in seine gewohnten Bahnen glitt. Die Dienstboten kehrten zurück, die Schäden wurden behoben, und die Weinberge trugen wieder Frucht.
Obwohl das Gewölbe, in dem man sie aufbewahrte, unberührt blieb, waren die Smaragde verschwunden und von da an für die Familie verloren.
Ich schloß das Buch. Ich war so müde, daß ich auf der Stelle einschlief.