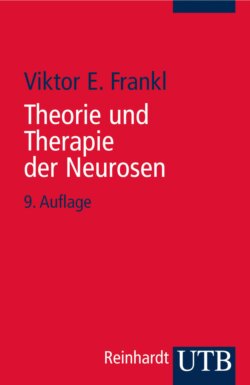Читать книгу Theorie und Therapie der Neurosen - Viktor E. Frankl, Viktor E. Frankl - Страница 11
ОглавлениеWas ist Logotherapie?
Bevor wir darangehen, zu sagen, was Logotherapie nun eigentlich ist, empfiehlt es sich, zunächst einmal zu sagen, was sie nicht ist: sie ist keine Panazee! Die Bestimmung der „Methode der Wahl“ in einem gegebenen Falle läuft auf eine Gleichung mit zwei Unbekannten hinaus:
Ψ = x + y
– wobei x für die Einmaligkeit und Einzigartigkeit der Patientenpersönlichkeit steht, und y für die nicht weniger einmalige und einzigartige Persönlichkeit des Therapeuten. Mit anderen Worten, weder läßt sich jede Methode in jedem Falle mit den gleichen Erfolgsaussichten anwenden, noch kann jeder Therapeut jede Methode mit der gleichen Wirksamkeit handhaben. Und was für die Psychotherapie im allgemeinen gilt, gilt im besonderen eben auch für die Logotherapie. Mit einem Wort, unsere Gleichung ließe sich ergänzen, indem wir nunmehr formulieren:
ψ = x + y = λ.
Und doch konnte es Paul E. Johnson einmal wagen, zu behaupten: „Logotherapy is not a rival therapy against others, but it may well be a challenge to them in its plus factor.“ Was diesen Plusfaktor aber ausmachen mag, verrät uns N. Petrilowitsch, wenn er meint, die Logotherapie verbleibe im Gegensatz zu allen anderen Psychotherapien nicht in der Ebene der Neurose, sondern gehe über sie hinaus und stoße in die Dimension der spezifisch humanen Phänomene vor („Über die Stellung der Logotherapie in der klinischen Psychotherapie“, Die medizinische Welt 2790, 1964). Tatsächlich sieht zum Beispiel die Psychoanalyse in der Neurose das Resultat psychodynamischer Prozesse1 und versucht demgemäß, die Neurose dadurch zu behandeln, daß sie neue psychodynamische Prozesse ins Spiel bringt, etwa die Übertragung; die lerntheoretisch engagierte Verhaltenstherapie sieht in der Neurose wieder das Produkt von Lernprozessen oder conditioning processes und bemüht sich dementsprechend, die Neurose dadurch zu beeinflussen, daß sie eine Art Umlernen beziehungsweise reconditioning processes in die Wege leitet. Demgegenüber steigt die Logotherapie in die menschliche Dimension ein und wird solcherart instand gesetzt, die spezifisch humanen Phänomene, auf die sie dort stößt, in ihr Instrumentarium aufzunehmen. Und zwar handelt es sich um nicht mehr und nicht weniger als die zwei fundamental-anthropologischen Charakteristika menschlicher Existenz, die da sind: ihre „Selbst-Transzendenz“ (Viktor E. Frankl, in: Handbuch der Neurosenlehre und Psychotherapie, Urban und Schwarzenberg, München 1959), erstens, und, zweitens, die – menschliches Dasein als solches, als menschliches, nicht weniger auszeichnende – Fähigkeit zur „Selbst-Distanzierung“ (Viktor E. Frankl, Der unbedingte Mensch, Franz Deuticke, Wien 1949, Seite 88).
Die Selbst-Transzendenz markiert das fundamental-anthropologische Faktum, daß menschliches Dasein immer auf etwas verweist, das nicht wieder es selbst ist, – auf etwas oder auf jemanden, nämlich entweder auf einen Sinn, den zu erfüllen es gilt, oder aber auf mitmenschliches Dasein, dem es begegnet. Wirklich Mensch wird der Mensch also erst dann und ganz er selbst ist er nur dort, wo er in der Hingabe an eine Aufgabe aufgeht, im Dienst an einer Sache oder in der Liebe zu einer anderen Person sich selbst übersieht und vergißt. Es ist wie mit dem Auge, das seiner Funktion, die Welt zu sehen, nur in dem Maße nachkommen kann, in dem es nicht sich selbst sieht. Wann sieht denn das Auge etwas von sich selbst? Doch nur, wenn es krank ist: wenn ich an einem grauen Star leide und eine „Wolke“ sehe oder an einem grünen Star leide und ringsum eine Lichtquelle Regenbogenfarben sehe, dann sieht mein Auge etwas von sich selbst, dann nimmt es seine eigene Krankheit wahr. Im gleichen Maße ist dann aber auch mein Sehvermögen gestört.
Ohne die Selbst-Transzendenz mit einzubeziehen in das Bild, das wir uns vom Menschen machen, stehen wir der Massenneurose von heute verständnislos gegenüber. Heute ist der Mensch im allgemeinen nicht mehr sexuell, sondern existentiell frustriert. Heute leidet er weniger an einem Minderwertigkeitsgefühl als vielmehr an einem Sinnlosigkeitsgefühl (Viktor E. Frankl, „The Feeling of Meaninglessness“, The American Journal of Psychoanalysis 32, 85, 1972). Und zwar geht dieses Sinnlosigkeitsgefühl für gewöhnlich mit einem Leeregefühl einher, mit einem „existentiellen Vakuum“ (Viktor E. Frankl, Pathologie des Zeitgeistes, Franz Deuticke, Wien 1955). Und es läßt sich nachweisen, daß dieses Gefühl, das Leben habe keinen Sinn mehr, um sich greift. Alois Habinger konnte anhand einer identischen Population von einem halben Tausend Lehrlingen nachweisen, daß das Sinnlosigkeitsgefühl in wenigen Jahren auf mehr als das Doppelte angestiegen war (persönliche Mitteilung). Kratochvil, Vymetal und Kohler haben darauf hingewiesen, daß sich das Sinnlosigkeitsgefühl keineswegs auf kapitalistische Länder beschränkt, vielmehr auch in kommunistischen Staaten bemerkbar macht, in die es „ohne Visum“ eingedrungen sei. Und den Hinweis darauf, daß es bereits in den Entwicklungsländern zu beobachten ist, verdanken wir L. L. Klitzke („Students in Emerging Africa – Logotherapy in Tanzania“, American Journal of Humanistic Psychology 9, 105, 1969) und Joseph L. Philbrick.
Fragen wir uns, was das existentielle Vakuum bewirkt und verursacht haben mag, so bietet sich folgende Erklärung an: Im Gegensatz zum Tier sagen dem Menschen keine Instinkte und Triebe, was er tun muß. Und im Gegensatz zu früheren Zeiten sagen ihm heute keine Traditionen mehr, was er tun soll. Weder wissend, was er muß, noch wissend, was er soll, weiß er aber auch nicht mehr recht, was er eigentlich will. Und die Folge? Entweder er will nur das, was die anderen tun, und das ist Konformismus. Oder aber umgekehrt: er tut nur das, was die anderen wollen – von ihm wollen. Und da haben wir den Totalitarismus. Darüber hinaus gibt es aber auch noch eine weitere Folgeerscheinung des existentiellen Vakuums, und das ist ein spezifischer Neurotizismus, nämlich die „noogene Neurose“ (Viktor E. Frankl, „Über Psychotherapie“, Wiener Zeitschrift für Nervenheilkunde 3, 461, 1951), die ätiologisch auf das Sinnlosigkeitsgefühl zurückzuführen ist, auf den Zweifel an einem Lebenssinn beziehungsweise auf die Verzweiflung, daß es einen solchen Sinn überhaupt gibt.2
Womit nicht gesagt sein soll, daß diese Verzweiflung an sich schon pathologisch ist. Nach dem Sinn seines Daseins zu fragen, ja diesen Sinn überhaupt in Frage zu stellen ist eher eine menschliche Leistung denn ein neurotisches Leiden; zumindest manifestiert sich darin geistige Mündigkeit: nicht mehr wird ein Sinnangebot kritiklos und fraglos, also unreflektiert übernommen, aus den Händen der Tradition, sondern Sinn will unabhängig und selbständig entdeckt und gefunden werden. Auf die existentielle Frustration ist daher das medizinische Modell von vornherein nicht anwendbar. Wenn überhaupt eine Neurose, dann ist die existentielle Frustration eine soziogene Neurose. Ist es doch ein soziologisches Faktum, nämlich der Traditionsverlust, der den Menschen von heute so sehr existentiell verunsichert.
Es gibt auch maskierte Formen der existentiellen Frustration. Ich erwähne nur die sich namentlich in der akademischen Jugend häufenden Fälle von Selbstmord3, die Drogenabhängigkeit, den so verbreiteten Alkoholismus und die zunehmende (Jugend-)Kriminalität. Heute läßt sich unschwer nachweisen, wie sehr die existentielle Frustration da mit im Spiel ist. Steht uns doch in Form des von James C. Crumbaugh entwickelten PIL-Tests (erhältlich durch Psychometric Affiliates, 1620 East Main Street, Murfreesboro, Tennessee 37130, USA) ein Meßinstrument zur Verfügung, mit dessen Hilfe sich der Grad der existentiellen Frustration quantifizieren läßt, und neuerdings hat Elisabeth S. Lukas mit ihrem Logo-Test einen weiteren Beitrag zur exakten und empirischen Logotherapieforschung geleistet (Zur Validierung der Logotherapie, in: Viktor E. Frankl, Der Wille zum Sinn, Hans Huber, Bern 1982).4
Was die Selbstmorde anlangt, wurden von der Idaho State University 60 Studenten unter die Lupe genommen, die Selbstmord versucht hatten, und in 85% ergab sich, „life meant nothing to them“ (das Leben hatte für sie keinen Sinn). Es ließ sich nun feststellen, daß von diesen an einem Sinnlosigkeitsgefühl leidenden Studenten 93% sich in einem ausgezeichneten physischen Gesundheitszustand befanden, im gesellschaftlichen Leben aktiv engagiert waren, hinsichtlich ihres Studiums ausgezeichnet abgeschnitten hatten und mit ihrer Familie in gutem Einvernehmen lebten. (Persönliche Mitteilung von Vann A. Smith.)
Nun zur Drogenabhängigkeit. William J. Chalstrom, der Direktor eines Naval Drug Rehabilitation Center, steht nicht an zu behaupten: „more than 60% of our patients complain that their lives lack meaning“ (persönliche Mitteilung). Betty Lou Padelford (Dissertation, United States International University, 1973) konnte statistisch nachweisen, daß es keineswegs das in diesem Zusammenhang von psychoanalytischer Seite inkriminierte „weak father image“ ist, das der Drogenabhängigkeit zugrunde liegt, vielmehr ließ sich anhand der von ihr getesteten 416 Studenten der Nachweis erbringen, daß der Grad der existentiellen Frustration signifikant mit dem drug involvement index korrelierte: der letztere betrug in den existentiell nicht frustrierten Fällen durchschnittlich 4,25, während er in den existentiellen frustrierten Fällen auf durchschnittlich 8,90, also mehr als das Doppelte, hinaufschnellte. Diese Forschungsergebnisse stimmen auch mit den von Glenn D. Shean und Freddie Fechtman erhobenen Befunden überein („Purpose in Life Scores of Student Marihuana Users“, Journal of Clinical Psychology 27, 112, 1971).
Es versteht sich von selbst, daß eine die existentielle Frustration als ätiologischen Faktor berücksichtigende und mittels einer logotherapeutischen Intervention ausräumende Rehabilitation Erfolg verspricht. So kommt es denn, daß laut Medical Tribune (Jahrgang 3, Nr. 19, 1971) von 36 Drogenabhängigen, die von der Universitätsnervenklinik Wien betreut wurden, nach einer Behandlungsdauer von 18 Monaten nur 2 sicher drogenfrei waren – was auf einen Prozentsatz von 5,5 hinausläuft. In der Deutschen Bundesrepublik können von „allen drogenabhängigen Jugendlichen, die ärztlich behandelt werden, mit einer Heilung weniger als 10% rechnen“ (Österreichische Ärztezeitung, 1973). In den USA sind es durchschnittlich 11%. Alvin R. Fraiser geht jedoch in dem von ihm geleiteten kalifornischen Narcotic Addict Rehabilitation Center logotherapeutisch vor und kann mit einem Prozentsatz von 40 aufwarten.
Vom Alkoholismus gilt Analoges. Unter schweren Fällen von chronischem Alkoholismus ließ sich feststellen, daß 90% an einem abgründigen Sinnlosigkeitsgefühl litten (Annemarie von Forstmeyer, The Will to Meaning as a Prerequisite for Self-Actualization, Dissertation, California Western University, 1968). Kein Wunder, daß James C. Crumbaugh auf Grund von Tests den Erfolg der Gruppenlogotherapie in Fällen von Alkoholismus objektivieren und, ihn mit dem Erfolg anderer Behandlungsmethoden vergleichend, feststellen konnte: „only logotherapy showed a statistically significant improvement“ („Changes in Frankl's Existential Vacuum as a Measure of Therapeutic Outcome“, Newsletter for Research in Psychology 14, 35, 1972).
Hinsichtlich der Kriminalität haben W. A. M. Black und R. A. M. Gregson von einer Universität in Neuseeland herausgefunden, daß Kriminalität und Lebenssinn in einem umgekehrt proportionalen Verhältnis zueinander stehen. Wiederholt in Gefängnisse eingelieferte Häftlinge unterschieden sich, gemessen am Lebenssinn-Test von Crumbaugh, von der durchschnittlichen Bevölkerung im Verhältnis von 86 zu 115. („Purpose in Life and Neuroticism in New Zealand Prisoners“, Br. J. soc. clin. Psychol. 12, 50, 1973.)
Wie Verhaltensforscher aus der Schule Konrad Lorenz nachweisen konnten, wird Aggressivität, die – etwa auf dem Fernsehschirm – auf harmlose Objekte abgelenkt und an ihnen abreagiert werden soll, in Wirklichkeit überhaupt erst provoziert und, wie ein Reflex, solcherart nur noch mehr gebahnt. Allgemeiner faßt sich die Soziologin Carolyn Wood Sherif von der Pennsylvania State University:
„There is a substantial body of research evidence that the successful execution of aggressive actions, far from reducing subsequent aggression, is the best way to increase the frequency of aggressive responses (Scott, Berkowitz, Pandura, Ross und Walters). Such studies have included both animal and human behavior.“ (Intergroup Conflict and Competition: Social-Psychological Analysis. Vortrag, Scientific Congress, XX. Olympiade, München, 22.8.1972.)
Des weiteren berichtete Professor Sherif aus den Vereinigten Staaten, daß die volkstümliche Vorstellung, der sportliche Wettkampf sei ein Ersatzkrieg ohne Blutvergießen, falsch ist: Drei Gruppen Jugendlicher in einem abgeschlossenen Camp hätten gerade durch sportliche Wettkämpfe Aggressionen gegeneinander aufgebaut, statt sie abzubauen. Die Pointe kommt aber erst: Ein einziges Mal waren unter den Lagerinsassen die gegenseitigen Aggressionen wie hinweggefegt, und das war der Fall, als die jungen Leute einen im lehmigen Boden steckengebliebenen Karren, mit dem die Lebensmittel in das Lager transportiert werden sollten, mobilisieren muß-ten; die wenn auch anstrengende, so doch sinnvolle „Hingabe an eine Aufgabe“5 hatte sie ihre Aggressionen buchstäblich „vergessen“ lassen. (Viktor E. Frankl, Anthropologische Grundlagen der Psychotherapie, Hans Huber, Bern 1974.)
Damit stehen wir auch schon vor den Möglichkeiten einer logotherapeutischen Intervention, die ja als solche, als logotherapeutische, auf eine Überwindung des Sinnlosigkeitsgefühls durch die Ingangsetzung von Sinnfindungsprozessen abzielt. Tatsächlich konnte Louis S. Barber an dem von ihm geleiteten Rehabilitationszentrum für Kriminelle binnen 6 Monaten den auf Grund von Tests ermittelten Pegel erlebter Sinnerfüllung von 86,13 auf 103,46 erhöhen, indem er das Rehabilitationszentrum zu einer „logotherapeutischen Umwelt“ ausgestaltete. Und während die durchschnittliche Rückfallsrate in den USA 40% beträgt, konnte Barber mit einem Prozentsatz von 17 aufwarten.6
Nach Besprechung der vielfachen und vielfältigen Erscheinungs- und Ausdrucksformen existentieller Frustration hätten wir uns nun zu fragen, wie muß die Verfassung menschlichen Daseins beschaffen sein – was ist die ontologische Voraussetzung dafür, daß sagen wir die 60 Studenten, die von der Idaho State University untersucht wurden, ohne Vorliegen irgendwelcher psychophysischer oder sozioökonomischer Gründe Selbstmord versuchen konnten. Mit einem Wort, wie muß menschliches Dasein konstituiert sein, daß so etwas wie existentielle Frustration überhaupt möglich ist. Mit anderen Worten – mit den Worten von Kant, wir fragen nach der „Bedingung der Möglichkeit“ von existentieller Frustration, und wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir annehmen, daß der Mensch so strukturiert ist – daß seine Verfassung so ist, daß er ohne Sinn eben einfach nicht auskommt. Mit einem Wort, die Frustration eines Menschen läßt sich nur verstehen, wenn wir seine Motivation verstehen. Und die ubiquitäre Präsenz des Sinnlosigkeitsgefühls mag uns als Indikator dienen, wo es darum geht, die primäre Motivation zu finden – das, was der Mensch letztlich will.
Die Logotherapie lehrt, daß der Mensch im Grunde eben von einem „Willen zum Sinn“ (Viktor E. Frankl, Der unbedingte Mensch, Franz Deuticke, Wien 1949) durchdrungen ist. Diese ihre Motivationstheorie aber läßt sich noch vor deren empirischer Verifizierung und Validierung auch operational definieren, indem wir folgende Erklärung abgeben: Willen zum Sinn nennen wir einfach das, was da im Menschen frustriert wird, wann immer er dem Sinnlosigkeits- und Leeregefühl anheimfällt.
James C. Crumbaugh und Leonard T. Maholick (Eine experimentelle Untersuchung im Bereich der Existenzanalyse: Ein psychometrischer Ansatz zu Viktor Frankls Konzept der „noogenen Neurose“, in: Die Sinnfrage in der Psychotherapie, herausgegeben von Nikolaus Petrilowitsch, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1972) haben sich ebenso wie Elisabeth S. Lukas (Logotherapie als Persönlichkeitstheorie, Dissertation, Wien 1971) anhand Tausender Versuchspersonen um die empirische Grundlegung der Lehre vom Willen zum Sinn bemüht. Inzwischen werden immer mehr Statistiken bekannt, aus denen die Legitimität unserer Motivationstheorie hervorgeht. Aus der Fülle des in letzter Zeit angefallenen Materials greife ich nur die Ergebnisse eines Forschungsprojekts heraus, das vom American Council on Education gemeinsam mit der University of California in Angriff genommen worden war. Unter 189.733 Studenten an 360 Universitäten galt das primäre Interesse von 73,7% – es handelt sich um den höchsten Prozentsatz! – einem einzigen Ziele: „developing a meaningful philosophy of life“ – sich zu einer Weltanschauung durchringen, von der aus das Leben sinnvoll ist. Der Bericht wurde 1974 veröffentlicht. 1972 waren es nur 68,1% gewesen (Robert L. Jacobson, The Chronicle of Higher Education).
Es darf hier aber auch auf das Ergebnis einer 2jährigen statistischen Untersuchung verwiesen werden, die von der höchsten Instanz psychiatrischer Forschung in den USA, nämlich dem National Institute of Mental Health, veröffentlicht wurde und aus der hervorgeht, daß 7.948 Studenten, die an 48 amerikanischen Hochschulen befragt worden waren, etwa zu 16% ihr Ziel darin sahen, „to make a lot of money“ – möglichst viel Geld zu machen; während die Spitzengruppe – es handelte sich um 78% – eines wollten: „to find a meaning and purpose to my life“ – in ihrem Leben einen Sinn finden.
Wenden wir uns nunmehr der Frage zu, was wir gegenüber der existentiellen Frustration, also der Frustration des Willens zum Sinn, und gegenüber der noogenen Neurose unternehmen können – war doch soeben von Sinngebung die Rede. Nun, eigentlich läßt sich Sinn gar nicht geben, und am allerwenigsten kann der Therapeut ihn geben – dem Leben des Patienten einen Sinn geben oder diesen Sinn dem Patienten mit auf den Weg geben. Sondern Sinn muß gefunden werden, und er kann jeweils nur von einem selbst gefunden werden. Und zwar wird dieses Geschäft vom eigenen Gewissen besorgt. In diesem Sinne haben wir das Gewissen als das „Sinn-Organ“ bezeichnet (Viktor E. Frankl, Logotherapie und Religion, in: Psychotherapie und religiöse Erfahrung, herausgegeben von Wilhelm Bitter, Ernst Klett, Stuttgart 1965). Sinn läßt sich also nicht verschreiben; aber was wir sehr wohl zu tun vermöchten, ist eine Beschreibung dessen, was da im Menschen vorgeht, wann immer er auf die Suche nach Sinn geht. Es stellt sich nämlich heraus, daß die Sinnfindung auf eine Gestaltwahrnehmung hinausläuft – ganz im Sinne von Max Wertheimer und Kurt Lewin, die bereits von einem „Aufforderungscharakter“ sprechen, der bestimmten Situationen innewohne. Nur daß es sich bei einer Sinngestalt nicht um eine „Figur“ handelt, die uns vor einem „Hintergrund“ in die Augen springt, sondern was bei der Sinnfindung jeweils wahrgenommen wird, ist – auf dem Hintergrund der Wirklichkeit – eine Möglichkeit: die Möglichkeit, die Wirklichkeit – so oder so – zu verändern.
Nun zeigt sich, daß der schlichte und einfache Mensch – also nicht einer, der jahrelanger Indoktrination ausgesetzt war, sei es als Student auf akademischem Boden, sei es als Patient auf analytischer Couch – es zeigt sich, daß der schlichte und einfache Mensch immer schon darum weiß, auf welchen Wegen sich Sinn finden – das Leben mit Sinn erfüllen läßt. Nämlich zunächst einmal dadurch, daß wir eine Tat setzen oder ein Werk schaffen, also schöpferisch. Aber auch durch ein Erlebnis, also dadurch, daß wir etwas erleben – etwas oder jemanden, und jemanden in seiner ganzen Einmaligkeit und Einzigartigkeit erleben heißt ihn lieben. Aber das Leben erweist sich als bedingungslos sinnvoll, es bleibt sinnvoll – es hat Sinn und behält ihn – unter allen Bedingungen und Umständen. Denn kraft eines präreflexiven ontologischen Selbst-Verständnisses, aus dem sich eine ganze Axiologie destillieren läßt, weiß der Mann von der Straße nicht zuletzt auch7 darum, daß er auch noch dann, ja gerade dann, wenn er mit einem unabänderlichen Faktum konfrontiert ist, eben in der Bewältigung dieser Situation sein Menschsein bewähren – Zeugnis davon ablegen kann, wessen der Mensch fähig ist. Was dann zählt, ist also die Haltung und Einstellung, mit der er die unausweichlichen Schicksalsschläge des Lebens abfängt. Diesem Leben Sinn abzuringen und abzugewinnen, ist dem Menschen also bis zu seinem letzten Atemzug vergönnt und verstattet.
Diese im Rahmen der Logotherapie ursprünglich intuitiv entwickelte Logo-Theorie – die Lehre von den ursprünglich so benannten „schöpferischen, Erlebnis- und Einstellungswerten“ (Viktor E. Frankl, „Zur geistigen Problematik der Psychotherapie“, Zentralblatt für Psychotherapie 10, 33, 1938) – wurde inzwischen empirisch verifiziert und validiert. So konnten Brown, Casciani, Crumbaugh, Dansart, Durlak, Kratochvil, Lukas, Lunceford, Mason, Meier, Murphy, Planova, Popielski, Richmond, Roberts, Ruch, Sallee, Smith, Yarnell und Young nachweisen, daß Sinnfindung und -erfüllung unabhängig sind vom jeweiligen Alter und Bildungsgrad und vom männlichen beziehungsweise weiblichen Geschlecht, aber auch davon, ob jemand religiös beziehungsweise irreligiös ist, und, wenn er sich zur Religion bekennt, unabhängig von der Konfession, zu der er sich bekennt. Und dasselbe gilt vom IQ. (Viktor E. Frankl, Der unbewußte Gott, Kösel-Verlag, München 1974.) Zuletzt konnte Bernard Dansart mit Hilfe eines von ihm entwickelten Tests die Einführung des Begriffs „Einstellungswerte“ empirisch legitimieren (Development of a Scale to Measure Attitudinal Values as Defined by Viktor Frankl, Dissertation, Northern Illinois University, 1974).
Wie sieht nun die Nutzanwendung dieser Logo-Theorie in der Praxis aus? In diesem Zusammenhang möchte ich den Fall einer Krankenschwester zitieren, die mir im Rahmen eines Seminars, das ich für das Department of Psychiatry an der Stanford University zu halten hatte, vorgestellt wurde:
Diese Patientin litt an einem nicht operierbaren Krebs, und sie wußte darum. Weinend trat sie ins Zimmer, in dem die Stanford-Psychiater versammelt waren, und mit von Tränen erstickter Stimme sprach sie von ihrem Leben, von ihren begabten und erfolgreichen Kindern und davon, wie schwer es ihr nun falle, von alledem Abschied zu nehmen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich, offen gesagt, noch keinen Ansatzpunkt gefunden, um logotherapeutisches Gedankengut in die Diskussion zu werfen. Nunmehr ließ sich das in ihren Augen Negativste, daß sie das für sie Wertvollste in der Welt zurücklassen muß, in etwas Positives umsetzen, als etwas Sinnvolles verstehen und deuten: Ich brauchte sie nur zu fragen, was denn eine Frau sagen soll, die keine Kinder hätte. Ich sei zwar überzeugt, daß auch das Leben einer kinderlos gebliebenen Frau keineswegs sinnlos bleiben muß. Aber ich könnte mir sehr wohl vorstellen, daß eine solche Frau zunächst einmal verzweifelt, weil eben nichts und niemand da ist, den sie „in der Welt zurücklassen muß“, wenn es dazu kommt, von der Welt Abschied zu nehmen. In diesem Augenblick hellten sich die Züge der Patientin auf. Plötzlich war sie sich dessen bewußt, daß es nicht darauf ankommt, ob wir Abschied nehmen müssen, denn früher oder später muß es jeder von uns. Sehr wohl kommt es aber darauf an, ob überhaupt etwas existiert, von dem wir Abschied nehmen müssen. Etwas, was wir in der Welt zurücklassen können, mit dem wir einen Sinn und uns selbst erfüllen an dem Tag, an dem sich unsere Zeit erfüllt. Es läßt sich kaum beschreiben, wie erleichtert die Patientin war, nachdem das sokratische Gespräch zwischen uns eine kopernikanische Wendung genommen hatte.
Ich möchte nun dem logotherapeutischen Stil einer Intervention den psychoanalytischen gegenüberstellen, wie er aus einer Arbeit von Edith Weisskopf-Joelson (einer amerikanischen Anhängerin der Psychoanalyse, die sich heute zur Logotherapie bekennt) hervorgeht:
„Die demoralisierende Wirkung der Verleugnung eines Lebenssinns, vor allem des tiefen Sinnes, der potentiell dem Leiden innewohnt, läßt sich anhand einer Psychotherapie illustrieren, die ein Freudianer einer Frau zuteil werden ließ, die an einem unheilbaren Krebs litt.“ Und Weisskopf-Joelson läßt K. Eissler zu Wort kommen: „Sie verglich die Sinnfülle ihres früheren Lebens mit der Sinnlosigkeit der gegenwärtigen Phase; aber selbst jetzt, wo sie nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten konnte und sich für viele Stunden am Tag hinlegen mußte, sei ihr Leben trotzdem sinnvoll, meinte sie, und zwar insofern, als ihr Dasein für ihre Kinder wichtig war und sie selbst so eine Aufgabe zu erfüllen hatte. Wenn sie aber einmal ins Spital eingeliefert würde, ohne Aussicht, jemals nach Hause zurückkehren zu können, und nicht mehr fähig, das Bett zu verlassen, würde aus ihr ein Klumpen nutzlosen faulenden Fleisches werden und ihr Leben jeden Sinn verlieren. Zwar war sie bereit, alle Schmerzen so lange zu ertragen, als dies noch irgendwie sinnvoll wäre; aber wozu wollte ich sie dazu verurteilen, ihre Leiden zu einer Zeit zu erdulden, zu der das Leben längst keinen Sinn mehr hätte? Daraufhin erwiderte ich, daß sie meines Erachtens einen groben Fehler begehe; denn ihr ganzes Leben sei sinnlos und von jeher sinnlos gewesen, noch bevor sie jemals erkrankt wäre. Einen Sinn des Lebens zu finden, sagte ich, hätten die Philosophen noch immer vergeblich versucht, und so bestehe denn auch der Unterschied zwischen ihrem früheren und ihrem gegenwärtigen Leben einzig und allein darin, daß sie in dessen früherer Phase an einen Sinn des Lebens noch zu glauben vermochte, während sie in der gegenwärtigen Phase eben nicht mehr imstande war, es zu tun. In Wirklichkeit, schärfte ich ihr ein, seien beide Phasen ihres Lebens ganz und gar sinnlos gewesen. Auf diese Eröffnung hin reagierte die Patientin, indem sie ratlos war, mich nicht recht zu verstehen vorgab und in Tränen ausbrach.“8
Eissler gab der Patientin nicht etwa den Glauben, daß auch noch das Leiden einen Sinn haben kann, sondern er nahm ihr auch noch den Glauben, daß das ganze Leben auch nur den geringsten Sinn haben könnte. Fragen wir uns aber nicht nur, wie ein Psychoanalytiker, sondern auch, wie ein Verhaltenstherapeut Fällen von menschlicher Tragik wie dem bevorstehenden eigenen Tod oder dem Tode eines anderen gegenübertritt. Einer der repräsentativsten Vertreter der lerntheoretisch begründeten Verhaltensmodifikation läßt es uns wissen: In solchen Fällen „sollte der Patient telephonische Anrufe besorgen, auf der Wiese das Gras mähen oder Geschirr waschen, und diese Betätigungen sollten vom Therapeuten gelobt oder anderweitig belohnt werden.“9
Wie sollte auch eine Psychotherapie, die ihr Menschenverständnis von Rattenexperimenten bezieht, mit dem fundamental-anthropologischen Faktum fertig werden, daß der Mensch einerseits mitten in der Überflußgesellschaft Selbstmord begeht und andererseits bereit ist zu leiden, vorausgesetzt, daß sein Leiden Sinn hat? Vor mir liegt der Brief eines jungen Psychologen, der mir schildert, wie er versucht habe, seine sterbende Mutter innerlich aufzurichten.“ Es war eine bittere Erkenntnis für mich“, – schreibt er dann – „daß ich nichts von all dem, das ich in 7 langen Jahren Studiums gelernt hatte, verwenden konnte, um meiner Mutter die Härte und Endgültigkeit ihres Schicksals zu erleichtern“ – nichts, als was er während seiner anschließenden logotherapeutischen Ausbildung gelernt hatte „vom Sinn des Leidens und von der reichen Ernte in die Geborgenheit der Vergangenheit“. Und angesichts dessen habe er sich eingestehen müssen, daß diese „teilweise unwissenschaftlichen, jedoch weisen Argumente in letzter menschlicher Instanz das höhere Gewicht besitzen“.
Inzwischen dürfte klargeworden sein, daß nur eine Psychotherapie, die es wagt, über Psychodynamik und Verhaltensforschung hinauszugehen und in die Dimension der spezifisch humanen Phänomene einzusteigen, mit einem Wort, daß nur eine rehumanisierte Psychotherapie imstande sein wird, die Zeichen der Zeit zu verstehen und den Nöten der Zeit sich zu stellen. Mit anderen Worten, es dürfte inzwischen klargeworden sein, daß wir, um die existentielle Frustration oder gar eine noogene Neurose auch nur zu diagnostizieren, im Menschen ein Wesen sehen müssen, das – kraft seiner Selbst-Transzendenz – ständig auf der Suche nach Sinn ist. Was aber nicht die Diagnose, sondern die Therapie anlangt, und zwar nicht die Therapie der noogenen, sondern die Therapie der psychogenen Neurose, müssen wir, um alle Möglichkeiten auszuschöpfen, auf die den Menschen nicht weniger auszeichnende Fähigkeit zur Selbst-Distanzierung zurückgreifen, und ihr begegnen wir nicht zuletzt in Form seiner Fähigkeit zum Humor. Eine humane, eine humanisierte, eine rehumanisierte Psychotherapie setzt also voraus, daß wir die Selbst-Transzendenz in den Blick bekommen und die Selbst-Distanzierung in den Griff bekommen. Beides ist aber nicht möglich, wenn wir im Menschen ein Tier sehen. Kein Tier schert sich um den Sinn des Lebens, und kein Tier kann lachen. Damit ist nicht gesagt, daß der Mensch nur Mensch und nicht auch Tier ist. Die Dimension des Menschen ist ja gegenüber der Dimension des Tieres die höhere, und das heißt, daß sie die niedrigere Dimension einschließt. Die Feststellung spezifisch humaner Phänomene im Menschen und die gleichzeitige Anerkennung subhumaner Phänomene an ihm widersprechen einander also gar nicht, denn zwischen dem Humanen und dem Subhumanen besteht ja kein Ausschließlichkeits-, sondern – wenn ich so sagen darf – ein Einschließlichkeitsverhältnis.
Es ist nun genau das Anliegen der logotherapeutischen Technik der paradoxen Intention, die Fähigkeit zur Selbst-Distanzierung im Rahmen der Behandlung der psychogenen Neurose zu mobilisieren, während einer weiteren logotherapeutischen Technik, der Dereflexion, das andere fundamental-anthropologische Faktum, nämlich die Selbst-Transzendenz, zugrunde liegt. Um diese beiden Behandlungsmethoden zu verstehen, müssen wir aber von der Neurosentheorie der Logotherapie ausgehen.
Wir unterscheiden da drei pathogene Reaktionsmuster. Das erste läßt sich folgendermaßen beschreiben: Der Patient reagiert auf ein gegebenes Symptom (Abbildung 1) mit der Befürchtung, es könnte wieder auftreten, also mit Erwartungsangst, und diese Erwartungsangst bringt es mit sich, daß das Symptom dann auch wirklich wieder auftritt – ein Ereignis, das den Patienten in seiner ursprünglichen Befürchtung nur bestärkt.
Nun kann das, vor dessen Wiederauftreten der Patient solche Angst hat, unter Umständen auch die Angst sein. Unsere Patienten sprechen da von einer „Angst vor der Angst“, und zwar ganz spontan. Und wie wird diese Angst von ihnen motiviert? Nun, für gewöhnlich fürchten sie sich vor dem Ohnmächtigwerden, vor einem Herzinfarkt oder davor, daß sie der Schlag treffen könnte. Wie reagieren sie aber auf ihre Angst vor der Angst? Mit Flucht. Sie vermeiden es etwa, das Haus zu verlassen. Tatsächlich ist die Agoraphobie das Paradigma dieses ersten, des angstneurotischen Reaktionsmusters.
Abb. 1
Warum soll dieses Reaktionsmuster aber „pathogen“ sein? Auf einem auf Einladung der American Association for the Advancement of Psychotherapy gehaltenen Vortrag (New York, 26.2.1960) haben wir es folgendermaßen formuliert: „Phobias and obsessive-compulsive neuroses are partially due to the endeavor to avoid the Situation in which anxiety arises.“ (Viktor E. Frankl, „Paradoxical Intention: A Logotherapeutic Technique“, American Journal of Psychotherapy 14, 520, 1960.) Diese unsere Auffassung jedoch, daß die Flucht vor der Angst durch das Vermeiden der die Angst auslösenden Situation für die Perpetuierung des angstneurotischen Reaktionsmusters so entscheidend ist, – diese unsere Auffassung ist inzwischen auch von verhaltenstherapeutischer Seite wiederholt bestätigt worden. So sagt I. M. Marks („The Origins of Phobic States“, American Journal of Psychotherapy 24, 652, 1970): „The phobia is maintained by the anxiety reducing mechanism of avoidance.“ Wie denn überhaupt nicht zu verkennen ist, daß die Logotherapie vieles vorweggenommen hat, das später von der Verhaltenstherapie auf eine solide experimentelle Grundlage gestellt wurde. War es doch bereits 1947, daß wir folgende Ansicht vertraten:
„Bekanntlich kann man die Neurose in einem gewissen Sinne und mit einem gewissen Recht auch als bedingten Reflex-Mechanismus auffassen. Allen vornehmlich analytisch orientierten seelenärztlichen Behandlungsmethoden geht es dann vorwiegend darum, die primären Bedingungen des bedingtes Reflexes, nämlich die äußere und innere Situation des erstmaligen Auftretens eines neurotischen Symptoms, bewußtseinsmäßig zu erhellen. Wir aber sind der Ansicht, daß die eigentliche Neurose – die manifeste, die bereits fixierte – nicht nur durch ihre primäre Bedingung verursacht ist, sondern durch ihre (senkundäre) Bahnung. Gebahnt jedoch wird der bedingte Reflex, als welchen wir das neurotische Symptom jetzt aufzufassen versuchen, durch den Circulus vitiosus der Erwartungsangst! Wollen wir demnach einen eingeschliffenen Reflex sozusagen entbahnen, dann gilt es allemal, die Erwartungsangst zu beseitigen, und zwar in jener angegebenen Art und Weise, als deren Prinzip wir die paradoxe Intention hingestellt haben“ (Viktor E. Frankl, Die Psychotherapie in der Praxis, Franz Deuticke, Wien 1947).
Abb. 2
Das zweite pathogene Reaktionsmuster ist nun nicht in angstneurotischen, sondern in zwangsneurotischen Fällen zu beobachten. Der Patient steht unter dem Druck (Abbildung 2) der auf ihn einstürmenden Zwangsvorstellungen und reagiert auf sie, indem er sie zu unterdrücken versucht. Er sucht also, einen Gegendruck auszuüben. Dieser Gegendruck aber ist es, was den ursprünglichen Druck nur erhöht. Wieder schließt sich der Kreis, und wieder schließt sich der Patient in diesen Teufelskreis ein. Was die Zwangsneurose charakterisiert, ist aber nicht, wie im Falle der Angstneurose, eine Flucht, sondern der Kampf, das Ankämpfen gegen die Zwangsvorstellungen. Wieder hätten wir uns zu fragen, was ihn dazu bewegt und veranlaßt. Und es stellt sich heraus, daß sich der Patient entweder davor fürchtet, die Zwangsvorstellungen könnten mehr als eine Neurose sein, indem sie eine Psychose signalisieren. Oder der Patient fürchtet sich davor, er könnte Zwangsvorstellungen kriminellen Inhalts in die Tat umsetzen, indem er jemandem etwas antut – jemandem oder sich selbst. So oder so: Der an einer Zwangsneurose leidende Patient hat nicht Angst vor der Angst selbst, sondern Angst vor sich selbst.
Es ist nun die Aufgabe der paradoxen Intention, die beiden Zirkelmechanismen zu sprengen, aufzubrechen, aus den Angeln zu heben. Und zwar geschieht das, indem den Befürchtungen des Patienten der Wind aus den Segeln genommen wird, indem er also, wie sich ein Patient einmal ausdrückte, „den Stier bei den Hörnern packt“. Wobei darauf Rücksicht zu nehmen ist, daß sich der Angstneurotiker vor etwas fürchtet, das ihm widerfahren könnte, während sich der Zwangsneurotiker auch vor etwas fürchtet, das er anstellen könnte. Beides wird nun berücksichtigt, wenn wir die paradoxe Intention folgendermaßen definieren: Der Patient wird angewiesen, genau das, wovor er sich immer so sehr gefürchtet hatte, nunmehr sich zu wünschen (Angstneurose) beziehungsweise sich vorzunehmen (Zwangsneurose).
Wie wir sehen, handelt es sich bei der paradoxen Intention um eine Inversion jener Intention, die die beiden pathogenen Reaktionsmuster charakterisiert, nämlich des Vermeidens von Angst und Zwang durch Flucht vor der ersteren beziehungsweise Kampf gegen den letzteren. Das ist aber genau das, was heute auch die Verhaltenstherapeuten für entscheidend halten: I. M. Marks bringt etwa im Anschluß an seine Hypothese, daß die Phobie durch die Angst herabsetzenden Mechanismen der Vermeidung aufrechterhalten wird, folgende therapeutische Empfehlung vor: „The phobia can then be properly overcome only when the patient faces the phobic Situation again.“ (l. c.) Und dazu bietet sich eben die paradoxe Intention an. In einer gemeinsamen mit S. Rachman und R. Hodgson verfaßten Arbeit hebt Marks ebenfalls hervor, daß der Patient dazu überredet und ermutigt werden muß, sich gerade auf das einzulassen, was ihn am meisten aufregt („The Treatment of Chronic Obsessive-Compulsive Neurosis“, Behav. Res. Ther. 9, 237, 1971). Aber auch in einer gemeinsam mit J. P. Watson und R. Gaind verfaßten Arbeit empfiehlt er therapeutisch, daß der Patient an den Gegenstand seiner Befürchtungen so nahe und so rasch herantreten muß, wie er nur kann, und nicht mehr solchen Gegenständen ausweichen darf („Prolonged Exposure“, Brit. Med. J. 1, 13, 1971).
Daß die Logotherapie in Form der bereits 1939 beschriebenen paradoxen Intention diese therapeutischen Empfehlungen längst schon in die Tat umgesetzt hatte, wird heute auch von führenden Verhaltenstherapeuten zugegeben.
„Die paradoxe Intention geht zwar von einem ganz anderen als dem lerntheoretischen Ansatz aus“, schreiben H. Dilling, H. Rosefeldt, G. Kockott und H. Heyse vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie, ihre „Wirkung könnte möglicherweise aber mit einfachen Prinzipien der Lernpsychologie erklärt werden“. Nachdem die Autoren zugeben, daß mit der paradoxen Intention „gute und zum Teil sehr rasche Erfolge erzielt wurden“, interpretieren sie diese Erfolge lernpsychologisch, indem sie „eine Lösung der konditionierten Verbindung zwischen auslösendem Reiz und Angst annehmen. Um neue, angepaßtere Reaktionsweisen auf bestimmte Situationen hin aufzubauen, muß das Meidungsverhalten mit seiner ständig verstärkenden Wirkung aufgegeben werden und die betreffende Person neue Erfahrungen mit den angstauslösenden Reizen gewinnen“. („Verhaltenstherapie bei Phobien, Zwangsneurosen, sexuellen Störungen und Süchten“, Fortschr. Neurol. Psychiat. 39, 293, 1971.)
Dieses Geschäft besorge eben die paradoxe Intention. Arnold A. Lazarus bestätigt ihre Erfolge ebenfalls und erklärt sie vom Standpunkt der Verhaltenstherapie aus folgendermaßen:
„When people encourage their anticipatory anxieties to erupt, they nearly always find the opposite reaction coming to the fore – their worst fears subside and when the method is used several times, their dreads eventually disappear.“ (Behavior Therapy and Beyond, McGraw-Hill, New York 1971).
Die paradoxe Intention wurde von mir bereits 1929 praktiziert (Ludwig J. Pongratz, Psychotherapie in Selbstdarstellungen, Hans Huber, Bern 1973), aber erst 1939 beschrieben (Viktor E. Frankl, „Zur medikamentösen Unterstützung der Psychotherapie bei Neurosen“, Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie 43, 26, 1939) und erst 1947 unter ihrem Namen publiziert (Viktor E. Frankl, Die Psychotherapie in der Praxis, Franz Deuticke, Wien 1947). Die Ähnlichkeit mit später auf den Markt gekommenen verhaltenstherapeutischen Behandlungsmethoden wie anxiety provoking, exposure in vivo, flooding, implosive therapy, induced anxiety, modeling, modification of expectations, negative practice, satiation und prolonged exposure ist unverkennbar und ist auch einzelnen Verhaltenstherapeuten nicht verborgen geblieben. Dilling, Rosefeldt, Kockott und Heyse zufolge „liegt der Methode der paradoxen Intention nach V. E. Frankl, obwohl sie ursprünglich nicht lernpsychologisch konzipiert wurde, möglicherweise ein ähnlicher Wirkungsmechanismus zugrunde wie den Flooding und Implosive Therapy genannten Behandlungsformen“ (l. c.). Und was die zuletzt genannte Behandlungsform anlangt, verweist I. M. Marks ebenfalls auf „certain similarities to the paradoxical intention technique“ (Fears and Phobias, Academic Press, New York 1969) sowie auf das Faktum, daß diese unsere Technik „closely resembled that now termed modeling“ (Treatment of Obsessive-Compulsive Disorders, in: Psychotherapy and Behavior Change 1973, edited by Hans H. Strupp et al., Aldine Publishing Company, Chicago 1974).10
Wenn jemand gegenüber der paradoxen Intention eine Priorität beanspruchen kann, dann sind es meines Erachtens nur folgende Autoren: Rudolf Dreikurs verdanke ich den Hinweis auf einen analogen „Trick“, der bereits 1932 von ihm (Das nervöse Symptom, Verlag Moritz Perles, Wien und Leipzig) und noch früher von Erwin Wexberg beschrieben wurde, welch letzerer ad hoc den Ausdruck „Antisuggestion“ prägte. Und 1956 wurde mir zur Kenntnis gebracht, daß H. v. Hattingberg ebenfalls auf eine analoge Erfahrung hinweist:
„Wem es zum Beispiel gelingt, das Auftreten eines nervösen Symptoms, gegen das er sich bisher ängstlich gewehrt hatte, bewußt zu wünschen, der kann durch diese willentliche Einstellung die Angst und schließlich auch das Symptom zum Schwinden bringen. Es ist also möglich, den Teufel durch den Beelzebub auszutreiben. Eine solche Erfahrung ist freilich nur manchen praktisch erreichbar. Es gibt jedoch kaum eine Erfahrung, die für den seelisch Gehemmten lehrreicher wäre.“ (Über die Liebe, München-Berlin 1940.)
Es ist auch nicht anzunehmen, daß die paradoxe Intention, wenn sie wirklich wirksam sein soll, nicht ihre Vorgänger und Vorläufer gehabt haben sollte. Was man der Logotherapie daher als Verdienst anrechnen kann, ist nur, daß sie das Prinzip zu einer Methode ausgebaut und in ein System eingebaut hat.
Nur um so bemerkenswerter ist es, daß der erste Versuch, die Wirksamkeit der paradoxen Intention experimentell zu beweisen, von Verhaltenstherapeuten unternommen wurde. Waren es doch die Professoren L. Solyom, J. Garza-Perez, B. L. Ledwidge und C. Solyom von der Psychiatrischen Klinik der McGill University, die in Fällen von chronischer Zwangsneurose jeweils zwei gleich intensiv ausgeprägte Symptome auswählten und dann das eine, das Zielsymptom, mit paradoxer Intention behandelten, während das andere, das „Kontroll“-Symptom, unbehandelt blieb. Tatsächlich ergab sich, daß einzig und allein die jeweils behandelten Symptome dahinschwanden, und zwar innerhalb weniger Wochen. Und zu Ersatzsymptomen kam es in keinem einzigen Falle! („Paradoxical Intention in the Treatment of Obsessive Thoughts: A Pilot Study“, Comprehensive Psychiatry 13, 291, 1972.)11
Unter den Verhaltenstherapeuten war es nun wieder Lazarus, dem „an integral element in Frankl’s paradoxical intention procedure“ aufgefallen ist: „the deliberate evocation of humor. A patient who fears that he may perspire is enjoined to show his audience what perspiration is really like, to perspire in gushes of drenching torrents of sweat which will moisturize everything within touching distance.“ (l. c.) Tatsächlich gehört, wie wir ja bereits vorwegnehmend bemerkt haben, als von der Mobilisierung der Fähigkeit zur Selbst-Distanzierung die Rede war – tatsächlich gehört der Humor, mit dem der Patient die paradoxe Intention jeweils formulieren muß, zum Wesen dieser Technik, und mit ihm hebt sie sich auch von den verhaltenstherapeutischen Behandlungsmethoden ab, die wir aufgezählt haben.
Mit welchem Recht wir aber immer schon und immer wieder auf die Bedeutung des Humors für den Erfolg der paradoxen Intention hingewiesen haben, wurde jüngst ebenfalls von einem Verhaltenstherapeuten bewiesen, und zwar war es Iver Hand vom Londoner Maudsley Hospital, der beobachten konnte, daß an Platzangst leidende Patienten, die – in Gruppen zusammengefaßt – mit den bis dahin von ihnen vermiedenen, weil ihre Angst auslösenden Situationen konfrontiert worden waren, ganz spontan sich selbst und einander mit Humor zur Übertreibung ihrer Angst antrieben: „They used humor spontaneously as one of their main coping mechanisms.“ (Vortrag auf dem Montrealer Logotherapie-Symposium, veranstaltet von der American Psychological Association auf ihrer Jahrestagung 1973.) Kurz, die Patienten „erfanden“ die paradoxe Intention – und so wurde ihr Reaktions-„Mechanismus“ von dem Londoner Forscher-Team auch interpretiert!
Nun wollen wir uns aber der paradoxen Intention zuwenden, wie sie lege artis, nach den Regeln der Logotherapie durchgeführt wird, und zwar soll dies anhand von Kasuistik erläutert werden. In diesem Zusammenhang darf zunächst einmal auf die Fälle verwiesen werden, die in meinen Büchern „Theorie und Therapie der Neurosen“, „Die Psychotherapie in der Praxis“, „Der Wille zum Sinn“ und „Ärztliche Seelsorge“ besprochen werden. Im folgenden konzentrieren wir uns aber auf unpubliziertes Material.
Spencer Adolph M. aus San Diego, California, schreibt mir:
„Zwei Tage, nachdem ich Ihr Buch Man’s Search for Meaning gelesen hatte, befand ich mich in einer Situation, die mir Gelegenheit gab, die Logotherapie einmal auf die Probe zu stellen. An der Universität nehme ich nämlich an einem Seminar über Martin Buber teil, und während der ersten Zusammenkunft nahm ich mir kein Blatt vor den Mund, als ich glaubte, genau das Gegenteil von dem sagen zu müssen, was die anderen gesagt hatten. Da begann ich auf einmal, mächtig zu schwitzen. Und sobald ich das bemerkt hatte, bekam ich es mit der Angst zu tun, die anderen könnten es merken, woraufhin ich erst recht zu schwitzen begann. Plötzlich fiel mir der Fall eines Arztes ein, der Sie wegen seiner Angst vor Schweißausbrüchen konsultiert hatte, und ich dachte mir, meine Situation sei doch ähnlich. Aber ich halte nicht viel von der Psychotherapie, und von der Logotherapie am allerwenigsten.
Aber nur um so mehr schien mir meine Situation eine einmalige Gelegenheit zu sein, um die paradoxe Intention einmal auszuprobieren. Was war es doch, was Sie Ihrem Kollegen geraten hatten? Er möge sich doch zur Abwechslung einmal wünschen und vornehmen, den Leuten zu zeigen, wie tüchtig er schwitzen kann – ,bisher hab’ ich nur 1 Liter zusammengeschwitzt, jetzt aber will ich 10 Liter herausschwitzen‘, heißt es in Ihrem Buch. Und während ich im Seminar weitersprach, sagte ich mir: Tu doch auch du einmal deinen Kollegen was vorschwitzen, Spencer! Aber so richtig – das ist noch gar nichts – noch viel mehr sollst du schwitzen! Und es vergingen nicht mehr als ein paar Sekunden, und ich konnte beobachten, wie meine Haut trocken wurde. Innerlich mußte ich lachen. War ich doch nicht darauf gefaßt, daß die paradoxe Intention wirken wird, und noch dazu sofort. Zum Teufel noch einmal, sagte ich mir, da muß was dran sein, an dieser paradoxen Intention – das hat hingehaut, und dabei bin ich doch so skeptisch gegenüber der Logotherapie.“
Einem Bericht von Mohammed Sadiq entnehmen wir folgenden Fall:
„Frau N., eine 48 Jahre alte Patientin, litt an Zittern, und zwar in dem Maße, daß sie außerstande war, eine Schale Kaffee oder ein Glas Wasser zu halten, ohne etwas zu verschütten. Auch konnte sie weder schreiben noch ein Buch ruhig genug halten, um lesen zu können. Eines Morgens ergab es sich, daß wir einander allein gegenübersaßen und sie wieder einmal begann zu zittern. Daraufhin beschloß ich, einmal die paradoxe Intention zu versuchen, und zwar richtig mit Humor. So begann ich denn: Wie wärs, Frau N., wenn wir einmal ein Wettzittern veranstalteten? – Sie: Was soll das heißen? – Ich: Wir wollen einmal sehen, wer schneller und wer länger zittern kann. – Sie: Ich hab’ nicht gewußt, daß Sie ebenfalls an Zittern leiden. – Ich: Nein, nein – keineswegs; wenn ich aber will, dann kann ich zittern. (Und ich begann – und wie.) Sie: Jö – Sie könnens ja schneller als ich. (Und lächelnd begann sie, ihr Zittern zu beschleunigen.) Ich: Schneller – los, Frau N., Sie müssen viel schneller zittern. – Sie: Aber ich kann ja nicht – hören Sie auf, ich kann nicht mehr weiter. – Und sie war wirklich müde geworden. Sie stand auf, ging in die Küche und kam zurück – mit einer Schale Kaffee. Und sie trank sie aus, ohne auch nur einen Tropfen zu verschütten. Wann immer ich sie seither beim Zittern ertappe, brauche ich bloß zu sagen: Nun, Frau N., wie wär’s mit einem Wettzittern? Woraufhin sie zu sagen pflegt: Schon recht, schon recht. – Und das hat noch jedesmal geholfen.“
Georg Pynummootil (USA) berichtet folgendes:
„Ein junger Mann kam in meine Ordination, und zwar wegen eines schweren Blinzeltics, der immer auftrat, wenn er mit jemandem zu sprechen hatte. Da die Leute ihn zu fragen pflegten, was denn los sei, wurde er immer nervöser. Ich überwies ihn an einen Psychoanalytiker. Aber nach einer ganzen Reihe von Sitzungen kam er wieder, um mir zu melden, der Psychoanalytiker hätte nicht die Ursache finden, geschweige denn ihm helfen können. Daraufhin empfahl ich ihm, das nächste Mal, wenn er mit jemandem zu sprechen habe, soviel wie möglich mit den Augen zu zwinkern, um seinem Gesprächspartner zu zeigen, wie ausgezeichnet er das könne. Er aber meinte, ich müsse wohl verrückt geworden sein, wenn ich ihm mit solchen Empfehlungen komme, denn so was könne seinen Zustand ja nur verschlechtern. Und er ging. Ein paar Wochen lang ließ er sich nicht wieder sehen. Dann aber kam er eines Tages wieder, und zwar um mir ganz begeistert zu erzählen, was inzwischen geschehen war: Da er von meinem Vorschlag nichts gehalten hatte, dachte er auch nicht daran, ihn in die Tat umzusetzen. Das Zwinkern verschlimmerte sich aber, und als ihm eines Nachts wieder einfiel, was ich ihm gesagt hatte, sagte er sich: Jetzt hab’ ich alles versucht, was es gibt, und nichts hat geholfen. Was kann schon passieren – versuchst halt’ mal, was der dir da empfohlen hat. Und als er am nächsten Tag dem Erstbesten begegnete, nahm er sich vor, soviel wie möglich mit den Augen zu zwinkern – und zu seiner größten Überraschung war er einfach außerstande, es auch nur im geringsten zu tun. Von da an machte sich der Blinzeltic nie mehr bemerkbar.“
Ein Universitätsassistent schreibt uns:
„Ich hatte mich irgendwo vorzustellen, nachdem ich mich um einen Posten beworben hatte, an dem mir sehr gelegen war, da ich dann in der Lage gewesen wäre, Frau und Kinder nachkommen zu lassen nach Kalifornien. Ich war aber sehr nervös und bemühte mich riesig, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Wann immer ich aber nervös werde, fangen meine Beine zu zucken an, und zwar in einem Ausmaß, daß es die Anwesenden merken müssen. Und so geschah’s auch diesmal. Diesmal aber sagte ich mir: Jetzt werde ich einmal diese Saumuskeln da so zwingen zu zucken, daß ich nicht mehr sitzen bleiben kann, sondern aufspringen muß und im Zimmer so lange herumtanzen, bis die Leute glauben, daß ich übergeschnappt bin. Diese Saumuskeln werden heute zucken wie noch nie – heut’ gibt’s einen Zuckrekord. – Nun, die Muskeln haben während der ganzen Besprechung kein einziges Mal gezuckt, ich hab’ den Posten bekommen, und meine Familie wird bald hier in Kalifornien sein.“
Zwei Beispiele von Arthur Jores (Der Kranke mit psychovegetativen Störungen, Vandenhoeck, Göttingen) passen in diesen Zusammenhang:
Es kam eine Krankenhausfürsorgerin zu Jores, „die darüber klagte, daß sie immer, wenn sie zu dem Arzt in sein Zimmer müsse, um mit ihm etwas zu besprechen, rot anlaufe. Wir übten zusammen die paradoxe Intention, und wenige Tage später bekam ich einen glücklichen Brief, es funktioniere ausgezeichnet.“ Ein anderes Mal kam ein Medizinstudent zu Jores, „für den es wegen eines Stipendiums außerordentlich wichtig war, ein gutes Physikum zu bestehen. Er klagte über Examensangst. Auch mit ihm wurde die paradoxe Intention geübt, und siehe da, er war während des Examens vollständig ruhig und bestand es mit einer guten Note“ (Seite 52).
Larry Ramirez verdanken wir folgenden kasuistischen Beitrag:
„The technique which has helped me most often and worked most effectively in my counseling sessions is that of paradoxical intention. One such example I have illustrated below. Linda T., an attractive nineteen year old College Student, had indicated on her appointment card that she was having some problems at home with her parents. As we sat down, it was quite evident to me that she was very tense. She stuttered. My natural reaction would have been to say, ,relax, it’s alright‘, or ,just take it easy‘, but from past experience I knew that asking her to relax would only serve to increase her tension. Instead, I responded with just the opposite, ,Linda, I want you to be as tense as you possibly can. Act as nervously as you can‘. ,O. K.‘, she said, ,being nervous is easy for me‘. She started by clenching her fists together and shaking her hands as though they were trembling. ,Thats good‘, I said, ,but try to be more nervous‘. The humor of the situation became obvious to her and she said, ,I really was nervous, but I can’t be any longer. It’s odd, but the more I try to be tense, the less I’m able to be‘. In recalling this case, it is evident to me that it was the humor that came from using paradoxical intention which helped Linda realize that she was a human being first and foremost, and a client second, and that I, too, was first a person, and her counselor second. Humor best illustrated our humanness.“
Vor der Royal Society of Medicine hielt J. F. Briggs einen Vortrag, dem wir folgendes entnehmen:
„I was asked to see a young man from Liverpool, a stutterer. He wanted to take up teaching, but stuttering and teaching do not go together. His greatest fear and worry was his embarassment by the stuttering so that he went through mental agonies every time he had to say anything. I remembered a short time before having read an article by Viktor Frankl, who wrote about a reaction of paradox. I then gave the following suggestions – ,You are going out into the world this week-end and you are going to show people what a jolly good stutterer you are.‘ He came up the following week and was obviously elated because his speech was so much better. He said ,What do you think happened! I went into a pub with some friends and one of them said to me ,I thought you used to be a stutterer‘ and I said ,I did – so what‘! It was an instance where I took the bull by the horns and it was successful.‘“
Ein anderer Fall von Stottern betrifft einen Studenten an der Duquesne University, der mir folgendes schreibt:
„17 Jahre hindurch war ich ein schwerer Stotterer. Es gab Zeiten, zu denen ich überhaupt außerstande war zu sprechen. Ich war auch wiederholt in Behandlung, hatte aber keinen Erfolg. Da wurde mir eines Tages von einem Professor der Auftrag erteilt, im Rahmen eines Seminars Ihr Buch Man’s Search for Meaning zu besprechen. So las ich es denn und stieß auch auf Ihre paradoxe Intention. Daraufhin beschloß ich, sie auch in meinem eigenen Falle zu versuchen, und siehe da, gleich das erste Mal wirkte sie fabelhaft. Von Stottern war keine Spur. Dann machte ich mich auf und begab mich in jene Situationen, in denen ich immer gestottert hatte, aber wieder blieb das Stottern aus, sobald ich die paradoxe Intention anwandte. Ein paarmal wandte ich sie aber nicht an, und sofort war das Stottern auch wieder da. Ich sehe darin einen Beweis dafür, daß es tatsächlich die paradoxe Intention war, die mich von dem Stottern befreit hatte.“
Der Pikanterie entbehrt nicht ein Bericht, den ich Uriel Meshoulam, einem Logotherapeuten von der Harvard University, verdanke:
Einer seiner Patienten wurde vom australischen Militär einberufen und war überzeugt, er würde nicht eingezogen werden, da er ein schwerer Stotterer war. Als er nun assentiert wurde, versuchte er vor dem Arzt dreimal, zu demonstrieren, wie schwer sein Stottern war, und war einfach total unfähig, überhaupt zu stottern. Schließlich wurde er zurückgestellt, aber auf Grund von hohem Blutdruck. „The Australian army probably doesn’t believe him until today“ – so schließt der Bericht – „that he is a stutterer.“
Die Anwendung der paradoxen Intentionen in Fällen von Stottern ist in der Literatur viel diskutiert worden. Manfred Eisenmann widmete dem Thema seine Dissertation an der Universität von Freiburg im Breisgau (1960). J. Lehembre publizierte seine Erfahrungen mit Kindern und hebt hervor, daß es nur ein einziges Mal zu Ersatzsymptomen gekommen wäre („L’intention paradoxale, procédé de psychothérapie“, Acta neurol. belg. 64, 725, 1964), was ja mit den Beobachtungen von L. Solyom, Garza-Perez, Ledwidge und C. Solyom übereinstimmt, die – nach paradoxer Intention – sogar in keinem einzigen Falle Ersatzsymptome feststellen konnten (l. c.).12
Jores (l. c.) behandelte einmal eine Patientin, die in der festen Vorstellung lebte, daß sie immer ausreichend Schlaf haben müsse. Sie war nun mit einem Manne verheiratet, der größere gesellschaftliche Verpflichtungen hatte, so daß es nicht ausblieb, daß sie immer wieder einmal recht spät ins Bett kam. Sie berichtete, daß sie das immer schlecht vertragen habe. Teilweise setzte schon nachts, so etwa gegen 1.00 Uhr, ein Migräneanfall ein oder spätestens am nächsten Morgen. Die Beseitigung dieser an das längere Aufbleiben gekoppelten Anfälle war durch die paradoxe Intention möglich. Es wurde der Patientin empfohlen, sich zu sagen: „So, jetzt willst du einmal einen richtigen, schönen Migräneanfall bekommen“. Daraufhin seien, wie Jores berichtet, die Anfälle ausgeblieben.
Dieser Fall leitet über zur Anwendung der paradoxen Intention in Fällen von Schlafstörung.
Sadiq, den wir bereits zitiert haben, behandelte einmal eine 54 Jahre alte Patientin, die von Schlafmitteln abhängig geworden und dann in ein Spital eingeliefert worden war: „Um 10 Uhr abends kam sie aus ihrem Zimmer heraus und bat um ein Schlafmittel. Sie: Darf ich um meine Pillen bitten? Ich: Tut mir leid – die sind heute ausgegangen, und die Schwester hat vergessen, rechtzeitig neue zu bestellen. Sie: Wie soll ich jetzt schlafen können? Ich: Heute wird’s eben ohne Schlafmittel gehen müssen. – 2 Stunden später erscheint sie wieder. Sie: Es geht einfach nicht. Ich: Und wie wärs, wenn Sie sich wieder hinlegten und zur Abwechslung einmal versuchten, nicht zu schlafen, sondern – im Gegenteil – die ganze Nacht aufzubleiben? Sie: Ich hab immer geglaubt, ich bin verrückt, aber mir scheint, sie sind’s auch. Ich: Wissen Sie, manchmal macht mir’s Spaß, verrückt zu sein, oder können Sie das nicht verstehen? Sie: War das Ihr Ernst? Ich: Was denn? Sie: Daß ich versuchen soll, nicht zu schlafen. Ich: Natürlich war das mein Ernst. Versuchen Sie’s doch einmal! Wir wollen einmal sehen, ob Sie die ganze Nacht wach bleiben können. Nun? Sie: O. K. – Und als die Schwester morgens ihr Zimmer betrat, um ihr das Frühstück zu bringen, war die Patientin noch immer nicht erwacht.“
Übrigens gibt es eine Anekdote, die es verdienen würde, in diesem Zusammenhang zitiert zu werden, und zwar aus dem bekannten Buch von Jay Haley, „Strategies of Psychotherapy“ (Grune & Stratton, New York 1963):
Während eines Vortrags, den der berühmte Hypnotiseur und Therapeut Milton H. Erickson hielt, stand ein junger Mann auf und sagte zu ihm: „Vielleicht können Sie andere Leute hypnotisieren – mich bestimmt nicht.“ Daraufhin lud Erickson den jungen Mann ein, sich aufs Podium zu begeben und Platz zu nehmen, und dann sagte er zu ihm: „Sie sind hellwach – Sie bleiben wach – Sie werden immer wacher, wacher und wacher ... “ Und prompt fiel die Versuchsperson in tiefe Trance.
R. W. Medlicott, dem Psychiater von der Universität Neuseeland, ist es vorbehalten geblieben, erstmalig die paradoxe Intention nicht nur aufs Schlafen, sondern auch aufs Träumen angewendet zu haben. Er hatte mit ihr schon viel Erfolg gehabt – auch, wie er hervorhebt, im Falle eines Patienten, der von Beruf Psychoanalytiker war.
Da war aber eine Patientin, die an regelmäßigen Alpträumen litt, und zwar träumte sie jeweils, daß sie verfolgt und schließlich niedergestochen werde. Dann schrie sie auf, und ihr Mann wachte ebenfalls auf. Medlicott trug ihr nun auf, alles daranzusetzen, um diese schrecklichen Träume zu Ende zu träumen, bis auch die Messerstecherei ein Ende habe. Und was geschah? Es gab keine Alpträume mehr, aber der Schlaf des Mannes war nach wie vor gestört: die Patientin schrie zwar nicht mehr auf, während sie schlief, aber dafür mußte sie nunmehr so laut lachen, daß der Mann auch jetzt nicht ruhig schlafen konnte. („The Management of Anxiety“, New Zealand Medical Journal 70, 155, 1969.)
Ähnliches berichtet uns eine Leserin aus den USA.
„Donnerstag morgens erwachte ich deprimiert und dachte, ich würde überhaupt nicht mehr gesund werden. Im Laufe des Vormittags fing ich dann zu weinen an und war einfach verzweifelt. Da fiel mir die paradoxe Intention ein und ich sagte zu mir: Wollen mal sehen, wie deprimiert ich werden kann. Jetzt wird einmal so geweint, daß ich die ganze Wohnung nur so überschwemme mit Tränen. Und ich stellte mir vor, meine Schwester kommt heim und jammert: Zum Teufel noch einmal, hat das wirklich sein müssen, diese Flut von Tränen? Woraufhin ich dermaßen lachen mußte, daß ich Angst bekam. Und so blieb mir denn nichts anderes übrig, als mir zu sagen: Das Lachen wird so arg werden, daß die Nachbarn zusammenlaufen werden, um nachzusehen, wer denn da so laut lacht. Währenddessen hatte ich aufgehört, deprimiert zu sein, ich lud meine Schwester ein, mit mir auszugehen, und das war wie gesagt Donnerstag, und heute haben wir Samstag, und ich fühle mich nach wie vor sauwohl. Ich glaube halt, die paradoxe Intention wirkte vor 2 Tagen wie ein Versuch, zu weinen und gleichzeitig in den Spiegel zu schauen – weiß Gott warum, aber es ist dann einfach nicht möglich, weiter zu weinen.“
Und sie mag nicht ganz so unrecht haben. Ist doch beides – die paradoxe Intention ebenso wie die Selbstbespiegelung – ein Vehikel der menschlichen Fähigkeit zur Selbstdistanzierung.
Immer wieder konnte beobachtet werden, daß die paradoxe Intention auch in schweren und chronischen, lang anhaltenden Fällen wirkt, und sie tut es auch dann, wenn die Behandlung kurz dauert. So wurden Fälle von Zwangsneurose beschrieben, die 60 Jahre lang bestanden hatten, bis mit der paradoxen Intention eine entscheidende Besserung herbeigeführt wurde (K. Kocourek, Eva Niebauer und Paul Polak, in: Ergebnisse der klinischen Anwendung der Logotherapie, Handbuch der Neurosenlehre und Psychotherapie, herausgegeben von Viktor E. Frankl, Victor E. v. Gebsattel und J. H. Schultz, Urban & Schwarzenberg, München-Berlin 1959). Die therapeutischen Erfolge, die sich mit dieser Technik erzielen lassen, sind zumindest dann erstaunlich und bemerkenswert, wenn wir sie mit dem ubiquitären Pessimismus konfrontieren, mit dem der Psychiater von heute schweren und chronischen Zwangsneurosen gegenübertritt. So verweisen L. Solyom, Garza-Perez, Ledwidge und C. Solyom (l. c.) auf das Ergebnis von 12 nachgehenden Untersuchungen, die aus 7 verschiedenen Ländern stammen und denen zufolge sich die Zwangsneurose in 50% der Fälle als therapeutisch unbeeinflußbar erwies. Die Autoren halten die Prognose der Zwangsneurose für schlechter als die Prognose jeder anderen Neurosenform, und die Verhaltenstherapie, meinen sie, habe da keinen Wandel zuwege gebracht, denn nur 46% der von Verhaltenstherapeuten publizierten Fälle seien gebessert worden. Aber auch D. Henkel, C. Schmook und R. Bastine (Praxis der Psychotherapie 17, 236, 1972) weisen unter Berufung auf erfahrene Psychoanalytiker darauf hin, „daß sich besonders schwere Zwangsneurosen trotz intensiver therapeutischer Bemühungen als unbehandelbar erweisen“, während die paradoxe Intention, die im Gegensatz zur Psychoanalyse stehe, „deutlich Möglichkeiten zu einer wesentlich kurzfristigeren Beeinflussung zwangsneurotischer Störungen erkennen läßt.“
Friedrich M. Benedikt hat in seiner Dissertation „Zur Therapie angst- und zwangsneurotischer Symptome mit Hilfe der paradoxen Intention und Dereflexion nach V. E. Frankl“ (München 1968) gezeigt, daß für die Handhabung der paradoxen Intention in schweren und chronischen Fällen ein unerhörter persönlicher Einsatz erforderlich sei. In diesem Zusammenhang möchten wir aber auch wiederholen, daß „der therapeutische Effekt der paradoxen Intention damit steht und fällt, daß der Arzt auch den Mut hat, dem Patienten ihre Handhabung vorzuspielen“ (Viktor E. Frankl, Die Psychotherapie in der Praxis, Franz Deuticke, Wien 1961), was anhand eines konkreten Falles bereits demonstriert wurde (l. c.). Die Verhaltenstherapie anerkennt ja die Bedeutung solchen Vorgehens ebenfalls, wenn sie dafür sogar einen eigenen Ausdruck geprägt hat und von modeling spricht.
Daß auch in Fällen von langer Dauer die paradoxe Intention helfen und dabei die Behandlung von kurzer Dauer sein kann, soll mit folgender Kasuistik belegt werden.
Ralph G. Victor und Carolyn M. Krug („Paradoxical Intention in the Treatment of Compulsive Gambling“, American Journal of Psychotherapy 21, 808, 1967) vom Department of Psychiatry an der University of Washington wandten diese Technik im Falle eines Mannes an, der seit seinem 14. Lebensjahr ein ausgesprochener Spieler war. Und zwar wiesen sie ihn an, täglich 3 Stunden lang zu spielen, obzwar er dabei so verlor, daß ihm nach 3 Wochen das Geld ausging. Und was taten die Therapeuten? Sie empfahlen ihm kaltblütig, er solle doch seine Uhr verkaufen. So oder so: es war das erste Mal nach mehr als 20 Jahren („after 20 years and five psychiatrists“, wie es in der Publikation wörtlich heißt), daß der Patient von seiner Spielleidenschaft loskommen konnte.
In dem von Arnold A. Lazarus herausgegebenen Buch „Clinical Behavior Therapy“ (Brunner-Mazel, New York 1972) bespricht Max Jacobs folgenden Fall:
Mrs. K. hatte mindestens 15 Jahre lang an einer schweren Klaustrophobie gelitten, als sie ihn in Südafrika aufsuchte, und zwar eine Woche, bevor sie von dort nach England fliegen mußte, das ihre Heimat ist. Sie ist Opernsängerin und muß viel in der Welt herumfliegen, um ihren Engagementverpflichtungen nachzukommen. Dabei konzentrierte sich die Klaustrophobie ausgerechnet auf Flugzeuge, Aufzüge, Restaurants und – Theater.
„Frankl’s technique of paradoxical intention was then brought in“, heißt es weiter, und tatsächlich wies Jacobs die Patientin an, die ihre Phobie auslösenden Situationen aufzusuchen und sich zu wünschen, was sie immer so gefürchtet hatte, nämlich zu ersticken – auf der Stelle will ich ersticken, mußte sie sich sagen, los – „let it do its damndest“. Dazu kam noch, daß die Patientin in „progressive relaxation“ und „desensitization“ instruiert wurde. 2 Tage später stellte sich heraus, daß sie bereits imstande war, ohne weiteres ein Restaurant aufzusuchen, im Aufzug und sogar in einem Autobus zu fahren. 4 Tage später konnte sie ohne Angst ein Kino besuchen und sah ihrem Rückflug nach England ohne Erwartungsangst entgegen. Aus London berichtete sie dann, daß sie sogar imstande war, erstmalig nach vielen Jahren wieder in der Untergrundbahn zu fahren. 15 Monate nach der so kurzen Behandlung ergab sich, daß die Patientin beschwerdefrei geblieben war.
Jacobs beschreibt anschließend einen Fall, in dem es sich nicht um eine Angst-, sondern um eine Zwangsneurose handelte.
Mr. T. hatte 12 Jahre lang an seiner Neurose gelitten und ohne Erfolg sowohl eine Psychoanalyse als auch eine Elektroschockbehandlung über sich ergehen lassen. Hauptsächlich fürchtete er zu ersticken, und zwar beim Essen, beim Trinken oder beim Überqueren einer Straße. Jacobs wies ihn nun an, genau das zu tun, was er immer so gefürchtet hatte: „Using the technique of paradoxical intention, he was given a glass of water to drink and told to try as hard as possible to make himself choke“ – im Sinne der paradoxen Intention reichte Jacobs dem Patienten ein Glas Wasser und forderte ihn auf, alles daranzusetzen, um zu ersticken. „He was instructed to try to choke at least 3 times a day“ – er sollte sich vornehmen, mindestens dreimal täglich zu ersticken. Daneben wurde Entspannung geübt, und während der 12. Sitzung konnte der Patient berichten, daß er komplett beschwerdefrei geworden war.
Immer wieder wird gefragt, unter welchen Bedingungen und Voraussetzungen eine Ausbildung in der logotherapeutischen Methode möglich sei. Gerade die Technik der paradoxen Intention bestätigt jedoch, daß es mitunter durchaus genügt, sich mit ihr auf Grund der vorliegenden Literatur vertraut zu machen. Jedenfalls gehören zu jenen Psychiatern und Psychologen, die mit der paradoxen Intention am erfolgreichsten und verständnisvollsten umgehen, auch solche, die kein einziges Mal mit uns Kontakt aufgenommen hatten. Wie sie die paradoxe Intention nur von unseren Publikationen her kennen, so wissen wir von ihren Erfolgen und Erfahrungen nur von ihren Publikationen her. Es ist aber auch interessant festzustellen, wie die diversen Autoren die paradoxe Intention modifizieren und mit anderen Verfahren kombinieren. Diese Feststellung bekräftigt nur unsere Überzeugung, daß die Psychotherapie, also nicht nur die Logotherapie, angewiesen ist auf die ständige Bereitschaft zur Improvisation. Wo die Möglichkeit gegeben ist, die Ausbildung in Form klinischer Demonstrationen zu bewerkstelligen, ist es nicht zuletzt dieses Improvisieren, was gelehrt werden muß – und auch gelernt werden kann.
Es ist erstaunlich, wie häufig auch Laien die paradoxe Intention mit Erfolg auf sich selbst anwenden.
Vor uns liegt der Brief einer 14 Jahre lang an Platzangst Leidenden, die 3 Jahre lang ohne Erfolg in orthodox-psychoanalytischer Behandlung gestanden war. 2 Jahre lang wurde sie von einem Hypnotiseur behandelt, woraufhin sich ihre Platzangst ein wenig verbesserte. Für die Dauer von 6 Wochen mußte sie sogar interniert werden. Nichts half wirklich. Immerhin schreibt die Kranke: „Nothing has really changed in 14 years. Every day of those years was hell.“ Dann war es wieder einmal so weit, daß sie auf der Straße umkehren wollte. So arg überkam sie die Platzangst. Da fiel ihr ein, was sie in meinem Buch „Man’s Search for Meaning“ gelesen hatte, und sie sagte sich: „Jetzt werd’ ich einmal all den Leuten rings um mich hier auf der Straße zeigen, wie ausgezeichnet ich das alles kann: in Panik geraten und kollabieren.“ Und auf einmal war sie ruhig. Sie setzte ihren Weg zum Supermarkt fort und besorgte ihre Einkäufe. Als es aber dann zum Zahlen kam, geriet sie in Schweiß und begann zu zittern. Da sagte sie sich: „Dem Kassier da werd’ ich jetzt einmal wirklich zeigen, was ich zusammenschwitzen kann. Der wird Augen machen.“ Erst auf dem Rückweg bemerkte sie, wie ruhig sie geworden war. Und so ging es weiter. Nach wenigen Wochen war sie imstande, mit Hilfe der paradoxen Intention die Platzangst so weit zu beherrschen, daß sie manchmal nicht glauben konnte, daß sie jemals krank gewesen war. „I have tried many methods, but none gave me the quick relief your method did. I believe in paradoxical intention, because I have tried it on my own with just a book.“
Der Pikanterie halber sei noch erwähnt, daß die – nunmehr gesundete – Kranke den Ehrgeiz gehabt hatte, ihr aus der Lektüre eines einzigen Buches gewonnenes Wissen um die paradoxe Intention zu komplettieren. Schließlich hatte sie in der „Chicago Tribune“ sogar eine Annonce aufgegeben, die sie eine Woche lang erscheinen ließ. Der Zeitungsausschnitt lag ihrem Brief bei. Die Annonce lautete folgendermaßen: „Would like to hear from anyone having knowledge of or treated by paradoxical intention for agoraphobia.“ Aber niemand meldete sich auf die Annonce hin.
Daß der Laie die paradoxe Intention überhaupt und noch dazu auf sich selbst anwenden kann, wird verständlich, wenn wir bedenken, daß sie auf coping mechanisms zurückgreift, die – wie ja auch die von uns bereits zitierten Beobachtungen von Hand beweisen – im Menschen bereitliegen. Und so ist denn auch ein Fall wie der folgende zu verstehen.
Ruven A. K. aus Israel, der an der U. S. International University studiert, wurde im Alter von 18 Jahren zum Militärdienst eingezogen. „I was looking forward to serving in the army. I found meaning in my country’s struggle for survival. Therefore, I decided to serve in the best way I could. I volunteered to the top troops in the army, the paratroopers. I was exposed to situations where my life was in danger. For example jumping out of the plane for the first time. I experienced fear and was literally shaking and trying to hide this fact made me shake more intensively. Then I decided to let my fear show and shake as much as I can. And after a while the shaking and trembling stopped. Unintentionally I was using paradoxical intention and surprisingly enough it worked.“
Aber die paradoxe Intention wird nicht nur von einzelnen Individuen ad usum proprium erfunden. Das ihr zugrunde liegende Prinzip wurde auch schon von der vorwissenschaftlichen Psychiatrie entdeckt. J. M. Ochs hielt in der Pennsylvania Sociological Society an der Villanova University einen Vortrag („Logotherapy and Religious Ethnopsychiatric Therapy“, 1968), in dem er die Ansicht vertrat, die Ethnopsychiatrie wende Prinzipien an, die später von der Logotherapie systematisiert worden seien. Im besonderen sei die Volksmedizin der Ifaluk ausgesprochen logotherapeutisch. „The Shaman of Mexican-American folk psychiatry, the curandero, is a logotherapist.“ Ochs verweist auch auf Wallace und Vogelson, denen zufolge die Volksmedizin auch im allgemeinen Prinzipien zur Anwendung bringe, die auch in der modernen Psychiatrie eine Rolle spielen. „It appears that logotherapy is one nexus between the two systems.“
Solche Hypothesen werden plausibel, wenn wir zwei Berichte wie die folgenden miteinander vergleichen.
Der erste handelt von einem 24 Jahre alten Schizophrenen, der an akustischen Halluzinationen litt. Er hörte Stimmen, die ihn bedrohten und verspotteten. Unser Gewährsmann hatte mit ihm im Rahmen eines Spitalsaufenthalts zu tun. „Der Patient verließ mitten in der Nacht sein Zimmer, um sich darüber zu beklagen, daß ihn die Stimmen nicht schlafen lassen. Es sei ihm empfohlen worden, sie zu ignorieren, aber das sei eben unmöglich. Es entspann sich nun folgender Dialog. Arzt: Wie wär’s, wenn Sie’s einmal auf eine andere Tour versuchten? Patient: Wie meinen Sie das? Arzt: Legen Sie sich jetzt einmal hin und verfolgen Sie so aufmerksam wie nur möglich, was Ihnen die Stimmen sagen – lassen Sie sich kein einziges Wort entgehen, verstehen Sie? Patient: Ist das Ihr Ernst? Arzt: Selbstverständlich meine ich das im Ernst. Ich seh’ auch nicht ein, warum Sie nicht zur Abwechslung einmal diese Scheiß-Stimmen (,these God damn things‘) genüßlich auskosten sollen? Patient: Ich hab doch gedacht ... Arzt: Jetzt versuchen Sie’s einmal – dann reden wir weiter. – 45 Minuten später war er eingeschlafen. Am Morgen war er begeistert – so sehr hatten ihn die Stimmen für den Rest der Nacht in Ruhe gelassen.“
Und nun das Gegenstück. Jack Huber (Through an Eastern Window, Bantam Books, New York 1968) besuchte einmal eine von Zen-Psychiatern geführte Klinik. Das Motto, das die Arbeit dieser Psychiater beherrscht, lautet: „Emphasis on living with the suffering rather than complaining about it, analyzing, or trying to avoid it.“
Da wurde nun eines Tages eine buddhistische Nonne eingeliefert, die sich in einem schweren Verwirrtheitszustand befand. Sie war ängstlich erregt, denn sie glaubte, Schlangen kriechen auf ihr herum. Europäische Ärzte, Psychiater und Psychologen hatten den Fall bereits aufgegeben, als eben der Zen-Psychiater beigezogen wurde. „Was ist los“, fragte er. „Ich fürchte mich so vor den Schlangen – überall sind da Schlangen um mich herum.“ Der Zen-Psychiater überlegte eine Weile, und dann sagte er: „Ich muß jetzt leider wieder gehen, aber in einer Woche komme ich wieder. Während dieser Woche möchte ich nun, daß Sie die Schlangen ganz genau beobachten – wenn ich Sie wieder besuche, müssen Sie nämlich ganz genau jede einzelne Bewegung beschreiben.“ Eine Woche später war die Nonne längst wieder normal und versah ihren Dienst. „Nun, wie geht’s“, fragte der Zen-Psychiater. „Ich hab die Schlangen so aufmerksam wie nur möglich beobachtet, aber das ging nicht lange, denn je mehr ich es tat, desto mehr machten sie sich aus dem Staube.“
Bliebe noch, das dritte pathogene Reaktionsmuster zu besprechen. Während das erste für angstneurotische und das zweite für zwangsneurotische Fälle charakteristisch ist, handelt es sich beim dritten pathogenen Reaktionsmuster um einen Mechanismus, dem wir bei Sexualneurosen begegnen, also in Fällen, in denen Potenz und Orgasmus gestört sind. Und zwar beobachten wir in diesen Fällen wieder, wie bei den Zwangsneurosen, daß der Patient kämpft, aber bei den Sexualneurosen kämpft er nicht gegen etwas – wir sagten doch, der Zwangsneurotiker kämpfte gegen den Zwang. Sondern der Sexualneurotiker kämpft um etwas, und er tut es insofern, als er, eben in Form von Potenz und Orgasmus, um sexuelle Lust kämpft. Aber leider: je mehr es einem um Lust geht, um so mehr vergeht sie einem auch schon. Dem direkten Zugriff entzieht sie sich nämlich. Denn Lust ist weder der wirkliche Zweck unseres Verhaltens und Handelns noch ein mögliches Ziel, vielmehr ist sie in Wirklichkeit eine Wirkung, eine Nebenwirkung, die sich von selbst einstellt, wann immer wir unsere Selbst-Transzendenz ausleben, wann immer wir uns also entweder liebend einem anderen oder aber dienend einer Sache hingeben. Sobald wir aber nicht mehr den Partner meinen, sondern nur noch Lust, steht dieser unser Wille zur Lust auch schon sich selbst im Wege. Die Selbst-Manipulation scheitert. Der Weg zu Lustgewinn und Selbstverwirklichung führt nun einmal über Selbst-Hingabe und Selbst-Vergessenheit. Wer diesen Weg für einen Umweg hält, ist versucht, eine Abkürzung zu wählen und auf die Lust wie auf ein Ziel loszusteuern. Allein, die Abkürzung erweist sich als eine Sackgasse.
Abb. 3
Und wieder können wir beobachten, wie sich der Patient in einem Teufelskreis verfängt. Der Kampf um die Lust, der Kampf um Potenz und Orgasmus, der Wille zur Lust, die forcierte, eine Hyper-Intention (Abbildung 3) der Lust bringt einen nicht nur um die Lust, sondern bringt auch eine ebenso forcierte, eine Hyper-Reflexion mit sich: man beginnt, während des Aktes sich selbst zu beobachten und auch den Partner zu belauern. Um die Spontaneität ist es dann geschehen.
Fragen wir uns, was in Fällen von Potenzstörung die Hyper-Intention ausgelöst haben mag, so läßt sich immer wieder feststellen, daß der Patient im Sexualakt eine Leistung sieht, die von ihm verlangt wird. Mit einem Wort, für ihn hat der Sexualakt einen Forderungscharakter. Bereits 1946 (Viktor E. Frankl, Ärztliche Seelsorge, Franz Deuticke, Wien) haben wir darauf hingewiesen, daß der Patient „sich zum Vollzug des Sexualakts gleichsam verpflichtet fühlt“, und zwar könne dieser „Zwang zur Sexualität ein Zwang seitens des eigenen Ich oder der Zwang seitens einer Situation sein.“ Der Zwang könne aber auch von der Partnerin ausgehen („temperamentvolle“, sexuell anspruchsvolle Partnerin). Die Bedeutung dieses dritten Moments wurde inzwischen sogar an Tieren experimentell bestätigt. So konnte Konrad Lorenz ein Kampffisch-Weibchen dazu bringen, dem Männchen bei der Paarung nicht kokett davon-, sondern energisch entgegenzuschwimmen, woraufhin der Kampffisch-Mann, wie es heißt, menschlich reagierte: es verschloß sich ihm auf reflektorischem Weg der Paarungsapparat.
Zu den aufgezählten drei Instanzen, von denen sich die Patienten zur Sexualität gedrängt fühlen, kommen nun neuerdings zwei weitere Faktoren hinzu. Zunächst einmal der Wert, den die Leistungsgesellschaft nicht zuletzt auch auf die sexuelle Leistungsfähigkeit legt. Die peer pressure, also die Abhängigkeit des einzelnen Individuums von seinesgleichen und davon, was die anderen, die Gruppe, der er angehört, für „in“ hält, – die peer pressure führt dazu, daß Potenz und Orgasmus forciert intendiert werden. Aber nicht nur die Hyper-Intention wird solcherart im kollektiven Maßstab gezüchtet, sondern auch die Hyper-Reflexion. Den Rest von Spontaneität, den die peer pressure noch unangetastet läßt, nehmen dem Menschen von heute dann die pressure groups. Wir meinen die sexuelle Vergnügungsindustrie und die Aufklärungsindustrie. Der sexuelle Konsumationszwang, auf den sie es abgesehen haben, wird durch die hidden persuaders an die Leute herangebracht, und die Massenmedien geben sich dazu her. Paradox ist nur, daß sich auch der junge Mensch von heute dazu hergibt, sich solcherart vom Industriekapital gängeln und von der Sexwelle schaukeln zu lassen, ohne zu bemerken, wer ihn da manipuliert. Wer gegen die Heuchelei auftritt, sollte es auch dort tun, wo die Pornographie, damit es zu keiner Geschäftsstörung kommt, je nachdem für Kunst oder Aufklärung ausgegeben wird.
Die Situation hat sich zuletzt insofern verschärft, als immer mehr Autoren unter den jungen Leuten eine Zunahme der Impotenz beobachten konnten und diese Zunahme auf die moderne Frauenemanzipation zurückführen. So berichtet J. M. Stewart über „impotence at Oxford“: Die jungen Frauen, heißt es da, rennen herum und fordern ihre sexuellen Rechte („demanding sexual rights“), und die jungen Männer fürchten sich davor, von Partnerinnen mit viel Erfahrung für armselige Liebhaber gehalten zu werden (Psychology and Life Newsletter I, 5, 1972). Aber auch George L. Ginsberg, William, A. Frosch und Theodore Shapiro brachten unter dem Titel „Die neue Impotenz“ eine Arbeit heraus, in der sie ausdrücklich davon sprechen, daß „der junge Mann von heute insofern gefordert ist, als sich bei der Exploration erweist, daß in diesen Fällen einer neuen Form von Impotenz die Initiative zum Geschlechtsverkehr von der weiblichen Seite kam“ (Arch. gen. Psych. 26, 218, 1972).
Der Hyper-Reflexion treten wir logotherapeutisch mit einer Dereflexion entgegen, während zur Bekämpfung der in Fällen von Impotenz so pathogenen Hyperintention eine logotherapeutische Technik zur Verfügung steht, die auf das Jahr 1947 (Viktor E. Frankl, Die Psychotherapie in der Praxis, Franz Deuticke, Wien 1947) zurückgeht. Und zwar empfehlen wir, den Patienten dazu zu bewegen, daß er den Sexualakt „nicht programmatisch sich vornimmt, sondern es bewenden läßt bei fragmentarisch bleibenden Zärtlichkeiten, etwa im Sinne eines mutuellen sexuellen Vorspiels“. Auch veranlassen wir „den Patienten, seiner Partnerin gegenüber zu erklären, wir hätten vorderhand ein strenges Koitusverbot erlassen – in Wirklichkeit soll sich der Patient über kurz oder lang nicht mehr daran halten, sondern – nunmehr entlastet vom Druck sexueller Forderungen, wie sie bis dahin seitens der Partnerin an ihn ergangen waren – in einer zunehmenden Annäherung ans Triebziel heranmachen, auf die Gefahr hin, daß er von der Partnerin – eben unter Hinweis auf das vergebliche Koitusverbot – abgewiesen würde. Je mehr er refüsiert wird, desto mehr reüssiert er auch schon.“
William S. Sahakian und Barbara Jacquelyn Sahakian („Logo-therapy as a Personality Theory“, Israel Annals of Psychiatry 10, 230, 1972) sind der Ansicht, daß die Forschungsergebnisse von W. Masters und V. Johnson unsere eigenen durchaus bestätigt haben. Tatsächlich ist ja auch die 1970 von Masters und Johnson entwickelte Behandlungsmethode der 1947 von uns publizierten und soeben skizzierten Behandlungstechnik in vielen Punkten sehr ähnlich. Im folgenden sollen aber unsere Ausführungen wieder einmal kasuistisch belegt werden.
Godfryd Kaczanowski („Logotherapy: A New Psychotherapeutic Tool“, Psychosomatics 8, 158, 1967) berichtet über ein Ehepaar, das ihn konsultierte.
Sie waren erst seit wenigen Monaten verheiratet. Der Mann erwies sich nun als impotent und war schwerst deprimiert. Sie hatten aus Liebe geheiratet, und der Mann war so glücklich, daß er nur ein Ziel kannte, und das war, auch seine Frau so glücklich wie nur möglich zu machen, und zwar auch sexuell, indem er ihr also einen möglichst intensiven Orgasmus ermöglichte. Nach wenigen Sitzungen war er aber von Kaczanowski an die Einsicht herangeführt worden, daß gerade diese Hyperintention des Orgasmus der Partnerin seine eigene Potenz verunmöglichen mußte. Auch sah er ein, daß er dann, wenn er seiner Frau „sich selbst“ gäbe, ihr mehr geben würde, als den Orgasmus, zumal sich der letztere ohnehin automatisch einstellen würde, wenn er es nicht mehr auf ihn abgesehen hätte. Nach den Regeln der Logotherapie verordnete Kaczanowski bis auf weiteres ein Koitusverbot, was den Patienten sichtlich von seiner Erwartungsangst entlastete. Wie erwartet kam es dann wenige Wochen später dazu, daß der Patient das Koitusverbot ignorierte, seine Frau sträubte sich eine Weile dagegen, gab aber dann ebenfalls auf, und seither ist das Sexualleben der beiden hundertprozentig normalisiert.
Analog ein Fall von Darrell Burnett, in dem es sich nicht um Impotenz, sondern um Frigidität handelte:
„A woman suffering from frigidity kept observing what was going on in her body during intercourse, trying to do everything according to the manuals. She was told to switch her attention to her husband. A week later she experienced an orgasm.“
Wie beim Patienten von Kaczanowski die Hyperintention durch die paradoxe Intention, nämlich durch das Koitusverbot, behoben wurde, so wurde bei der Patientin von Burnett die Hyperreflexion durch die Dereflexion beseitigt, was aber nur geschehen konnte, wenn die Patientin zur Selbst-Transzendenz zurückfand.
Ähnlich verlief folgender Fall, den ich meiner eigenen Kasuistik entnehme.
Die Patientin wandte sich wegen ihrer Frigidität an mich. In der Kindheit war sie vom eigenen Vater geschlechtlich mißbraucht worden. „Dies muß sich rächen“, so lautete die Überzeugung der Patientin. Im Banne dieser Erwartungsangst aber war sie, wann immer es zu einem intimen Beisammensein mit ihrem Partner kam, „auf der Lauer“; denn sie wollte sich endlich einmal in ihrer Weiblichkeit bewähren und bestätigen. Eben damit war jedoch ihre Aufmerksamkeit aufgeteilt zwischen dem Partner und ihr selbst. All dies mußte aber auch schon den Orgasmus vereiteln; denn in dem Maße, in dem man auf den Sexualakt achtgibt, in ebendemselben Maße ist man auch schon unfähig, sich hinzugeben. – Ich redete ihr ein, ich hätte im Augenblick keine Zeit, die Behandlung zu übernehmen, und bestellte sie in 2 Monaten wieder. Bis dahin aber möge sie sich nicht weiter um ihre Fähigkeit beziehungsweise Unfähigkeit zum Orgasmus kümmern – die würde dann im Rahmen der Behandlung ausgiebig zur Sprache kommen – , sondern nur um so mehr während des Geschlechtsverkehrs ihre Aufmerksamkeit dem Partner zuwenden. Und der weitere Verlauf gab mir recht. Was ich erwartet hatte, trat ein. Die Patientin kam nicht erst nach 2 Monaten wieder, sondern bereits nach 2 Tagen – geheilt. Die bloße Ablösung der Aufmerksamkeit von sich selbst, von ihrer eigenen Fähigkeit beziehungsweise Unfähigkeit zum Orgasmus – kurz: eine Dereflexion – und die nur um so unbefangenere Hingabe an den Partner hatten genügt, um erstmalig den Orgasmus herbeizuführen.
Mitunter kann unser „Trick“ nur ausgespielt werden, wenn weder der eine noch der andere Partner eingeweiht ist. Wie erfinderisch man in einer solchen Situation sein muß, erhellt ein folgender Bericht, den ich Myron J. Horn – einem ehemaligen Studenten von mir – verdanke:
„Ein junges Paar suchte mich wegen der Impotenz des Mannes auf. Seine Frau hatte ihm wiederholt gesagt, daß er ein miserabler Liebhaber (,a lousy lover‘) sei und sie nunmehr gedenke, sich mit anderen Männern einzulassen, um endlich einmal wirklich befriedigt zu werden. Ich forderte die beiden nun auf, eine Woche hindurch jeden Abend mindestens eine Stunde lang nackt miteinander im Bett zu verbringen und zu tun, was ihnen behagt, das Einzige, das aber unter keinen Umständen zulässig ist, sei der Koitus. Eine Woche später sah ich sie wieder. Sie hätten versucht, meinten sie, meine Anweisungen zu befolgen, aber ,leider‘ sei es dreimal zum Koitus gekommen. Ich gab mich erzürnt und bestand darauf, daß sie sich wenigstens in der kommenden Woche an meine Instruktionen halten. Es vergingen nur wenige Tage, und sie riefen mich an, um abermals zu berichten, daß sie außerstande gewesen waren, mir zu folgen, vielmehr war es jetzt sogar mehrmals täglich zum Koitus gekommen. Ein Jahr später erfuhr ich dann, daß es bei diesem Erfolg auch geblieben war.“
Es ist aber auch möglich, daß wir nicht den Patienten, sondern seine Partnerin in unseren „Trick“ einweihen müssen. So geschah es im folgenden Falle.
Die Teilnehmerin an einem Logotherapie-Seminar, das Joseph B. Fabry an der Universität von Berkeley hielt, wandte unsere Technik unter seiner Führung auf ihren eigenen Partner an, der von Beruf Psychologe war und als solcher eine Sexualberatungsstelle leitete. (Ausgebildet worden war er von Masters und Johnson.) Dieser Sexualberater erwies sich nun selber und seinerseits als potenzgestört. „Using a Frankl technique“, – so wird uns berichtet – „we decided that Susan should tell her friend that she was under doctor’s care who had given her some medication and told her not to have intercourse for a month. They were allowed to be physically close and do everything up to actual intercourse. Next week Susan reported that it had worked.“ Dann gab’s aber einen Rückfall. Fabrys Studentin Susan war aber erfinderisch genug, um diesmal allein mit der Potenzstörung ihres Partners fertig zu werden: „Since she could not have repeated the story about doctor’s orders she had told her friend that she had had seldom, if ever, reached orgasm and asked him not to have intercourse that night but to help her with her problem of orgasm.“ Sie übernahm also die Rolle einer Patientin, um ihrem Partner die Rolle des praktizierenden Sexualberaters aufzudrängen und ihn so in die Selbst-Transzendenz zu lotsen. Damit wurde aber auch schon die Dereflexion herbeigeführt und die so pathogen gewesene Hyperreflexion ausgeschaltet. „Again it worked. Since then no more problem with impotence occurred.“
Gustave Ehrentraut, ein kalifornischer Sexualberater, hatte einmal einen Patienten zu behandeln, der seit 16 Jahren an Ejaculatio praecox litt.
Zuerst wurde der Fall verhaltenstherapeutisch angegangen, aber auch nach 2 Monaten stellte sich kein Erfolg ein. „I decided to attempt Frankl’s paradoxical intention“, heißt es dann weiter. „I informed the patient that he wasn’t going to be able to change his premature ejaculation, and that he should, therefore, only attempt to satisfy himself.“ Als Ehrentraut dem Patienten dann noch empfahl, den Koitus so kurz wie nur möglich dauern zu lassen, wirkte sich die paradoxe Intention so aus, daß die Dauer des Koitus auf das Vierfache verlängert werden konnte. Zu einem Rückfall kam es seither nicht.
Ein anderer kalifornischer Sexualberater, Claude Farris, überließ mir einen Bericht, aus dem hervorgeht, daß die paradoxe Intention auch in Fällen von Vaginismus anwendbar ist.
Für die Patientin, die in einem katholischen Kloster erzogen wurde, war die Sexualität ein strenges Tabu. In Behandlung kam sie wegen heftiger Schmerzen während des Koitus. Farris wies sie nun an, die Genitalgegend nicht zu entspannen, sondern die Scheidenmuskulatur möglichst zu innervieren, so daß es ihrem Mann unmöglich wird, in die Scheide einzudringen. Eine Woche später erschienen die beiden abermals, um zu berichten, daß der Koitus das erste Mal in ihrem Eheleben schmerzfrei gewesen war. Rezidiv war keines zu verzeichnen. Das Bemerkenswerte an diesem Bericht ist aber der Einfall, die paradoxe Intention einzuschalten, um Entspannung zustande zu bringen.
In diesem Zusammenhang soll auch ein Experiment von David L. Norris, einem kalifornischen Forscher, erwähnt werden, in dessen Rahmen die Versuchsperson Steve angewiesen wurde, sich möglichst zu entspannen, was sie auch versuchte, aber ohne Erfolg, da Steve zu aktiv auf dieses Ziel lossteuerte. Norris konnte das sehr genau beobachten, da die Versuchsperson in einen Elektromyographen eingespannt war, der ständig auf 50 Mikro-Ampere ausschlug. Bis Steve von Norris erfuhr, daß er es in seinem ganzen Leben nicht dazu bringen werde, sich wirklich zu entspannen. Da platzte Steve heraus: „Soll die Entspannung der Teufel holen. Ich pfeif auf Entspannung.“ Und da schnellte auch schon der Zeiger des Elektromyographen auf 10 Mikro-Ampere hinunter. „With such speed“, berichtet Norris, „that I thought the unit had become disconnected. For the succeeding sessions Steve was successful because he was not trying to relax.“
Etwas Analoges gilt auch von den diversen Methoden, um nicht zu sagen Sekten, der Meditation, die heute nicht weniger „in“ ist als die Entspannung. So schreibt mir eine amerikanische Psychologieprofessorin: „I was recently trained in doing Transcendental Meditation but I gave up after a few weeks because I feel I meditate spontaneously on my own, but when I start meditation formally I actually stop meditating.“