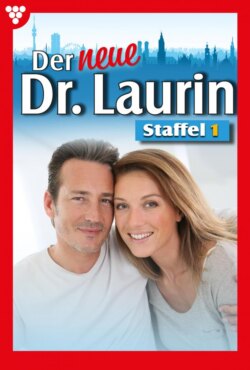Читать книгу Der neue Dr. Laurin Staffel 1 – Arztroman - Viola Maybach - Страница 6
ОглавлениеDr. Leon Laurin stand wie festgewachsen auf einer belebten Straße in der Münchener Innenstadt, während er seine Frau Antonia, die vor einem Café auf der anderen Straßenseite saß, nicht aus den Augen ließ. Seit mehr als siebzehn Jahren waren sie miteinander verheiratet, hatten vier Kinder, führten, jedenfalls seiner Ansicht nach, eine glückliche Ehe. Und nun sah er sie zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit mit ihrem Jugendfreund Ingo Ewert in sehr vertrautem und angeregtem Gespräch – und auch dieses Mal, daran zweifelte er nicht, würde sie die Begegnung zu Hause ihm gegenüber nicht erwähnen.
Er war der Ansicht gewesen, die Eifersucht seiner frühen Jahre längst überwunden zu haben, nun musste er feststellen, dass er einem Irrtum erlegen war. Am liebsten hätte er Ingo Ewert – Dr. Ingo Ewert, Leiter der Kinderklinik Dr. Ewert – direkt zur Rede gestellt. Oder noch besser: ihn am Kragen gepackt und geschüttelt und Auskunft darüber verlangt, wie er dazu kam, am helllichten Tag mit seiner, Leons, Ehefrau in einem Café zu sitzen und sich allem Anschein nach gut zu unterhalten. Jetzt griff er sogar nach ihrer Hand und drückte sie! Leon hatte Mühe, an sich zu halten.
Als er die beiden vor zwei Wochen das erste Mal zusammen gesehen hatte, war er noch überzeugt gewesen, Antonia werde ihn mit den Worten empfangen: »Rate mal, wen ich heute getroffen habe!«
Aber nichts Dergleichen war geschehen, kein Wort hatte sie gesagt, sie hatte Ingo Ewert nicht einmal erwähnt. Dabei wusste er ja nur zu gut, dass Ingo früher einmal bis über beide Ohren in Antonia verliebt gewesen war. Allem Anschein nach war er es immer noch.
Er musste sie zur Rede stellen, er brauchte Gewissheit. Aber vielleicht war alles ganz harmlos, und er sah Gespenster. Dann würde sie ihn auslachen, und er stünde da wie der letzte Depp. War es also doch besser, ruhig abzuwarten, bis Antonia von sich aus auf ihn zukam, um mit ihm über Ingo zu sprechen? Aber was würde sie ihm dann sagen? ›Ich verlasse dich, Leon, es tut mir leid, aber ich habe erkannt, dass Ingo meine einzige wahre Liebe ist‹?
Seine Augen brannten. Er war ein sehr erfolgreicher Arzt und der geschätzte und geachtete Chef der Kayser-Klinik vor den Toren Münchens, die er einige Zeit nach der Hochzeit mit Antonia von seinem Schwiegervater Professor Joachim Kayser übernommen hatte. Seine Arbeit war ihm wichtig, aber alles, was er in seinem Leben erreicht hatte, zählte nichts angesichts der Aussicht, Antonia zu verlieren, seine Liebe, seinen Halt.
»Führst du Selbstgespräche?«
Er fuhr herum. »Schon fertig?«, fragte er.
»Klar, ich habe doch nur ein Pfund Kaffee gebraucht.«
Er war mit Sandra Brink, seiner Schwester, in die Innenstadt gefahren, weil er ihr helfen sollte, ein Geburtstagsgeschenk für Kyra, seine jüngste Tochter zu kaufen. Sie wurde elf. Sie hatten eine sehr schöne Smartphone-Hülle gefunden und noch ein niedliches T-Shirt mit Aufdruck, Kyra liebte solche T-Shirts. Sie war sein heimlicher Liebling, weil sie Antonia so ähnlich sah, deshalb wusste er über ihre Wünsche ziemlich gut Bescheid.
»Also, wieso führst du Selbstgespräche?«
»Das tue ich überhaupt nicht, du siehst Gespenster!«
Sandra betrachtete ihn prüfend. Da er verhindern wollte, dass sie Antonia und ihren Jugendfreund auf der anderen Straßenseite entdeckte, setzte er sich langsam in Bewegung und lotste sie aus der Gefahrenzone.
»Ich fand dich letzte Woche schon verändert, du wirkst so nervös. Habt ihr Ärger zu Hause?«
Einen kurzen Moment lang war er versucht, ihr zu erzählen, was ihm zu schaffen machte, aber dann entschied er sich doch dagegen. Sandra würde ihm raten, mit Antonia zu reden, was zweifellos vernünftig gewesen wäre, aber er wusste, er würde es nicht tun. Er würde nicht zugeben, dass er schon mehrmals nachts aufgewacht war, weil er geträumt hatte, dass Antonia ihn und die Kinder verließ …
»Ich sag’s doch: Du siehst Gespenster.« Er schaffte es, seine Stimme fest klingen zu lassen. Den skeptischen Blick seiner Schwester übersah er geflissentlich.
Sie näherten sich bereits seinem Wagen, als Sandra plötzlich stehen blieb. »Was ist denn mit der Frau los?«
Leon folgte ihrem Blick. Die junge Frau, die sich ihnen mit langsamen Schritten näherte, war unsicher auf den Beinen, sie torkelte, musste sich mehrfach an einer Hauswand abstützen. Sie war schlank, hatte feine helle Haare, die ihr bis zum Kinn reichten. Auch ihre Haut war hell. Sie trug einen kurzen Rock mit einem T-Shirt, dazu Turnschuhe.
»Denkst du, sie ist betrunken?«, fragte Sandra weiter.
»Möglich, aber ich glaube es eigentlich nicht. Warte bitte einen Moment, Sandra.« Leon eilte auf die junge Frau zu, doch bevor er sie erreichte, sackte sie in sich zusammen und schlug auf dem Gehweg auf. Er kniete neben ihr nieder, schlug ihr sanft auf die Wangen. »Hallo«, sagte er, »ich bin Arzt, bitte sagen Sie mir, ob Sie mich hören können.«
Es dauerte nur wenige Sekunden, bis ihre Lider zu flattern begannen und sie die Augen aufschlug. Ihr Blick war leer, sie schien nicht zu wissen, wo sie sich befand.
»Ich bin Dr. Laurin«, sagte Leon. »Bitte, sagen Sie mir, wie Sie heißen.«
Sie schien nachdenken zu müssen, aber dann kam ihre Antwort doch ganz klar und verständlich. »Eva Maischinger«, sagte sie. »Mir … mir ist plötzlich so übel geworden.«
»Sie müssen gründlich untersucht werden. Ist Ihnen das schon einmal passiert?«
»Ja, schon, aber da war es nicht so schlimm wie heute.«
Mittlerweile hatten sich die üblichen Neugierigen eingefunden, aber die ersten gingen bereits weiter, als klar wurde, dass es nichts Aufregendes zu sehen geben würde.
Leon sah, dass Sandra ihr Telefon in der Hand hatte und ihn fragend ansah. Er nickte und hörte, wie sie einen Krankenwagen rief. Die Kayser-Klinik war in der Nähe, er würde Eva Maischinger also dort wiedersehen, nahm er an.
»Ich glaube, ich kann jetzt aufstehen und nach Hause gehen«, sagte die junge Frau.
»Sie bleiben schön liegen. Der Krankenwagen kommt gleich und bringt Sie in meine Klinik, dort untersuchen wir Sie und finden heraus, warum Sie ohnmächtig geworden sind.«
»Nein, ich … bitte, ich möchte nicht in eine Klinik, es ist ja schon alles wieder in Ordnung!«
»Danach sieht es aber nicht aus. Sie sind bleich, Sie zittern, und eben war Ihnen noch übel.«
Sie wollte erneut widersprechen, doch das sich rasch nähernde Martinshorn des Rettungswagens ließ sie verstummen. Leon erklärte den Sanitätern die Lage und bat sie, Eva Maischinger in die Kayser-Klinik zu bringen.
Als der Rettungswagen sich entfernte, wieder mit eingeschaltetem Martinshorn, rief Leon seinen Kollegen Eckart Sternberg an, von dem er wusste, dass er Nachtdienst in der Notaufnahme hatte. »Bist du schon in der Klinik, Eckart?«
»Gerade eingetroffen, was auch gut ist, denn wir haben sehr viel zu tun.«
Leon berichtete ihm von Eva Maischinger. »Ich komme noch mal vorbei. Wenn ihr so überlastet seid, kümmere ich mich selbst um die Patientin.«
»Das wäre eine große Hilfe. Bis gleich.«
»Fahr ohne mich los, Leon«, sagte Sandra, »ich bleibe noch ein bisschen in der Stadt. Irgendwie komme ich schon nach Hause.«
Sie umarmten sich zum Abschied, zehn Minuten später parkte Leon auf dem Klinikparkplatz.
Eckart Sternberg hatte nicht übertrieben: In der Notaufnahme war viel zu tun. Eva Maischinger lag bereits in einem der Behandlungsräume. Marie Laube, die dienstälteste Schwester der Klinik und so etwas wie ihre gute Seele, hatte sich um die junge Frau gekümmert, die einen erschöpften und auch verstörten Eindruck machte.
»Sie will unbedingt nach Hause, das hat sie jetzt schon mehrfach gesagt«, raunte Marie dem Klinikchef zu. »Es kommt mir so vor, als hätte sie Angst, dass wir etwas herausfinden.«
Leon sah sie nachdenklich an. Diesen Eindruck hatte er zuvor auch schon gehabt.
»Ich untersuche sie gründlich, dann wissen wir mehr«, sagte er.
Marie nickte. »Brauchen Sie mich dabei, Chef?«
»Danke, Marie, unterstützen Sie die Kollegen, ich sehe ja, was hier los ist.«
Marie ging, und Leon wandte sich seiner Patientin zu.
»Ich will nicht untersucht werden, mir fehlt nichts«, sagte sie. »Mir war nur ein bisschen übel.«
»Nein, so einfach ist es nicht, Frau Maischinger. Sie haben gewirkt wie eine Betrunkene, sie konnten nicht einmal richtig geradeaus gehen. Das passiert nicht, wenn einem nur ein bisschen übel ist.«
Behutsam begann er mit seiner Untersuchung, wobei er bemerkte, wie angespannt sie war. Als er vorsichtig ihren Bauch abtastete, stutzte er. Ihm entging nicht, dass sie unwillkürlich den Atem anhielt.
»Ich denke, ich sollte Sie auch gynäkologisch untersuchen«, sagte er betont beiläufig. »Ich bin Gynäkologe.«
»Nein!«, sagte sie. »Das will ich nicht, und Sie können mich nicht zwingen.«
Das stimmte allerdings, dennoch war er überzeugt davon, dass er bereits wusste, was mit ihr los war.
»Dann lassen Sie mich wenigstens einen Ultraschall machen«, schlug er listig vor. »Damit wir sicher sein können, dass wir keine gefährliche Krankheit bei Ihnen übersehen.«
Sie zögerte, stimmte dann aber zu. Offenbar war ihr nicht klar, was ein Ultraschallbild zeigen würde.
»Wie alt sind Sie, Frau Maischinger?«
»Zwanzig«, sagte sie. »Gerade geworden.«
Er strich Gel auf ihren Bauch, bevor er mit der Untersuchung begann. Der Bauch war ziemlich flach, so dass er sich fragte, ob er sich nicht vielleicht doch geirrt hatte. Aber was er gleich darauf auf dem Monitor sah, war eindeutig.
»Sie sind schwanger, Frau Maischinger«, sagte er ruhig. »Und sie sind schon ziemlich weit. Beginn sechster Monat, würde ich sagen.«
»Nein«, rief sie, während sich ihr blasses Gesicht mit hektischen roten Flecken überzog, »ich bin nicht schwanger, auf keinen Fall! Sehen Sie doch meinen Bauch! Sieht so der Bauch einer Schwangeren aus?«
»Normalerweise nicht«, gab er zu. »Aber ich kann Ihr Kind sehen, hier auf dem Monitor. Und wenn Sie den Kopf wenden würden, könnten Sie es auch sehen.«
Aber sie wandte den Kopf nicht. Immer wieder stieß sie hervor, sie sei nicht schwanger, er müsse sich irren, auf gar keinen Fall erwarte sie ein Kind.
Er wischte das Gel von ihrem Bauch. »Sie sind schwanger«, wiederholte er ruhig, »ich irre mich ganz sicher nicht. Und es ist nötig, dass Sie von jetzt an regelmäßig untersucht werden, damit wir uns davon überzeugen können, dass mit dem Baby alles in Ordnung ist. Sie werden eine kleine Tochter bekommen.«
Dieses Mal blieb sie stumm. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Als er sie erneut fragte, ob er sie untersuchen dürfe, erhob sie keine Einwände mehr.
*
»Verstehen kann ich dich nicht, Antonia, wenn ich ehrlich sein soll«, sagte Ingo Ewert. »Was kann denn passieren, wenn du offen mit Leon redest? Eines Tages muss er es ja doch erfahren.«
Antonia seufzte. »Ich weiß«, erwiderte sie. »Und ich weiß noch mehr: Es wird ihm nicht gefallen. Er wird tausend Einwände erheben, und am Ende wird er es vielleicht sogar schaffen, mir die Sache wieder auszureden. Also warte ich noch, bis ich ganz sicher bin, dass ich meinen Plan nicht aufgeben werde und vor allem, dass ich dem, was ich mir vorgenommen habe, auch gewachsen bin.«
Ingo betrachtete sie kopfschüttelnd. »Was für ein Unsinn!«, sagte er. »Ich habe selten eine Ärztin getroffen, die so gut mit Kindern umgehen konnte wie du – und die so genau weiß, worauf sie achten muss. Gut, dir fehlt die Berufspraxis, aber es ist ja nicht so, dass du in den letzten achtzehn Jahren auf dem Mond gelebt hättest, wo du von den neuesten medizinischen Entwicklungen nichts mitbekommen hast. Du hast dich immer weitergebildet, und nicht zuletzt hast du vier Kinder auf die Welt gebracht und durch alle Kinderkrankheiten begleitet.«
»Das weiß ich ja alles, Ingo. Trotzdem ist es so, dass mir die Praxis fehlt, wie du ganz richtig gesagt hast. In ein paar Jahren lache ich vielleicht über meine jetzigen Bedenken, aber im Augenblick habe ich ganz einfach Angst vor meiner eigenen Courage.«
»Aber die Erfahrungen bei uns in der Klinik müssten dich doch in deinem Vorhaben bestärken! Eigentlich war es so gedacht, dass du bei uns ein Praktikum machst, aber tatsächlich arbeitest du als volle Kraft, wenn du bei uns bist.«
»Es ist sehr freundlich von dir, das zu sagen, aber ich weiß selbst, dass ich mir vieles wieder aneignen muss, was ich einfach vergessen habe. Und ich lerne nicht mehr so schnell wie früher, leider.«
»Mit welchen Einwänden von Leon rechnest du eigentlich?«
»Er ist es gewöhnt, dass ich da bin, wenn er nach Hause kommt. Wir sprechen über seine Fälle in der Klinik, er fragt mich oft um Rat, den ich ihm natürlich gern gebe. Wir sprechen auch über die Angestellten, da gibt es ja auch immer mal Probleme. Dafür werde ich weniger Zeit haben, wenn ich selbst wieder praktiziere. Auch für die Kinder werde ich weniger Zeit haben, das wird ihm überhaupt nicht gefallen. Er meint ja, dass Kyra noch sehr viel Betreuung braucht. Er wird also sagen, dass unser Familienleben leidet, weil ich plötzlich auf die Idee gekommen bin, mit Mitte vierzig noch einmal ein neues Leben anzufangen – und ob ich mich vielleicht nicht ausgelastet fühle? Er wird außerdem sagen, was ja auch stimmt, dass mir die Berufspraxis fehlt und dass er keinen Sinn darin sieht, dass ich mich jetzt, nach beinahe zwanzig Jahren erfüllten Familienlebens, an meine Anfänge erinnere und versuche, nachzuholen, was natürlich nicht nachzuholen ist.«
Ingo sagte eine Weile lang gar nichts. Er schwieg so lange, bis Antonia schließlich nervös fragte: »Was ist? Klingt das alles so wenig verständlich in deinen Ohren?«
»Überhaupt nicht, ich kann das gut nachvollziehen. Ich wundere mich nur, wie genau du zu wissen meinst, was dein Mann sagen wird.«
»Ich kenne Leon ziemlich gut, und ich liebe ihn sehr. Außerdem ist er ein großartiger Arzt, dafür bewundere ich ihn. Aber ich finde, nun bin ich an der Reihe, meinen beruflichen Träumen zu folgen, und das wird bei ihm erst einmal auf Unverständnis stoßen, weil eine Veränderung unserer Lebensumstände nämlich mit Unbequemlichkeiten für ihn verbunden sein wird. Damals, als wir geheiratet haben, gab es gar keine Diskussion, dass ich meinen Beruf würde aufgeben müssen, damit ich mich um die Kinder kümmern kann. Mittlerweile hat sich aber die Welt ein bisschen weiter gedreht.«
»Die Kinder können jedenfalls kein Argument mehr sein«, stellte Ingo fest.
»Ach, Ingo«, seufzte Antonia, »alles wird ein Argument sein. Ich weiß schon, warum ich so lange zögere, mit ihm zu reden. Solange ich selbst nicht zu hundert Prozent davon überzeugt bin, dass ich wieder als Kinderärztin arbeiten kann – und zwar so, dass ich meinen eigenen Ansprüchen genüge – sage ich kein Wort, sonst knicke ich bei der ersten Diskussion ein. Ich kenne mich schließlich.«
»Die selbstbewusste Antonia, wer hätte das gedacht?« Ingo lächelte voller Sympathie. »Früher dachte ich immer, du weißt, was du willst, und du lässt dich von niemandem aufhalten. Allein, wie du gegen den Willen deines Vaters deine eigene Praxis aufgemacht hast, als ganz junge Frau … Ich habe dich so dafür bewundert!«
»Ohne die finanzielle Unterstützung meines Onkels wäre das nichts geworden«, erwiderte sie nachdenklich. »Aber du hast Recht: Früher habe ich mich eher nicht beirren lassen. Jetzt denke ich länger über die Konsequenzen meines Handelns nach. Denn ich will natürlich nicht, dass meine Familie darunter leidet, dass ich mich selbst verwirklichen kann, wie man das heute nennt.«
»Denkst du denn, die Kinder würden leiden?«
»Die Zwillinge bestimmt nicht, die würden sich über etwas mehr Freiheit eher freuen. Kevin auch nicht, solange sichergestellt ist, dass ich nicht irgendwie verschwinde. Kyra … ja, die würde es wahrscheinlich vermissen, dass ich nicht jederzeit verfügbar bin, aber sie würde sich schnell daran gewöhnen. Sie ist zwar unsere Kleine, und ein bisschen verwöhnt ist sie deshalb auch, aber sie streckt die Fühler bereits aus und beginnt, sich die Welt zu erobern. Insofern: Nein, sie würden nicht leiden, denke ich. Ein bisschen maulen würden sie, weil sie hier und da selbst mit anpacken müssten, weil Mama nicht mehr so viel Zeit hat, aber leiden würden sie nicht.«
»Und meinst du nicht, Leon wäre nach dem ersten Schock stolz auf dich?«
»Vielleicht, ja.« Plötzlich lachte Antonia und sah in diesem Moment beinahe wieder so aus wie die junge Frau, in die Ingo seinerzeit verliebt gewesen war. »Ich bin einfach ein Feigling, Ingo, so ist das.«
»Du und feige? Nie im Leben!« Ingo bat die Kellnerin um die Rechnung.
»Aber bezahlen tue ich dieses Mal«, erklärte Antonia. »Und dann sollte ich mich schleunigst auf den Heimweg machen.«
»Damit der gestrenge Gatte nicht etwa fragt, wo du so lange gewesen bist?«
Sie errötete verlegen. »Na ja, ich lüge einfach nicht gern, und ich kann es auch nicht besonders gut. Dabei habe ich in letzter Zeit schon mehrmals schwindeln müssen. Das ist übrigens der Hauptgrund, weshalb ich bald mit Leon reden werde. Ich hasse Heimlichkeiten!«
Sie verließen das Café, zum Abschied umarmten sie sich freundschaftlich.
*
»Im sechsten Monat?«, fragte Eckart Sternberg verblüfft. »Ich habe sie doch gesehen, als sie eingeliefert wurde – von einer Schwangerschaft ist mir nichts aufgefallen.«
»Mir auch nicht. Sie wollte sich zuerst ja auch nicht untersuchen lassen, aber das Ultraschallbild war eindeutig, danach hat sie dann einer gynäkologischen Untersuchung zugestimmt.«
Leon Laurin hatte seinen ersten Facharzt als Gynäkologe gemacht und sich später auch noch zum Chirurgen ausbilden lassen – es waren die beiden Fachrichtungen, die ihn von Anfang an am meisten fasziniert hatten. Heute war er froh darüber, sich diesen Anstrengungen unterzogen zu haben, denn nach wie vor war er auf beiden Gebieten tätig, und nach wie vor interessierten sie ihn beide.
»Sie hat zuerst hartnäckig behauptet, auf keinen Fall schwanger zu sein. Aber ich hatte sofort den Eindruck, dass sie eigentlich von ihrer Schwangerschaft wusste, sie allerdings nicht wahrhaben wollte.«
»Und jetzt? Was sagt sie jetzt?«
»Nichts mehr. Sie leugnet die Schwangerschaft nicht mehr, aber sie steht auch nicht dazu.«
»Können wir sie wieder entlassen?«
»Nein, ich will zuerst wissen, warum sie zusammengebrochen ist. Mir kommt das Baby etwas klein vor, was damit zusammenhängen kann, dass Frau Maischinger die ganze Zeit so getan hat, als wäre sie nicht schwanger.«
»Hat sie geraucht, Alkohol getrunken?«
»Auf diese Fragen hat sie mir bislang leider nicht geantwortet. Wenn du mich fragst: wahrscheinlich beides.«
»Das verheißt nichts Gutes für das Kind«, seufzte Eckart. »Gut, dann weiß ich Bescheid. Behalten wir sie zuerst in der Notaufnahme?«
»In der Gynäkologie haben wir kein freies Bett, ich habe schon nachgefragt. Also behalten wir sie hier, und morgen sehen wir weiter.«
Eckart Sternberg nickte. »Ich sehe ab und zu nach ihr, wenn wir heute Nacht nicht mit Patienten überschwemmt werden.«
»Und ich fahre nach Hause.«
»Grüß Antonia und die Kinder von mir.«
»Wird gemacht«, erwiderte Leon.
Antonia … Eva Maischinger hatte ihn von seinen Grübeleien abgelenkt, jetzt kehrten die unerwünschten Gedanken an die Heimlichkeiten seiner Frau zurück.
*
»Mama, sag ihr, sie soll gefälligst von meinem Kleiderschrank wegbleiben!«, fauchte Kaja. »Sie bringt immer alles durcheinander, und hinterher gibt sie mir meine Sachen nicht zurück.«
»Tue ich wohl!«, rief Kyra aufgebracht. »Ich gebe immer alles zurück! Es ist ungerecht, dass du immer neue Sachen kriegst, und ich muss deine alten auftragen. Ich hasse es, die Jüngste zu sein!«
Mit funkelnden Augen stand sie da, aber Antonia erkannte die Zeichen: Wenn sie nicht eingriff, würde die Szene in Tränen enden. Schon schwankte Kyras Stimme bedenklich, schon zitterte ihre Unterlippe. Ihre Jüngste hatte es oft schwer, sich gegen die drei älteren Geschwister durchzusetzen, bei ihr flossen schnell Tränen, so sehr sie sich auch bemühte, sie zu unterdrücken.
»Du hast bald Geburtstag, Mäuschen«, sagte sie, »es könnte schon sein, dass du da ein paar neue Sachen ganz für dich allein bekommst, meinst du nicht? Und es stimmt sowieso nicht, dass du nur alte Sachen deiner Schwester auftragen musst. Erst vor zwei Wochen haben wir dir einen schönen neuen Rock gekauft, und …«
Es half nichts, Kyra weinte bereits. »Aber er ist nicht so schön wie der, den Kaja bekommen hat, und wir haben ihn im Ausverkauf gekauft, weil ihn vorher keiner haben wollte!«
»Jetzt heult sie schon wieder, damit sie ihren Willen kriegt!« Kaja, mit ihren sechzehn Jahren, fühlte sich ihrer fünf Jahre jüngeren Schwester meilenweit überlegen und ließ sie das auch gerne spüren.
Antonia unterdrückte einen Seufzer. Die beiden Mädchen hatten sich früher so gut verstanden, aber seit einem halben Jahr stritten sie dauernd, was das Familienleben nicht eben wenig belastete. Ein weiteres Argument dagegen, dass ich eine Praxis aufmache, dachte sie niedergeschlagen. Leon wird sagen, dass das noch schlimmer wird, wenn die Kinder mehr sich selbst überlassen sind, ohne Mutter, die schlichtend eingreifen kann. Und ganz Unrecht hätte er damit ja auch nicht.
»Ich heule überhaupt nicht!«, schrie Kyra aufgebracht. »Immer sagst du das, dabei hast du doch früher dauernd geheult, daran kann ich mich noch gut erinnern!«
Oh ja, sie war noch nicht ganz elf, aber sie lernte allmählich, die Krallen auszufahren.
Sie hörte, wie die Haustür aufgeschlossen wurde und atmete erleichtert auf. Leon kam ihr wie gerufen. Allein die Unterbrechung würde dem Streit der Mädchen schon einiges von seinem Schwung nehmen.
Genau so war es. Kyra beschwerte sich auch bei ihrem Vater noch einmal bitterlich über die ungerechte Behandlung, die ihr in ihren Augen zuteil wurde, und Kaja stand ihr in nichts nach, aber danach verpuffte der Streit einfach, weil Leon erstaunt fragte: »Und deshalb veranstaltet ihr so ein Geschrei? Wegen ein paar Kleidungsstücken? Kommt schon, das kann doch nicht euer Ernst sein!«
Kaja begehrte noch einmal auf, sie habe ein Recht auf ihre eigenen Sachen, sie ginge schließlich auch nicht an den Kleiderschrank ihrer Mutter, um sich dort zu bedienen, aber das war’s dann auch schon mehr oder weniger. Sie verschwand zwar türenknallend in ihrem Zimmer, aber mehr passierte nicht.
Leon begrüßte seine Frau mit einem Kuss, den sie als ziemlich flüchtig empfand. Er sah müde aus, und sofort ergriff sie wieder das schlechte Gewissen, weil das, was sie plante, schließlich bedeutete, dass sie in Zukunft weniger für ihn da sein würde. Aber sie schob diesen Gedanken energisch beiseite. Ich bin jetzt auch mal an der Reihe, dachte sie.
Beim Abendessen waren die beiden Mädchen wieder halbwegs friedlich. Kyra erzählte, wen sie zu ihrem Geburtstag eingeladen hatte – es schienen jeden Tag mehr Kinder zu werden. Antonia graute jetzt schon davor. Kindergeburtstage waren von Jahr zu Jahr anstrengender geworden, weil die Kinder immer höhere Ansprüche zu entwickeln schienen. Mit einem bisschen Kuchenbacken und ein paar einfachen Spielen war es längst nicht mehr getan.
Leon, der ihr bis eben ziemlich angespannt vorgekommen war, grinste plötzlich über das ganze Gesicht. »Ihr wolltet doch in dieses Musical gehen, oder?«, fragte er. »Ich habe ja frei an deinem Geburtstag, ich könnte euch begleiten.«
Kyra blieb der Mund offen stehen. »Aber dafür kriegen wir keine Karten«, sagte sie. »Das ist doch längst ausverkauft, Papa!«
»Na ja, als ich hörte, dass das dein Wunsch ist, habe ich mich natürlich gleich auf den Weg gemacht und Karten gekauft. Aber du musst allmählich aufhören, immer noch mehr Kinder einzuladen, sonst reichen die Karten nicht, Mäuschen.« Mit einer lässigen Gebärde warf er ein kleines Bündel Karten auf den Tisch.
Kyra sprang mit einem spitzen Schrei auf und stürzte sich auf ihren Vater. Er wurde mit Küssen überschüttet, danach tanzte die Kleine ausgelassen um den Tisch herum.
Kaja beobachtete sie mit leicht säuerlicher Miene. »Als ich mir mal Zirkuskarten gewünscht habe …«, begann sie, verstummte aber, als sie dem bittenden Blick ihrer Mutter begegnete.
Kajas Zwillingsbruder Konstantin hingegen freute sich uneingeschränkt für seine jüngste Schwester, und auch Kevin ließ nicht erkennen, dass er ihr den Musicalbesuch neidete.
Antonia schenkte ihrem Mann ein dankbares Lächeln. Mit keinem Wort hatte er die Karten erwähnt, dabei hatte sie ihm erst vor zwei Tagen von dem bevorstehenden Stress mit Kyra und ihren Gästen vorgejammert.
Er erwiderte ihr Lächeln, aber sie merkte dennoch, dass er nicht so heiter war, wie er gern gewirkt hätte. Etwas schien ihm zu schaffen zu machen. Sie würde ihn später, im Bett, danach fragen.
Aber dazu kam es nicht mehr, denn er legte sich vor ihr hin, weil er so müde war – und als sie dann endlich auch das Schlafzimmer betrat, war er bereits eingeschlafen. Sie legte sich neben ihn, strich ihm zart mit einer Hand über die Wange. »Ach, Leon«, sagte sie leise und wünschte wieder einmal, sie hätte das entscheidende Gespräch mit ihm bereits hinter sich.
Er öffnete die Augen, sah sie an und murmelte etwas Unverständliches. Im nächsten Moment drehte er sich um, gab einen leisen Schnaufer von sich und schlief weiter.
*
Marco Friedrich bestellte noch ein Bier. Er wusste, dass er zu viel trank, seit Eva sich von ihm getrennt hatte, aber er konnte nicht anders. Ohne Alkohol hielt er es überhaupt nicht mehr aus. Wenn er nüchtern war, überfiel ihn ein solcher Schmerz, dass er am liebsten wie ein Wolf den Mond angeheult hätte. Sie waren glücklich gewesen, Eva und er, und dann, von einem Tag auf den anderen, hatte sie Schluss mit ihm gemacht. »Ich liebe dich nicht mehr«, hatte sie gesagt, und das war das Ende gewesen. Zack, Schluss.
Eva machte eine Ausbildung zur Erzieherin, er selbst wollte Schreiner werden, demnächst würde er seine Gesellenprüfung ablegen. Er hatte nach der mittleren Reife eine gute Lehrstelle gefunden, aber sie würden ihn bald hinauswerfen, wenn er so weitermachte, das wusste er. Der Meister hatte ihn schon mal beiseite genommen und gefragt, was eigentlich mit ihm los sei, er sei ja ganz verändert. Natürlich hatte er nichts gesagt. Mit seinem Ausbilder konnte man nicht über Liebeskummer reden, das war unmöglich.
Überall sah er Eva. Wenn er auf der Straße eine schlanke blonde junge Frau von hinten sah, der die Haare bis zum Kinn reichten, war er überzeugt, das müsse Eva sein. Hörte er ein helles Frauenlachen, erinnerte ihn das an Evas Lachen. Sah er lange schlanke Beine unter einem kurzen Rock, mit Füßen, die in Turnschuhen steckten, konnte das nur Eva sein. Er träumte von ihr, und nicht selten schreckte er mitten in der Nacht auf, weil er überzeugt war, dass sie neben ihm lag und seinen Namen gesagt hatte.
Nein, nüchtern war das alles nicht zu ertragen. Eva war die Richtige für ihn, das war ihm vom ersten Augenblick an klar gewesen. Seine Freunde hatten sich darüber lustig gemacht. »Wieso willst du dich jetzt schon festlegen? Du hast doch überhaupt noch keine Erfahrungen mit Frauen!«
Sein Vater sagte das im Übrigen auch. Nur seine Mutter, die hatte Eva gleich gemocht und ihm das auch gesagt. Aber nun war Eva weg. Einmal hatte er sie noch abholen wollen aus der Kita, damit sie ihm erklärte, warum sie so plötzlich Schluss gemacht hatte, aber sie war angeblich krank gewesen. Später hatte er sie dann gesehen, wie sie die Kita durch einen Nebenausgang verlassen hatte.
So weit war es mit ihnen gekommen: Sie ließ sich verleugnen, damit sie ihm nicht begegnen musste! Wenn er daran dachte, wie sie sich ängstlich umgesehen und dann ganz eilig aus dem Gebäude gelaufen war, wurde der Schmerz unerträglich. Dabei hatten sie sich ewige Liebe geschworen, und er war so dumm gewesen, daran auch noch zu glauben.
Jemand schob sich auf den Barhocker neben ihm. Wie üblich hatte er sich an den Tresen gesetzt, bloß keinen Umstand beim Trinken machen! Je schneller sich sein Hirn vernebelte, desto besser.
»Mir auch ein Bier«, hörte Marco. Ohne den Kopf zu wenden, wusste er, wer sich neben ihn gesetzt hatte: Tom Fröbel. Der hatte ihm gerade noch gefehlt! Tom war auch mal in Eva verliebt gewesen, aber Eva hatte ihn abblitzen lassen, sie mochte Tom nicht. Marco mochte ihn auch nicht. Tom war ein Aufschneider, außerdem war er gewalttätig. Mit solchen Leuten hatte er nicht gern zu tun.
»Also hat sie dich jetzt auch sitzen lassen«, sagte Tom.
Marco biss die Zähne zusammen. Bloß nicht provozieren lassen, dachte er. Er hielt es für das Beste, überhaupt nicht zu antworten.
»Bist du taub?«, fragte Tom.
»Keine Lust auf Unterhaltung«, erwiderte Marco.
Aber natürlich ließ Tom nicht locker. »Eva ist eine Schlampe«, sagte er. »Das war sie schon immer. Erst macht sie dich heiß, dann zeigt sie dir die kalte Schulter. Verdammte Weiber.«
Marco merkte, dass er unwillkürlich die Fäuste ballte, aber natürlich wusste er, dass Tom es nur darauf anlegte, ihn aus der Reserve zu locken. Tom prügelte sich gern, dafür war er bekannt. Er bekam zu Hause Prügel von seinem Alten, und den Frust darüber musste er dann woanders loswerden.
»Hör auf, über Eva zu reden«, presste er zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor.
»Ich kann reden, über wen ich will. Und über Eva schon sowieso. Andere reden auch über sie, und sie sagen genau das Gleiche wie ich.«
»Gut, dann geh zu den anderen und rede mit denen über sie, aber nicht mit mir. Lass mich einfach in Ruhe, in Ordnung?«
»Ich kann sitzen und trinken, wo ich will. Und ich kann auch sagen, was ich will. Du hast mir überhaupt nichts zu befehlen.«
Marco legte einen Geldschein auf den Tresen und winkte dem Mann am Zapfhahn. Wenn Tom nicht ging, würde eben er selbst gehen.
Er bekam sein Wechselgeld, ließ einen Euro liegen und rutschte von seinem Barhocker. Ohne ein weiteres Wort bahnte er sich seinen Weg zur Tür. Bloß weg hier!
Aber als er draußen auf der Straße stand, war Tom wieder neben ihm. »Ich hab gehört, du weinst der Schlampe nach?« Seine Stimme war höhnisch. »Das hat sie überhaupt nicht verdient, die Eva. Je eher du sie vergisst, desto besser.«
Die klare Luft traf Marco nach dem alkoholgeschwängerten Dunst in der Kneipe wie ein Keulenschlag. Anders konnte er sich hinterher nicht erklären, wieso seine Faust nach vorn geschossen war, mitten in Toms höhnisches Gesicht hinein. Es krachte, Tom schrie auf und taumelte.
Marco drehte sich um und ging. Endlich fühlte er sich besser.
*
Um Mitternacht war es endlich ruhig in der Notaufnahme der Kayser-Klinik.
Eckart Sternberg und sein Assistent Michael Hillenberg freuten sich über dieses unerwartete Geschenk, denn bis dahin hatten sie mehr als genug zu tun gehabt: zwei Verkehrsunfälle, eine Prügelei, ein häuslicher Sturz von einer Leiter, Verbrennungen, Prellungen, ein gebrochener Arm, ein Schlaganfall, ein Herzinfarkt. Nicht eine Minute Pause hatten sie sich gönnen können – bis jetzt. Auch Schwester Marie war zufrieden, bedeutete die Ruhe doch, dass sie sich besser um die Patientinnen und Patienten kümmern konnte, die die Nacht über in der Notaufnahme bleiben würden.
Nur Robert Semmler, der junge Pfleger, der ebenfalls Dienst hatte, langweilte sich. Ihm war es lieber, wenn er zu tun hatte. Robert war wegen seines heiteren Gemüts allgemein sehr beliebt. Zum Glück war er aber auch sehr fit in medizinischen Belangen. Marie arbeitete gern mit ihm zusammen. Robert hatte immer einen Scherz auf den Lippen, das half, besonders, wenn die Arbeit hart war.
Die Ruhe war bald wieder vorüber. Kurz nach Mitternacht wurde eine hochschwangere Frau eingeliefert, die vor Schmerzen schrie und deren nervöser Ehemann so aussah, als bräche er jeden Moment zusammen. »Meine Frau erwartet Zwillinge!«, rief er. »Es ist zwei Wochen zu früh, aber sie hat schon Wehen. Wo ist Herr Dr. Laurin? Bei ihm ist meine Frau in Behandlung, Herr Dr. Laurin muss kommen!«
Eckart Sternberg versuchte, den Mann zu beruhigen, während Michael sich um die schwangere Frau kümmerte, doch die schrie weiter, und die Aufregung des Mannes nahm eher noch zu. Da gleich darauf ein schwer verletztes junges Paar eingeliefert wurde, das von einem zu schnell fahrenden Motorradfahrer angefahren worden war und die ganze Aufmerksamkeit der beiden Ärzte beanspruchte, rief Eckart seinen Chef an. Wie üblich meldete sich Leon bereits nach dem zweiten Klingeln.
»Frau Müthen hat schon Wehen?«, rief er. »Ach, du liebe Güte. Ich bin gleich da, Eckart!«
Eckart Sternberg atmete erleichtert auf. Wie oft hatte er Leon schon als ›verrückt‹ bezeichnet, weil er sich so für seine Patientinnen und Patienten aufrieb, dabei war er selbst nicht anders – und in Situationen wie dieser war er einfach nur dankbar dafür, dass der Klinikchef nicht lange zögerte, sondern sich einfach auf den Weg machte. An einem großen Krankenhaus ging es sicherlich ganz anders zu.
Keine Viertelstunde später war Leon Laurin zur Stelle. »Frau Müthen, was machen Sie für Geschichten? Ich glaube, Sie haben Ihre Zwillinge nicht im Griff. Sagen Sie denen mal, dass sie jetzt Ruhe geben sollen. Und Sie, Herr Müthen, ziehen sich jetzt bitte einen Kaffee am Automaten und machen einen kleinen Spaziergang draußen durch den Park. Geben Sie uns eine halbe Stunde!«
Eckart Sternberg bekam das nur noch am Rande mit, aber ihn wunderte nicht, dass es seinem Chef innerhalb kürzester Zeit gelang, nicht nur die Patientin zu beruhigen, sondern auch deren Ehemann. Es war ein Phänomen, das er schon öfter hatte beobachten können. Er war selbst ein ausgezeichneter Arzt, das wusste er, aber diese Fähigkeit, mit Menschen umzugehen, die Leon auszeichnete, besaß er nicht, darüber machte er sich keinerlei Illusionen: Er war viel zurückhaltender, konnte nicht so gut aus sich herausgehen. Und ihm fehlte auch Leons Lockerheit. Aber er haderte nicht damit. Die Talente waren nun einmal ungleich verteilt, er fand das in Ordnung so.
Robert Semmler kam herein. »Der Chef meint, es dauert noch bei Frau Müthen, Marie hilft ihm, deshalb kann ich mich hier nützlich machen.«
»Dann legen Sie der Patientin bitte eine Infusion mit Kochsalz an, während wir den jungen Mann für die OP vorbereiten«, bat Eckart.
Robert nickte nur und machte sich an die Arbeit.
Es war wieder ruhig in der Notaufnahme, seit Flora Müthen aufgehört hatte zu schreien.
*
Antonia war aufgestanden und hatte sich in der Küche Milch warm gemacht. Wie oft schon war sie mit Leon aus dem Schlaf gerissen worden und hatte hinterher nicht wieder einschlafen können? All die Notfälle in den vergangenen Jahren … Sie hatte das ja schon von ihrem Vater gekannt, aber es war noch einmal etwas anderes, wenn der eigene Ehemann nachts angerufen wurde, damit er in der Klinik ein Leben rettete. Oder auch mehrere.
Sie saß am Küchentisch und trank die Milch, in die sie einen Esslöffel Honig gegeben hatte, als Kevin auftauchte. Er sah nicht einmal verschlafen aus, sondern eher so, als hätte er bis jetzt heimlich unter der Bettdecke gelesen. Das machte er oft, wie sie wusste.
»Kannst du nicht schlafen?«, fragte sie.
»Doch, aber ich habe gehört, wie Papa weggefahren ist. Ein Notfall?«
»Ja, Frau Müthen, die Frau, die Zwillinge erwartet. Sie ist zu früh dran, ich hoffe, es gibt keine Probleme.«
»Du hast auch Zwillinge gekriegt.«
»Ja, allerdings. Das war ganz schön aufregend damals.«
»Ich bin froh, dass ich kein Zwilling bin.«
»Ach ja?«, fragte Antonia überrascht. So etwas hatte Kevin noch nie gesagt. »Wieso das denn?«
»Es war bestimmt schön, dass ich den ganzen Platz in deinem Bauch für mich allein hatte«, sagte er nachdenklich. »Ich meine, ich erinnere mich ja nicht daran, aber ich denke, es hat mir gefallen.«
Sie strich ihm liebevoll über die widerspenstigen Haare. Er war drei Jahre jünger als die Zwillinge. Sie fragte sich manchmal, ob sie genug Zeit für ihn gehabt hatte, als er auf die Welt gekommen war. Es war schon sehr fordernd gewesen, sich um die damals dreijährigen Zwillinge zu kümmern, sie hatten einen Großteil ihrer Kräfte für sich beansprucht. Aber Kevin schien in sich zu ruhen, er machte nicht den Eindruck, als sei er zu kurz gekommen.
»Du hast mich oft getreten«, sagte sie. »Du warst sehr lebhaft.«
»Hat das weh getan? Wenn ich dich getreten habe?«
»Nein, ich fand es schön. Es zeigte mir ja, dass du lebendig warst, dass es dir gut ging. Außerdem hatte ich immer das Gefühl, dass du mir auf diese Weise etwas mitteilen wolltest. Wenn du mal eine Zeitlang nichts von dir hast hören lassen, war ich gleich beunruhigt.«
»Wie war das denn mit Kyra? Hat sie dich auch getreten?«
»Kyra war viel ruhiger als du, daran musste ich mich erst gewöhnen.«
»Und die Zwillinge?«
»Da war auch ganz schön was los. Wahrscheinlich hast du Recht: Es war vielleicht etwas eng in meinem Bauch, und sie haben versucht, sich mehr Platz zu erkämpfen.«
»Kann ich auch Milch haben?«
»Klar, mach sie dir warm, der Topf steht noch auf dem Herd.«
Als er mit einem Becher zu ihr an den Tisch kam, schob sie ihm den Honig hin. »Du magst es ja gern süß«, sagte sie.
Eine Weile saßen sie schweigend beieinander. Antonia wartete darauf, dass Kevin ihr sagte, warum er zu ihr in die Küche gekommen war, denn alles an seinem Verhalten ließ darauf schließen, dass er etwas auf dem Herzen hatte.
Er hatte seine Milch schon fast getrunken, als er endlich hörbar die Luft ausstieß und sagte: »Mike und ich, wir haben uns gestritten. Jetzt reden wir nicht mehr miteinander.«
Mike – eigentlich Michael – Brönner war seit Jahren Kevins bester Freund. Die beiden Jungen waren unzertrennlich. Von einem Streit war bisher noch nie die Rede gewesen. Es hatte wohl schon kleinere Unstimmigkeiten gegeben, aber dass die beiden nicht miteinander redeten? Davon hatte Antonia noch nie gehört.
»Worüber habt ihr gestritten?«, fragte sie.
»Er hat blöd geredet, ich habe gesagt, er soll seine Klappe halten, da war er beleidigt. Und ich war auch beleidigt.«
»Worüber hat er blöd geredet?«
Kevin druckste eine Weile herum, bis er mit seiner Antwort herausrückte. »Über Kaja«, sagte er.
»Hat er etwas Schlechtes über sie gesagt?« Antonia konnte sich das eigentlich nicht vorstellen. Wenn sie sich recht erinnerte, war Mike, wenn er Kaja hier im Haus begegnete, eher verlegen und rot geworden. Kaja war ja auch ein sehr hübsches Mädchen, viele Jungen blickten ihr hinterher, was ihre Eltern mit durchaus gemischten Gefühlen sahen. Vor allem Leon machte sich Sorgen um sie, er hatte, wie alle liebenden Väter, Angst um seine Kinder, vor allem um seine Töchter.
»Nee, eher … er hat über ihre Figur geredet und so. Vor allem über ihre … du weißt schon. Ich habe ihm gesagt, wenn er nicht aufhört, haue ich ihm eine rein. Da hat er gesagt, dass ich ein blöder Spießer bin und hat mich stehen lassen.«
Endlich begann Antonia zu ahnen, was vorgefallen war. Pubertätsprobleme also. Klar, dreizehnjährige Jungs fantasierten natürlich von Mädchen. »Er hat wahrscheinlich gedacht, du würdest es als Kompliment auffassen, wenn er durchblicken lässt, dass er Kaja attraktiv findet«, sagte sie.
»Dann braucht er sich aber nicht so … so ordinär auszudrücken«, erwiderte Kevin mit finsterem Blick.
»Sag ihm das«, schlug Antonia vor. »Ihr seid schon so lange befreundet, es wäre schade, wenn eure Freundschaft wegen so etwas auseinander ginge. Außerdem kann ich dir sagen, dass du solche Bemerkungen wahrscheinlich noch öfter hören wirst. Ihr seid in dem Alter, wo Mädchen interessant werden. Und weil das nicht alle zugeben wollen, reden sie ein bisschen großspurig daher. Nimm das nicht so ernst. Irgendwann redest du vielleicht auch so.«
»Ist das die Pubertät?«, erkundigte sich Kevin.
»Ja. Da baut sich das Gehirn um. Deshalb machen Jugendliche in eurem Alter oft Dinge, die Erwachsene nicht verstehen können. Und weil ihr nicht alle im selben Alter in die Pubertät kommt, versteht ihr euch zwischendurch untereinander auch nicht mehr. Vielleicht interessiert sich Mike schon stark für Mädchen, du aber noch nicht. Könnte das sein?«
Kevin dachte über die Frage nach und nickte schließlich. »Das heißt, er ist schon weiter als ich, und deshalb findet er mich blöd und ich ihn? Jedenfalls manchmal?«
»So ungefähr. Es kann sein, dass ihr euch nie wieder so gut versteht wie bisher, aber möglich ist auch, dass dieses Fremdheitsgefühl wieder verschwindet. In der Pubertät ändern sich Menschen, und das tun sie ja nicht absichtlich. Versuch, das im Auge zu behalten, dann ärgerst du dich weniger.«
Kevin leerte seinen Becher und stand auf. »Danke, Mama«, sagte er ernsthaft. »Ich sollte öfter mal nachts mit dir reden, glaube ich.«
Sie stand auf und schloss ihn in die Arme. Das ließ er sich normalerweise nicht mehr so gern gefallen, doch jetzt erwiderte er die Umarmung sogar. »Schlaf gut«, sagte sie liebevoll.
»Du auch.«
Er trottete zurück in sein Zimmer, und auch Antonia beschloss, sich wieder ins Bett zu legen. Leon hatte angekündigt, dass es dauern konnte, bis er nach Hause kam.
Also hatte es wenig Sinn, auf ihn zu warten.
*
Marco wusste, er würde nicht schlafen können, wenn er jetzt nach Hause ging, also kehrte er in einer weiteren Kneipe ein. Er würde in der Schreinerei wieder völlig übermüdet sein und sich den nächsten Tadel seines Ausbilders einfangen, aber er konnte sich jetzt zu Hause nicht ins Bett legen. Er war ja noch nicht einmal angetrunken, er würde also nur an Eva denken und wieder nur das heulende Elend kriegen. Das kannte er nun schon, und dem musste er entgehen.
Er hatte gehört, dass man Liebeskummer am besten mit einer neuen Liebe verjagte – aber wie sollte er das anstellen? Ihn interessierten andere Frauen nun einmal nicht, er dachte immer nur an Eva. So war das, seit er sie kennengelernt hatte.
Jemand legte ihm von hinten eine Hand auf die Schulter. »Komm mit nach draußen«, sagte eine heisere Stimme.
Er fuhr herum. Tom, schon wieder!
»Lass mich in Ruhe, das habe ich dir eben schon gesagt! Verschwinde einfach, okay?«
»Du hast mir die Nase gebrochen, und ich soll verschwinden? Du bist wohl zu feige, mit nach draußen zu kommen, oder? Du hast mich angegriffen!«
Marco bezahlte sein Bier und folgte Tom aus der Kneipe, vor allem, weil er es hasste, Aufsehen zu erregen. Und die Leute um sie herum hatten bereits angefangen, sie zu beobachten. Er konnte ihre Augen glitzern sehen. Eine Schlägerei, in die man selbst nicht verwickelt war, war immer eine beliebte Abwechslung während einer langen Nacht, in der sonst nicht viel passierte.
»Du hast mich zuerst angegriffen, mit Worten«, sagte er. »Wenn du mich einfach in Ruhe gelassen hättest, wäre überhaupt nichts passiert.« Er hatte seinen Satz kaum beendet, als Tom auch schon zuschlug.
Doch Marco hatte den Schlag kommen sehen und konnte den Kopf noch drehen, so dass er nur an der Schulter getroffen wurde. Er kam etwas aus dem Gleichgewicht, fing sich aber schnell wieder. Zwei gute Schläge konnte er landen, einen an Toms Hals, den anderen an der Schläfe. Er hatte ein Boxtraining gemacht, seit er früher oft verprügelt worden war. Ihn hatten die größeren Jungs als leichte Beute angesehen, weil er schmal war und den Eindruck erweckte, ein kräftiger Schlag genüge, um ihn zu Boden zu schicken. Doch diese Zeiten waren vorüber. Er hatte gelernt, sich zu wehren.
»Seid ihr verrückt geworden?«, hörte er jemanden rufen. »Hört sofort auf! Wollt ihr Ärger mit den Bullen haben? Die fahren hier überall Streife und warten nur auf zwei wie euch.«
Sascha Buder! Wo kam der jetzt auf einmal her? Aber Marco war nicht böse über dessen Auftauchen. Nicht, dass sie direkt Freunde gewesen wären, aber er kannte Sascha ganz gut, und er wusste, dass Tom ihn auch kannte. Sascha war in Ordnung.
»Halt dich da raus, Sascha!«, hörte er Tom knurren.
Marco sah ihn zu einem weiteren Schlag ausholen, und plötzlich packte ihn der Zorn. Er wollte sich nicht prügeln, aber um dieser lächerlichen Schlägerei ein Ende zu bereiten, musste er Tom wohl zuerst k.o. schlagen. Er duckte sich und zielte dann direkt auf Toms Gesicht, das er auch traf. Es krachte wieder, Tom schrie auf.
»Aufhören, aufhören!«, rief Sascha Buder.
Fast zeitgleich blitzte etwas in Toms Hand auf, das Marco zu spät sah. Tom, mit seinem blutenden Gesicht, stürzte sich mit wütendem Gebrüll auf ihn, und gleich darauf verspürte er einen heftigen Schmerz in der Brust, ohne zu begreifen, was geschehen war. Schon im Fallen holte er aus und versetzte Tom noch einen heftigen Tritt zwischen die Beine, der diesen mit einem Schmerzensschrei zu Boden schickte.
Dann landete Marco auf dem Bürgersteig, und ihm wurde schwarz vor Augen.
Sascha Buder blickte sich hektisch um, dann holte er sein Handy heraus und rief einen Rettungswagen. Als dieser wenig später kam, erklärte er, die beiden Verletzten nicht näher zu kennen, er sei rein zufällig vorbeigekommen. In welches Krankenhaus man sie denn bringen werde?
Nachdem er das in Erfahrung gebracht hatte, gelang es ihm, zu verschwinden, bevor die Polizei am Ort des Geschehens eintraf. Das Messer steckte in einer Plastiktüte in seiner Tasche.
*
»Sie sind ja wach«, sagte Schwester Marie, als sie neben Eva Maischingers Bett trat. Verwundert war sie nicht darüber: Flora Müthen hatte wieder angefangen zu schreien, und die Wände in der Notaufnahme waren dünn.
»Ich kann bei dem Geschrei nicht schlafen«, erwiderte Eva. »Wieso schreit die Frau überhaupt so?«
»Sie bekommt Zwillinge, und es gibt Komplikationen. Ich weiß, eine Notaufnahme ist kein Aufenthalt in einem Kurhotel. Wir verlegen Sie morgen auf die Gynäkologie.«
»Auf keinen Fall!«, erklärte Eva. »Morgen gehe ich nach Hause. Ich hätte überhaupt nicht hier bleiben sollen, Sie reden mir hier nur Sachen ein. Aber Sie können mich nicht gegen meinen Willen festhalten.«
»Das stimmt, das können wir nicht, aber wir können an Ihre Vernunft appellieren, Frau Maischinger. Und wenn wir Ihnen sagen, dass Sie noch Ruhe brauchen, dann ist das so, glauben Sie mir.«
»Mir geht es bestens«, behauptete Eva. »Das war ein kleiner Schwächeanfall – na, und?«
»Das war kein kleiner Schwächeanfall, und das wissen Sie auch. Sie waren bislang noch bei keiner Vorsorgeuntersuchung, und es hat sich herausgestellt, dass Ihr Baby ziemlich klein ist. Wollen Sie denn nicht, dass es gesund zur Welt kommt?«
»Welches Baby?«, fragte Eva. »Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Ich bin nicht schwanger.«
Marie schwieg. Sie waren schon einmal weiter gewesen, aber offenbar hatte sich die junge Frau entschieden, zu ihrer vorherigen Haltung zurückzukehren und ihre Schwangerschaft zu leugnen.
Sie griff in ihre Tasche, holte ein Ultraschallbild heraus und legte es auf den Nachttisch der jungen Frau. »Das ist ein Bild von Ihrer kleinen Tochter«, sagte sie sanft. »Ich lasse es hier, falls Sie es sich später ansehen möchten. Es ist ein Bild, auf dem man ziemlich viel erkennen kann. Nicht alle Ultraschallbilder sind so klar.«
Nach diesen Worten ging sie leise hinaus. Als sie später noch einmal einen Blick in Eva Maischingers Zimmer warf, hielt die Patientin das Ultraschallbild in der Hand und betrachtete es mit unbewegtem Gesicht.
Marie seufzte. Warum machten sich nur manche Menschen das Leben so schwer?
*
Flora Müthens erster Zwilling, ein kleiner Junge, war bereits auf der Welt, als die Komplikationen einsetzten: Der zweite Zwilling, ein Mädchen, ließ sich Zeit, und irgendwann konnte Leon keine Herztöne mehr hören. Er entschied sich für einen Kaiserschnitt, und das rettete dem Mädchen das Leben, denn die Nabelschnur hatte sich um seinen Hals gelegt und drohte es zu ersticken. Es vergingen bange Sekunden, bis es den ersten zaghaften Schrei ausstieß, dann jedoch kannte das Glück der jungen Eltern keine Grenzen.
Leon war müde, als er wenig später mit Eckart einen Kaffee auf dem Stationsflur trank. »Das war knapp«, sagte er.
»Bei mir auch«, erwiderte Eckart. »Eine blutige Notoperation.«
»Der Motorradunfall?«
»Ja, Unfall mit Fahrerflucht, es gibt Zeugen. Hoffentlich erwischen sie den Flüchtigen.« Eckart leerte seine Tasse. »Fahr nach Hause, Leon, du hast morgen Vormittag eine OP.«
»Ich weiß, aber im Augenblick bin ich hellwach. Außerdem muss ich noch einmal nach Frau Müthen und ihrem Mann sehen. Und nach ihren Zwillingen natürlich.«
Robert Semmler erschien im Laufschritt und unterbrach ihr Gespräch. »Zwei Verletzte, Schlägerei und Messerstecherei – ob wir sie aufnehmen können? Die anderen Notfallambulanzen sind überlastet …«
»Ja, natürlich nehmen wir sie auf«, sagten Leon und Eckart wie aus einem Mund.
Fünf Minuten später wurden zwei junge Männer in die Notaufnahme gebracht, von denen einer zwar eine gebrochene Nase und Quetschungen im Genitalbereich hatte, sonst aber keine größeren Verletzungen aufwies, während der andere eine böse Stichwunde in Herznähe abbekommen hatte. Das Messer hatte das Herz nur um wenige Zentimeter verfehlt. Allerdings waren etliche Blutgefäße verletzt worden, so dass sich Leon und Eckart kurz darauf in einem Operationssaal wiederfanden, während sich Michael Hillenberg um den anderen jungen Mann kümmerte.
»Jetzt bist du wohl doch froh, dass ich noch nicht nach Hause gefahren bin, oder?«, fragte Leon eine Stunde später.
Eckart nickte. »Ich muss gestehen, dass ich Frau Müthens Zwillingen aufrichtig dankbar bin, dass sie dich hergeholt haben«, gestand er. »Für Herrn Hillenberg und mich wäre das alles doch ein bisschen viel geworden.« Ein Blick auf den Monitor zeigte ihm, dass der junge Mann stabil war. »In den Aufwachraum mit ihm«, sagte er.
Sie tranken erneut Kaffee, als zwei Polizeibeamte erschienen und sich nach den beiden Männern erkundigten, die in eine Schlägerei und Messerstecherei verwickelt gewesen waren.
»Ein Mann wurde mit einem Messer verletzt, das wir aber nicht gefunden haben«, erklärte Leon. »Der andere hat eine gebrochene Nase und Prellungen im Genitalbereich – wohl herrührend von einem kräftigen Tritt. Den Mann mit der Stichverletzung haben wir gerade operiert, er ist frühestens morgen ansprechbar.«
»Und der andere?«
»Dem haben wir ein Schmerzmittel gegeben, damit er zur Ruhe kommt. Aber morgen dürften Sie ihm ein paar Fragen stellen können.«
»Gibt es Zeugen für den Vorfall?«, erkundigte sich Eckart.
»Eben nicht«, antwortete einer der Beamten. »Wir wissen nicht einmal, wer den Notruf betätigt hat. Die Sanitäter haben ausgesagt, dass ein junger Mann vor Ort war und gesagt hat, er sei zufällig vorbeigekommen und habe angerufen, als er gesehen habe, dass beide Männer verletzt waren. Dieser junge Mann ist aber wie vom Erdboden verschluckt. In der Kneipe haben ein paar Leute zwar mitbekommen, dass die beiden Männer gestritten haben, aber keiner will sich besonders dafür interessiert haben.«
»Merkwürdige Geschichte«, sagte Eckart.
»Ja, das finden wir auch. Jedenfalls wissen wir bis jetzt nicht sicher, ob es vielleicht dieser dritte Mann war, der dem einen Opfer die Stichverletzung beigebracht hat – oder ob es der andere Verletzte war. Deshalb müssten wir möglichst bald mit den beiden sprechen.«
»Wie gesagt, morgen«, erklärte Leon. »Zurzeit sind beide nicht vernehmungsfähig.«
»Wie gefährlich war die Stichverletzung?«
»Sie hätte tödlich enden können, wenn das Messer das Herz getroffen hätte. Das wurde aber knapp verfehlt.«
»Wissen Sie die Namen der beiden?«
»Bislang nicht, aber … Schwester Marie?«
Es erwies sich, dass Marie tatsächlich wusste, wie die beiden Verletzten hießen: Marco Friedrich und Tom Fröbel, zwanzig und einundzwanzig Jahre alt. Verwandte der beiden hatte sie bislang noch nicht ausfindig machen können.
Die Polizeibeamten bedankten sich für die Auskünfte und verließen die Klinik.
Leon sah noch einmal nach Flora Müthen, die erschöpft ,aber glücklich schlief – ebenso wie ihr Mann, der neben ihrem Bett eingeschlafen war. Den Zwillingen ging es den Umständen entsprechend gut – dem kleinen Jungen etwas besser als dem Mädchen, aber die Kleine erholte sich schnell von ihrem stressigen Weg ans Licht der Welt.
Kurz darauf verabschiedete sich Leon und fuhr nach Hause. Als er sich zu Antonia ins Bett legte, waren die bohrenden Fragen mit einem Schlag wieder da: Wieso erzählte sie ihm nichts von ihren Treffen mit Ingo Ewert? Und warum traf sie sich überhaupt mit ihm?
Aber in diesem Fall trug seine Müdigkeit den Sieg davon: Schon bald verwirrten sich seine Gedanken, und er schlief ein.
*
»Der Herr Fröbel ist wach geworden und will noch etwas gegen die Schmerzen haben«, sagte Robert Semmler. »Dabei hat er schon eine ganz schöne Dosis bekommen.«
Eckart Sternberg nickte. »Ich sehe selbst mal nach ihm. Wie geht es dem anderen?«
»Herr Friedrich hat noch keinen Mucks von sich gegeben.«
»Ist wahrscheinlich auch besser so.« Eckart betrat den Raum, in dem Tom Fröbel lag. Der sah wüst aus mit seiner unförmig angeschwollenen Nase und dem sich langsam ausbreitenden Bluterguss rund um ein Auge.
»Sie haben Schmerzen, Herr Fröbel?«
»Starke«, antwortete der Patient. Er sprach undeutlich, was Eckart nicht wunderte. Auch im Kieferbereich waren Schwellungen zu sehen, auch dort würde sich in den nächsten Tagen die Haut verfärben.
»Die Polizei war hier und wollte Sie befragen, das haben wir für heute Nacht abgelehnt. Die Beamten werden morgen wiederkommen.«
»Polizei?«
»Ja. Ihr Freund Marco Friedrich hatte eine Stichverletzung, die ihn mit etwas Pech hätte umbringen können. Aber das Messer hat sein Herz zum Glück verfehlt. War das Ihr Messer?«
Eckart ließ den jungen Mann nicht aus den Augen. Dessen Blick flackerte, als er hervorstieß: »Nein!«
Er log, ganz offensichtlich, aber sich damit auseinanderzusetzen war Sache der Polizei. »Nun, das können Sie den Beamten ja dann morgen sagen«, erwiderte Eckart betont gleichmütig. Er wollte Tom Fröbel nicht spüren lassen, dass er ihm nicht glaubte. Für ihn war er ein Patient, dem er helfen musste, und das tat er. Alles andere fiel nicht in seinen Zuständigkeitsbereich.
Er stattete auch Marco Friedrich noch einen Besuch ab. Nachdenklich betrachtete er das noch ein wenig kindliche Gesicht des Patienten. Beide jungen Männer hatten Alkohol im Blut gehabt, Marco Friedrich etwas weniger als Tom Fröbel. Kannten sie sich oder waren sie sich rein zufällig über den Weg gelaufen und hatten Streit miteinander bekommen?
Er hoffte, dass die Polizei Licht in diese Angelegenheit würde bringen können.
Zum Schluss sah er noch nach Flora Müthen, die einmal kurz die Augen aufschlug und ihn anlächelte, dann aber sofort wieder einschlief. Ihr Mann bekam von seinem Besuch überhaupt nichts mit. Den Zwillingen ging es gut.
Auch in Eva Maischingers Zimmer warf er einen Blick, doch sie schlief. Immerhin war sie noch da. Marie hatte ihm erzählt, dass sie auf keinen Fall in der Klinik bleiben wollte und ihre Schwangerschaft immer noch leugnete. Ein merkwürdiger Fall war das!
Er trank die siebte oder achte Tasse Kaffee dieser Nacht und aß ein Brötchen. Mit einem bisschen Glück passierte jetzt nichts mehr, und der Rest des Nachtdienstes verlief ruhig.
*
Marco hatte das Gefühl zu schweben. Alles fühlte sich leicht an, so, als befände er sich im All, wo die Schwerkraft der Erde nicht mehr wirkte. Um ihn herum gluckste und summte es, von ferne meinte er, eine leise Stimme zu hören. Er fühlte sich wohler als seit langem, obwohl er sich nicht erklären konnte, wieso. Was war denn jetzt anders als zuvor, wo er so unglücklich gewesen war? Denn das wusste er noch ganz genau: dass er die Freude am Leben verloren hatte. Allerdings fiel ihm nicht sofort ein, wie das geschehen war.
Jetzt jedenfalls war er glücklich und schwebte durchs All.
Er versuchte, die Augen zu öffnen, doch das erwies sich als unmöglich. Es war, als wären an seinen Augenlidern schwere Gewichte befestigt. So sehr er sich auch bemühte, er konnte die Augen nicht öffnen. Schließlich gab er seine Bemühungen auf und ließ sich weiter treiben, schwerelos, befreit von allem, was ihm vorher zu schaffen gemacht hatte.
Als er das nächste Mal versuchte, die Augen zu öffnen, hatte er unerwartet Erfolg. Zunächst sah er nicht viel, nur einen ihm unbekannten Raum. Das Surren und Glucksen war noch immer zu hören. Als es ihm gelang, den Blick ein wenig nach links und rechts schweifen zu lassen, sah er, dass sich Maschinen in diesem Raum befanden, was er überhaupt nicht verstand. Wo war er hier – und vor allem: warum?
Ein Gesicht schob sich in sein Blickfeld. Es war ein ziemlich vergnügtes Männergesicht mit lustig blitzenden Augen. »Das wurde aber auch Zeit«, hörte er den Mann sagen, »ich dachte schon, Sie wachen überhaupt nicht mehr auf. Ich bin Robert. Robert Semmler, Pfleger.«
Pfleger. Was hieß das nun wieder? Marco entschloss sich, eine Frage zu stellen. »Wo bin ich?«, fragte er. Seine Stimme klang seltsam.
»Keine Erinnerung, was?«
»Nein.«
»In der Kayser-Klinik. Jemand hat Sie gestern Abend mit einem Messer schwer verletzt.«
Marco schloss die Augen wieder. Mit einem Messer? Er versuchte, sich an den vorangegangenen Abend zu erinnern, aber seine Gedanken schwammen ihm davon, alles blieb unklar und grau. Er hatte Bier getrunken, um seinen Kummer zu vergessen, das wusste er noch. Immerhin kehrte blitzartig auch die Erinnerung für den Grund seines Kummers zurück: Eva hatte ihn verlassen, sie wollte nicht mehr mit ihm zusammen sein.
Ja, und dann war Tom aufgetaucht und hatte wieder einmal hässlich über Eva geredet, das tat er offenbar besonders gern.
So weit war alles klar. Aber darüber hinaus? Was war dann passiert?
Mit aller Macht öffnete er die Augen noch einmal. »Ich war einen trinken«, sagte er. »Aber ein … Messer?«
»Ja, der Stich hat Ihr Herz verfehlt, zum Glück.«
»Aber …« Er wollte etwas einwenden, doch ihm fehlte die Kraft für weitere Worte, und das Gefühl von Schwerelosigkeit ergriff ihn wieder. Er schwebte. Seine Lider sanken herab, er schlief erneut ein.
Robert Semmler betrachtete ihn nachdenklich. Er hätte zu gern gewusst, ob der andere Patient der Messerstecher gewesen war oder ob es da noch einen Dritten gab. Diesen Mann, der angeblich den Krankenwagen gerufen hatte. Aber da sein Dienst bald endete, würde er sich wohl bis zum Abend gedulden müssen, bevor er weitere Einzelheiten erfuhr.
Er kontrollierte die Infusionen und die Geräte, dann machte er sich auf die Suche nach Dr. Sternberg, um ihm zu sagen, dass der Patient Marco Friedrich kurz bei Bewusstsein gewesen war und einen orientierten Eindruck gemacht hatte, obwohl ihm offenbar jegliche Erinnerung an das, was geschehen war, fehlte.
*
Als Eckart Sternberg sich vergewissert hatte, dass es Marco Friedrich weiterhin den Umständen entsprechend gut ging, sah er sich auf dem Stationsflur plötzlich einem jungen Mann gegenüber, der sich suchend umblickte und erleichtert lächelte, als er den Arzt erblickte.
»Kann ich Ihnen helfen?«, fragte Eckart. Krank sah der Mann nicht aus, Hilfe schien er nicht zu benötigen.
»Ich … ich habe gehört, dass zwei Bekannte von mir hier sein sollen«, antwortete der junge Mann. »Marco Friedrich und Tom Fröbel.«
Mehrere Gedanken schossen Eckart gleichzeitig durch den Kopf: zuerst, dass dieses vermutlich der Mann war, der einen Krankenwagen gerufen hatte; dann, dass er ihn in die Flucht schlagen würde, wenn er ihm erzählte, dass die Polizei ihn suchte; und schließlich, dass er keine Ahnung hatte, wie er sich jetzt verhalten sollte. Also antwortete er vorsichtig: »Wir dürfen über unsere Patienten nur Angehörigen Auskunft geben, das verstehen Sie sicher. Sonst könnte ja jeder kommen und sich hier Informationen verschaffen, die ihn nichts angehen.«
»Ach so, ja, klar. Aber ich bin kein Verwandter, nur ein Freund. Aber immerhin …« Er stockte, überlegte, kam dann zu einem Entschluss. »Also, ich habe die Notrufnummer angerufen vorhin, aber dann wollte ich da nicht hineingezogen werden, deshalb bin ich gegangen.«
»Darf ich fragen, wie Sie heißen?«
Ein misstrauischer Blick traf ihn. »Wegen der Polizei? Die suchen ja garantiert nach Zeugen.«
Auf den Kopf gefallen war er jedenfalls nicht. »Das stimmt«, gab Eckart zu. »Die beiden Verletzten sind noch nicht vernehmungsfähig, und natürlich will die Polizei wissen, was vorgefallen ist.«
»Also sind sie hier?«
Eckart nickte. Es schien ihm unsinnig zu sein, das zu leugnen. »Wie haben Sie das erfahren?«
»Ich habe die Sanitäter gefragt, wo sie sie hinbringen, die haben mir das gesagt, weil sie dachten, ich … na ja, ich bin irgendwie für die beiden zuständig.«
»Und dann haben Sie das Weite gesucht, bevor die Polizei eintraf?«
»Ja, wie gesagt …« Er zögerte. »Ich kenne die beiden. Nicht besonders gut, aber ab und zu trifft man sich und redet mal. Tom kann ich nicht besonders leiden, aber Marco ist in Ordnung, auch wenn er gerade eine Krise durchmacht und ziemlich durchhängt. Sagen Sie mir wenigstens, ob sie in Ordnung sind. Das dürfen Sie doch bestimmt, oder?«
»Sie haben also gesehen, was da passiert ist?«
»Wie es angefangen hat, weiß ich nicht. Als ich zu der Kneipe kam, war die Schlägerei schon in vollem Gange. Ich wusste, dass Polizei in der Nähe war und habe gerufen, sie sollten aufhören, damit sie keinen Ärger kriegen, aber die haben einfach weitergemacht. Na ja, und dann ist das aus dem Ruder gelaufen.«
»Sie meinen das Messer?«
Der junge Mann biss sich auf die Lippen, antwortete aber nicht.
»Haben Sie das Messer an sich genommen? Das ist Unterschlagung von Beweismitteln, damit machen Sie sich strafbar«, sagte Eckart eindringlich. »Was haben Sie sich nur dabei gedacht?«
Nach kurzem Zögern griff der Mann in die Tasche seiner Jacke. Zum Vorschein kam eine Plastiktüte. »Bitte, hier ist es!«, sagte er. »Ich habe nicht richtig nachgedacht, sondern es einfach eingesteckt, weil ich dachte, das bringt den beiden nur Ärger. Geht es ihnen gut? Sagen Sie mir wenigstens das!«
Zögernd nahm Eckart das Beweisstück an sich. »So weit ja, weil das Messer das Herz verfehlt hat«, sagte er. »Das hätte böse ausgehen können.«
Diese Auskunft sorgte dafür, dass der junge Mann leichenblass wurde und sich gegen eine Wand lehnen musste. »Echt jetzt? Ich … ich dachte, das wäre irgendwie eher aus Versehen passiert, deshalb habe ich das Messer auch genommen. Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass es ein wichtiges Beweisstück sein könnte, ehrlich nicht. Ich dachte doch nicht …« Er brach ab, schüttelte langsam den Kopf. »Das Herz verfehlt«, murmelte er.
»Sie haben nicht mitbekommen, worum es bei dem Streit ging?«
»Nein, die haben sich ja schon geprügelt, als ich kam, aber ich kann’s mir denken. Es ging um eine Frau. Tom war mal in sie verliebt, aber sie hat ihn abblitzen lassen, wegen Marco. Nur … also, ich glaube, von dem ist sie jetzt auch getrennt. Tom konnte es nicht lassen, sie immer wieder zu beschimpfen, und Marco wollte das nicht hören.«
»Sie müssen mir Ihren Namen sagen. Und Sie müssen mit der Polizei reden.«
Der junge Mann nickte. »Sascha Buder. Also eigentlich Alexander, aber alle nennen mich Sascha. Was machen die mit mir, wenn sie erfahren, dass ich das Messer habe mitgehen lassen?«
»Ich schätze mal, Sie kommen mit einer Verwarnung davon. Mir wäre es am liebsten, wir würden sofort bei der Polizei anrufen und die Sache klären. Vermutlich wäre das auch für Sie das Beste.«
Sascha Buder nickte. »Okay, Sie sind der Boss. Kann ich die beiden sehen?«
»Erst, wenn Sie mit der Polizei gesprochen haben.«
Der junge Mann nickte ergeben, und Eckart rief die Nummer an, die auf einer der Visitenkarten stand, die die Beamten ihm gegeben hatten.
*
Es war schon fast sechs Uhr, als Eva die Zeit für gekommen hielt. Schwester Marie war gerade noch einmal bei ihr gewesen, jetzt musste sie handeln, denn bald würde die Schicht wechseln, so viel hatte sie herausgefunden. Diese Zeit des Übergangs von einem Team zum nächsten wollte sie nutzen.
Sie stand auf, wobei sie erschrocken feststellte, wie unsicher sie auf den Beinen war, aber sie ließ sich nicht beirren. Sie holte ihre Sachen aus dem Schrank, setzte sich auf den Bettrand und begann, sich anzuziehen. Auf dem Stationsflur war es jetzt völlig still. Endlich.
Sie brauchte länger zum Anziehen als sonst, weil ihr jede Bewegung schwer fiel. Woran das lag, konnte sie sich nicht erklären. Und seltsamerweise war ihr Bauch plötzlich dicker als vorher – als wäre er in dem Augenblick gewachsen, in dem dieser Arzt zum ersten Mal das Wort ›schwanger‹ in den Mund genommen hatte. Natürlich war sie nicht dumm, sie wusste, dass sie schwanger war, aber sie hatte diese Erkenntnis, so gut es eben ging, verdrängt, bis sie beinahe so weit gewesen war, ihren Zustand auch vor sich selbst zu verleugnen. Nur nachts hatte sie es sich manchmal gestattet, eine Hand auf ihren Bauch zu legen, um zu fühlen, was da in ihr wuchs.
Als es ihr endlich gelungen war, auch ihre Schuhe anzuziehen, stand sie langsam auf. Sie durfte sich nicht schnell bewegen, so viel hatte sie schon begriffen, sonst wurde ihr wieder schwindelig, und sie wollte ja nicht noch einmal bewusstlos auf der Straße landen, denn was dann passieren würde, konnte sie sich ausmalen: Man würde sie wieder in diese Klinik bringen, wo ihr lauter unangenehme Wahrheiten gesagt wurden, die sie nicht hören wollte.
Sie nahm ihre Tasche, vergewisserte sich, dass noch alles darin war, was ihr gehörte, und ging zur Tür, die sie vorsichtig einen Spaltbreit öffnete, gerade so weit, dass sie hinaussehen konnte. Der Flur war leer. Also öffnete sie die Tür ganz und schlüpfte hinaus. Da sie auf der einen Seite am Dienstzimmer vorbeigehen musste, wählte sie die andere Seite. Den Aufzug würde sie meiden und lieber die Treppe nehmen, auch wenn es ihr schwer fiel. Im Treppenhaus war das Risiko, entdeckt zu werden, geringer.
Sie war schon fast am Ziel, als Schwester Marie wie aus dem Nichts neben ihr auftauchte. »Das ist ja wohl nicht Ihr Ernst!«, sagte sie. »Sie können sich kaum auf den Beinen halten, das sehe ich Ihnen an. Wo wollen Sie denn hin in diesem Zustand?«
Dummerweise verließen Eva ausgerechnet in diesem Moment die Kräfte. Sie schwankte und wäre vielleicht gefallen, wenn Marie nicht mit einem Satz bei ihr gewesen wäre und sie gestützt hätte.
»Und jetzt sofort zurück ins Bett mit Ihnen. Machen Sie so einen Unsinn nicht noch einmal, verstanden?«
Eva nickte. Sie würde froh sein, wenn sie wieder lag. Ihr war ganz unverständlich, wie sie es bis hierher geschafft hatte – und wie sie sich hatte einbilden können, sie werde bis nach Hause kommen. Als sie hörte, wie jemand ihren Namen rief, reagierte sie zunächst nicht.
»Eva! Was machst du denn hier?«
Da Schwester Marie unwillkürlich stehen geblieben war und sie fragend ansah, blieb Eva notgedrungen ebenfalls stehen. Langsam drehte sie sich um. Sascha Buder, ausgerechnet!
Er kam direkt auf sie zu. »Bist du wegen Marco hier?«, fragte er.
Eva spürte, wie ihre Beine unter ihr nachgaben, als er nach Marco fragte, aber Schwester Marie verstärkte ihren Griff. »Helfen Sie mir, sie wieder ins Bett zu bringen«, sagte sie zu Sascha. »Es geht ihr nicht gut.«
Eva war froh, dass er daraufhin den Mund hielt und keine weiteren dummen Fragen stellte. Er nahm ihren anderen Arm und geleitete sie zusammen mit Marie zurück zu dem Raum, den sie gerade erst verlassen hatte. Erleichtert ließ sie sich auf den Bettrand sinken. Dass ein kurzer Ausflug von nur wenigen Schritten so anstrengend sein konnte!
»Danke«, sagte die Schwester zu Sascha. »Ab jetzt kommen wir allein zurecht.«
Eigentlich hatte Eva nicht fragen wollen, aber sie musste es wissen. »Was ist mit Marco?«
Doch als Schwester Marie sah, dass er Anstalten machte, die Frage zu beantworten, wurde sie energisch. Sie drängte ihn förmlich aus dem Zimmer, dann schloss sie nachdrücklich die Tür.
»Aber ich will es wissen«, sagte Eva. »Wieso hat er mich nach Marco gefragt? Ist er hier?«
»Und wieso wollen Sie das wissen?«, fragte Marie.
Eva spürte, dass sie am Ende war. Sie schlug beide Hände vors Gesicht und begann zu weinen.
Schwester Marie setzte sich neben sie, nahm sie in die Arme und schaukelte sie sachte hin und her, als wäre sie ein kleines Mädchen, das Trost brauchte. Auf einmal war sie überhaupt nicht mehr energisch, sondern ganz sanft, liebevoll und fürsorglich.
Eva legte ihren Kopf an Maries Schulter und dachte, wie schön es wäre, wenn sie ihr alles erzählen könnte. Alles, was sie bedrückte, alles, was ihr Leben derzeit so schwer machte. Aber sie wusste, es wäre ein Fehler, und so presste sie die Lippen fest zusammen, damit ihr nur ja kein unbedachtes Wort entschlüpfte.
*
»Guten Morgen«, sagte Antonia leise.
Leon schlug die Augen auf. Da lag sie, schön wie immer, und lächelte ihn an, als gäbe es in ihrem Leben keine heimlichen Treffen mit einem anderen Mann! Was sollte er nun von diesem Lächeln halten? Es sprach reine Liebe daraus, und er fragte sich, warum er ihr nicht einfach diese Frage stellte, die ihm auf der Seele brannte: ›Warum triffst du dich heimlich mit Ingo Ewert?‹ Aber er brachte sie nun einmal nicht über die Lippen, er hätte sich gedemütigt gefühlt, wenn er sie um eine Auskunft hätte bitten müssen, die sie ihm seiner Meinung nach von sich aus hätte geben sollen, ohne Nachfragen.
»Guten Morgen«, erwiderte er ebenso leise.
»Du bist erst ziemlich spät wiedergekommen. Ist mit den Zwillingen von Frau Müthen alles gut gegangen?«
»Das Mädchen musste ich per Kaiserschnitt holen, das war heikel, wir hatten plötzlich keine Herztöne mehr und mussten uns deshalb sehr beeilen. Die Kleine drohte sich mit der Nabelschnur zu strangulieren. Aber alles ist gut ausgegangen.«
»Schön.«
»Und dann kamen noch zwei Notfälle.« Er erzählte ihr von den jungen Männern, von denen einer eine böse Stichverletzung gehabt hatte. »Eckart war froh, dass ich noch da war, Herr Hillenberg und er wären sonst ziemlich ins Rotieren gekommen. Das war eine anstrengende Nacht. Ich kann nur hoffen, dass er danach noch etwas Ruhe gefunden hat.«
»Aber hast du nicht heute Morgen gleich wieder eine große OP?«
»Das schaffe ich schon.«
Sie schmiegte sich an ihn und küsste ihn. Sofort wurde ihm heiß, ganz automatisch schlossen sich seine Arme um sie. Auch nach all den Ehejahren übte sie auf ihn noch immer diese Wirkung aus …
Zwanzig Minuten später sprang er aus dem Bett. Er hatte das fällige Gespräch mit seiner Frau noch immer nicht geführt, aber sie hatten sich geliebt an diesem Morgen, wie sie es früher oft getan hatten, und sie war so leidenschaftlich und zärtlich gewesen wie immer. Unmöglich, dass sie eine heimliche Affäre mit einem Jugendfreund hatte, vollkommen ausgeschlossen!
Nach einer ausgiebigen Dusche und einem Frühstück, das nicht ganz so ruhig ausfiel, wie er es gern gehabt hätte – mit vier Teenagern im Haushalt war das offenbar nicht durchzusetzen – küsste er seine Frau und die beiden Töchter, verabschiedete sich von seinen Söhnen jeweils mit einem liebevollen Schlag auf die Schulter und verließ wie immer als Erster das Haus.
Er wollte vor der Operation genug Zeit haben, um Flora Müthen und ihren Zwillingen in aller Ruhe einen Besuch abzustatten. Das war ihm wichtig.
Als die junge Frau ihn sah, strahlte sie. »Mein Mann ist gerade erst gefahren, Herr Dr. Laurin!«, sagte er. »Er wollte wenigstens noch ein paar Stunden richtig schlafen. Er hat ja die ganze Nacht hier auf dem Stuhl verbracht.«
»Er wird sich schnell erholen, Frau Müthen.«
Eine Schwester kam mit den Zwillingen herein. Der Junge quäkte ein bisschen, das kleine Mädchen war ganz still, schlug aber die Augen auf, als es seiner Mutter in den Arm gelegt wurde.
»Geben Sie mir meinen Sohn auch!«, bat Flora Müthen. »Wozu habe ich zwei Arme?«
Dieses Bild nahm Leon mit in den Operationssaal: eine glückliche junge Mutter mit Zwillingen im Arm. Wie Antonia damals …
Die Operation verlief komplikationslos. Als er danach in sein Büro kam, blickte Moni Hillenberg, seine Sekretärin, auf. Sie war mit Michael Hillenberg, Eckarts Assistenten, verheiratet. »Ihr Schwager hat angerufen, Chef«, sagte sie.
»Dringend?«
»Er meinte, wenn Sie mal Zeit hätten, sollten Sie ihn zurückrufen.«
»Dann mache ich das gleich«, seufzte Leon. »Ob Sie einen Kaffee für mich hätten?«
»Kommt sofort«, sagte Moni, und so war es auch. Sein Schwager Andreas Brink, der Mann seiner Schwester Sandra, meldete sich in dem Augenblick, in dem Moni eine Tasse wundervoll duftenden Kaffees vor ihn auf die Schreibtischplatte stellte.
Er dankte ihr mit einem Lächeln. »Andy? Was gibt’s?«
»Ich habe hier einen Mordversuch auf dem Tisch«, sagte Andreas, der mittlerweile Kriminaloberkommissar war. »Angeblich liegt das Opfer bei euch in der Klinik, nach einem beinahe tödlichen Messerstich.«
»Mordversuch? Also, ich weiß nicht …« Leon berichtete, was er über Marco Friedrich und Tom Fröbel wusste. »Es hat sich eher nach einer gewöhnlichen Kneipenschlägerei angehört, die dann ausgeartet ist.«
»Kann sein, kann auch nicht sein. Das Opfer hätte jedenfalls getötet werden können, wenn der Stich ins Herz getroffen hätte.«
»Das stimmt«, musste Leon zugeben. »Und das ist jetzt dein Fall?«
»Zumindest im Augenblick«, erklärte Andreas. »Mehr weißt du nicht?«
»Ich hatte keinen Nachtdienst, ich war nur wegen eines Notfalls hier, sonst hätte ich von der Sache überhaupt nichts mitbekommen. Aber die beiden an der Schlägerei beteiligten Männer dürften heute vernehmungsfähig sein.«
»Gut, dann komme ich später selbst vorbei. Vielleicht finden wir beide dann ja ein paar Minuten Zeit, um miteinander zu reden. Oder operierst du?«
»Das habe ich für heute schon hinter mir. Wenn du ungefähr sagen kannst, wann du kommst, sehe ich zu, dass ich Zeit habe.«
»In der Mittagszeit, gegen eins?«
»Klingt perfekt. Vorausgesetzt, mir kommt hier kein Notfall dazwischen, du weißt ja, wie das ist.«
Nach dem Gespräch genoss Leon den Kaffee und sann über den ›Mordversuch‹ nach. Ob es wirklich einer gewesen war?
*
»Kann ich jetzt gehen?«, fragte Sascha Buder. »Ich habe überhaupt nicht geschlafen letzte Nacht, ich bin ziemlich müde. Außerdem will ich noch mal in die Klinik.«
Die beiden Polizeibeamten, die auf den Anruf von Eckart Sternberg hin in der Klinik aufgetaucht waren, hatten Sascha mitgenommen, damit sie seine Aussage zu Protokoll nehmen konnten.
Die Sache mit dem Messer hatte keinen guten Eindruck auf sie gemacht, das war ihm nicht entgangen. Zu Beginn der Befragung hatten sie ihn sogar verdächtigt, dass er selbst mit dem Messer zugestochen und es deshalb mitgenommen hatte. Irgendwann war es ihm dann aber wohl gelungen, sie zu überzeugen, dass das nicht der Fall war. Außerdem würde Tom ja hoffentlich die Wahrheit sagen, wenn er gefragt wurde. Und Marco würde sich bestimmt auch daran erinnern, dass Tom ihm das Messer zwischen die Rippen gejagt hatte und nicht etwa er, Sascha.
»Hier unterschreiben, bitte. Aber lesen Sie sich das vorher noch einmal durch.«
Es stand alles so da, wie er es zu Protokoll gegeben hatte, also unterschrieb er.
»Es kann sein, dass wir in den nächsten Tagen noch weitere Fragen an Sie haben, also halten Sie sich bitte zu unserer Verfügung.«
»Ich gebe Ihnen meine Handy-Nummer«, bot Sascha an. Es konnte nicht schaden, guten Willen zu zeigen, nachdem er schon den Fehler gemacht hatte, das Messer einzustecken. Das war wirklich dumm gewesen.
Einigermaßen zufrieden machte er sich auf den Heimweg. Bevor er wieder in die Klinik ging, musste er schlafen. Im Büro würde er sich krank melden, arbeiten konnte er heute auf keinen Fall.
Und dann musste er noch herausfinden, wieso Eva in der Klinik war. Sie hatte ganz schön fertig ausgesehen, das war ihm aufgefallen. Aber dieser alte Drachen von Schwester hatte ihn ja gleich fortgejagt.
Er unterdrückte ein Gähnen. Erst schlafen, dann würde er weitersehen.
*
»Alles in Ordnung?«, fragte Antonia, als sie gegen neun in der Kinderklinik eintraf und Ingo Ewert sie müde anlächelte.
»Geht so«, erwiderte er. »Wir sind unterbesetzt, das weißt du ja. Der Krankenstand ist hoch, und unsere Neue … ich glaube nicht, dass sie die Probezeit bei uns übersteht. Wenn wir nicht so große Personalnot hätten, würde ich ihr das am liebsten gleich sagen. Sie hatte gute Zeugnisse und Referenzen, aber sie kann nicht mit Menschen umgehen – und das als Kinderärztin. So etwas lässt sich aus Zeugnissen ja leider nicht ablesen.«
»So schlimm?«
Er nickte unglücklich. »Ich glaube nicht, dass ich übertreibe. Außerdem ist sie rechthaberisch, zugleich kommt sie mir unsicher vor.«
»Unsicher? Du meinst, so wie ich?«
»Aber nein! Du bist vorsichtig, aber nicht unsicher, das ist etwas völlig anderes. Du weißt, dass es dir an Praxis fehlt, aber du hast nichts vergessen, du bist umsichtig. Außerdem habe ich dich noch nie rechthaberisch erlebt. Frau Kröger dagegen beharrt auch dann noch auf ihrer Meinung, wenn alles gegen sie spricht. Ich möchte auf Dauer wirklich nicht mit ihr zusammenarbeiten.«
»Immerhin ist sie ausgebildete Kinderärztin, also gib ihr ein bisschen Zeit«, sagte Antonia. »ich habe sie ja noch nicht kennengelernt, aber so schlimm kann es doch eigentlich nicht sein.«
Eine Stunde später wusste sie es besser. Lisa Kröger war genau so, wie Ingo sie beschrieben hatte, wenn nicht schlimmer, denn sie benahm sich zu allem Überfluss auch noch herablassend gegenüber dem Pflegepersonal, und sie war tatsächlich ungeschickt im Umgang mit ihren kleinen Patientinnen und Patienten und deren Eltern. Sie schien nicht einmal zu merken, wenn sie den falschen Ton anschlug. Mehr als einmal griff Antonia später unauffällig ein, um die aufgeregten Gemüter ängstlicher Eltern zu besänftigen und Kinder zu beruhigen, die die wenig zugewandte Art der jungen Medizinerin in Angst und Schrecken versetzt hatte.
Antonia selbst wurde von Lisa Kröger womöglich noch herablassender behandelt als Schwestern und Pfleger. Ingo Ewert hatte Antonia zwar als ›Kollegin‹ vorgestellt, aber natürlich war es Lisa Kröger nicht lange verborgen geblieben, dass Antonia in der Kinderklinik nicht angestellt war, sondern dort gewissermaßen ein Praktikum machte. Das genügte ihr, um Antonia weitgehend zu übersehen und alles, was sie fachlich äußerte, auch vor Zeugen in Frage zu stellen.
Antonia biss die Zähne zusammen. Sie war hier, um in ihren Beruf zurückzufinden, da würde sie sich doch von einer hochmütigen dummen Gans nicht verunsichern lassen! Sie wusste selbst, dass sie ihr Wissen auffrischen und wieder Sicherheit im Umgang mit ihren kleinen Patientinnen und Patienten gewinnen musste.
Manches vergaß man nie, aber wenn es um seltenere Erkrankungen ging, so nahm sie an, würde sie sie vermutlich nicht auf Anhieb erkennen. Dabei hatte sie, seit sie regelmäßig in die Kinderklinik kam, festgestellt, dass es zwar Dinge gab, die sie vergessen hatte, dass es aber meistens genügte, noch einmal die Fachliteratur darüber zu lesen, und dann war alles, was sie einmal gelernt hatte, wieder da.
Ingo wurde am späten Vormittag zu einem Notfall gerufen. Wenig später kam ein verzweifeltes Elternpaar mit einem zweijährigen Kind, dem es erkennbar schlecht ging. Die Kleine hieß Susie Strasser, hatte hohes Fieber und bereits mehrmals erbrechen müssen. Außerdem wimmerte sie vor Schmerzen und war nicht ansprechbar.
Antonia nahm das Kind in Empfang.
»Der Kopf tut ihr weh«, sagte Anke Strasser, die Mutter, mit Tränen in den Augen. »Das hat sie immer wieder gesagt, als sie noch sprechen konnte. Vorher hatte sie Halsschmerzen, die waren auch schlimm. Jetzt kann sie sich gar nicht mehr äußern.«
Sönke Strasser legte seiner Frau einen Arm um die Schultern. »Helfen Sie unserem Kind!«, bat er.
Antonia begann mit ihrer Untersuchung. Währenddessen stellte sie den Eltern eine Menge Fragen. Seit wann ging es der Kleinen schlecht? Wann hatten die Halsschmerzen begonnen, wann hatte sie Fieber bekommen? Wie schnell hatte sich ihr Zustand verändert?
»Und dann konnte sie auf einmal den Kopf nicht mehr drehen«, sagte Anke Strasser.
»Ja, es war, als wäre ihr Nacken plötzlich unbeweglich geworden«, setzte ihr Mann hinzu.
Schon zuvor hatte Antonia einen Verdacht gehabt, jetzt begann er sich zu erhärten. Sie untersuchte die Haut des Kindes, während ihr das Herz bis zum Hals schlug. Und wenn sie sich nun irrte?
Lisa Kröger erschien. »Ich übernehme«, sagte sie knapp.
»Aber …«, begann Antonia, doch die junge Ärztin wandte ihr einfach den Rücken zu.
Die Strassers blickten unsicher von Antonia zu Lisa Kröger und zurück.
»Was fehlt dem Kind?«, fragte Lisa Kröger.
»Ich habe die Kleine bereits untersucht und eine Anamnese erstellt«, sagte Antonia. »Ich vermute …«
»Ich habe nicht Sie gefragt, sondern die Eltern«, erwiderte Lisa Kröger kalt.
Anke Strasser begann erneut zu weinen, ihr Mann warf Antonia einen weiteren Blick zu, dann sagte er: »Wir möchten, dass Frau Dr. Laurin unsere Tochter weiter behandelt.«
Lisa Kröger erstarrte.
Antonia gab sich einen Ruck. Nein, sie war nicht sicher, aber wenn sich ihr Verdacht als richtig erwies, brauchte Susie Strasser umgehend Hilfe. »Mein Verdacht lautet auf Meningitis«, sagte sie ruhig. »Und da das Mädchen erst zwei Jahre alt ist und die Symptome schon vor ein paar Stunden aufgetreten sind, ist Eile geboten. Wir müssen sofort mit Antibiotika behandeln ….«
»Aber doch wohl nicht, bevor die Diagnose feststeht«, warf Lisa Kröger ein. »Was reden Sie denn da für einen Unsinn?«
Erneut versuchte Sönke Strasser etwas zu sagen, doch Antonia kam ihm zuvor, indem sie nun ihrerseits Lisa Kröger belehrte. Mit Höflichkeit oder kollegialer Rücksichtnahme erreichte man bei ihr ja offenbar nichts. »Bei Verdacht auf Meningitis muss man bei so kleinen Kindern sofort Antibiotika einsetzen, auch wenn die Diagnose noch nicht feststeht, das sollten Sie eigentlich wissen!«, fuhr sie die junge Ärztin an. Und dann wandte sie sich an die Schwester, die bei ihrer Untersuchung zugegen gewesen war und erteilte ihr mit klarer Stimme Anweisungen.
»Das wird Ihnen noch leid tun!«, zischte Lisa Kröger, bevor sie aus dem Raum rauschte, mit hochrotem Kopf.
»Meningitis?«, fragte Anke Strasser mit zitternder Stimme. »Ist das … ist das eine Hirnhautentzündung?«
»Ja, Frau Strasser. Ich bin darauf gekommen, als ich hörte, dass Ihre Tochter einen steifen Nacken hat. Und es gibt noch ein paar andere Anzeichen, die in die gleiche Richtung weisen.«
Anke Strasser schlug beide Hände vors Gesicht, auch ihr Mann hatte Tränen in den Augen.
Die Schwester kam mit den Medikamenten zurück und legte sofort einen Zugang.
»Wir müssen jetzt etliche Untersuchungen vornehmen«, sagte Antonia, nun wieder mit sanfter Stimme. »Sie sollten draußen warten. Es wird eine Weile dauern, bis wir Gewissheit haben, aber die Medikamente werden Ihrer Tochter helfen, die Krankheit zu bekämpfen.«
»Wird sie wieder gesund werden, Frau Doktor?«
»Wir tun für sie, was in unserer Macht steht, das verspreche ich Ihnen.«
Antonia vergaß alles um sich herum, während sie die Untersuchungen für Susie Strasser veranlasste und zum Teil selbst durchführte. Es kam ihr so vor, als hätte sie nie etwas anderes getan. Es gab keine Unsicherheit mehr, keine Fragen, kein Zögern.
Es ging nur noch darum, herauszufinden, ob die kleine Patientin tatsächlich an Meningitis litt oder nicht. Alles andere hatte dahinter zurückzustehen.
*
»Ich bin Dr. Laurin«, sagte Leon. »Wir sind uns heute Nacht schon begegnet, im OP – Sie werden daran keine Erinnerung haben. Wie fühlen Sie sich jetzt, Herr Friedrich?«
»Nicht so gut«, antwortete Marco. »Stimmt es, dass ich niedergestochen wurde? Jemand hat das gesagt.«
»Sie erinnern sich also nicht daran?«
»Nur an Tom, der mich die ganze Zeit dumm angemacht hat. Ich habe ihm irgendwann eine gelangt, damit er endlich Ruhe gibt. Aber er ist mir gefolgt und hat immer weiter gemacht, und dann ist eine richtige Prügelei daraus geworden. So weit kann ich mich schon erinnern. Aber dann ist da so ein … na ja, eine Art Filmriss, und ich weiß nichts mehr.«
»Erinnern Sie sich auch nicht daran, dass noch ein Freund von Ihnen dazu gekommen ist?«
»Ein Freund?« Marco dachte nach. »Ach so, Sie meinen Sascha. Ein Freund ist er nicht direkt, aber es stimmt, er ist dann plötzlich aufgetaucht, und ich war froh darüber, weil ich dachte, damit wäre die Prügelei beendet.«
»Aber das war sie nicht?«
»Ich weiß es nicht, ich erinnere mich nicht an das, was dann passiert ist.«
»Sie werden gleich Besuch von der Polizei bekommen. Da Sie durch einen Stich in Herznähe schwer verletzt worden sind, interessiert sich die Polizei für diesen Fall.«
»In Herznähe?«
»Ja, Sie haben mehr Glück als Verstand gehabt, Herr Friedrich.«
Leon verabschiedete sich und stattete auch Tom Fröbel einen Besuch ab, den er jedoch wesentlich weniger sympathisch fand als Marco Friedrich, und das lag nicht an seinem durch die stark geschwollene Nase verunstalteten Gesicht.
»Ich will endlich nach Hause! Sie haben kein Recht, mich hier noch länger festzuhalten!«
»Die Polizei besteht aber darauf«, erwiderte Leon kühl. »Es gibt einige Fragen an Sie, Herr Fröbel. Wenn Sie die beantwortet haben, dürfen Sie gehen.«
Nach Tom Fröbel suchte er auch Eva Maischinger noch auf, deren Geschichte ihn nach wie vor stark beschäftigte. Sie lag nicht länger in der Notaufnahme, sondern war frühmorgens auf die gynäkologische Station verlegt worden.
»Ich hörte, Sie wollten uns heute Nacht verlassen, Frau Maischinger?«, fragte er, als er an ihr Bett trat.
Sie wurde rot, leugnete aber nicht. »Ja«, gab sie zu, »aber ich habe gemerkt, dass es wohl zu früh war. Was ist denn mit mir los, Herr Doktor? Warum wird mir sofort schwindelig, wenn ich aufstehe?«
»Wir werden ein paar Untersuchungen vornehmen müssen, um das herauszufinden. Immerhin hoffe ich, dass es Ihnen hier auf der Gynäkologie besser gefällt als in der Notaufnahme?«
»Schon, aber … ich …« Sie brach ab.
Er griff nach ihrer Hand. »Warum wollten Sie nicht wahrhaben, dass Sie schwanger sind?«, fragte er ganz ruhig.
»Weil es zu früh ist!«, stieß sie hervor. »Und … und ich bin auch allein. Mein Freund will überhaupt keine Kinder, wir haben uns getrennt. Was soll ich denn mit einem Kind?«
»Wieso haben Sie nicht verhütet, wenn Sie nicht schwanger werden wollten?«
»Das haben wir doch, nur das eine Mal nicht, da … Aber das waren nicht die gefährlichen Tage, da konnte eigentlich überhaupt nichts passieren …«
»Und es ist doch passiert. Aber auch da hätte es noch Möglichkeiten gegeben, Frau Maischinger. Nicht, dass ich das für die geeignete Empfängnisverhütung halte, aber es gibt die Pille danach, das wissen Sie doch sicher?«
»Ich … ich … ich hätte doch nie gedacht, dass ich von dem einen Mal schwanger geworden bin!«, stieß Eva hervor. »Und dann … ich weiß auch nicht, mir ist einfach alles über den Kopf gewachsen, und da habe ich mir eingeredet, dass ich mich geirrt habe, dass ich überhaupt nicht schwanger bin. Ich wurde ja auch gar nicht dick, und …«
»Haben Sie sich von Ihrem Freund getrennt oder er sich von Ihnen?«
»Ich habe mich getrennt, weil ich ihm zuvorkommen wollte. Ich wollte nicht, dass er mich wegschickt, wenn er merkt, dass ich …« Tränen liefen ihr über die Wangen.
Leon hielt noch immer ihre Hand, und seine Stimme klang so ruhig wie zuvor. »Aber, Frau Maischinger, wie passt das denn zusammen? Eben haben Sie mir doch gesagt, dass Sie sich eingeredet haben, gar nicht schwanger zu sein? Dann hätten Sie sich doch auch nicht trennen müssen.«
Eva brach in Tränen aus. »Ich hab’s Ihnen doch schon gesagt, dass ich ganz durcheinander bin. Mal wusste ich, dass ich ein Kind erwarte, und dann war ich ganz sicher, dass ich mir das nur eingebildet habe. Aber ich konnte nicht länger mit meinem Freund zusammen sein, auf keinen Fall. Es hätte so oder so nicht gepasst.«
»Wie darf ich das verstehen?«
»Er hat mich nicht richtig geliebt, er hätte mich nur unglücklich gemacht.«
»Hat er Ihnen das gesagt? Dass er Sie nicht richtig liebt?«
»Nein, das weiß ich. Ich habe ihn einmal mit einer anderen Frau gesehen. Und er hat mir von einem Freund erzählt, der reingelegt wurde von seiner Freundin. Sie hatte behauptet, dass sie verhütet, aber das war gelogen. Sie hat es darauf angelegt, schwanger zu werden, damit er sie heiratet. Aber das hat er dann nicht getan, und Marco fand das richtig. Er hätte mich auch sitzen lassen, da bin ich ihm lieber zuvorgekommen.«
»Wie hat er es aufgenommen?«
»Überhaupt nicht. Er hat sich umgedreht und ist gegangen.«
»Vielleicht wäre es gut, wenn Sie sich aussprechen würden.«
Noch während Leon diese Worte aussprach, wurde ihm bewusst, dass er seiner jungen Patientin Ratschläge gab, die er selbst nicht beherzigte. Sprach er sich dann mit Antonia aus, die ja auch Geheimnisse vor ihm hatte? Hatte er sie auch nur ein einziges Mal gefragt, warum sie ihm nicht von ihren Treffen mit Ingo Ewert erzählte und was diese Treffen für sie bedeuteten?
»Wir reden nicht mehr miteinander«, schluchzte Eva.
Er ließ ihre Hand los, damit sie sich das Gesicht trocknen konnte. »Kann ich Sie was fragen, Herr Dr. Laurin?«
»Ja, natürlich. Was möchten Sie wissen?«
»Gestern war jemand hier, den ich kannte … und der auch Marco kennt. Er hat mich gefragt, ob ich wegen Marco hier bin. Ich … ich habe mich gefragt, was das heißen sollte, aber als ich ihn fragen wollte, hat Schwester Marie ihn weggeschickt, weil ich ziemlich wackelig auf den Beinen war und so … Also …«
Leon begann ein paar Zusammenhänge zu ahnen, ließ sich davon aber nichts anmerken. »Ich höre mich mal um«, sagte er. »Wie heißt denn Ihr Marco mit Nachnamen?«
»Marco Friedrich.«
Sieh mal einer an, dachte Leon. Er verriet sich auch jetzt nicht. Zuerst wollte er ein Gespräch mit Schwester Marie führen. Vielleicht wusste die ja schon mehr über diese Geschichte als er. Es war ihr zuzutrauen.
*
»Wann kann ich denn endlich nach Hause?«, fragte Tom. Er hatte diese Frage schon ungefähr zehn Mal gestellt.
»Sobald der Kommissar hier war und mit Ihnen gesprochen hat«, antwortete Hannes Baumgarten.
»Was denn für ein Kommissar, verdammt? Was habe ich mit einem Kommissar zu schaffen? Ich wurde angegriffen und habe mich verteidigt. Fertig. Mehr gibt’s dazu nicht zu sagen.«
Hannes’ junger Kollege Robert Semmler hatte ihn morgens bei der Übergabe informiert, was in der Nacht vorgefallen war. Über den genauen Hergang der Prügelei, die mit einem bösen Messerstich geendet hatte, hatte er ihm freilich nichts sagen können, doch im Lauf der letzten Stunden war einiges durchgesickert.
Hannes Baumgarten war schon Mitte fünfzig. Obwohl es ihm schwerer fiel als früher, übte er seinen Beruf noch immer gerne aus. Eines jedenfalls hatte er in seiner langen Zeit als Pfleger gelernt: Man durfte sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Je aufgeregter Patienten wurden, desto ruhiger wurde er. So war es auch jetzt.
»Erzählen Sie das dem Kommissar«, sagte er gelassen. »Außerdem muss noch einmal ein Arzt nach Ihrer Nase sehen, bevor Sie entlassen werden können. Falls sich das hinzieht, werden Sie bis morgen bleiben müssen.«
Ein giftiger Blick traf ihn, aber Tom Fröbel kam nicht auf die Idee, sich nach Marco Friedrich zu erkundigen. Ein Minuspunkt, dachte Hannes. Der interessiert sich nur für sich selbst, dabei muss er doch wissen, was er getan hat!
Zwar gab es noch keine Beweise dafür, dass es Tom Fröbel gewesen war, der mit einem Messer zugestochen hatte, aber nicht nur Hannes war davon überzeugt, sondern auch die meisten seiner Kollegen. Er nahm an, dass die Polizei die Wahrheit schon herausfinden würde.
Er ließ Tom Fröbel allein, um noch einmal nach Marco Friedrich zu sehen. Der war noch ziemlich matt, aber wenn man bedachte, dass er erst in der Nacht notoperiert worden war, hatte er sich doch erstaunlich schnell erholt.
»Wie geht es Tom?«, fragte er sofort.
»Er will endlich entlassen werden, aber wir erwarten die Polizei, vorher kann er nicht gehen. Seine Nase sieht übel aus.«
»Das war ich«, sagte Marco. »Tut mir nicht leid, ehrlich. Der ist mir so auf die Nerven gegangen, wieder einmal.«
»Schon öfter?«
»Ja, er kann einfach keine Ruhe geben. Dabei habe ich ihm noch gesagt, er soll abschwirren, aber nein, er musste ja unbedingt weiter machen. Und irgendwann hat’s mir dann gereicht.«
»Worum ging es denn?«, fragte Hannes beiläufig.
Marco verzog das Gesicht zu einem verlegenen Grinsen. »Um eine Frau«, sagte er.
Nach einer längeren Pause setzte er hinzu: »Meine Ex-Freundin«, und schlagartig war das Grinsen wie weggewischt.
Erstaunt sah Hannes, dass der junge Patient mit einem Mal um Fassung rang. Er wandte den Kopf zur Seite, mied den Blick des Pflegers.
»Tut mir leid«, sagte Hannes, ohne dass er hätte erklären können, was ihm leid tat. Aber mit dieser Ex-Freundin schien es ja eine besondere Bewandtnis zu haben.
»Mir auch.« Marcos Stimme klang merkwürdig hohl. »Ich … also, sie hat Schluss gemacht.«
»Und du wolltest das nicht.« Hannes ging unwillkürlich zum ›Du‹ über, das hier entwickelte sich ja beinahe zu einer Art ›Vater-Sohn-Gespräch‹.
»Nein, ich wollte das nicht. Und … und ich versteh’s auch immer noch nicht. Es war echt toll mit uns, aber auf einmal sagt sie, dass Schluss ist.«
»Und weshalb?«
»Es würde alles nicht passen – dabei war sie meine große Liebe, und ich war ihre.«
O je, dachte Hannes, auch noch ein Romantiker! Um Marco etwas Zeit zu geben, sich wieder zu fassen, fragte er betont sachlich: »Und was hat jetzt Tom Fröbel damit zu tun? Wieso hat er über deine Ex geredet?«
»Weil er in sie verliebt war, aber nicht bei ihr landen konnte. Seitdem redet er schlecht über sie, wo er kann. Richtig eklig. Er nennt sie ›Schlampe‹ und sagt … sagt noch andere hässliche Dinge über sie, die alle gelogen sind.«
»Ach, so ist das. Und da ist dir irgendwann der Kragen geplatzt.«
Marco nickte. »Es tut mir nicht leid!«
»Aber du erinnerst dich nicht mehr daran, dass er das Messer gezogen hat?«
Marco schüttelte den Kopf. »Ist seine Nase gebrochen?«
»Ja, und er hat ziemliche Schmerzen, glaub mir.«
»Das tut mir auch nicht leid.«
»Erhol dich, die Polizei wird bald hier sein und dir Fragen stellen. Wenn ich dir einen Rat geben darf: Bleib bei der Wahrheit.«
Der Blick, der Hannes daraufhin traf, war zutiefst verwundert. »Was denn sonst? Ich habe gar keinen Grund zu lügen. Und ich sage denen auch, dass es mir nicht leid tut, zuerst zugeschlagen zu haben.«
»Vielleicht kommt das mit deiner Freundin ja noch wieder in Ordnung«, sagte Hannes, erfüllt von dem Wunsch, Marco Mut zu machen. »Bis später.«
Er war gespannt auf den Fortgang dieser Geschichte.
*
Susie Strasser hatte tatsächlich Meningitis, aber dank der frühzeitigen Gabe von Antibiotika, die Antonia veranlasst hatte, stabilisierte sich ihr Zustand bereits.
Als Ingo Ewert in die Klinik zurückgekehrt war, hatte Lisa Kröger bereits auf ihn gewartet und sich sofort auf ihn gestürzt, wütende Anschuldigungen gegen Antonia hervorsprudelnd. Ingo hatte das Klügste getan, was er tun konnte: Er hatte darum gebeten, zunächst einmal auch die andere Seite zu hören und sich dann nicht nur von Antonia informieren lassen, sondern auch von seinen Angestellten sowie den Eltern der kleinen Patientin. Das Ergebnis fiel für Lisa Kröger vernichtend aus, und genau so sagte er es ihr dann auch.
»Ich hätte Sie auch dann fristlos entlassen, wenn die Diagnose anders ausgefallen wäre, Frau Kröger, denn ausnahmslos alle haben mir berichtet, wie unangemessen Ihr Auftreten gewesen ist. Sie haben nicht nur die Autorität einer Kollegin ohne Not in Frage gestellt, Sie haben auch die ohnehin verstörten und verängstigten Eltern eines sehr kranken Kindes zusätzlich verunsichert, und zu allem Überfluss haben Sie dessen Behandlung durch Ihr unsachgemäßes Eingreifen verzögert. Rechnen Sie mit einer Klage, sollte diese Verzögerung zu bleibenden gesundheitlichen Schäden bei Susie Strasser führen. Und jetzt verlassen Sie bitte auf der Stelle meine Klinik.«
Lisa Kröger war tatsächlich gegangen, aber noch im Gehen hatte sie Drohungen ausgestoßen. Sie würde niemals eine gute Ärztin sein, weil es ihr an vielem fehlte, nicht nur am nötigen Fachwissen, trotz ihrer guten Zeugnisse, sondern auch an Einsicht in eigene Schwächen und am Einfühlungsvermögen.
»Die Kleine wäre gestorben, wenn du nicht hier gewesen wärst«, sagte Ingo danach erschüttert zu Antonia, als sie sich zum ersten Mal von Susie Strassers Bett entfernte, um auf dem Stationsflur einen Kaffee mit ihm zu trinken. Stundenlang war sie keine Sekunde von der Seite ihrer kleinen Patientin gewichen. »Und du redest davon, dass du unsicher bist und dass dir die Praxis fehlt!«
Sie sah ihn an und lächelte, zum ersten Mal, seit sie die Diagnose gestellt hatte. »Meine Unsicherheit war wie weggeblasen, Ingo«, sagte sie. »Ich hatte keinerlei Zweifel, was zu tun war, wie wir vorgehen mussten. Ich meine, ich war ja nicht sicher, ob die Kleine wirklich Meningitis hatte, aber ich wusste, dass die Möglichkeit bestand – und ich wusste, was in dem Fall zu tun ist.«
»Frau Kröger wusste das offenbar nicht.«
»Nein«, gab Antonia zu. »Es hat sie auch gar nicht interessiert. Sie wollte mich nur wieder einmal demütigen, ich glaube, in dem Moment, als sie mich sah, hat sie an das Kind überhaupt nicht gedacht. Ich frage mich, warum solche Menschen Medizin studieren. Sie war wahrscheinlich eine sehr gute Schülerin, aber sie interessiert sich nicht für ihre Mitmenschen. Warum ist sie dann Ärztin geworden?«
»Ich bin dir zu großem Dank verpflichtet. Ohne dich wäre in meiner Klinik heute etwas Schreckliches passiert, ich hätte mir das niemals verzeihen können.«
»Du weißt nicht, was passiert wäre, Ingo.«
»Doch, das weiß ich. Und ich weiß noch etwas: Dass du endlich mit Leon reden und ihm sagen solltest, was du planst. Und vergiss bei diesem Gespräch nicht, ihm von Susie Strasser zu erzählen.«
»Darüber rede ich bestimmt nicht mit ihm.«
»Vielleicht sollte ich mit ihm reden.«
»Willst du unsere Freundschaft aufs Spiel setzen?«
Er griff nach ihrer Hand. »Natürlich nicht. Aber denkst du nicht, dass er sich fragt, was mit dir los ist? Er bekommt doch mit, dass du jetzt viel häufiger unterwegs bist als früher. Meinst du nicht, er fragt sich, was dahintersteckt?«
»Er bekommt nichts davon mit!«, erklärte Antonia. »Wie denn? Wenn Leon nach Hause kommt, bin ich längst wieder da. Und wenn er doch einmal Fragen stellt, habe ich immer eine Antwort.«
»Es tut mir weh, dass du meinst, dir Lügen ausdenken zu müssen, damit er nichts von deinen Plänen erfährt.«
»Noch nicht, Ingo. Ich rede ja mit ihm, aber erst, wenn ich mich ganz sicher fühle.«
Ingo brach in Gelächter aus. Bis eben war er angespannt und blass gewesen, die Sache mit der kleinen Susie Strasser und das nachfolgende unangenehme Gespräch mit Lisa Kröger hingen ihm nach. Jetzt aber fiel zumindest ein Teil dieser Anspannung von ihm ab. »Weißt du was? Du wirst dich niemals ganz sicher fühlen, und wahrscheinlich bist du deshalb so eine gute Ärztin. Du suchst immer nach der Wahrheit, auch dann noch, wenn du sie schon gefunden hast.«
»Das war sehr hübsch ausgedrückt. Aber jetzt entschuldige mich bitte, ich möchte noch einmal nach meiner Patientin sehen – und nach deren Eltern.«
»Wolltest du nicht längst zu Hause sein?«
»Ich habe angerufen, dass ich später komme, Kyra weiß Bescheid, und sie schafft es durchaus, einmal allein zu essen. Die anderen kommen alle später.«
Ingo sah Antonia nach, wie sie mit langen Schritten zur Tür eilte. Schade, dass sie nicht in seiner Klinik anfangen wollte. Eine Kollegin wie sie hätte er sehr gern an seiner Seite gehabt, aber sie hatte ja andere Pläne.
Antonia aber beugte sich schon wieder über Susie Strasser. Das Fieber war zurückgegangen, die Medikamente schlugen an. »Es geht ihr schon besser«, sagte sie zu Susies Eltern.
Sönke Strasser erhob sich und ergriff mit beiden Händen Antonias rechte Hand. »Wir werden Ihnen nie vergessen, was Sie für Susie getan haben, Frau Dr. Laurin.«
»Ich bin sehr froh, dass sie auf dem Weg der Besserung ist, Herr Strasser«, erwiderte Antonia.
Anke Strasser hatte Tränen in den Augen, als auch sie sich bedankte.
Antonia blieb noch eine Weile bei ihnen, weil sie merkte, dass es auch ihr selbst gut tat, noch bei dem kleinen Mädchen zu sitzen, für das sie sich eingesetzt und dem sie vielleicht das Leben gerettet hatte. So würde es nicht immer sein. Manchmal konnten Ärzte ein Leben nicht retten, obwohl sie alles dafür taten. Aber wenn es gelang, so wie dieses Mal, dann war es eins der schönsten Gefühle der Welt.
*
»Und? Hast du etwas herausgefunden?«, erkundigte sich Leon, als Andreas Brink sein Büro betrat.
»Der Herr Friedrich erinnert sich nicht, das habe ich ihm geglaubt. Bei Herrn Fröbel bin ich beinahe sicher, dass er lügt. Wenn du mich fragst, hat er zugestochen. Das hat ja auch Herr Buder vermutet, wobei der aber leider nicht direkt gesehen hat, wie Herr Fröbel zugestochen hat. Aber offenbar war ja sonst niemand anwesend, also …«
»Na ja, theoretisch kommt auch Herr Buder als Täter in Frage – oder nicht?«
»Die Kollegen hatten ihn im Verdacht, aber er hat überzeugend dargelegt, dass er keinerlei Motiv hat. Während die beiden Herren, die sich geprügelt haben, offenbar nicht zum ersten Mal aneinandergeraten sind.«
Leon nickte, das wusste er bereits, aber dieses Wissen behielt er für sich. Er fand nicht, dass er seinem Schwager Einzelheiten einer offenbar etwas komplizierten Liebesgeschichte erzählen musste, zumal diese Einzelheiten zur Aufklärung sicherlich nichts beitrugen. Stattdessen fragte er: »Fingerabdrücke?«
»Das wäre der Idealfall.« Andreas grinste seinen Schwager müde an. »Aber alles ist verschmiert und verwischt, damit kann vermutlich niemand mehr etwas anfangen. Unsere Spurensicherung hat sich alle Mühe gegeben, aber es ist bislang nichts Vernünftiges dabei herausgekommen.«
»Und was heißt das jetzt? Dass der mutmaßliche Täter ungeschoren davonkommt?«
»Nicht so schnell, nicht so schnell, Herr Doktor! Diese Kneipe, vor der das passiert ist, war voller Leute. Ein paar Gäste haben wir schon ausfindig machen können. Zwei haben ausgesagt, dass Herr Fröbel den Herrn Friedrich nicht in Ruhe gelassen hat, obwohl der ihn mehrfach dazu aufgefordert hat. Vielleicht finden wir auch noch jemanden, der zufällig aus dem Fenster gesehen hat.«
»Ich wünsche euch viel Glück. Den Herrn Fröbel entlassen wir übrigens morgen früh. Über Nacht behalten wir ihn noch hier, zur Vorsicht.«
»Gut. Falls noch Fragen auftauchen, komme entweder ich wieder oder ich schicke jemanden anders vorbei. Danke für den Kaffee, Leon.«
»Gerne. Ich wünsche euch viel Erfolg.«
Sobald Andreas gegangen war, wählte Leon die Privatnummer von Schwester Marie. Sie meldete sich schon nach dem ersten Klingeln.
»Sie haben doch nicht etwa auf meinen Anruf gewartet, Marie?«
»Chef! Ist etwas passiert? Wenn Sie anrufen …« Sie unterbrach sich. »Ist etwas mit Eva Maischinger?«
»Seltsam, dass Sie nach ihr fragen, Marie. Über Frau Maischinger wollte ich nämlich mit Ihnen sprechen. Sie haben doch wieder Nachtdienst?«
»Ja, noch die ganze Woche.«
»Wenn Sie etwas früher kommen könnten? Dann hätten wir Zeit für ein Gespräch. Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Es könnte wichtig sein.«
»Sie verstehen es, jemanden neugierig zu machen«, stellte Schwester Marie fest. »Ich werde früher da sein, bis nachher also.«
Leon stand auf und streckte sich, dann bat er Moni Hillenberg um eine weitere Tasse Kaffee.
*
»Klar hat er dich niedergestochen«, sagte Sascha, »wer denn sonst? War ja niemand da außer ihm. Und mir natürlich. Die Bullen hatten zuerst mich im Verdacht, weil ich dieses blöde Messer mitgenommen habe.«
»Dich?«, fragte Marco. »Warum hättest du mich denn niederstechen sollen?«
»Das habe ich sie auch gefragt. Ich habe kein Motiv. Es war auf jeden Fall blöd von mir, dass ich das Messer mitgenommen habe. Ich dachte irgendwie, es würde euch Ärger ersparen. Also, vor allem natürlich Tom, der das eigentlich gar nicht verdient hat. War so ’ne Art Kurzschlusshandlung. Man macht ja manchmal komische Sachen, wenn man unter Druck steht. Zu blöd aber auch, dass du dich nicht erinnerst.«
Marco sah Sascha nachdenklich an. »Ganz ehrlich jetzt: Auch wenn ich mich erinnern könnte, würde ich nichts sagen. Er ist ein Mistkerl, aber dass sie ihm einen Mordversuch anhängen, finde ich übertrieben. Er hat mich bestimmt nicht umbringen wollen. Er hatte zu viel getrunken, und er war sauer, weil ich ihm eins auf die Nase gegeben hatte.«
Sascha nickte, so sah er das auch. »Ich war ja gerade bei ihm, er ist sauer, weil sie ihn erst morgen entlassen. Und er hat nicht nach dir gefragt, das ist mies von ihm. Aber andererseits … er ist ein armes Schwein. Ich möchte nicht in seiner Haut stecken.«
»Aber er hätte nicht über Eva herziehen dürfen«, sagte Marco. »Das verzeihe ich ihm nicht.«
»Ach ja, die Eva … Die war gestern ja auch hier, hat sie dich noch besucht?«
Marco starrte Sascha an, als hätte dieser plötzlich angefangen, Chinesisch zu sprechen. »Eva? Hier in der Klinik? Die weiß doch gar nicht, dass ich hier bin! Wieso hätte sie da auf die Idee kommen sollen, mich zu besuchen? Außerdem redet sie nicht mehr mit mir, seit sie sich von mir getrennt hat.«
»Sie war irgendwie komisch – aber ich habe sie nur ganz kurz gesehen. Eine Schwester war bei ihr, so eine ältere, die hat nicht gewollt, dass ich mit ihr rede und mich aufgefordert, dass ich ihr helfe, sie in ein Zimmer zu bringen.«
»Als wäre sie eine Patientin oder so?«
Sascha dachte nach. »Ja, wir haben sie dann gemeinsam in ein Zimmer gebracht, weil sie nicht gut laufen konnte. Sie sah … also irgendwie elend aus. Krankenhauskleidung hatte sie nicht an, aber sie ist komisch gegangen. Tut mir leid, das ging alles so schnell, und ich war auch so überrascht, sie hier zu sehen, dass ich gar nicht weiter darüber nachgedacht habe. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass sie mittlerweile bei dir war.«
Marco versuchte, aus Saschas Worten klug zu werden, aber es gelang ihm nicht. Er konnte sich nicht vorstellen, dass Eva seinetwegen hier gewesen war – sie hatte ihn ja gemieden seit ihrer Trennung. Aber was hatte sie dann in die Kayser-Klinik geführt? Und wieso ging sie komisch?
»Bist du ganz sicher, dass es Eva war?«
»Sehe ich aus, als würde ich Eva mit einer anderen Frau verwechseln? Natürlich war das Eva! Aber reg dich ab, ich frage einfach noch mal nach und sage dir dann Bescheid. Alles in Ordnung? Du bist plötzlich ganz blass. Mach mir hier jetzt bloß nicht schlapp – ich weiß ja, dass du letzte Nacht erst operiert wurdest.«
»Ist schon … in Ordnung.«
»Es ist wegen Eva, oder?«
Marco nickte stumm. Dann drehte er den Kopf zur Seite, damit Sascha seine Tränen nicht sah.
Sascha war nicht blind, aber klug genug, sich blind zu stellen – und eine Entscheidung zu fällen.
*
Immerhin, nur Kyra war zu Hause! Antonia atmete auf. Alle ihre Kinder gingen auf Ganztagsschulen, die anderen würden erst in etwa einer Stunde allmählich eintrudeln und mit etwas Glück brauchten sie gar nicht zu erfahren, dass ihre Mutter praktisch den ganzen Tag außer Haus gewesen war.
Kyra saß im Wohnzimmer auf dem Boden und legte ein Puzzle. »Hallo, Mama«, sagte sie. »Da bist du ja endlich.«
»Tut mir leid, dass es so spät geworden ist.« Antonia drückte ihrer Jüngsten einen Kuss auf den Scheitel und warf einen Blick auf das Puzzle. Zum Geburtstag würde Kyra ein neues bekommen, eines, das sie sich sehnlichst gewünscht hatte. »Du bist ja schon richtig weit.«
Kyra wandte sich ihr zu. »Du warst gar nicht bei Frau Lehmann, oder?«
Frau Lehmann war eine frühere Nachbarin, die seit kurzem in einem Pflegeheim war. Antonia besuchte sie tatsächlich häufiger, aber in letzter Zeit hatte die arme Frau Lehmann bei jeder unliebsamen Frage als Erklärung herhalten müssen.
»Wie kommst du darauf?«, fragte Antonia, um Zeit zu gewinnen, während sie in einem Sessel Platz nahm.
Kyra grub ihre Zähne in die Unterlippe. »Weil ich dich gesehen habe«, sagte sie schließlich.
Scham und Erschrecken ließen Antonia das Blut in die Wangen schießen. »Wo hast du mich gesehen?«
»Vor der Kinderklinik. Du hast mit Herrn Ewert gesprochen.«
Meine Güte, dachte Antonia, vielleicht haben mich auch andere schon gesehen und sich gefragt, was ich da zu suchen habe? Am Ende sogar Leon? Sie war froh, dass sie schon saß, denn ihr wurden die Knie weich. Wieso war ihr nie der Gedanke gekommen, ihre Heimlichkeiten könnten entdeckt werden, bevor sie bereit war, darüber zu reden? Hatte sie sich tatsächlich eingebildet, sie allein hätte den Gang des Geschehens in der Hand? Wie sagte ihr Schwager Andreas manchmal? ›Kommissar Zufall hat uns in die Hände gespielt.‹
Was nun? Weiter lügen? Oder ihre Jüngste einweihen und sie so zur Mitwisserin machen, während Leon nach wie vor nichts ahnte? Unmöglich! Antonia fasste einen schnellen Entschluss.
»Stimmt, ich war nicht bei Frau Lehmann«, sagte sie. Irgendwie schaffte sie es, äußerlich ruhig zu bleiben, dabei klopfte ihr Herz so heftig, dass es schmerzte.
Kyras Stimme klang mit einem Mal ganz piepsig, als sie fragte: »Bist du in Herrn Ewert verliebt?«
Diese Frage kam so unerwartet, dass Antonia beinahe gelacht hätte. Aber als sie die ängstlichen Augen ihrer jüngsten Tochter sah, verging ihr das Lachen schnell. »Aber nein, wo denkst du denn hin? Ich hatte etwas mit ihm zu besprechen. Etwas, das für mich wichtig ist.«
»Aber warum hast du dann gelogen und gesagt, dass du zu Frau Lehmann gehst?«
»Weil ich über das, worüber ich im Augenblick nachdenke, noch nicht reden wollte. Ich wollte es erst für mich klären, bevor ich darüber spreche. Hätte ich aber die Wahrheit gesagt, hätte ich auch alles andere sagen müssen, das wollte ich nicht.«
»Weiß Papa auch nichts davon?«
»Nein, Mäuschen, er weiß auch nichts davon. Aber heute ist sowieso etwas passiert, das mir gezeigt hat, dass ich jetzt reden sollte, und das werde ich auch tun. Zuerst mit Papa, dann mit euch. Das kann noch ein paar Tage dauern, aber nicht länger, das verspreche ich dir. Einverstanden?«
»Aber du bist nicht in Herrn Ewert verliebt?«, vergewisserte sich Kyra noch einmal. »Du willst dich nicht scheiden lassen und ihn dann heiraten?«
»Ganz bestimmt nicht! Wie kommst du denn nur auf diese Idee?«
»Hast du ihn öfter getroffen?«
»Ja«, gab Antonia zu, »aber das hatte andere Gründe. Mit Liebe hat das nichts zu tun.«
Tiefe Falten erschienen auf Kyras glatter Kinderstirn. »Ich glaube, Papa weiß, dass du ihn auch angeschwindelt hast. Er hat manchmal so komisch geguckt. Vielleicht hat er dich auch mal mit Herrn Ewert gesehen, als du gesagt hast, dass du zu Frau Lehmann gehst.«
»Hoffentlich nicht«, sagte Antonia. »Das wäre ja ein wirklich zu dummes Missverständnis.«
Kyra nickte ernsthaft. »Deshalb soll man ja auch immer die Wahrheit sagen, Mama.«
Nun lachte Antonia doch, obwohl ihr ein wenig ängstlich zumute war. Was, wenn Leon sie wirklich einmal mit Ingo gesehen hatte? Unmöglich war das nicht. Aber, beruhigte sie sich gleich darauf selbst, er hätte sie sicherlich danach gefragt.
Sie drückte Kyra an sich. »Ich gelobe Besserung«, sagte sie. »Und ich rede mit Papa, so bald wie möglich.«
»Und dann mit uns!«
»Ja, dann mit euch. Kannst du dich bis dahin noch gedulden?«
»Du meinst, ob ich den anderen verrate, dass du geschwindelt hast?« Kyra schüttelte den Kopf. »Ehrenwort, Mami, ich sage nichts.«
»Das habe ich zwar nicht gemeint, aber mir soll es recht sein, wenn du warten kannst, bis ich euch alles erkläre.« Antonia stand auf. »Und jetzt sollte ich mich wohl besser ums Essen kümmern. Hilfst du mir?«
Kyra warf einen bedauernden Blick auf das Puzzle, nickte dann aber und folgte ihrer Mutter in die Küche.
*
»Und was jetzt?«, fragte Leon, nachdem Schwester Marie und er ihre Informationen ausgetauscht und ein paar Vermutungen angestellt hatten.
»Überlassen Sie das mir, Chef«, schlug Marie vor. »Ich bin die ganze Nacht in der Klinik, und nachts reden die Menschen leichter als tagsüber. Eva Maischinger hätte sich mir schon letzte Nacht gerne anvertraut, das habe ich genau gespürt, aber es war noch zu früh.«
»Marco Friedrich ist also der Vater von Frau Maischingers Kind«, sagte Leon nachdenklich, »und sie liebt ihn noch immer.«
»Ich habe die Wahrheit gestern schon geahnt«, gestand Marie. »Die Art und Weise, wie sie reagiert hat, als der Name ›Marco‹ fiel, war eindeutig.«
»Und ich könnte mir vorstellen, dass es zwischen den beiden einfach … wie sagt man? Dass es dumm gelaufen ist. Ein paar Missverständnisse zu viel. Ich glaube nämlich, Herr Friedrich liebt Frau Maischinger auch immer noch. Er macht mir nicht gerade den Eindruck eines großen Draufgängers.«
»Dazu kann ich nichts sagen, ich habe ihn ja bislang noch nicht kennengelernt«, sagte Marie nachdenklich. »Aber …«
Es klopfte, Hannes Baumgarten erschien im Türspalt. »Oh, Entschuldigung, Chef, ich wollte nicht stören, aber ich hätte Sie gern gesprochen, wegen Marco Friedrich. Ich hatte da vorhin ein Gespräch mit ihm …«
»Kommen Sie doch herein, Hannes. Zufällig reden wir gerade über Herrn Friedrich. Über ihn und Eva Maischinger.«
Hannes trat ein und schloss die Tür hinter sich. »Wer ist Eva Maischinger? Ach so, die Patientin, die …« Hannes brach ab und starrte erst Leon an, dann Schwester Marie. »Soll das etwa heißen, dass die beiden sich kennen?«
»Nicht nur das, sie kennen sich sogar sehr gut. Aber erzählen Sie doch mal, worüber Sie mit mir reden wollten.«
Hannes gab also sein Gespräch mit Marco Friedrich wieder. Schwester Marie und Leon Laurin lauschten ihm mit gespannter Aufmerksamkeit. Hannes hatte seine Ausführungen gerade beendet, als es erneut klopfte. Dieses Mal war es Sascha Buder, der sich für die Störung entschuldigte und dann erklärte: »Ich komme wegen Marco, es gibt da ein paar Fragen. Aber wenn es jetzt nicht passt, kann ich später …«
»Nein, nein, kommen Sie nur herein«, forderte Leon den jungen Mann auf. »Ich glaube, wir wissen schon, worum es geht, und Sie können uns vielleicht noch ein paar offene Fragen beantworten. Aber im Großen und Ganzen wissen wir schon ganz gut Bescheid.«
Also trat auch Sascha Buder ein und schloss die letzten Wissenslücken der anderen drei, die sich daraufhin schnell darüber verständigen konnten, wie es nun weitergehen sollte.
Eine Stunde später machte sich Leon bereit, die Klinik zu verlassen. Flora Müthen und ihren Zwillingen ging es gut, auch dem kleinen Mädchen, das heute ziemlich munter gewesen war und sich im Arm seiner glücklichen Mutter offensichtlich wohl gefühlt hatte. Nun musste nur die Sache mit Eva Maischinger und Marco Friedrich noch in Ordnung kommen, aber dafür würde Schwester Marie schon sorgen.
»Ach, da bist du ja noch«, sagte Eckart Sternberg. »Ich dachte schon, ich hätte dich verpasst.«
»Hättest du auch beinahe.«
»Ich hoffe, ich muss dich heute Nacht nicht wieder aus dem Schlaf klingeln.«
»Soll ich dir was verraten? Am liebsten würde ich hierbleiben, es werden sich große Dinge tun, schätze ich.«
»Große Dinge? Was willst du damit sagen?«, fragte Eckart erstaunt
»Warte es ab.« Die Geheimnistuerei machte Leon Spaß. »Wir haben heute Nachmittag ein paar Informationen zusammengetragen, Schwester Marie, Hannes, Herr Buder und ich.«
»Herr Buder? Wieso tragt ihr mit dem Informationen zusammen? Oder hat sich herausgestellt, dass doch er es war, der mit dem Messer zugestochen hat?«
»Nein, nein, wo denkst du hin? Aber hör auf, mir weitere Fragen zu stellen, mehr sage ich nicht. Warte einfach ab, was passiert. Einen Tipp immerhin kann ich dir geben: Halte dich an Schwester Marie.«
»Man sollte nicht meinen, dass du diese Klinik leitest, Leon. Du kannst ein richtiger Kindskopf sein.«
Leon lachte nur, gab seinem Freund und Kollegen einen kräftigen Schlag auf die Schulter und verließ ohne ein weiteres Wort die Klinik.
*
»Ich soll Ihnen etwas von Herrn Dr. Laurin ausrichten, Eva«, sagte Schwester Marie. »Es geht um einen Mann namens Marco Friedrich.«
Eva wurde erst blass, dann rot, dann wieder blass. »Ja?«, fragte sie.
»Er liegt hier in der Klinik. In der vergangenen Nacht wurde er angegriffen und mit einem Messer verletzt, ziemlich schwer.«
Eva richtete sich auf. »Schwer verletzt?« Ihre Stimme zitterte.
»Ja. Aber er schwebt nicht in Lebensgefahr, er wurde letzte Nacht sofort operiert.«
»Aber … ist er überfallen worden?«
»Er hat sich geprügelt, und der andere hat schließlich ein Messer gezogen. Soll ich Ihnen die ganze Geschichte erzählen, soweit wir sie bis jetzt kennen?«
Eva nickte stumm, während sie sich langsam wieder zurücksinken ließ.
Marie hatte sich zuvor gut überlegt, was sie sagen würde, und so musste sie nicht lange nach Worten suchen. Evas Reaktionen auf das, was sie sagte, waren eindeutig. Wenn sie noch Zweifel an den Gefühlen der jungen Frau für Marco Friedrich gehabt hatte, so verschwanden sie nun restlos.
Als sie ihren Bericht beendet hatte, blieb es still. Eva weinte, ohne einen Laut von sich zu geben. Die Tränen liefen ihr über das Gesicht, aber sie achtete nicht darauf. Sie lag einfach da und weinte, und Marie hatte das Gefühl, dass es das Beste wäre, sie weinen zu lassen. Da hatte sich so viel angestaut in den letzten Monaten, es war sicher gut, wenn zumindest ein Teil der Verzweiflung, der Erschütterung, der Angst und des Kummers einfach weggespült wurde von dieser Tränenflut.
Marie blieb bei der jungen Patientin sitzen, bis die Tränen versiegten. Die anderen wussten, dass sie hier war und würden nur nach ihr rufen, wenn sie anderswo gebraucht wurde. Aber zum Glück schien es eine eher ruhige Nacht in der Notaufnahme zu werden.
»Kann ich zu ihm?«, fragte Eva. »Ich meine, jetzt gleich? Ich muss mit ihm reden, Schwester Marie. Ich … ich hätte ihn niemals wegschicken dürfen, das weiß ich doch längst. Aber ich dachte, er will mich bestimmt nicht mehr, nachdem ich ihn so schlecht behandelt hatte. Und als ich ihn dann noch mit einer anderen gesehen habe …«
»Fragen Sie ihn danach«, riet Marie. »Fragen Sie ihn und hören Sie sich an, was er dazu sagt. Wenn Sie schon reinen Tisch machen wollen, dann müssen Sie alles ansprechen, was Sie bekümmert oder beunruhigt.«
Eva nickte. »Dass Tom sich so verhält, wundert mich nicht«, sagte sie leise. »Ich kann ihn nicht ausstehen. Er hält sich für den Größten, aber wenn ihm jemand sagt, dass er das nicht ist, kann er das nicht aushalten. Er hat einen miesen Charakter.« Sie richtete sich auf. »Aber ich will mir was anziehen, wenn ich Marco besuche.«
»Ich helfe Ihnen«, sagte Marie.
*
Robert Semmler war von seinem Kollegen Hannes Baumgarten über die Verbindung von Eva Maischinger und Marco Friedrich informiert worden – und auch über den Plan, das verhinderte Liebespaar wieder zusammenzubringen. Nun wartete er gespannt darauf, dass sich etwas tat, aber vorläufig geschah leider nichts.
Es war überhaupt wenig los bislang, was ihm ebenfalls nicht gefiel. Er wurde müde, wenn er nichts zu tun hatte. Zu Beginn der Nacht ging es noch, aber je später es wurde, desto mehr sehnte er sich nach Arbeit, die ihn wach hielt. Jetzt war es noch früh am Abend, aber er musste bereits dauernd gähnen.
Nur der Ärger über Tom Fröbel hielt ihn einigermaßen wach, denn der ließ seine Übellaunigkeit vor allem an den Schwestern und Pflegern aus. Gut, dass er am nächsten Morgen entlassen werden sollte. Auf Patienten wie ihn konnten sie hier gut verzichten. Er hoffte von ganzem Herzen, dass die Polizei ihm den Messerstich noch nachweisen konnte. Dafür hatte er eine empfindliche Strafe verdient – und wahrscheinlich auch noch für einiges andere.
Marco Friedrich hingegen wurde ihm immer sympathischer. Er hoffte nur, es gelang, ihn mit seiner Ex-Freundin zu versöhnen, denn diese Geschichte schien schwer auf ihm zu lasten.
Als Robert wieder einmal nach ihm sah, fragte Marco: »Wissen Sie zufällig, ob es hier eine Patientin gibt, die Eva Maischinger heißt? Jemand hat sie hier gesehen und wollte sich danach erkundigen, aber … aber er hat es wohl vergessen.«
Sascha Buder, dachte Robert, hielt aber den Mund. »Ich meine, ich hätte den Namen schon gehört«, sagte er zögernd. »Soll ich mal nachfragen?«
»Das wäre sehr nett. Vielleicht war sie ja auch nur als Besucherin hier, aber es klang so, als … Ach, ich weiß auch nicht. Mein Kopf ist nicht besonders klar im Moment.«
»Dann schlafen Sie doch einfach eine Runde, Schlaf ist für Sie sowieso das Beste.«
»Mir geht zu viel durch den Kopf«, gestand Marco. »Aber wissen Sie was? Mir ist plötzlich etwas wieder eingefallen, das ich vergessen hatte.«
»Und was?«
»Das Messer«, sagte Marco. »Die Polizei hat mich doch dauernd gefragt, ob ich mich daran erinnern kann, an den Stich, den ich abbekommen habe, und das konnte ich nicht.«
»Aber jetzt können Sie’s?«
»Ich weiß plötzlich wieder, dass ich etwas habe aufblitzen sehen in Toms Hand, und dann war da dieser Schmerz in meiner Brust. Ich habe noch zugetreten, das ist mir jetzt auch wieder eingefallen. Danach muss ich ohnmächtig geworden sein.« Er stockte. »Eigentlich wollte ich Tom nicht verraten, auch nicht, wenn meine Erinnerung zurückkehren würde, aber mir ist klar geworden, dass ich keinen Grund habe, ihn zu schützen. Ich meine, er wollte mich bestimmt nicht umbringen, aber man nimmt ja kein Messer mit, wenn man nicht auch vorhat, es unter Umständen zu benutzen, oder?«
»Sehe ich auch so. Sie sollten das unbedingt der Polizei mitteilen.«
»Ja, das habe ich auch vor. Morgen.«
»Ich könnte dort anrufen und schon mal ankündigen, dass Sie sich jetzt erinnern. Herr Fröbel soll nämlich morgen entlassen werden, da wäre es vielleicht gut, wenn Sie Ihre Aussage vorher machten.«
»Stimmt. Aber jetzt ist es doch wahrscheinlich zu spät.«
»Überlassen wir das doch der Polizei«, schlug Robert vor. »Ich sage denen jedenfalls Bescheid.« Er ging zur Tür, aber Marcos Stimme hielt ihn noch einmal auf.
»Finden Sie es nicht feige, dass ich einen Kumpel verpfeife?«
»Erstens: Ich hatte gar nicht den Eindruck, dass Herr Fröbel Ihr Kumpel ist. Zweitens: Wenn mein Kumpel eine Straftat begeht, hat es nichts mit verpfeifen zu tun, wenn ich der Polizei das mitteile. Drittens: Das Messer hat Ihr Herz knapp verfehlt, er hätte Sie um ein Haar umgebracht. Noch Fragen?«
Marco lächelte. »Keine Fragen mehr, Euer Ehren.«
Robert lächelte auch, als er das Zimmer verließ. Am Ende des Stationsflurs sah er zwei Frauen aus dem Aufzug treten. Eine davon war Schwester Marie.
Das passt ja, dachte er, bevor er ins Dienstzimmer ging, um die Polizei anzurufen.
*
»Ich muss mit dir reden, Leon«, sagte Antonia.
Ihre Stimme war so ernst, dass sein Herz ins Stolpern geriet. Er hatte es irgendwie geschafft, sich selbst zu beruhigen wegen ihrer heimlichen Treffen mit Ingo Ewert, doch jetzt waren die Ängste wieder da, schlimmer noch als zuvor. Sie lächelte nicht einmal, und ihm entging nicht, dass sie nervös war. So schlimm also war das, was sie ihm zu sagen hatte, dass sie ihm nicht einmal in die Augen blicken konnte und dass ihre Finger nervös mit den Enden des Tuchs spielten, das sie sich um den Hals geschlungen hatte?
»Über Ingo Ewert?«, hörte er sich fragen. Er hatte diese Frage eigentlich nicht stellen wollen, sie war ihm gegen seinen Willen entschlüpft.
Ihr Erschrecken war offensichtlich, aber sie fasste sich schnell wieder. »Eigentlich nicht über Ingo, er hat mit meinen Plänen nur indirekt zu tun.«
»Mit deinen Plänen?« Er verstand nicht, worauf sie hinaus wollte.
»Ich möchte wieder arbeiten, Leon.« Jetzt sah sie ihn doch an, ihr Gesicht war noch immer ernst. »Und weil mir die Berufspraxis fehlt, habe ich Ingo gebeten, bei ihm eine Art Praktikum machen zu dürfen. Es ist dann etwas mehr geworden als ein Praktikum, weil er unbedingt Unterstützung in seiner Klinik braucht.«
Leon war fassungslos. Das war es also gewesen, was sie vor ihm verheimlicht hatte? Und er hatte sich mit wer weiß was für Gedanken gequält! Beinahe hätte er gelacht vor Erleichterung, dass es also doch keine Ehekrise gab im Hause Laurin, aber dann wurde ihm klar, was ihre Ankündigung bedeutete. »Wir haben vier Kinder«, sagte er. »Wie stellst du dir das vor?«
»Ich habe seit über sechzehn Jahren auf die Ausübung meines Berufs verzichtet«, erwiderte sie ruhig. »Ich stelle mir vor, dass du mich jetzt bei meinem Wunsch unterstützt, wieder als Kinderärztin tätig zu werden. Du weißt, wie wichtig mir mein Beruf war – und er ist es noch immer. Die Kinder werden langsam flügge, selbst Kyra ist schon ziemlich selbstständig. Sie brauchen keine Mutter mehr, die den ganzen Tag zu Hause auf sie wartet.«
»Aber …« Er verstummte. Damals hatte er es selbstverständlich gefunden, dass sie ihren Beruf aufgab und sich fortan der Familienarbeit widmete. Die klassische Rollenaufteilung. Er wusste, dass ihn Kollegen darum beneideten, dass er eine Frau hatte, die ihm ›den Rücken freihielt‹, wie einer es einmal ausgedrückt hatte. Aber die Zeiten hatten sich geändert, das war ihm natürlich nicht entgangen, auch wenn es ihn, wie er sich eingestand, mit Unbehagen erfüllte, weil er wusste, er würde einige lieb gewordene Gewohnheiten aufgeben müssen.
»Ich habe dir meine Pläne auch deshalb bis jetzt verheimlicht, weil ich wusste, du würdest Einwände erheben«, fuhr Antonia fort. »Aber wenn wir davon ausgehen, dass Frauen die gleichen Rechte haben sollten wie Männer, dann erklär mir, warum du arbeiten darfst und ich nicht.«
»Weil wir Kinder haben, die Betreuung brauchen«, sagte er. »Auch wenn sie allmählich flügge werden, wie du sagst, heißt das ja nicht, dass sie allein zurechtkommen.«
»Nur mal so als Beispiel: Du könntest weniger arbeiten, damit du mehr Zeit für die Kinder hättest.«
Er wollte aufbrausen, hielt sich aber gerade noch rechtzeitig zurück. »Ich leite eine Klinik«, sagte er steif, »da kann ich nicht sagen: Ab sofort leite ich sie nur noch halbtags.«
»Es gäbe schon Lösungen, wenn man ernsthaft danach suchen würde«, erwiderte sie, noch immer ganz ruhig, »aber das verlange ich gar nicht. Ich möchte eine Praxis eröffnen und wieder arbeiten. Wir werden eine Haushälterin einstellen, und ich werde sehen, wie viele Stunden pro Woche ich arbeiten kann, ohne dass unser Familienleben zusammenbricht.«
»Und wenn ich damit nicht einverstanden wäre?«
Sie sah ihn weiterhin unverwandt an. »Es ist mein Wunsch, Leon«, sagte sie mit sanfter Stimme. »Ich erzähle dir jetzt, was sich heute in Ingos Klinik ereignet hat.«
Er hörte der Geschichte von Susie Strasser und ihren verzweifelten Eltern zu, ohne seine Frau auch nur ein einziges Mal zu unterbrechen.
»Ich war vorher unsicher, obwohl Ingo mir immer wieder gesagt hat, dass mir vielleicht die Praxis fehlt, dass ich aber nichts vergessen oder verlernt habe. Und heute, als ich dieses kleine Mädchen sah, da wusste ich plötzlich, dass er Recht hatte: Ich bin eine gute Ärztin, und ich kann noch sehr vielen Kindern helfen, das weiß ich. Und ich sehne mich danach, es zu tun.«
Er hatte ihren Argumenten nichts entgegenzusetzen, er wusste es. Doch er konnte nicht leugnen, dass ihm die Vorstellung nicht behagte, in Zukunft öfter nach Hause zu kommen und Antonia nicht anzutreffen, weil sie noch berufliche Verpflichtungen hatte. Ja, das war egoistisch, er gestand es sich offen ein, aber war es nicht nachvollziehbar, dass er sein gut eingespieltes, angenehmes Familienleben so fortführen wollte, wie er es gewöhnt war und wie es sich seit Jahren bewährt hatte?
Nachvollziehbar schon, dachte er selbstkritisch, aber auch ungerecht. Antonia wünscht sich etwas anderes, und ich verstehe sie nur zu gut. Wenn man mir meinen Beruf wegnähme …
Sie trat zu ihm, schlang beide Arme um seinen Hals. »Mach nicht so ein Gesicht«, bat sie. »Ich will nur arbeiten, Leon. Ich will dich und die Kinder ja nicht verlassen!«
Er umarmte sie nun seinerseits. »Und wo soll deine Praxis sein?«, fragte er.
Sie lächelte. »In der Kayser-Klinik natürlich. Ich dachte, in einem der neuen Flügel. Da gibt es noch ein paar Räume, die sich sehr gut eignen würden für eine Kinderarzt-Praxis. Schließlich holt ihr eine Menge Kinder auf die Welt. Einige von denen könnten dann in meiner Praxis weiterhin betreut werden.«
Die Idee war großartig, das erkannte er sofort. Auch die Kayser-Klinik musste schließlich sehen, dass sie wirtschaftlich arbeitete, die Zeiten waren härter geworden. Und sie hatten tatsächlich noch freie Räume, in denen man ohne große Probleme eine Praxis einrichten konnte.
Im nächsten Moment schämte er sich dieser Gedanken bereits. Um wirtschaftliche Fragen ging es hier ja nicht, sondern um Antonias Wunsch, wieder in ihrem Beruf zu arbeiten, und so sagte er nur: »Das ist eine ziemlich gute Idee.«
»Ich weiß. Und dass ich wieder arbeite, ist auch eine gute Idee. Du kannst es jetzt vielleicht noch nicht so sehen, aber irgendwann wirst du mir zustimmen. Du wirst dich darüber freuen, dass du eine Frau hast, die glücklich ist, wieder in dem Beruf arbeiten zu können, den sie liebt.«
»Da hast du sicher Recht, aber es wird mir trotzdem nicht gefallen, nach Hause zu kommen, und du bist nicht da.«
»Dir wird auch anderes nicht gefallen«, stellte sie sachlich fest, »ebenso wenig wie den Kindern. Ihr werdet es alle ein bisschen weniger bequem haben.«
»Du auch. Du wirst dir jede Menge Stress aufladen.«
Sie lächelte ihn von unten herauf an. »Versuchst du jetzt auf diese Weise, mir mein Vorhaben auszureden?«
Er küsste sie. »Das würde ich nie versuchen, weil ich weiß, wie eigensinnig du bist. Du lässt dir nichts ausreden, was du unbedingt willst.«
»Wenn es einen wirklich schwerwiegenden Einwand gegen meine Pläne gäbe, vielleicht schon. Aber eure Bequemlichkeit lasse ich als solchen nicht gelten.« Sie rückte ein Stück von ihm ab. »Hast du mich mit Ingo gesehen? Weil du vorhin gleich nach ihm gefragt hast?«
Er nickte. »Ja, mehrmals sogar. Und ich habe immer gewartet, dass du mir von euren Begegnungen erzählst, aber das hast du nicht getan.«
»Du hast aber nicht gedacht, dass ich fremdgehe, oder?«
Er zögerte, aber nur kurz. »Der Gedanke ist mir gekommen«, gestand er. »Und mir hat nicht gefallen, wie ich darauf reagiert habe, dich mit einem anderen Mann zu sehen.«
»Wie dumm du bist, Leon!« Sie schmiegte sich erneut in seine Arme und küsste ihn. »Mit den Kindern reden wir an Kyras Geburtstag, einverstanden?«
»Habe ich eine Wahl?«
Sie lachte. »Nein, hast du nicht.«
*
»Guten Tag, Marco«, sagte Eva.
Er starrte sie an wie eine Erscheinung. Gerade noch hatte er mit Robert Semmler über Eva gesprochen, und nun stand sie vor ihm.
Sie kam langsam näher, sie ging sehr vorsichtig, als hätte sie Angst, eine falsche Bewegung zu machen.
»Hallo«, sagte Marco. »Bist du krank?«
Sie kam ihm verändert vor, außerdem war sie dicker geworden, schien ihm. Aber ob dick oder dünn: Sie gefiel ihm immer. Er musste sie nur ansehen, schon ging ihm das Herz auf.
Sie ließ sich vorsichtig auf den Stuhl neben seinem Bett sinken. »Ich bin schwanger«, sagte sie. »Deshalb habe ich mich von dir getrennt, weil ich ja wusste, du willst keine Kinder.«
Er war nicht sicher, ob er sie richtig verstanden hatte. »Schwanger? Von mir?«
»Von wem denn sonst? Es hat ja keinen anderen gegeben, das solltest du eigentlich wissen.«
Das Atmen fiel ihm plötzlich schwer, er hatte das Gefühl, dass er es nicht mehr schaffte, genügend Luft in seine Lungen zu pumpen. »Aber … aber das stimmt doch gar nicht, dass ich keine Kinder will, Eva!«
»Erinnerst du dich nicht an die Geschichte, die du mir erzählt hast? Von diesem Freund, der von seiner Freundin reingelegt worden ist? Sie hatte behauptet zu verhüten, aber das hat sie nicht getan, sie hat heimlich die Pille abgesetzt und deshalb …«
»Aber das heißt doch nicht, dass ich keine Kinder will!«, rief Marco aufgeregt. »Ich bin schließlich nicht von meiner Freundin hereingelegt werden, das ist etwas ganz anderes. Und die Geschichte von meinem Freund war auch eine ganz andere als unsere, die beiden haben sich überhaupt nicht geliebt, das wusste ich damals schon, deshalb fand ich die Sache mit der Schwangerschaft ja auch so gemein.«
»Aber …«, begann Eva, dann verstummte sie.
Marco griff nach ihrer Hand. »Wenn du schwanger geworden bist, kann es ja nur bei dem einen Mal passiert sein, wo ich keine Gummis dabei hatte und …« Er brach ab, die Erinnerung an ihre leidenschaftliche Vereinigung ließ seine Wangen heiß werden.
Auch Eva schien sich zu erinnern, denn sie errötete ebenfalls. »Genau dabei ist es passiert«, flüsterte sie. »Und dann habe ich dich noch mit einer anderen gesehen, mit so einer hübschen Schwarzhaarigen, da dachte ich, ich mache lieber von mir aus Schluss, bevor du mich verlässt.«
»Eine hübsche Schwarzhaarige? Wo denn?«, fragte Marco verblüfft. »Und wer soll das gewesen sein? Ich kenne überhaupt keine hübsche Schwarzhaarige.«
»Vor der Schreinerei, ich wollte dich noch einmal sehen und vielleicht doch mit dir über das Baby reden, aber dann bin ich lieber gegangen.«
Marco kam die Erleuchtung. »Das kann nur die Tochter vom Chef gewesen sein, Eva! Sie war verlobt und wollte uns damals zu ihrer Hochzeit einladen, dich und mich. Aber da war dann ja Schluss zwischen uns und … also, ich bin auch nicht hingegangen. Allein hatte ich keine Lust. Ich hatte sowieso zu gar nichts mehr Lust ohne dich.«
»Es gibt gar keine andere?«, flüsterte Eva.
»Es hat nie eine andere gegeben, ich wollte doch immer nur dich, weißt du das nicht?«
Evas Augen schwammen in Tränen.
»Wieso bist du hier? Wenn man schwanger ist, ist man doch nicht krank!«
Sie versuchte ihm zu erklären, wie es ihr in den letzten Monaten ergangen war: dass sie es geschafft hatte, ihre Schwangerschaft weitgehend zu leugnen, vor anderen, aber auch vor sich selbst, dass sie die Lust am Leben verloren hatte und schließlich auf der Straße ohnmächtig geworden und deshalb in der Kayser-Klinik gelandet war. »Dem Baby geht es offenbar trotzdem gut, obwohl ich nicht gerade nett zu ihm war, weil ich ja dauernd so getan habe, als gäbe es kein Baby. Es ist ein Mädchen, Marco.«
»Ich muss so schnell wie möglich raus aus der Klinik, damit wir heiraten können«, sagte Marco. »Und dann muss ich mit meinem Chef reden und ihm erklären, was mit mir los war. Ich glaube nämlich, dass er überlegt, mich rauszuschmeißen, weil ich in letzter Zeit so unzuverlässig war.«
»Du und unzuverlässig? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen!«, sagte Eva.
»Doch. Ich habe zu viel getrunken, ich war dauernd in der Kneipe«, gestand Marco. »Ich … ich war so schrecklich unglücklich deinetwegen, Eva.«
»Ich war auch unglücklich. Und jetzt sagst du, dass ich alles ganz falsch verstanden habe.«
»Aber wirklich alles. Wie konntest du nur annehmen, ich würde mich von dir hereingelegt fühlen? Ich wusste doch, dass wir das eine Mal nicht verhütet haben, und das war ja nicht deine Schuld. Ich … ich war doch so verrückt nach dir, dass ich mich nicht beherrschen konnte, denkst du, ich hätte das vergessen?«
Sie weinte jetzt, dabei war sie so glücklich wie seit langem nicht.
Marco rückte ein bisschen näher zu ihr. »Ich kann mich nicht gut bewegen«, sagte er. »Aber ich würde dich gerne küssen.«
Sie stemmte sich hoch, was ihr nicht ganz leicht fiel, aber sie schaffte es. Und dann küsste sie Marco so zärtlich, wobei ihre Tränen auch über sein Gesicht liefen, dass der Kummer, der ihn nun schon lange begleitete, sich wie Nebel im Sonnenschein einfach in nichts auflöste.
Schwester Marie, die einen vorsichtigen Blick ins Zimmer warf, um sich zu vergewissern, dass es ihrer Patientin und deren Freund gut ging, schloss die Tür rasch wieder. Um diese beiden musste sich niemand mehr Sorgen machen.
*
Tom Fröbel hörte auf zu leugnen, dass er Marco mit einem Messer angegriffen hatte, als Andreas Brink ihn mit Marcos Aussage und einem schließlich doch noch sichergestellten Fingerabdruck auf dem Messer konfrontierte. Immerhin konnte Tom glaubhaft machen, dass er Marco nicht ernsthaft hatte verletzen wollen, stattdessen gab er zu, dass vor allem gekränkte Eitelkeit – wegen Eva Maischingers Abfuhr – ihn veranlasst hatte, Marco bei jeder Gelegenheit zu beleidigen und zu reizen. Da Marco beschlossen hatte, auf eine Anzeige zu verzichten, war noch nicht sicher, wie die Sache ausgehen würde.
In der Kayser-Klinik waren jedenfalls alle froh darüber, dass sich das junge Liebespaar wiedergefunden hatte. Marco erholte sich schnell, und Evas Probleme verschwanden praktisch von dem Moment an, da sie sich mit dem Vater ihres Kindes ausgesprochen hatte. Innerhalb kürzester Zeit wurde sie so rund, wie es für eine Schwangere im bald siebten Monat angemessen war, und es zeigte sich, dass sie viel mehr Unterstützung erfuhr, als sie angenommen hatte. Weder ihre noch Marcos Eltern stellten sich gegen die Verbindung ihrer noch so jungen Kinder, und Marcos Lehrherr war vor allem froh, dass er sich in seinem Auszubildenden doch nicht getäuscht hatte – das nämlich war seine Befürchtung gewesen. Dass der junge Mann nun schon Vater wurde, bevor er seine Ausbildung beendet hatte, fand er zwar nicht ideal, aber eine Katastrophe war es schließlich auch nicht.
Alles jedenfalls war auf einem guten Weg, als Kyra Laurin endlich ihren elften Geburtstag feierte. Sie jubelte über ihre Geschenke, und nachmittags ging sie mit ihren Freundinnen und Freunden – und ihrem Papa, was ein ganz besonderes Geschenk war – in das Musical, für das er Karten besorgt hatte. Die Mädchen und Jungen waren begeistert und folgten dem Geschehen auf der Bühne, wenn es besonders spannend wurde, mit angehaltenem Atem.
Danach gab es bei Laurins noch ein kaltes Büffet, bevor die Kinder von ihren Müttern oder Vätern abgeholt wurden. Kyra war selig. »Das war der aller-aller-allerschönste Geburtstag meines Lebens«, sagte sie mit glänzenden Augen.
»Da wir hier alle gerade so schön zusammensitzen, möchte ich die Gelegenheit nutzen, mit euch über meine Zukunftspläne zu sprechen«, erklärte Antonia.
Kaja, die gerade beschlossen hatte, in ihr Zimmer zu gehen, blieb stehen. »Zukunftspläne?«, fragte sie.
»Ja. Ich werde wieder arbeiten«, erwiderte Antonia freundlich. »Ich mache eine Praxis auf und fange wieder an als Kinderärztin zu arbeiten. Das wird unser Familienleben natürlich verändern.«
Kaja erstarrte. »Und wir haben dabei natürlich kein Wörtchen mitzureden.«
»Falls du damit meinst, ob ihr etwas zu entscheiden habt: Nein, das habt ihr nicht. Ich bin jetzt all die Jahre zu Hause geblieben, und das habe ich gern gemacht, weil ich das Gefühl hatte, ihr braucht mich. Aber das ist ja nun jedes Jahr ein bisschen weniger der Fall. Ihr werdet älter und selbstständiger, ihr sucht euch Freunde außerhalb, und so soll es auch sein. Und da ich meinen Beruf immer sehr geliebt habe, möchte ich jetzt wieder anfangen, ihn auszuüben.«
»Kannst du das denn überhaupt noch?«, fragte Konstantin. »Ich meine, das ist ja schon ziemlich lange her …«
»Ich war in den letzten paar Monaten regelmäßig in der Ewert-Klinik und habe dort eine Art Praktikum gemacht, das sich dann zu richtiger Arbeit ausgewachsen hat«, erklärte Antonia. Sie begegnete Kyras Blick, sah das Verstehen in den Augen ihrer Jüngsten und lächelte ihr liebevoll zu. »Es stimmt, mir fehlt die Berufspraxis, aber vergessen habe ich eigentlich nichts. Ich habe eine Menge neuerer Fachliteratur gelesen und denke, dass ich jetzt so weit bin, meinen Plänen Taten folgen zu lassen.«
Kaja wandte sich anklagend an ihren Vater. »Hast du das gewusst?«, fragte sie.
»Zuerst nicht, dann schon«, antwortete er. »Ich war zuerst auch nicht begeistert, muss ich gestehen, aber dann ist mir klar geworden, dass ich einen ziemlich egoistischen Standpunkt eingenommen habe: Es ging mir vor allem darum, dass ich auf nichts verzichten möchte, woran ich mich in den letzten anderthalb Jahrzehnten gewöhnt habe.«
Aber davon wollte Kaja nichts hören. »Wir kommen dann also nach Hause, und niemand ist da!«
Antonia musste lachen. »Ich war immer da, Kaja – aber wie oft hast du dich denn, wenn du nach Hause gekommen bist, in den letzten Jahren zu mir gesetzt, mich gefragt, wie mein Tag war und ein richtiges Gespräch mit mir geführt? Ihr wolltet wissen, was es zu essen gibt, dann seid ihr meistens in euren Zimmern verschwunden. Ich beklage mich nicht darüber, ich war früher auch so. Aber tu doch jetzt bitte nicht so, als brauchtest du eine Mutter, die zu Hause ist, wenn du aus der Schule kommst.«
Kaja errötete heftig, wusste sie doch darauf nichts zu erwidern.
»Ich find’s gut«, sagte Kevin. »Du bist bestimmt eine tolle Ärztin, Mama.«
»Ich find’s auch gut«, stimmte Konstantin seinem jüngeren Bruder zu.
»Ich weiß noch nicht«, sagte Kyra. »Wenn ich nach Hause komme, und du bist nicht da, Mami, das finde ich nicht schön. Aber ich finde es gut, dass du andere Kinder wieder gesund machen willst.«
»Wie schön, dass ihr euch alle einig seid«, fauchte Kaja. »Da brauche ich ja nichts mehr zu sagen.« Sie stürmte hinaus in den Flur und die Treppe hinauf in ihr Zimmer, nicht ohne dessen Tür heftig hinter sich zuzuknallen.
Antonia überlegte, ihr zu folgen, aber Konstantin hielt sie zurück. »Lass sie, Mama, sie kriegt sich schon wieder ein. Sie hat Ärger mit ihrem Freund, deshalb ist sie so gereizt.«
Antonia und Leon fielen aus allen Wolken. »Sie hat einen Freund?«
»Oh, Mist, das sollte ich natürlich für mich behalten. Er heißt Timo und scheint ziemlich blöd zu sein. Jedenfalls hat er heute mit einer anderen rumgemacht.«
»Rumgemacht?«, fragte Antonia.
»Na ja, er hat sie halt angebaggert, und das vor Kajas Augen. Ich habe ihr gleich gesagt, dass der Typ eine Null ist, aber sie wollte mir nicht glauben, weil sie bis über beide Ohren in ihn verknallt ist. Oder war. Vielleicht hat ihr das heute ja die Augen geöffnet.«
»Ich habe vielleicht auch bald einen Freund«, sagte Kyra in die Stille hinein, die auf Konstantins Worte folgte. »Er hat mich noch nicht gefragt, ob ich seine Freundin sein will, aber wenn er es tut, sage ich ›ja‹. Und dass ihr es wisst: Er ist auf keinen Fall eine Null.«
Als Leon sich von dieser weiteren Überraschung erholt hatte, wandte er sich an seine Söhne. »Was ist mit euch? Möchtet ihr uns jetzt auch von euren Freundinnen erzählen?«
»Ich habe keine!«, erklärte Kevin sofort. »Mir reicht es, dass Mike mein Freund ist, das ist anstrengend genug, weil er neuerdings manchmal so blöd ist.«
»Ihr sprecht also wieder miteinander?«, fragte Antonia.
Kevin nickte. »Jedenfalls brauche ich nicht auch noch eine Freundin.«
»Und du, Konny?«
»Na ja, es gibt da schon ein Mädchen, das ich toll finde, aber bis jetzt ist noch nichts passiert«, erklärte Konstantin.
»Da sieht man mal, wie ahnungslos eine Mutter sein kann, auch wenn sie immer zu Hause ist«, stellte Antonia trocken fest.
Kyra kletterte auf ihren Schoß und umschlang sie mit beiden Armen.
»Möchtest du wieder ein kleines Mädchen sein?«
»Nur manchmal, Mami.«
Da wollten Kevin und Konstantin nicht zurückstehen. Sie ließen sich neben ihren Eltern auf das Sofa fallen, einer rechts und einer links, und umarmten alles, was zwischen ihnen war.
Nur Kaja fehlte, und sie ließ sich an diesem Abend auch nicht mehr blicken.