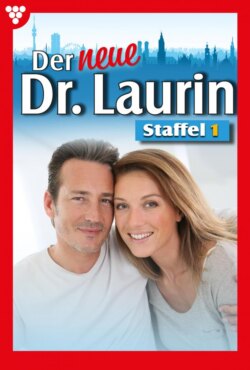Читать книгу Der neue Dr. Laurin Staffel 1 – Arztroman - Viola Maybach - Страница 9
ОглавлениеProfessor Joachim Kayser war fassungslos. »Du hast vier Kinder, Antonia!«, hielt er seiner Tochter aufgebracht vor. »Und da willst du wieder arbeiten? In meinen Augen ist das verantwortungslos, aber du hast ja schon als junge Frau immer deinen Kopf durchsetzen müssen.« Er wandte sich an seinen Schwiegersohn. »Und du hast ihr diesen Unsinn nicht ausreden können?«
Dr. Leon Laurin fing einen Blick seiner Frau auf, der ihn warnte. Dieses Gespräch brachte ihn in eine unangenehme Situation, da er die Vorstellung, dass Antonia schon bald wieder als Kinderärztin arbeiten würde, auch nicht besonders angenehm fand. Geld verdiente er als Chef der Kayser-Klinik, die er von seinem Schwiegervater übernommen hatte, genug, und er hatte sich daran gewöhnt, dass Antonia zu Hause war, wenn er müde aus der Klinik kam. Manchmal, wenn es viel zu besprechen gab, führten sie dann lange Gespräche, es kam aber auch vor, dass sie nur still beieinander saßen. Er liebte diese ruhigen Stunden mit ihr. Ruhe war in seinem Leben selten und daher besonders kostbar.
Er war schließlich auch nur ein Mensch: Er war nicht gern allein und liebte es, wenn seine Frau ihn verwöhnte und umsorgte. Bald würde sie dafür deutlich weniger Zeit haben als bisher. Natürlich gefiel ihm diese Vorstellung nicht, insofern berührten die Vorhaltungen seines Schwiegervaters einen wunden Punkt.
Andererseits wusste er, dass seiner Frau der Verzicht auf ihren Beruf schwer gefallen war, obwohl es für sie nie einen Zweifel daran gegeben hatte, dass sie der Kinder wegen zu Hause bleiben würde. Vier Kinder zog man nicht nebenbei auf, wenn es nicht zwingende Gründe dafür gab, wie etwa Geldsorgen. Und sie war eine sehr gute Ärztin gewesen, so lange sie praktiziert hatte. Erst neulich waren sie einer jungen Frau begegnet, die gesagt hatte: »Sie haben mir damals die Angst vor Ärzten genommen, Frau Doktor! Wenn Sie nicht gewesen wären …«
Leon merkte, dass sein Schwiegervater noch immer auf Antwort wartete – und nicht nur er. Auch Teresa, seine zweite Frau, und Antonia sahen ihn an und warten.
»Unsere Kinder sind sehr selbstständig, sie wissen, was sie wollen, und sie nabeln sich allmählich von uns ab. Das gilt auch für Kyra«, sagte er, viel ruhiger wirkend, als ihm zumute war. »Ich verhehle nicht, dass mir der Gedanke zunächst auch nicht gefallen hat, aber die Zeiten haben sich geändert, Joachim. Antonia ist eine sehr gute Ärztin, sie kann noch vielen Kindern helfen. Wer bin ich, sie daran zu hindern, wenn es ihr sehnlichster Wunsch ist? Ich habe versucht, mir vorzustellen, wie ich reagieren würde, wenn man mir meinen Beruf wegnähme. Um es kurz zu machen: Es ist mir nicht gelungen.«
Er hörte Antonia erleichtert ausatmen und bemerkte ein kleines Lächeln auf Teresas Gesicht, das ihm wehmütig vorkam. Sie hatte damals, als Joachim und sie geheiratet hatten, sofort ihre Boutique aufgegeben, ihm zuliebe, wobei Joachim das als Selbstverständlichkeit betrachtet hatte, obwohl sie beide nicht mehr in dem Alter gewesen waren, in dem man eine Familie gründete. Antonia hatte schon gelegentlich laut darüber nachgedacht, ob Teresa diesen Schritt jemals bereut hatte, aber nie gewagt, ihr diese Frage zu stellen.
Joachim Kayser betrachtete seinen Schwiegersohn kopfschüttelnd. »Ich muss mich doch sehr über dich wundern«, bemerkte er, »dass du dir von Antonia auf dem Kopf herumtanzen lässt, statt mit der Faust auf den Tisch zu schlagen. Kyra ist erst elf, natürlich braucht sie ihre Mutter!«
»Mit der Faust auf den Tisch schlagen!« Antonia war zornig, und es war ihr anzusehen. »Das ist wieder mal typisch für dich, so etwas zu sagen, Papa. Wo lebst du eigentlich? In welchem Jahrhundert? Ist dir schon mal aufgefallen, dass es nicht mehr so ist wie früher: Der Mann verdient das Geld, und die Frau bleibt zu Hause?«
»Ach, und das war schlecht?«, rief Joachim Kayser. »Hat es den Kindern geschadet, dass ihre Mütter sie umsorgt haben?«
»Vielleicht hat es ja den Müttern geschadet?« Antonia war aufgesprungen. »Hast du jemals versucht, dich in die Frauen hineinzuversetzen, die vielleicht auch klug waren und Träume hatten, die sie gerne verwirklicht hätten? Du siehst alles immer nur von deinem Standpunkt aus, immer hast du bestimmt, wie es laufen soll. Du hast mich ja damals nicht einmal unterstützt, als ich meine erste Praxis eröffnet habe. Das musste Onkel Bert tun.«
Teresa und Leon kamen gleichzeitig zu dem Ergebnis, dass es dringend geboten war, einzugreifen, bevor die Situation weiter aus dem Ruder lief. Es gab immer wieder heftige Streits zwischen Antonia und ihrem Vater, weil beide von aufbrausendem Temperament waren und dann Dinge sagten, die sie später bereuten. Sie liebten einander, aber sie wussten auch um ihre wechselseitigen Schwächen, so dass sie sich schlimmere Verletzungen zufügen konnten, als Fremde es vermocht hätten. Der Hinweis, dass Joachim Kaysers Bruder Bert seiner Nichte damals das Geld für die Eröffnung ihrer Praxis gegeben hatte, war so ein Punkt: Joachim Kayser wurde nur sehr ungern daran erinnert.
Aber bevor er reagieren konnte, sagte Teresa: »Hört auf zu streiten, bitte. Ich möchte, dass dieser Abend friedlich zu Ende geht.«
Und Leon setzte hinzu: »Wir sollten uns auf den Heimweg machen, Antonia, es ist schon spät geworden.«
Aber Antonia blieb stur. Ihr Vater war zu weit gegangen, sie wollte jetzt nicht zurückstecken und gute Miene zum bösen Spiel machen. Im Gegenteil: Etwas reizte sie, die Sache auf die Spitze zu treiben. Sie wusste, dass es unklug war, sie fand sich selbst sogar ein wenig kindisch, aber sie blieb sitzen.
»Ich will noch nicht nach Hause«, sagte sie störrisch. »Ich will, dass wir das mal zu Ende diskutieren. Sag mir eins, Teresa: Hast du nie bereut, deine Boutique aufgegeben zu haben? Es war doch klar, dass ihr beiden keine Kinder mehr bekommt, ihr habt ja erst kurz vor uns geheiratet. Und du hast sehr an deinem Geschäft gehangen. Trotzdem bist zu nach deiner Heirat zu Hause geblieben. Warum?«
»Antonia!«, rief Leon warnend.
Er sah das Unheil kommen. Sein Schwiegervater war nun einmal ein konservativer Mann, er würde sich jetzt, mit über siebzig, nicht mehr ändern. Wozu also eine solche Diskussion? Abgesehen davon hatte Antonia ihre Stiefmutter mit dieser Frage in eine unangenehme Situation gebracht. Er verstand nicht, warum sie das tat.
»Weil ich deinen Vater liebe«, antwortete Teresa ganz ruhig, und wieder einmal war seine Bewunderung für sie grenzenlos.
Er hatte Teresa schon gekannt, bevor sie seine Schwiegermutter geworden war, denn bei ihr waren seine Schwester Sandra und er aufgewachsen, nachdem sie ihre Eltern durch einen tödlichen Unfall verloren hatten. Sie war die beste Freundin ihrer Mutter gewesen und hatte nicht gezögert, die beiden Waisenkinder zu sich zu nehmen und großzuziehen.
Er hing mit zärtlicher Liebe an ihr. Dass das Schicksal es dann so gefügt hatte, dass Teresa auch noch seine Schwiegermutter geworden war, sah er bis heute als Glücksfall an. Sandra und er waren seinerzeit der Grund dafür gewesen, dass sich Teresa von ihrer Jugendliebe Joachim Kayser getrennt hatte. Und dann waren sie, viele Jahre später, doch noch ein Paar geworden – und zwar ein sehr glückliches.
»Ist es dir schwer gefallen?«, fragte Antonia weiter.
Teresa lächelte. »Ja und nein. Ich habe an meiner Boutique gehangen, das weißt du. Aber ich wusste, dein Vater würde es nicht verstehen, wenn ich weiterhin arbeite. Und ich wollte mit ihm zusammen sein. Also habe ich eine Entscheidung gefällt.«
»Du hättest versuchen können, ihn zu überzeugen, dass dir die Boutique sehr wichtig ist.«
»Ja, das hätte ich«, erwiderte Teresa. »Heute würde ich es vielleicht tun, weil sich, wie du richtig festgestellt hast, die Zeiten geändert haben. Aber damals habe ich nicht einmal darüber nachgedacht.«
Leon sah den Gesichtsausdruck seines Schwiegervaters: Offenbar war es Joachim Kayser noch nie in den Sinn gekommen, dass seine geliebte Teresa vielleicht gerne ihre Boutique behalten hätte, auch als seine Ehefrau. Er sah noch fassungsloser aus als zu Beginn dieses Gesprächs, und es hatte ihm tatsächlich die Sprache verschlagen.
Antonia schien endlich genug zu haben, denn sie stand auf. »Ich werde jedenfalls wieder eine Praxis eröffnen, Papa, gewöhn dich also besser an den Gedanken.« Sie klang sehr viel friedfertiger als zuvor.
Joachim Kayser erhob sich, er sah müde und ein wenig verwirrt aus, Leon empfand beinahe Mitleid mit ihm.
Auf dem Heimweg fragte Leon: »War das nötig? Ich meine, musstest du Teresa da mit hineinziehen? Du hast sie in eine unangenehme Situation gebracht, das muss dir doch klar gewesen sein.«
»Na, und?«
Beinahe hätte er gelacht. Antonia war Mitte vierzig, aber ihre Antwort klang ganz nach der jungen Frau, in die er sich damals verliebt hatte. Sie hatte ihn ja wochenlang so kühl und abweisend behandelt, dass er manchmal gedacht hatte, es werde ihm nie gelingen, sie für sich zu gewinnen.
Aber so einfach wollte er sie nicht davonkommen lassen. »Du solltest sie da nicht hineinziehen. Ich meine, in diesen Konflikt zwischen dir und deinem Vater. Sie hat damit nichts zu tun. Und wenn du wissen willst, ob es ihr schwer gefallen ist, damals ihre Boutique aufzugeben, dann frag sie danach, ohne dass dein Vater dabei ist. Wie die beiden das untereinander regeln, ist ihre Sache. So wie es unsere Sache ist, wie wir das machen.«
Sie schwieg. Erst als sie schon fast zu Hause waren, sagte sie: »Du hast Recht, das war kindisch. Aber er hat mich so auf die Palme gebracht wie früher! In welcher Welt lebt er denn? Merkt er nicht, dass sich alles verändert hat? Muss er immer noch den Chef herauskehren, sogar bei sich zu Hause? Und dann diese Rede an dich! Ich dachte, ich platze! Diese Vorstellung, der Mann haut mit der Faust auf den Tisch, und danach wird gemacht, was er für richtig hält!« Sie redete sich schon wieder in Rage.«
»Dein Vater ist alt und wird seine Ansichten nicht mehr ändern.«
»So alt ist er nun auch wieder nicht, dass er nicht noch dazu lernen könnte«, erklärte Antonia kämpferisch. Doch nach einer Weile setzte sie mit einem halben Lächeln hinzu: »So wie du, zum Beispiel.«
»Ich bin um einiges jünger, und ich habe auch immer noch Schwierigkeiten, mir vorzustellen, wie es sein wird, wenn ich nach Hause komme, und du bist noch in deiner Praxis.«
»Du wirst dich daran gewöhnen«, erklärte Antonia.
»Muss ich ja wohl«, brummte er, als er die Haustür aufschloss.
Sie schlang beide Arme um seinen Hals. »Danke, dass du mich verteidigt hast, ich weiß, dass dir das nicht ganz leicht gefallen ist«, flüsterte sie, bevor sie ihn küsste.
Als sie sich von ihm löste, lauschte sie. »Da redet doch noch jemand! Das muss Kaja sein!«
Mit schnellen Schritten lief sie zur Treppe, eilte hinauf und öffnete die Tür zum Zimmer ihrer älteren Tochter.
Kaja versuchte noch, ihr Handy zu verstecken, aber sie war nicht schnell genug.
»Weißt du, wie spät es ist?«, fragte Antonia. »Du musst morgen früh raus, und da telefonierst du noch mitten in der Nacht?«
»Es war wichtig«, erwiderte Kaja störrisch. »Und ich kann es nicht leiden, wenn du hier einfach reingerauscht kommst. Du willst auch, dass man deine Privatsphäre achtet.«
»Ich bin erwachsen, du nicht. Mach das Handy aus und gib es mir.«
»Nein, ich …«
»Mach es aus und gib es mir! Wir hatten eine klare Abmachung, an die du dich nicht gehalten hast. Also …«
Leon erschien neben Antonia, er hatte genug gehört, um zu wissen, worum es ging. »Mach schon, Kaja«, sagte er ruhig.
Schimpfend schaltete Kaja ihr Handy aus und gab es ihrer Mutter. »Ihr benehmt euch, als wäre ich noch ein Baby! Keine meiner Freundinnen wird so bevormundet wie ich.«
Konstantin erschien auf dem Flur, Kajas Zwillingsbruder. »Was ist denn los?«, fragte er verschlafen. »Warum macht ihr hier so einen Stress mitten in der Nacht?«
»Bedank dich bei Kaja«, erwiderte Antonia. »Aber der Stress ist schon vorüber. Gute Nacht.«
Als sie im Bett lagen, schmiegte sich Antonia in die Arme ihres Mannes.
»Was sollen wir nur mit Kaja machen? Sie wird jeden Tag aufmüpfiger. Manchmal erkenne ich sie gar nicht wieder.«
»Du warst doch bestimmt auch schwierig in der Pubertät«, murmelte Leon, der schon halb schlief.
»Soll das jetzt eine Aufmunterung sein?«, fragte Antonia.
Sie bekam keine Antwort mehr, und wenig später schlief sie auch ein, allem Stress mit ihrem Vater und Kaja zum Trotz.
*
»Mach nicht so ein Gesicht, Jo«, bat Teresa Kayser ihren Mann, als Antonia und Leon sich verabschiedet hatten.
»Das sagt sich so leicht. Ich habe gerade erfahren, dass meine Frau nicht so glücklich mit mir ist, wie ich immer dachte.«
»Aber ich bin glücklich, und das weißt du auch!«
»Hast du nicht gerade eben zu meiner Tochter gesagt, dass es dir nicht leicht gefallen ist, deine Boutique nach unserer Hochzeit aufzugeben?«
»Es ist die Wahrheit. Findest du das so schwer zu verstehen? Es war mein Geschäft, ich hatte es aufgebaut, und ich war stolz darauf.«
»Aber warum hast du nicht mit mir darüber gesprochen?«
»Du hast nie gefragt«, erwiderte Teresa sanft. »Und letzten Endes war mir die Boutique nicht so wichtig wie du. Ja, ich hätte sie gern behalten, aber für dich wäre es nicht einmal vorstellbar gewesen, eine Frau zu haben, die arbeitet.«
Seine betroffene Miene zeigte ihr, dass sie Recht hatte.
»Ich wusste ja außerdem«, fuhr sie fort, »dass du die Klinikleitung in absehbarer Zeit an Leon übergeben wolltest, da hätte meine Arbeit in der Boutique ohnehin nicht mehr gepasst. Es schien mir besser zu sein, wenn wir beide in den Ruhestand gehen. Unser Leben hat sich dann ja auch sehr verändert.«
Joachim schwieg eine Weile. »Stimmst du Antonia zu? Bin ich ein verbohrter alter Mann, der nicht mehr mit der Zeit geht?«
»So hat sie das nicht gesagt.«
»Aber gemeint hat sie es so.«
»Jo«, sagte Teresa, »wir beide sind alt, Antonia ist Mitte vierzig. Sie hat die Hälfte ihres Lebens noch vor sich, und heute sind Frauen nicht mehr damit zufrieden, ihren Männern den Haushalt zu führen und die Kinder großzuziehen. Ganz abgesehen davon, dass viele Ehen scheitern und ein Beruf für Frauen also auch eine Art Lebensversicherung ist. Es stimmt schon: Die Welt hat sich weitergedreht, alles hat sich verändert.«
»Zum Schlechten«, grollte Joachim. »All diese Kinder, um die sich niemand mehr richtig kümmert, weil beide Eltern keine Zeit haben …«
»Du kannst deiner Tochter gewiss nicht vorwerfen, dass sie sich nicht um ihre Kinder gekümmert hätte! Und noch etwas: Viele Frauen arbeiten, weil das Geld sonst nicht reicht.«
»Das trifft aber auf Antonia auf keinen Fall zu.«
»Nein, sicher nicht. Aber sie möchte arbeiten, sie liebt ihren Beruf, wie auch wir unsere Berufe geliebt haben. Was soll schlecht daran sein, wenn sie wieder als Ärztin arbeitet? Kyra ist elf und ein sehr selbstständiges Mädchen, die anderen drei sind sowieso mehr unterwegs als zu Hause. Was also spricht gegen ihre Pläne?«
Sie hatte ihm den Wind aus den Segeln genommen, und sie wusste es. Es kam nicht oft vor, dass sie sich in einer Diskussion gegen ihn stellte. Tat es doch einmal, brachte ihn das jedes Mal aus dem Konzept.
»Denk noch einmal darüber nach«, schlug sie vor. » Du bist kein verbohrter alter Mann, Joachim, aber wir beide sind in einer anderen Zeit mit anderen Vorstellungen groß geworden. Gewiss sind nicht alle neuen Entwicklungen gut, aber früher war auch nicht alles in Ordnung, auch wenn wir das in unserer Erinnerung oft verklären. Lass bitte nicht zu, dass es zwischen dir und Antonia wieder zu einem dauerhaften Zerwürfnis kommt – wie damals. Ich weiß ja nur aus Erzählungen davon, aber das muss sich nicht wiederholen, finde ich. Und bedenke bitte, dass sie zwanzig Jahre älter und Mutter von vier Kindern ist, kein unerfahrenes junges Ding, das noch nicht weiß, wie es im Leben zugeht.«
Endlich nickte er, seine Züge entspannten sich. »Das stimmt«, sagte er. »Eigentlich ist sie alt genug, um die Konsequenzen ihres Handelns abzuschätzen.«
»Siehst du? Das denke ich auch.«
Er stieß einen langen Seufzer aus. »Aber ich finde es trotzdem falsch, Resi.«
»Dann behalte es für dich«, schlug sie vor. »Auch wenn es dir schwer fällt.«
»Weil ich ja ein verbohrter alter Mann bin«, murmelte er, aber sie hörte das Lächeln, das seine Worte begleitete.
Er liebte seine Tochter über alles, ebenso wie seine Enkelkinder. Sie verstand, dass er sich Sorgen machte. Die gestand sie ihm auch zu. Nur musste er Antonia trotzdem tun lassen, was sie für richtig hielt. Er hatte ihr seine Meinung gesagt, mehr, fand sie, sollte er nicht tun.
Sie hatte keine eigenen Kinder, aber sie hatte immerhin zwei groß gezogen, sie wusste also, wie schwer es sein konnte, jemanden, den man liebte und um den man sich sorgte, auch einmal einen Weg beschreiten zu lassen, den man für falsch oder sogar gefährlich hielt.
»Nein«, widersprach sie, »weil du ein Vater bist, der seine Tochter liebt und Vertrauen zu ihr hat.«
Daraufhin zog Joachim sie in seine Arme und küsste sie.
*
»Ich liebe dich, Ella«, sagte Florian Ammerdinger, »aber ich will keine Kinder, das habe ich dir vor unserer Heirat gesagt. Tu also nicht so, als hätte ich dich getäuscht.«
»Ich weiß, dass du es gesagt hast.« Ella hatte Mühe, ihre Tränen zurückzuhalten. »Aber ich dachte, das ist so eine Phase, die vorübergeht. Ich bin nicht auf den Gedanken gekommen, dass du dabei bleibst.«
»Ich bleibe dabei«, erklärte er. »Es tut mir leid, dass du jetzt enttäuscht bist, aber ich werde meine Meinung nicht ändern.« Er zog sie in seine Arme und drückte sie an sich. »Ich liebe dich wirklich sehr, und es tut mir leid, dass ich dich enttäuschen muss, aber glaub mir, ich kann nicht anders. Ich will nicht Vater werden, um nichts in der Welt.«
Sie hielt die Tränen zurück, bis er gegangen war, dann ließ sie sich aufs Bett fallen und schluchzte hemmungslos, bis ihr einfiel, dass sie sich ja auf den Weg zur Kayser-Klinik machen musste, dort hatte sie einen Termin bei Herrn Dr. Laurin. Sie musste mit jemandem über ihre Situation sprechen, sonst würde sie verrückt werden. Und Dr. Laurin schien ihr der richtige Gesprächspartner zu sein. Er konnte gut zuhören, er war ein ausgezeichneter Arzt, und sie wusste, er würde sie verstehen. Ob er ihr in diesem besonderen Fall freilich helfen konnte, bezweifelte sie. Aber wenn sie sich einmal alles von der Seele reden konnte, würde sie sich zumindest ein wenig besser fühlen.
Sie wusch sich das Gesicht und schminkte sich, um die Spuren ihres verzweifelten Tränenausbruchs zu überdecken. Sie war heute zum Spätdienst im Kaufhaus eingeteilt worden, wo sie in der Abteilung für Damenmode arbeitete. Sie hatte immer Verkäuferin werden wollen, es gefiel ihr, Kundinnen zu beraten und die richtigen Kleidungsstücke für sie zu finden. Sie konnte sich keinen schöneren Beruf vorstellen.
In der Kayser-Klinik musste sie nicht lange warten, bis sie aufgerufen wurde.
»Frau Ammerdinger«, sagte Dr. Laurin. »Was führt Sie zu mir?«
»Ich … ich muss mit Ihnen reden, Herr Doktor.«
»Denken Sie, Sie sind schwanger?«
Sie spürte, dass ihr schon wieder die Tränen kamen, weshalb sie sie wegzublinzeln versuchte. »Nein!«, stieß sie hervor. »Und ich werde auch nie schwanger werden!«
Er sah sie fragend an. Ella Ammerdinger war eine ausgesprochen attraktive junge Frau, mit schönen blonden Haaren, großen, veilchenblauen Augen und einer reizvollen Figur. Sie und ihr Mann waren ein noch junges, sehr verliebtes Paar, das häufig Sex hatte, wie ihm seine Patientin mit rosig angehauchten Wangen und glückstrahlendem Blick gestanden hatte. Daran konnte es also nicht liegen.
»Aber bei Ihnen ist alles in bester Ordnung, Frau Ammerdinger, ich habe Sie ja gründlich untersucht. Ihr Mann allerdings … Ich hatte Ihnen ja gesagt, dass er sich ebenfalls untersuchen lassen müsste, wenn Sie weiterhin nicht schwanger werden.«
»Er wird sich nicht untersuchen lassen, er will keine Kinder, nicht nur jetzt nicht, sondern überhaupt nie.«
Leon Laurin schwieg und wartete auf weitere Erklärungen. Ella Ammerdinger war schon länger seine Patientin, und er wusste, wie sehnsüchtig sie sich ein Kind wünschte. Wenn er sie gefragt hatte, wann ihr Mann bereit sei, sich ebenfalls untersuchen zu lassen, hatte sie jedes Mal ausweichend gesagt, er finde es noch zu früh für ein Kind. Mehr Informationen über Florian Ammerdinger hatte er bislang nicht gehabt und angenommen, das Problem werde sich eines Tages auf natürliche Weise lösen. Ein frisch verliebtes Paar dachte ja nicht immer an Verhütung, und dann, so hatte er angenommen, würde Ella Ammerdinger sofort schwanger werden.
Nun stellte sich die Sache mit einem Mal anders dar.
»Das hat er mir schon vor der Hochzeit gesagt, aber ich habe nicht geglaubt, dass er dabei bleibt«, fuhr seine junge Patientin fort. »Wir lieben uns wirklich, Herr Dr. Laurin, nur in diesem einen Punkt können wir uns nicht einigen.«
»Sie verhüten doch, oder?«, fragte Leon.
»Früher ja, aber jetzt verhütet mein Mann«, antwortete Ella zu seiner Überraschung. »Er weiß ja, dass ich gern ein Kind hätte, und da er solche Angst hat, ich könnte eins bekommen, hat er gesagt, er nimmt das lieber selbst in die Hand, damit auch ja nichts schief geht.«
»Das heißt, er vertraut Ihnen nicht?«
»Er will jedenfalls nichts riskieren. Und es kann schon sein, dass ich die Pille heimlich absetzen würde«, gestand Ella. »Aber er verhütet immer, er vergisst es nicht, nicht einmal, wenn es … also, wenn es ziemlich stürmisch zugeht zwischen uns. Ich versuche manchmal, ihm so den Kopf zu verdrehen, dass er die blöden Kondome endlich mal vergisst, aber bis jetzt habe ich das noch kein einziges Mal geschafft.«
»Aber er hat sich nicht sterilisieren lassen?«
Sie sah ihn an, fassungslos. »Nein, jedenfalls hat er davon nichts gesagt«, stammelte sie. »Ich … also … nein, ich denke, das hätte er mir erzählt.«
»Hat Ihr Mann Ihnen gesagt, warum er keine Kinder will?«
Ella schüttelte traurig den Kopf. »Er behauptet, es gibt keinen besonderen Grund dafür, er wüsste nur, dass er ein völlig ungeeigneter Vater wäre, weil er mit Kindern einfach nicht umgehen kann. Dabei stimmt das nicht, ich habe ihn schon manchmal beobachtet, wenn er mit Kindern aus der Nachbarschaft redet. Die mögen ihn alle, aber wenn ich das erwähne, winkt er nur ab und will es nicht hören. Dann sagt er, wenn man mal ein paar Sätze mit Kinder wechselt, kann man das nicht vergleichen mit der Situation, ein Kind großzuziehen und dauerhaft Verantwortung zu übernehmen.«
»Haben Sie denn schon versucht, einmal in aller Ruhe ein Gespräch mit ihm darüber zu führen? Ich meine ein Gespräch, in dem sie ihn um eine Erklärung bitten, damit Sie seine Haltung verstehen können? Und vor allem ein Gespräch, in dem Sie nicht weinen, sondern sich um Gelassenheit bemühen, damit er sich nicht unter Druck gesetzt fühlt?«
»Versucht habe ich es, aber ich kriege es nicht hin. Ich fange immer an zu weinen oder ihm Vorwürfe zu machen, und dann streiten wir. Eigene Kinder sind bei uns das einzige Thema, über das wir streiten.«
»Was erzählt er denn über seine Kindheit und Jugend?«
»Nicht viel, er hat sich nicht besonders gut mit seiner Mutter verstanden, sie haben praktisch keinen Kontakt mehr. Ich habe sie bis heute nicht kennengelernt, sie war auch nicht bei unserer Hochzeit.«
»Und der Vater?«
»Der hat überhaupt keine Rolle in seinem Leben gespielt, die Eltern haben sich früh scheiden lassen.«
»Vielleicht ist der Grund da zu suchen?«
»Danach habe ich ihn auch schon mal gefragt, aber dann winkt er immer gleich ab und sagt, ich soll aufhören, die Psychologin zu spielen. Er würde sich der Vaterrolle einfach nicht gewachsen fühlen, fertig. Bitte, helfen Sie mir, Herr Dr. Laurin!«
»Aber wie? Der Einzige, der Ihnen helfen kann, ist Ihr Mann. Wenn er einmal herkäme, könnte ich versuchen, ihm etwas mehr zu entlocken, aber so …« Leon schüttelte den Kopf. »Es muss Gründe geben für die Selbsteinschätzung Ihres Mannes, und es liegt ja nahe, diese Gründe in seiner Familie zu vermuten. Aber wenn er sich weigert, darüber zu reden und wenn er selbst eine Empfängnis verhütet …«
Ella schlug beide Hände vor ihr Gesicht und brach in Tränen aus. »Dann muss ich mich von ihm trennen«, schluchzte sie. »Aber ich liebe ihn doch so sehr, Herr Doktor!«
Selten hatte sich Leon Laurin so hilflos gefühlt. Hier lag ja kein schwieriges medizinisches Problem vor, das er hätte lösen müssen. Hier ging es um etwas anderes, und noch sah er keine Möglichkeit, seiner Patientin zu helfen.
Dennoch sagte er: »Reden Sie noch einmal mit ihm. Bitten Sie ihn, Ihnen seine Haltung zu erklären. Er ist Ihr Mann, er liebt Sie. Also wird er Ihnen doch offen sagen können, warum er keine Kinder möchte.«
»Ich glaube nicht, dass er das tut«, erwiderte Ella niedergeschlagen. »Ich habe es ja schon öfter versucht. Wissen Sie, was ich mir schon mal überlegt habe?«
»Was denn?«
»Dass ich all seine Gummis durchlöchere und dann abwarte, was passiert, wenn ich gegen seinen Willen schwanger geworden bin.«
»Was denken Sie? Was würde er tun?«
»Sich scheiden lassen«, antwortete Ella nach kurzem Zögern.
»Ich würde Ihren Mann gerne kennenlernen, um mir selbst ein Bild von ihm zu machen, Frau Ammerdinger.«
»Er wird nicht kommen, nie im Leben. Und wenn er wüsste, was ich Ihnen heute alles erzählt habe, würde er es als Verrat ansehen.« Sie lächelte traurig. »Ich befolge Ihren Rat und bitte ihn, offen mit mir zu reden, aber ehrlich gesagt: Ich verspreche mir nichts davon.«
Als sie sich verabschiedet hatte, machte sich Leon nachdenklich ein paar Notizen. So ein seltsamer Fall war ihm schon lange nicht mehr untergekommen. Was nur sollte er tun, um Ella Ammerdinger zu helfen?
*
»Na, Brillenschlange?«
Peter Stadler versuchte, einfach weiterzugehen, ohne den Kopf einzuziehen oder seine Schritte zu beschleunigen. Wenn er das nämlich tat, machte er alles nur noch schlimmer, wie er aus leidvoller Erfahrung wusste.
Die vier Jungen, die ihn seit Wochen fast jeden Tag nach der Schule drangsalierten, waren alle größer als er, und sie gingen auf eine andere Schule. Er hatte keine Ahnung, warum sie sich gerade ihn ausgesucht hatten, aber es gab offenbar keine Möglichkeit, ihnen zu entkommen. Er hatte schon größere Umwege in Kauf genommen, aber irgendwie schienen sie immer zu wissen, wo sie ihn finden konnten, jedenfalls spürten sie ihn auch dann auf, wenn er nicht den üblichen Heimweg wählte.
Er war noch neu in München, erst seit zwei Monaten wohnte er hier. Seine Mutter hatte eine Stelle in einem Architekturbüro bekommen, deshalb waren sie aus dem bayrischen Wald hierher gezogen. Der neue Chef seiner Mutter hatte ihnen sogar geholfen, eine Wohnung zu finden. Die war zwar kleiner als die vorherige, aber groß genug für sie beide.
Seinen Vater kannte Peter nicht, seine Eltern hatten sich schon kurz nach seiner Geburt wieder getrennt. Ihm machte das nicht viel aus, er vermisste keinen Vater. Seine Mutter fand er toll, mit ihr konnte er über alles reden, und sie war meistens guter Dinge.
Er dagegen war ein eher ernsthafter Junge, der über den Lauf der Welt nachdachte und beschlossen hatte, später einmal in die Politik zu gehen, um die Welt zu verbessern. Seine Mutter hatte nur gesagt: »Nur zu, mach das. Du hast schon immer gewusst, was du willst, ich verspreche dir, ich wähle dich, weil ich überzeugt davon bin, dass du ein großartiger Politiker sein wirst.«
So war sie. Auf sie konnte er sich immer verlassen – und sie sich auf ihn.
Da sie es aber gerade ein bisschen schwer hatte in dem neuen Büro – sie musste sich da ja erst durchsetzen – wollte er ihr nicht von diesen vier Jungen erzählen, die offenbar beschlossen hatten, ihm das Leben schwer zu machen. Er war ja schon elf, da konnte man auch mal versuchen, allein mit einem Problem fertig zu werden.
Dumm war nur, dass er nicht besonders stark war und dass die vier Jungen immer geduldig warteten, bis er diese Straße entlanglaufen musste, wo immer so viel los war, dass die Menschen nicht darauf achteten, was um sie herum passierte. Da kriegte er dann meistens den ersten Boxhieb in die Rippen, jemand zog ihn kräftig an den Haaren oder stellte ihm ein Bein, so dass er stolperte und manchmal sogar fiel. Einmal hatten sie ihm auch die Brille von der Nase gerissen, das war schlimm gewesen, denn ohne Brille sah er nicht viel.
Einmal hatte er auch einen richtig schmerzhaften Schlag in den Bauch abbekommen – so schmerzhaft, dass ihm unwillkürlich die Tränen gekommen waren. Er weinte nicht schnell, aber der Schmerz war so heftig gewesen, dass er gegen die aufsteigenden Tränen nichts hatte machen können. Daraufhin hatten sie ihn natürlich verspottet – und das taten sie auch jetzt wieder.
»Wein doch ein bisschen, Brillenschlange, wir sehen das so gern. Du könntest auch nach deiner Mama rufen!«
Sie schubsten ihn, wie sie es immer taten. Die Erwachsenen, die ihnen entgegen kamen, schienen das für harmlose Rangeleien zu halten, denn keiner sah genauer hin. Er nahm sich fest vor, es anders zu machen, wenn er mal älter war: Er würde Kindern in Not helfen, ganz sicher. Die mussten doch sehen, dass er keinen Spaß daran hatte, herumgeschubst zu werden! Aber niemand schien ihn wahrzunehmen.
Heute aber meinte es das Schicksal gnädig mit ihm, denn auf der anderen Straßenseite tauchte eine Gruppe von Jungen auf, die noch älter waren als die, von denen Peter bedrängt wurde. Sie blieben stehen, riefen etwas und rannten dann plötzlich los, sorgten für Chaos auf der Straße, für Gehupe, schimpfende Autofahrer und quietschende Bremsen, aber wie durch ein Wunder gelangten sie heil auf dem Gehweg an und setzten den anderen nach, die ihr Heil in der Flucht suchten.
Peter war plötzlich allein und konnte es nicht fassen, dass sein Leiden für heute bereits beendet war. Langsam ging er weiter. Interessant fand er, dass offenbar auch die vier Jungen, die es auf ihn abgesehen hatten, nicht frei von Angst waren, denn sonst wären sie ja nicht weggelaufen, oder?
Er beschloss, die Augen an den nächsten Tagen offen zu halten und vielleicht herauszufinden, wer diese größeren Jungen waren. Sie hatten ihm heute unabsichtlich geholfen und wussten das sicherlich nicht einmal. Aber wenn er herausfand, wer sie waren, konnte er sie vielleicht fragen, ob sie ihn nicht auch sonst beschützen konnten. Oder würden sie ihn auslachen, wenn er ihnen eine solche Bitte vortrug?
Dieses Problem hätte er gern mit seiner Mutter besprochen – aber um das zu tun, hätte er ihr zunächst einmal von seinen Verfolgern erzählen müssen.
Dafür war es noch zu früh. Sie brauchte ihre Kräfte jetzt für den neuen Job. Er beschloss, noch zu warten, bis er sie um Rat fragte.
*
»Hör auf, dich bei mir zu bedanken, Antonia«, sagte Ingo Ewert verlegen. »Das sogenannte ‚Praktikum’, das du bei mir gemacht hast, war viel mehr, und das weißt du auch. Nicht zuletzt hast du einem sehr kranken kleinen Mädchen mit deiner richtigen Diagnose das Leben gerettet.«
»Aber ohne dich hätte ich niemals den Mut gehabt, noch einmal eine Praxis zu eröffnen«, erwiderte Antonia. »Ich musste ja erst herausfinden, ob ich noch als Ärztin arbeiten kann oder vielleicht alles vergessen habe. Immerhin habe ich meinen Beruf nicht mehr ausgeübt, seit ich Mutter geworden bin.«
»Du hast überhaupt nichts vergessen«, stellte er fest. »Und ich bin stolz darauf, dass ich dir dabei helfen durfte, dein Wissen aufzufrischen. Wann geht es denn eigentlich los bei dir?«
»Ich treffe mich nachher noch mit der Architektin, die den Umbau meiner zukünftigen Praxisräume geplant hat und nun auch durchführen soll. Sie hatte ein paar sehr gute Ideen, von denen ich sofort überzeugt war, und nun bin ich gespannt, was sie mir heute sagt, wie lange es dauern wird, bis es losgehen kann.«
»Wird es denn ein größerer Umbau werden?«
»Nein, gar nicht, es müssen nur ein paar kleinere Veränderungen vorgenommen werden. Vor allem brauche ich natürlich einen eigenen Eingang, das ist ja klar.
»Ich bin froh, dass du Leon offenbar doch ganz leicht überzeugen konntest. Du hattest ja Bedenken.«
»Ganz leicht war es nicht, und begeistert ist er von meinen Plänen noch immer nicht. Aber es hat sich herausgestellt, dass Leon gar nicht mein größtes Problem ist.«
»Nicht?«
»Nein, ich habe zwei andere entschiedene Gegner – oder besser, einen Gegner und eine Gegnerin: meinen Vater und Kaja.«
»Bei deinem Vater kann ich es mir vorstellen, aber Kaja? Ich dachte, die jungen Mädchen wollen heute alle gleichberechtigt sein?«
»Tja, für sich selbst würde Kaja das sicher auch wollen, aber wenn es um ihre Mutter geht und damit darum, auf ein bisschen eigene Bequemlichkeit zu verzichten, dann sieht das schon ganz anders aus.«
»Sie ist in der Pubertät, nimm nicht so ernst, was sie im Augenblick sagt«, riet Ingo.
»Das hatte ich mir eigentlich auch vorgenommen, aber irgendwie hat mich ihre Reaktion doch verletzt.«
»Und die anderen drei?«
»Die Jungs waren sofort auf meiner Seite, und Kyra auch. Sie hatte uns übrigens ein paar Mal gesehen, dich und mich und offenbar ein paar Befürchtungen.«
»Tatsächlich?« Ingo wurde verlegen. »Dann dürfte sie ja jetzt beruhigt sein.«
»Ist sie.« Antonia verschwieg vorsichtshalber, dass nicht nur Kyra sie mit Ingo zusammen gesehen hatte, sondern auch Leon. Alles musste ihr alter Freund schließlich auch nicht wissen.
»Ich muss los, Ingo, sonst komme ich zu spät zu meinem Treffen mit der Architektin.«
»Ich wünsche dir alles Glück der Welt bei deinem Vorhaben.«
»Und ich werde dir ewig dankbar sein für deine Unterstützung!«
Antonia umarmte Ingo, küsste ihn auf beide Wangen und eilte davon. Er blickte ihr mit einem Lächeln nach. Es hatte einmal eine Zeit gegeben, in der er in sie verliebt gewesen war. Aber das gehörte der Vergangenheit an. Heute freute er sich darüber, dass sie gute Freunde sein konnten.
*
»Du machst ja so ein nachdenkliches Gesicht«, stellte Dr. Eckart Sternberg fest, als er mittags einen Kaffee mit Leon trank.
»Die Geschichte einer Patientin geht mir nicht aus dem Kopf«, gestand Leon.
»Erzählst du sie mir? Oder lieber nicht?«
»Sie ist eine sehr attraktive und sympathische junge Frau, kerngesund, glücklich verheiratet. Nur: Ihr Mann will keine Kinder«, sagte Leon. »Das hat er ihr schon vor der Hochzeit gesagt, sie hat angenommen, er wird seine Meinung ändern, doch danach sieht es derzeit nicht aus. Die beiden sind sehr verliebt ineinander, sie haben regelmäßigen Geschlechtsverkehr, aber sie ist trotzdem todunglücklich, und ich frage mich natürlich, was mit dem Mann los ist.«
»Kann ich mir vorstellen. Warum fragst du ihn nicht einfach?«
»Dazu müsste ich ihn erst einmal kennenlernen, aber er hat offenbar keinerlei Interesse daran. Er will sich auch nicht untersuchen lassen.«
»Du bist aber sicher, dass die Patientin dir die Wahrheit erzählt?«
Leon sah seinen Kollegen und Freund verdutzt an. »Ja«, antwortete er, nachdem er über die Frage nachgedacht hatte. »Etwas anderes ist mir bislang nicht einmal in den Sinn gekommen. Und gar so schlecht ist meine Menschenkenntnis ja nicht.«
»Gut, nehmen wir also an, sie sagt dir die Wahrheit. Vielleicht ist es dann so, dass er weiß, dass er keine Kinder zeugen kann und um das nicht zugeben zu müssen, erzählt er, dass er keine will.«
»Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen«, gestand Leon. »Möglich wäre es. Er behauptet offenbar, er wäre den Aufgaben eines Vaters nicht gewachsen, aber meine Patientin schwört, dass alle Kinder der Nachbarschaft ihn lieben. Das spricht für deine Theorie.«
»Mhm. Aber wenn er keine Kinder zeugen kann, würde es natürlich schwierig mit dem Kinderwunsch deiner Patientin.«
Leon nickte. »Sie ist echt verzweifelt, und ich kann ihr nicht helfen. Das ist ein seltsames Gefühl. Wenn es um eine schwierige OP ginge oder um die geeignete Therapie bei einer seltenen Erkrankung – da würde mir etwas einfallen, aber in diesem Fall scheine ich nichts tun zu können.«
»Hat sie schon versucht, die Pille wegzulassen? Ich meine, falls meine Theorie mit der Zeugungsunfähigkeit doch falsch wäre …«
»Der Gedanke ist ihr gekommen, aber es würde ihr nichts nützen. Der Mann verhütet selbst. Was übrigens auch gegen deine Theorie spricht, wie mir gerade auffällt. Denn er müsste ja nicht verhüten, wenn er wüsste, dass sowieso nichts passieren kann.«
»Oder er macht es zur Tarnung, damit sie nicht merkt, dass er ihr etwas vorgemacht hat.«
»Du liebe Güte, deine Fantasie, was hinter seinem Verhalten steckt, ist ja noch lebhafter als meine!«, rief Leon aus. »Du kannst dir nicht vorstellen, was ich mir schon alles überlegt habe, aber deine Ideen hatte ich noch nicht.«
»Jedenfalls scheint deine Patientin einen wirklich seltsamen Mann geheiratet zu haben.«
»Sie sagt, er ist völlig normal – nur in diesem einen Punkt nicht.«
»Na, der eine Punkt reicht ja schon.«
»Sie will noch einmal versuchen, mit ihm zu reden. Ein besserer Rat ist mir nicht eingefallen.«
Es klopfte kurz, Dr. Michael Hillenberg erschien. »Sie wollten sich doch Frau Lederer selbst noch einmal ansehen«, sagte er zu Eckart Sternberg. »Sie ist jetzt da.«
Dieser war bereits aufgestanden. »Ich komme«, sagte er. »Bis dann, Leon. Viel Glück bei deinem verzwickten Fall.
»Das habe ich nötig«, erwiderte Leon trübsinnig.
War es tatsächlich möglich, dass Florian Ammerdinger zeugungsunfähig war? Aber dann hätte er seine Frau in einem wichtigen Punkt belogen, und das schien ihm so gar nicht zu dem Mann zu passen, den seine Patientin ihm geschildert hatte. Er ließ seine Gedanken noch ein bisschen hin- und herspazieren, kam einer Lösung des Problems auf diese Weise aber auch nicht näher, und so war er froh, als es Zeit für die Visite wurde.
*
Antonia ging mit Britta Stadler, der Architektin, die ihre neue Praxis gestalten sollte, durch die Räume, die sie zur Verfügung haben würde. Die Praxis würde im neuen Flügel der Kayser-Klinik untergebracht werden.
»Innerhalb von sechs Wochen haben wir das erledigt, Frau Dr. Laurin. Ich sehe da gar kein Problem.« Britta Stadler lächelte Antonia an. »Ich bin sehr froh, dass ich mit diesem Auftrag betraut worden bin.«
»Aber es ist doch nichts, was eine Architektin reizt, oder?«, fragte Antonia verwundert. »So ein kleiner Umbau …«
»Ich bin neu in München, ich muss mich noch durchsetzen, und die Kayser-Klinik ist eine sehr renommierte Klinik. Für mich ist das ein richtiger Glücksfall, denn die Kollegen achten eifersüchtig darauf, dass ihnen die Neue nichts wegnimmt, von dem sie meinen, dass es ihnen zusteht.«
»Und wieso haben Sie als Neue den Auftrag trotzdem bekommen, wenn doch unsere Klinik so renommiert ist?«
Britta Stadler lächelte. Sie war eine hübsche, lebhafte Blondine, der man sofort am Gesicht ablesen konnte, was sie dachte. »Weil er, wie Sie ja selbst sagen, so klein ist, das war mein Glück. Ich bin die einzige Frau im Team, an die richtig großen Sachen lassen mich die Kollegen natürlich noch nicht ran. Als es ‚Kayser-Klinik’ hieß, wollten sich alle vordrängeln, aber als dann klar wurde, dass es ein sehr begrenztes Projekt ist, kam ich plötzlich doch infrage. Und da bin ich.«
»Ihre Offenheit ist sehr erfrischend«, stellte Antonia fest. »Jetzt erklären Sie mir bitte Ihren Plan noch einmal ganz genau, ich bin nicht geübt im Lesen von Plänen.«
»Das sind die wenigsten. Hier, sehen Sie? Das soll Ihr neuer Eingang werden, ich hatte mir das so gedacht …«
Die Architektin erläuterte jede Einzelheit, und sie tat es so anschaulich, dass Antonia ihr tatsächlich folgen konnte.
»Ich rate Ihnen übrigens, einen weiteren Raum mit einzuplanen. Hier ist Platz genug, wie ich gesehen habe.«
»Ja, mein Mann hat seinerzeit sehr großzügig geplant, als es um eine Erweiterung der Klinik ging, und das erweist sich jetzt als Segen. Dieser Flügel hier ist unsere stille Reserve.« Antonia sah die Architektin nachdenklich an. »Warum einen weiteren Raum? Ich will auf keinen Fall eine Riesenpraxis haben, das schaffe ich auch gar nicht, immerhin habe ich vier Kinder, die alle noch zu Hause sind. Das ändert sich zwar in den nächsten Jahren, aber ich will nicht in die Situation kommen, mich zwischen Beruf und Familie aufzureiben. Ich möchte so arbeiten, dass ich Zeit für meine kleinen Patientinnen und Patienten habe und sie richtig betreuen kann. Und ich muss weiterhin für meine Familie da sein können, denn sonst wird es sehr bald ungemütlich werden.«
»Das finde ich sehr vernünftig, aber Sie müssen ja damit rechnen, dass Sie die Kinderärztin von etlichen der Kinder werden, die hier in der Klinik auf die Welt kommen.«
»Das wird wahrscheinlich so sein, ja.«
»Und ich sage Ihnen voraus, dass Sie den Ansturm schon bald nicht mehr bewältigen werden.«
»Wollen Sie mich entmutigen?«
»Nichts liegt mir ferner«, beteuerte Britta Stadler. »Aber warum wollen Sie alles allein machen? Warum suchen Sie sich nicht eine Kollegin oder einen Kollegen für eine Gemeinschaftspraxis – und verweisen von Anfang an auf die Möglichkeit, in der Kayser-Klinik nicht nur zu entbinden, sondern mit dem Kind dann auch weiterhin in einer kinderärztlichen Praxis betreut zu werden, die an die Klinik angebunden ist? Eine Partnerin oder ein Partner würde Sie entlasten, und es wäre für viele Schwangere vermutlich ein unwiderstehliches Angebot, ihr Kind hier betreuen zu lassen.«
Antonia war fassungslos. »Sie denken viel weiter als ich!«, sagte sie. »Ich bin ja schon froh, dass ich meinem Traum, noch einmal in den Beruf einzusteigen, näher gekommen bin, und jetzt sagen Sie mir, ich soll mich nicht mit einer kleinen überschaubaren Praxis zufrieden geben, sondern …«
Britta Stadler hob beide Hände. »Entschuldigen Sie, ich schieße manchmal, wenn mir eine Idee kommt, vor lauter Begeisterung übers Ziel hinaus. Es steht mir gar nicht zu, Ihnen solche Vorschläge zu machen, aber …«
»Sie müssen sich nicht entschuldigen, es ist eine großartige Idee, besonders die mit einer Partnerin, die ich allerdings erst noch finden müsste. Aber es stimmt: Das würde mich entlasten, und ich müsste nicht so ängstlich darauf achten, dass das Ganze nur ja nicht zu groß gerät.«
»Denken Sie jetzt aber bitte nicht, dass ich Ihnen eine größere Praxis einreden will, damit mein Auftrag größer wird«, bat Britta Stadler verlegen.
Antonia musste lachen. »Ich schätze, wenn wir so weitermachen, werden Ihre Herren Kollegen am Ende doch noch neidisch, dass sie sich den Auftrag nicht selbst unter den Nagel gerissen haben, oder?«
»Sie sind mir also nicht böse?«
»Ich bin Ihnen nicht böse. Und letzten Endes ist die Idee einer Gemeinschaftspraxis nur konsequent: Ich plane meine Kinderarztpraxis ja schließlich hier in der Klinik, weil ich denke, dass Praxis und Klinik sich gut ergänzen können. Und da ist es besser, das auch gleich ganz bewusst zu planen. Das hatte ich eigentlich nicht vor, ich bin eher davon ausgegangen, dass es sich irgendwie von selbst ergibt. Aber es ist viel sinnvoller, das von Anfang an anders anzugehen, da haben Sie schon Recht. Ich hätte selbst darauf kommen müssen.«
»Na ja«, erwiderte die Architektin nachdenklich, »die Idee mag gut sein, aber sie lässt sich nur verwirklichen, wenn Sie die passende Partnerin oder einen passenden Partner finden.«
»Eine Frau wäre mir lieber, das ist jedenfalls mein Bauchgefühl. Aber ich muss ohnehin erst in Ruhe darüber nachdenken. Vielleicht hat die Idee bei genauerem Hinsehen doch ein paar Tücken, die ich jetzt noch nicht sehe.«
»Das ist möglich«, gab Britta Stadler freimütig zu. »Mir passiert das öfter: Ich bin begeistert von einer Idee, aber wenn ich eine Nacht darüber geschlafen habe, merke ich, dass sie so gut, wie ich dachte, leider doch nicht ist.«
»Und was machen wir jetzt? Sie können ja die Umbauten nicht vornehmen, so lange in diesem Punkt keine Klarheit herrscht.«
»Ich warte, bis Sie mir sagen, wofür Sie sich entschieden haben.«
»Und das ist kein Problem?«
»Wenn Sie für Ihre Entscheidung nicht ein paar Monate brauchen, dann nicht.«
»Bestimmt nicht, aber ein paar Tage werden es schon sein.«
»So lange kann ich warten«, sagte Britta Stadler lächelnd.
Sie verabschiedete sich kurz darauf, und Antonia wanderte noch einmal allein durch die Räume, während sie über ihr Gespräch mit der Architektin nachdachte. Eine sympathische Frau, so offen und lebendig – und mit interessanten Ideen, die es wert waren, sich gründlich mit ihnen zu beschäftigen.
*
»Nicht schon wieder, Ella, bitte!«, stöhnte Florian Ammerdinger unglücklich. »Ich kann doch nicht immer den gleichen Satz wiederholen!«
»Aber du könntest mir erklären, warum du keine Kinder willst.« Ella blieb hartnäckig. »Du sagst immer, dass du kein guter Vater wärst, aber woher willst du das wissen? Versuch wenigstens, mir zu sagen, wieso du das denkst.«
»Ich kann es nicht erklären, ich weiß es eben. Ella, Liebste, mich quälen diese Diskussionen. Ich habe dir nie etwas vorgemacht, sondern dir immer gesagt, dass ich keine Kinder will.«
»Ich weiß, aber ich habe dir nicht geglaubt, wie gesagt – Ich dachte, das ändert sich, wenn wir zusammen sind und dass du dir dann auch wünschst, was ich mir wünsche. Ich …« Sie schlang ihre Arme um seinen Hals und küsste ihn stürmisch. »Du liebst mich doch, oder?«
Er stöhnte. »Ich liebe dich sogar sehr, das weißt du, aber …«
Doch sie ließ ihn nicht zu Wort kommen, sie küsste ihn weiter, drängte sich an ihn, entfachte seine Leidenschaft, bis er sich nicht anders zu helfen wusste, als sie von sich zu stoßen.
»Warum tust du das?«, rief er schwer atmend. »Warum versuchst du, mich verrückt zu machen, damit ich mich vergesse, wo du doch weißt, dass ich das auf keinen Fall will? Das ist nicht richtig von dir, Ella. Ich habe dir nie etwas vorgemacht, es ist nicht meine Schuld, dass du mir nicht geglaubt hast.«
Als er die Tränen in ihren Augen sah und ihren verletzten Blick, musste er an sich halten, um sie nicht erneut in die Arme zu schließen, aber er beherrschte sich. Er musste dieses Thema ein- für allemal klären, es hatte keinen Sinn, dass sie immer wieder deswegen Streit anfingen.
»Wenn du damit nicht leben kannst, dass ich keine Kinder haben will, müssen wir uns trennen«, sagte er und schaffte es irgendwie, seine Stimme fest und unnachgiebig klingen zu lassen, obwohl er innerlich zitterte und es kaum aushalten konnte, wie fassungslos Ella ihn ansah. Er liebte sie mehr als sein Leben, er hätte alles für sie getan – nur diesen einen Wunsch, den konnte und wollte er ihr nicht erfüllen.
»Du willst dich von mir trennen?« Sie war schneeweiß geworden.
»Ich will mich nicht von dir trennen – aber ich sehe nicht, wie wir weitermachen sollen, wenn du nicht aufhören kannst, über dieses Thema zu reden, über das ich nicht reden will. Noch einmal: ICH WILL KEINE KINDER! Ist das denn so schwer zu verstehen? Und glaubst du nicht, dass wir auch ohne Kinder glücklich sein können? Wir sind es doch bis jetzt auch gewesen, aber seit du immer wieder darauf zu sprechen kommst …«
»Du liebst mich nicht«, flüsterte sie. »Wenn du mich lieben würdest, würdest du mir meinen sehnlichsten Wunsch erfüllen.«
»Und wenn du mich lieben würdest, würdest du meine Entscheidung respektieren. Ella, so kommen wir doch nicht weiter! Glaub mir, ich werde meine Meinung nicht ändern – und wenn du damit nicht leben kannst, bleibt uns nur die Trennung.«
Alles in ihm hoffte, flehte, dass sie nachgab, dass sie sagte, er sei ihr wichtiger als Kinder, sie könne doch ohne ihn nicht leben. Aber was er gerne hören wollte, sagte sie nicht, im Gegenteil, sie sagte: »Ich kann damit nicht leben.«
Nach diesen Worten verließ sie das Zimmer, mit hochgezogenen Schultern und gesenktem Kopf.
Er ließ sich in einen Sessel sinken und verbarg das Gesicht in beiden Händen. Wie hatte es mit ihnen nur so weit kommen können – mit ihnen und der großen Liebe, die sie verband?
Er hörte die Wohnungstür ins Schloss fallen und lief zum Fenster. Gleich darauf erschien Ella unten auf der Straße, die sie überquerte, ohne nach links oder rechts zu sehen. Er hielt den Atem an, als er ein Auto zwei Meter vor ihr zum Stehen kommen sah. Der Fahrer hupte und brüllte aufgebrachte Worte aus dem heruntergelassenen Fenster, aber Ella sah sich nicht einmal um. Sie setzte ihren Weg fort, ohne ihre Umgebung wahrzunehmen.
Es kostete Florian viel Überwindung, in der Wohnung zu bleiben, statt seiner Frau zu folgen. Was hätte es genutzt? Es hatte sich ja nichts geändert, sie wären sehr schnell wieder dort gelandet, wo ihr Gespräch eben geendet hatte. Sie drehten sich ja seit längerer Zeit im Kreis, fanden keine Lösung für ihr Problem.
Wahrscheinlich gab es keine Lösung. Sie hätten, trotz ihrer großen Liebe, niemals heiraten dürfen, denn nun hatte es sich ja herausgestellt: Ihre Träume, ihre Sehnsüchte, ihre Vorstellungen vom Leben unterschieden sich gar zu sehr.
Er sah keinen Ausweg – außer dem, den er bereits vorgeschlagen hatte: die Trennung. Aber allein der Gedanke daran machte ihm Angst.
Ein Leben ohne Ella konnte er sich so wenig vorstellen wie ein Leben mit Kindern.
*
Antonia hörte den Streit bereits, als sie die Haustür aufschloss. Kaja und Kyra, mal wieder. Sie biss sich auf die Lippen, als sie Kaja schreien hörte: »Du warst schon wieder in meinem Zimmer! Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du da nichts zu suchen hast!«
»Aber ich wollte mit dir sprechen, und du warst nicht da, und …«
Kyras Stimme war anzuhören, dass sie den Tränen nahe war.
»Dann geht man wieder, wenn jemand nicht da ist, man schnüffelt nicht herum.« Kajas Stimme überschlug sich beinahe, wie so oft in letzter Zeit. Konstantin sagte dann immer: »Sie flippt gerade wieder aus« – ihn schien das nicht weiter aufzuregen. Wenn Kaja ausflippte, ging er ihr aus dem Weg, das war die einfachste Methode. Kevin, sein jüngerer Bruder, verhielt sich ähnlich.
Nur Kyra, die ihre große Schwester bewunderte und verehrte und nichts mehr wollte, als von ihr geliebt und beachtet zu werden, machte alles falsch. Sie begriff einfach nicht, dass sie Kaja nur immer mehr gegen sich aufbrachte, wenn sie ihr überallhin folgte, sie bei nebensächlichen Dingen um Rat fragte und ständig an ihre Tür klopfte, weil sie angeblich etwas ganz Wichtiges mit ihr zu besprechen hatte. Bis vor einem halben Jahr waren die beiden ein Herz und eine Seele gewesen, aber seit Kaja voll in der Pubertät war, hatte sich alles verändert.
Manchmal fragte sich Antonia, wann es bei Konstantin so weit sein würde. Zwei ausflippende Teenager im Haus – sie mochte sich die Folgen für ihr Familienleben nicht einmal vorstellen. Es war ja auch so häufig genug schon unerträglich.
»Was ist hier los?«, rief sie, während sie die Treppe hinauflief, wo sich neben ihrem und Leons Schlafzimmer auch die Zimmer der Kinder befanden.
Kyra weinte mittlerweile, während Kaja mit zornigen Augen wie eine Rachegöttin in der offenen Tür ihres Zimmers stand. Sie war ein sehr hübsches Mädchen, mit ihren lockigen hellbraunen Haaren und den schönen blauen Augen – Antonia war bereits aufgefallen, dass ihrer großen Tochter häufig bewundernde Blicke folgten.
»Ich wollte sie nur was fragen«, schluchzte Kyra.
»Das sagt sie immer! Und dann sieht sie, dass ich nicht im Zimmer bin und kommt rein und bringt alles durcheinander.«
»Jetzt komm wieder runter, Kaja«, sagte Antonia, um einen ruhigen Tonfall bemüht. »Wenn deine jüngere Schwester mal dein Zimmer betritt, ist das wohl kaum ein Grund, gleich so einen Aufstand zu machen.«
»Mal?«, rief Kaja. »Wenn sie mal mein Zimmer betritt? Das macht sie dauernd!«
»Deshalb brauchst du hier trotzdem nicht so herumzuschreien.«
Nun richtete sich Kajas Zorn auf ihre Mutter. »Was weißt du denn schon? Du bist doch kaum noch hier und kriegst nichts mit, weil dir ja neuerdings dein Beruf wichtiger ist als wir.«
»Wag es nicht noch einmal, in diesem Ton mit mir zu reden!« Antonias Stimme war scharf geworden. »Ich weiß nicht genau, was du dir einbildest, aber du hast jedenfalls kein Recht, uns alle zu terrorisieren mit deinem ewigen Geschrei! Und schon gar nicht hast du das Recht, mir gegenüber unverschämt zu werden!«
Kaja schnappte nach Luft. Wenn Antonia in diesem Ton sprach, sah man sich besser vor, das wusste sie. Aber sie wollte trotzdem das letzte Wort behalten. Also stieß sie hervor: »Ich habe jedenfalls ein Recht auf meine Privatsphäre. In Zukunft schließe ich mein Zimmer ab!« Sie verschwand, knallte die Tür hinter sich zu und drehte gut hörbar von innen den Schlüssel im Schloss herum.
Antonia lächelte in sich hinein. Dieser Abgang würde Kaja schon bald leid tun.
Falls sie geglaubt hatte, ihre Mutter würde vor ihrer Tür stehen bleiben und sie aufzufordern, wieder herauszukommen, so hatte sie sich gründlich geirrt.
Ganz ruhig sagte sie: »Komm mit nach unten, Kyra. Wo sind übrigens die Jungs?«
»Fußball«, nuschelte Kyra, während sie ihrer Mutter nach unten folgte.
Antonia setzte Wasser auf. »Ich koche uns einen Tee«, sagte sie. »Und dann erkläre ich dir, was du falsch machst.«
Kyra sah sie verwundert an.
Der Anblick ihrer verweinten, unglücklichen, verwirrten Jüngsten tat Antonia weh. Kyra ließ immer alles viel zu nah an sich heran, so war es von Anfang an gewesen. Ein verletzter Vogel konnte sie tagelang beschäftigen, und alles Unrecht dieser Welt hätte sie am liebsten eigenhändig beseitigt.
»Was ich falsch mache?«
»Ja«, sagte Antonia. Sie machte Pfefferminztee, mit frischer Minze aus ihrem Kräutergarten, der schmeckte auch kalt sehr gut.
Als sie ihn aufgegossen hatte, setzte sie sich zu Kyra an den Küchentisch. »Beachte Kaja nicht mehr«, sagte sie. »Auch wenn du gern ständig mit ihr zusammen wärst: Lass sie in Ruhe. Am Anfang wird sie das gar nicht merken, aber nach einer Weile wird es ihr auffallen, und dann wird sie feststellen, dass ihre kleine Schwester ihr fehlt.«
»Glaubst du?« Kyras Stimme zitterte noch immer.
»Ich bin sogar ganz sicher. Sie hat das Gefühl, du läufst ihr nach, und das geht ihr auf die Nerven. Sie hat ein paar Probleme im Moment, und vermutlich auch ein paar Geheimnisse, die sie nicht mit uns teilen will. Lass ihr Zeit.«
Antonia wurde bewusst, dass sie diese Ratschläge nicht nur Kyra, sondern auch sich selbst gab.
»Aber sie ist doch meine Schwester. Wieso will sie dann nicht mit mir reden? Immer schickt sie mich weg, das hat sie früher nie gemacht.« Noch einmal wurden Kyras Augen nass.
»Sie ist mit anderen Dingen beschäftigt.«
»Mit ihrem Freund?«
»Was weißt du denn über ihren Freund?«
»Nichts, nur Konny hat gesagt, dass sie einen hat, und ich höre sie immer mit ihm telefonieren.«
»Dann ist sie wohl mit ihm beschäftigt«, seufzte Antonia. »Meinst du, du schaffst es, nicht mehr an ihre Tür zu klopfen?«
Kyra dachte über diese Frage lange nach. Schließlich nickte sie. »Wenn ich es mir vornehme, schaffe ich es. Und ich nehme es mir vor, weil ich nicht mehr dauernd angeschrien werden will.«
»Bravo«, sagte Antonia, und strich ihr eine vorwitzige Haarsträhne aus dem Gesicht. »Hilfst du mir, das Gemüse zu schneiden?«
»Was gibt es denn?«
»Gefüllte Brathähnchen.«
Kyra strahlte. »Mein Lieblingsgericht. Ich kann die Karotten schneiden, Mami.«
Es war wieder still im Haus. Während sie einträchtig das Abendessen vorbereiteten, überfiel Antonia plötzlich der Gedanke, dass Stunden wie diese, wo sie mit einem ihrer Kinder – oder auch mehreren – friedlich zusammenarbeitete, in Zukunft vermutlich rar sein würden. Sie mussten ja eine Haushälterin einstellen, sonst konnte sie ihre Pläne vergessen. Leise Angst überfiel sie. Tat sie das Richtige? Oder hatte am Ende doch ihr Vater Recht, der sie für verantwortungslos hielt?
Die Antwort kam von unerwarteter Seite, denn plötzlich sagte Kyra: »Ich finde es toll, dass du bald wieder Ärztin bist.«
Antonia lächelte. »Ich war die ganze Zeit Ärztin, ich habe nur nicht als Ärztin gearbeitet.«
»Das meine ich ja. Es ist doch eine ziemliche Verschwendung, dass du dich immer nur um uns kümmerst, wo du doch so viele andere Kinder wieder gesund machen kannst.«
Antonia ließ die Zwiebel, die sie gerade häutete, sinken und sah ihre Jüngste überrascht an. »Da hast du Recht«, sagte sie schließlich. »Ich hoffe nur, ich kann wirklich viele andere Kinder gesund machen.«
»Klar kannst du das.« Kein Zweifel war in Kyras Stimme zu hören. »Reichen die Karotten oder brauchen wir noch eine?«
Statt zu antworten, beugte sich Antonia zu ihr und drückte ihr einen Kuss auf den Scheitel.
»Mami?«
»Noch zwei Karotten bitte.«
*
»Wie war’s?«, fragte Peter, als seine Mutter nach Hause kam. Er wusste, dass sie heute einen wichtigen Termin mit einer Kundin gehabt hatte. »Sehr schön«, antwortete Britta. »Die Frau ist klug und nett, man kann ganz normal mit ihr reden, und sie hört zu. Außerdem sieht sie toll aus.«
»Du siehst auch toll aus, Mama.«
Sie wuschelte ihm durch die Haare. »Danke, mein Großer, das hört jede Mutter gern. Wollen wir zur Feier des Tages essen gehen?«
»Echt?« Seine Augen leuchteten auf. »Können wir mal japanisch essen oder ist das zu teuer? Ich habe noch nie Sushi gegessen, aber alle reden immer davon, wie toll das ist.«
»Du meinst das japanische Restaurant vorne an der Ecke, wo man vor so einer Art Fließband sitzt, auf dem die Gerichte an einem vorbeirollen?«
Peter nickte. »Geht das? Es soll ganz toll schmecken, habe ich gehört. Außerdem finde ich es cool, wenn ständig Essen vor einem vorbeirollt.«
»Na, ich weiß nicht. Meinst du nicht, das ist ungemütlich?«
»Das hängt doch von uns ab«, fand Peter. »Wir gucken uns erst alles an, und dann suchen wir uns aus, worauf wir Lust haben.«
»Wir probieren es aus«, beschloss seine Mutter. »Als ich es dir vor zwei Jahren mal vorgeschlagen habe, hast du dich geschüttelt, deshalb bin ich auf das Thema nicht zurückgekommen.«
»Echt? Das weiß ich überhaupt nicht mehr.«
»Ich habe den Fehler gemacht zu erwähnen, dass Sushi aus rohem Fisch bestehen. Fisch war damals nicht gerade dein Lieblingsessen. Und eigentlich ist es das ja immer noch nicht, oder?«
»Mal sehen«, sagte er ausweichend. »Gehen wir gleich?«
»Von mir aus gern. Ich esse ja sowieso lieber früh.«
Sie machten sich also auf den Weg. Peter überlegte, ob er seiner Mutter von den Jungen erzählen sollte, die ihm so zu schaffen machten, aber sie war so gut gelaunt, weil das Treffen mit der Kundin so gut gelaufen war, dass er beschloss, ihr den Abend nicht zu verderben. Helfen konnte sie ihm ja wahrscheinlich sowieso nicht.
Es wurde ein wunderbares Essen, das sie beide zu Sushi-Fans machte. Peter konnte sich nicht genug darüber wundern, aber roher Fisch schmeckte ihm ganz wunderbar. Außerdem hatten sie viel zu lachen, seine Mutter und er. Sie tranken grünen Tee und aßen langsam, wobei sie ihm lustige Geschichten aus ihrem Büro erzählte – und ein bisschen auch von der neuen Kundin, die eine Arztpraxis einrichten wollte.
Als sie auf dem Heimweg waren, wusste er, dass es richtig gewesen war, sein Problem nicht zu erwähnen. Es hätte ihnen nur diesen schönen Restaurantbesuch verdorben.
*
»Frau Ammerdinger, beruhigen Sie sich doch bitte«, bat Leon. »Und sagen Sie mir, was passiert ist. Sie sind ja ganz außer sich!« Er hatte nicht damit gerechnet, seine junge Patientin so bald wieder zu sehen – sie war ja erst einige Stunden zuvor bei ihm gewesen! Er hatte die Klinik eigentlich gerade verlassen wollen, als sie erneut aufgetaucht war.
Aber Ella konnte kein Wort herausbringen. Wann immer sie es versuchte, kamen die Tränen aufs Neue und sie sank schluchzend in sich zusammen. Leons Sekretärin Moni Hillenberg war natürlich längst gegangen, also kochte er selbst einen Kräutertee für seine aufgelöste Patientin.
Dieser wirkte offenbar, denn Ella beruhigte sich, während sie ihn trank und konnte Leon schließlich berichten, wie das Gespräch mit ihrem Mann verlaufen war. »Er hat gesagt, wenn ich das Thema nicht fallen lasse, müssen wir uns trennen, Herr Dr. Laurin«, beendete sie ihren traurigen Bericht. »Und sowieso würde er sich scheiden lassen, wenn ich versuche, ihn auszutricksen.«
»Hat er das so gesagt?«
»Nicht wörtlich, aber das war der Sinn.«
»Dann sehe ich nicht, wie Sie Ihre Ehe retten und gleichzeitig ein Kind bekommen können«, sagte Leon. »Ich habe das bisher, glaube ich, noch nie gesagt, aber jetzt bleibt mir nichts anderes übrig: Ich weiß nicht weiter. Ich kann Ihnen keinen Rat geben, denn Sie werden so oder so unglücklich werden: entweder ohne ihren Mann oder ohne eigene Kinder.«
»Das habe ich jetzt auch begriffen.« Ella sprach sehr leise.
»Ich kann Ihnen nicht helfen, weil Ihr Problem ja kein medizinisches ist.«
»Und mein Mann hat überhaupt kein Problem«, sagte Ella. »Jedenfalls behauptet er das.«
»Aber Sie glauben ihm nicht?«
Sie zögerte. »Nein«, sagte sie endlich. »Ich glaube ihm das nicht, weil er nämlich manchmal im Traum weint und schreit. Ich wecke ihn immer auf, weil mir das Angst macht. Er zittert dann, und er schwitzt auch. Aber wenn ich versuche, mit ihm darüber zu reden, verschließt er sich. Er sagt, jeder träumt mal schlecht, darüber muss man nicht lange reden.«
»Wie oft kommt das vor?«
»Manchmal wochenlang überhaupt nicht, und dann in zwei Wochen drei Mal. Das ist unterschiedlich.«
»Also relativ häufig?«
»Ja.«
»Und Sie denken, es gibt einen Zusammenhang zwischen diesen Träumen und seinem Entschluss, keine Kinder zu zeugen?«
»Mir ist dieser Gedanke erst vor kurzem gekommen«, gestand Ella. »Sie wissen, ich liebe meinen Mann, also denke ich viel über ihn und unser Problem nach. Ich würde es gerne lösen, und ich würde ihm gerne helfen. Auch wenn er meint, dass er keine Hilfe braucht: Ich sehe das anders. Wenn wir zusammen sind, ist er glücklich. Vielleicht will er es auch nur unbedingt sein, aber tief in seinem Inneren sitzt irgendein Unglück, das er vergraben hat und das ihm immer noch Schmerzen bereitet.«
Leon sah Ella Ammerdinger überrascht an. Bis jetzt war sie für ihn vor allem eine unglückliche junge Frau gewesen, der er gern geholfen hätte, ohne einen Weg zu sehen, wie er das hätte anstellen sollen. Jetzt zeigte sie ihm zum ersten Mal, dass sie versucht hatte, den Ursachen für ihr Unglück selbst auf den Grund zu gehen, und ihm schien, dass sie dabei durchaus schon weit gekommen war.
»Wenn er nicht darüber reden will, wird es schwer sein, ihn dazu zu bringen«, sagte er nachdenklich.
»Ja, ich weiß.« Ganz ruhig sagte Ella das, ihre Augen waren jetzt trocken. Sie sah aus, als hätte sie ganz plötzlich eine Erleuchtung gehabt, was jetzt zu tun war.
Die plötzliche Ruhe der jungen Frau war Leon unheimlich, und ihm schoss die Frage durch den Kopf, ob sie imstande wäre, sich etwas anzutun, wenn sie keinen Ausweg mehr sah.
Noch bevor er eine Antwort auf diese Frage gefunden hatte, stand sie auf. »Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie so überfallen habe, Herr Dr. Laurin. Es hat mir gut getan, mit Ihnen zu reden, ich fühle mich besser.«
»Und was wollen Sie jetzt tun?«
Sie sah ihn direkt an. »Das weiß ich noch nicht, aber auf keinen Fall mache ich einfach so weiter wie bisher.«
Über diesen Satz dachte er auf dem Heimweg nach. Was bedeutete er? Welche Möglichkeiten gab es denn überhaupt für sie? Sie liebte ihren Mann, sie würde ihn sicherlich nicht verlassen. Schon der Gedanke an eine mögliche Trennung hatte sie ja heute beinahe den Verstand verlieren lassen.
Er war in Gedanken immer noch bei Ella Ammerdinger, als er zu Hause eintraf. Der Duft aus der Küche ließ ihm das Wasser im Mund zusammenlaufen.
»Wir können essen!«, rief Antonia bei seinem Anblick. »Endlich, Leon, wir sind schon halb verhungert!«
Er war froh, dass er daran gedacht hatte, sie anzurufen, um ihr zu sagen, dass er sich verspäten würde. »Das duftet herrlich. Brathähnchen?«
Antonia nickte. »Eine Gemeinschaftsarbeit von Kyra und mir. Sie hat die Hauptarbeit gehabt mit dem Gemüse-Schnipseln.«
»Bravo, Kyra!«
Seine Jüngste errötete vor Freude über das Lob.
Die beiden Jungen erschienen, mit offenkundig hungrigem Blick. »Gibt es endlich was zu essen?«
»Jawohl, bitte Platz zu nehmen!«, rief Antonia. »Leon, deine chirurgischen Fähigkeiten sind gefragt.«
Er wollte nach Kaja fragen, die sich als einzige bislang nicht hatte blicken lassen, aber gerade noch rechtzeitig fing er Antonias Blick auf. So nahm er nur die Geflügelschere und ein scharfes Messer und begann damit, die Hähnchen fachgerecht zu zerlegen.
Kaja fehlte auch am Tisch, ihr Platz blieb leer. Nun fragte er aber doch: »Was ist mit Kaja los?«
»Ich habe sie gerufen, sie hat offenbar keinen Hunger«, erklärte Antonia kühl. »Noch etwas Püree?«
Er nickte und beschloss, keine weiteren Fragen zu stellen. Die drei seiner Kinder, die anwesend waren, hatten viel zu erzählen, und so genoss er das Essen und ihre muntere Unterhaltung. »Sehr lecker, die Brathähnchen«, sagte er zwischendurch.
»Kann ich noch einen Flügel haben?«, fragte Kevin. »Ihr mögt die Flügel doch sowieso nicht.«
»Nimm zwei«, sagte Antonia. »Ist ja sowieso nicht viel dran.«
Strahlend griff Kevin zu.
Nach den Hähnchen gab es noch Obstsalat, von dem kein Fitzelchen übrig blieb, dann räumten die Kinder den Tisch ab und die Spülmaschine ein, bevor sie sich in ihre Zimmer zurückzogen.
»Was war denn schon wieder los?«, fragte Leon. »Wieso hat Kaja nicht mit uns gegessen?«
»Sie und Kyra haben schon wieder gestritten. Ich habe Kyra ein paar gute Ratschläge gegeben, ihre große Schwester betreffend. Mal sehen, ob sie es schafft, sie zu beherzigen.«
»Und Kaja? Hast du ihr keine Ratschläge gegeben?«
»Dazu hatte ich keine Gelegenheit mehr, denn sie hat sich in ihrem Zimmer eingeschlossen. Sie vergreift sich in letzter Zeit mir gegenüber öfter im Ton, ich musste heute deshalb etwas deutlicher werden. Ich nehme an, das hat dazu geführt, dass ihr der Appetit vergangen ist.«
»Und wie soll das weitergehen?«
»Das liegt ganz bei ihr«, erklärte Antonia. »Für mich sehe ich keinen Handlungs- oder Klärungsbedarf. Meinen Standpunkt habe ich sehr deutlich gemacht.«
»Du kannst ja richtig hart sein.«
Sie ließ sich in seine Arme fallen. »Wenn es sein muss, aber nur dann. Und es fällt mir schwer, das muss ich schon sagen.«
»Sie hat sich dir gegenüber im Ton vergriffen? Was hat sie denn gesagt?«
Antonia wiederholte Kajas Worte.
»Das ist allerdings unverschämt«, sagte Leon nachdenklich. »So kenne ich sie nicht. Sie zickt herum in letzter Zeit, aber unverschämt habe ich sie noch nicht erlebt.«
»Sie ist durcheinander, aber so lange sie nicht mit uns redet, warum das so ist, können wir ihr nicht helfen.«
Leon schwieg. »Aber wenn sie nun wegläuft, weil sie sich von uns unverstanden fühlt? Du weißt, Teenager sind zu den verrücktesten Dingen fähig, und ich will mir nicht irgendwann Vorwürfe machen müssen, ihr nicht genug Verständnis entgegen gebracht zu haben.«
»Sie wird nicht weglaufen, sondern sich das nächste Mal gut überlegen, ob sie noch einmal so einen Auftritt hinlegt wie vorhin. Sie hat sich um ein schönes Abendessen mit uns gebracht, und glaub mir Leon: Das tut ihr jetzt schon leid.«
Er zog sie in seine Arme und küsste sie. »Und was war sonst noch so los?«
»Zuerst du. Welche Patientin hat dich heute besonders beschäftigt?«
Sie redeten noch über eine Stunde miteinander, und dieser Austausch tat ihnen beiden gut. Am schönsten war es für Antonia, dass Leon der Idee einer kinderärztlichen Gemeinschaftspraxis in der Kayser-Klinik sehr aufgeschlossen gegenüberstand. »Da hätten wir auch selbst drauf kommen können«, sagte er. »Es ist doch viel besser, wenn von vornherein nicht alles allein auf dir lastet«, sagte er.
Als sie später ins Bett gingen, hielten sie vor Kajas Tür unwillkürlich an, gingen dann aber weiter.
Drei Stunden später wurde Antonia wach und wusste im ersten Moment nicht, was sie geweckt hatte, bis es ihr klar wurde: Sie hatte unten im Haus Geräusche gehört.
Leise stand sie auf und schlich aus dem Schlafzimmer und dann die Treppe hinunter zur Küche, denn von dort war ein schmaler Lichtstreifen zu sehen. Von der Tür aus sah sie Kaja neben dem Kühlschrank stehen und gierig die Reste des Abendessens in sich hineinschlingen.
»Guten Appetit«, sagte Antonia.
Kaja fuhr erschrocken zusammen, fasste sich aber schnell wieder. »Ich hatte Hunger«, sagte sie, und dann: »Es tut mir leid, Mami, entschuldige bitte. Ich … ich wollte nicht sagen, dass du eine schlechte Mutter bist oder so. Aber ich war so wütend und da …«
»Da sind dir ein paar Worte herausgerutscht, die du eigentlich gar nicht sagen wolltest.«
Kaja nickte stumm.
Antonia begriff, dass sie den Tränen nahe war, und so ging sie zu ihr und schloss sie in die Arme. »Versuch wenigstens, nicht beim geringsten Anlass hochzugehen wie eine Rakete. Kyra ist fünf Jahre jünger als du, und sie hat dich schon immer bewundert, das weißt du doch. Es tut ihr weh, wenn du für sie unerreichbar bist.«
Wieder nickte Kaja, ohne etwas zu sagen, aber Antonia spürte, wie ihre Schulter nass wurde. Da schlang sie die Arme noch ein bisschen fester um ihre Älteste.
Sie wusste ja aus eigener Erfahrung, dass es nicht einfach war, sechzehn Jahre alt zu sein.
*
Peter war am nächsten Tag guter Dinge, als er aus der Schule kam. Er hatte in Mathematik eine gute Note erhalten, und in Englisch war er auch gelobt worden. Außerdem hatte Kyra ihn angelächelt. Sie war das einzige Mädchen aus seiner Klasse, das ihm gefiel. Sie war anders als die anderen, die immer kicherten und irgendwie albern waren und sich mit ihren Handys fotografierten. Kyra tat das nicht. Sie war ohnehin eher ernst, das hatte er schon gemerkt. Aber heute hatte sie ihn angelächelt.
Mehr als ein paar Worte hatte er bisher noch nicht mit ihr gewechselt, aber vielleicht würde er morgen in der großen Pause versuchen, ein richtiges Gespräch mit ihr zu führen. Allerdings würde er sich vorher überlegen müssen, worüber, denn in solchen Dingen war er nicht gut. Mit seiner Mutter konnte er ohne Probleme lange Gespräche führen, weil er sich in ihrer Gegenwart wohl und sicher fühlte. Wenn er aber jemanden noch nicht gut kannte, blieb er lieber stumm. Für ihn war es ja schon eine Überwindung, sich mündlich am Unterricht zu beteiligen, da ihm bewusst war, dass er es schriftlich besser konnte.
Er hatte doch tatsächlich die Jungen völlig vergessen, die ihn seit Wochen verfolgten, und so fuhr er vor Schreck zusammen, als sie wie aus dem Nichts neben ihm auftauchten.
Es war ihm schon lange nicht mehr passiert, dass er einfach nicht an sie gedacht hatte.
»Na, Brillenschlange? Hast du gedacht, wir hätten dich vergessen? Wir haben ja noch was nachzuholen von gestern.«
Und schon schubsten sie ihn wieder, einer trat ihm von hinten in die Kniekehlen – das tat gemein weh – während die anderen ihn vor den Blicken der Erwachsenen abschirmten, damit diese nichts davon mitbekamen.
»Hört auf!«, rief Peter, aber das schien sie erst recht anzustacheln.
»Wir haben doch gerade erst angefangen!«, rief er einer, und schon lachten sie und boxten ihn, rissen ihn an den Haaren und amüsierten sich, als sie sahen, wie er vor Schmerz das Gesicht verzog. Sah es für die vorüber eilenden Erwachsenen wirklich wie eine harmlose Rangelei unter Kindern aus? Aber vermutlich sahen sie ihn überhaupt nicht, weil immer einer der anderen Jungen ihnen den Blick verstellte.
Er fragte sich, was geschehen würde, wenn er laut um Hilfe riefe. Ob ihn jemand ernst nähme? Ob die Jungen vor Schreck von ihm abließen?
Er dachte nicht lange darüber nach, sondern schrie einfach, doch schon im nächsten Moment bekam er einen so harten Fausthieb ins Gesicht, dass ihm buchstäblich die Luft wegblieb.
»Wenn du noch einmal schreist, wirst du es bereuen!«, zischte der Junge, den er für den Anführer der Bande hielt, weil er am größten und am stärksten war und immer die Kommandos gab, denen die anderen folgten.
Peter konnte nichts mehr sehen, er spürte etwas warm und klebrig über sein Gesicht laufen, und plötzlich fühlten sich seine Beine an wie Pudding.
Er hörte noch, wie der Junge einen deftigen Fluch ausstieß, dann wurde ihm schwarz vor Augen.
*
Antonia rannte zur gleichen Zeit los wie ein Mann, der von der anderen Seite kam. Sie packte den Jungen, der den Kleineren geschlagen hatte, an der Schulter und riss ihn herum. »Was fällt euch denn ein?’«, rief sie. »Ihr seid zu viert und verhaut einen Jüngeren, ihr Feiglinge?«
Der Junge befreite sich mit einem Ruck aus ihrem Griff und ergriff die Flucht, auch zwei andere rannten weg, aber der Mann hielt den vierten, der ebenfalls fliehen wollte, eisern fest, was nicht so einfach war, denn der Junge wehrte sich mit Händen und Füßen. Da Antonia sah, dass der am Boden liegende Junge heftig aus einer Wunde über dem rechten Auge blutete, kniete sie neben ihm nieder und begann, ihn zu untersuchen. Sein Puls raste, aber seine Augenlider flatterten bereits, er würde bald wieder zu sich kommen.
»Ich rufe die Polizei und einen Krankenwagen, der Junge ist bewusstlos und hat eine Wunde, die genäht werden muss. Schaffen Sie es, den Bengel so lange festzuhalten?«
»Keine Sorge, der entkommt mir nicht«, erwiderte der Mann grimmig. Der Junge spuckte nach ihm, gleichzeitig trat er heftig zu, schaffte es aber trotzdem nicht, sich zu befreien. Der Griff des Mannes wurde nur noch fester.
Antonia rief zuerst den Krankenwagen. Den Anruf bei der Polizei konnte sie sich sparen, denn die Besatzung eines Streifenwagens kam vorbei und fragte, was denn geschehen sei. Die Antwort überließ sie dem Mann, der sehr klar schilderte, was er gesehen hatte. Seine Schilderung deckte sich mit Antonias Beobachtungen.
Daraufhin nahmen die Beamten ihre Personalien auf und verfrachteten den Jungen, der sich noch immer heftig wehrte, in ihren Wagen. »Er wird uns den Namen der anderen schon sagen«, erklärten sie. »Wie schlimm ist das Opfer verletzt?«
»Die Wunde muss genäht werden«, sagte Antonia. »Außerdem hat er vielleicht eine Gehirnerschütterung, er hat einen ziemlich heftigen Schlag abbekommen, das habe ich gesehen.«
»Sind Sie Ärztin?«
»Ja.«
Der am Boden liegende Junge schlug die Augen auf und blinzelte. Erst jetzt bemerkte Antonia, dass der Mann, der mit ihr dem Jungen zu Hilfe gekommen war, mittlerweile neben ihr kniete.
»Hallo«, sagte er freundlich. »Da bist du ja wieder.«
Er sagte nichts, sah erst Antonia, dann den Mann an, als überlegte er, wieso er am Boden lag und sie neben ihm knieten.
»Wie heißt du?«, fragte der Mann.
Er war noch jung, sah sie jetzt. Seine Stimme war sanft, und offenbar hatte er den richtigen Ton angeschlagen, der Junge jedenfalls reagierte positiv darauf.
»Peter Stadler«, sagte er.
»Und ich bin Florian Ammerdinger. Weißt du, was passiert ist? Kannst du dich daran erinnern?«
»Sie haben mich wieder geschlagen«, antwortete der Junge leise.
»Wieder? Haben sie das schon öfter gemacht?«
Ein stummes Nicken beantwortete diese Frage.
»Hast du denn mit niemandem darüber gesprochen?«
»Nein. Ich … ich dachte, ich schaffe das irgendwie allein.«
Florian Ammerdinger sah auf, er begegnete Antonias Blick. Sie konnte sehen, dass er nicht weniger erschüttert war als sie selbst.
»Ich sehe nichts«, sagte der Junge. »Wo ist meine Brille?«
Antonia bemerkte erst jetzt die zerbrochene Brille, die neben ihm lag. »Sie ist kaputt gegangen«, sagte sie, »du kannst sie nicht mehr aufsetzen. Aber wir packen sie ein und nehmen sie mit.«
»Wohin? Ich will nach Hause.«
»Du hast eine Wunde über einem Auge, die genäht werden muss. Keine große Sache. Gleich kommt ein Krankenwagen, der bringt dich in die Kayser-Klinik, die ist ganz in der Nähe. Ich werde auch bald dort sein, in Ordnung? Mein Name ist Antonia Laurin, ich bin Ärztin.«
Sie meinte, Florian Ammerdinger zusammenzucken zu sehen. Sagte ihm ihr Name etwas? »Fahren Sie mit in die Klinik?«, fragte sie. »Es wäre vielleicht gut, wenn wir zusammen mit Peters Eltern sprechen könnten.«
»Mit meiner Mutter«, sagte der Junge. »Können Sie sie anrufen? Britta Stadler. Ich kann Ihnen ihre Handynummer diktieren. Aber machen Sie ihr bitte keine Angst. Ich … es geht mir ja schon wieder gut.«
»Britta Stadler?«, fragte Antonia. »Die Architektin?«
»Kennen Sie sie?«
»Ja, ich kenne sie. Du musst mir ihre Nummer nicht diktieren, Peter, ich habe sie gespeichert.«
Der Krankenwagen kam. Sie informierte die Sanitäter und bat sie, den Jungen in die Kayser-Klinik zu bringen, die ohnehin das nächst gelegene Krankenhaus war. »Ich komme gleich nach«, sagte sie. »Und ich sage dort in der Notaufnahme Bescheid, damit die Kollegen vorbereitet sind.«
Die Sanitäter nickten und kümmerten sich um Peter Stadler, während Antonia mit Eckart Sternberg sprach. »Er hat vielleicht einen Schock erlitten, diese Jungs waren zu viert und haben ihm offenbar schon öfter zugesetzt.«
»Wir kümmern uns um ihn, bis du hier bist«, versprach Eckart.
Als der Krankenwagen abgefahren war, wandte sich Antonia wieder Florian Ammerdinger zu. Ihr war so, als hätte sie den Namen ›Ammerdinger‹ schon einmal gehört, doch ihr fiel nicht ein, in welchem Zusammenhang das gewesen sein könnte. »Kommen Sie mit mir in die Klinik?«, fragte sie.
»Nein«, erwiderte er steif, »die Kayser-Klinik möchte ich nicht betreten. Meine Frau ist eine Patientin Ihres Mannes, und jedes Mal, wenn sie bei ihm war, bekommen wir Streit.«
»Aber wieso denn?«, fragte Antonia verblüfft.
Sie wurde aus ihm nicht klug. Er war überaus einfühlsam mit Peter Stadler umgegangen, jetzt jedoch wirkte er plötzlich kühl und abweisend, sie erkannte den hilfsbereiten Mann von vor wenigen Minuten kaum wieder.
»Mehr möchte ich nicht sagen«, erwiderte er. »Aber glauben Sie mir, es ist besser, wenn Ihr Mann und ich uns nicht begegnen. Er hetzt meine Frau gegen mich auf.«
»Herr Ammerdinger, ich kenne meinen Mann, so etwas würde er niemals tun.«
»Ich weiß es besser«, sagte er sehr bestimmt, »und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich bin immerhin froh, dass wir dem Jungen helfen konnten. Die Polizei hat ja meine Nummer, wenn es noch Fragen gibt, wissen sie, wie sie mich erreichen können.« Er nickte ihr noch einmal zu und war im nächsten Augenblick in der Menge verschwunden.
Sie stand noch einen Moment verwirrt da, dann fiel ihr ein, dass sie Britta Stadler anrufen musste.
Diese fiel natürlich aus allen Wolken. »Ich … ich bin noch im Büro, aber ich komme sofort. Meine Güte, Frau Dr. Laurin, Sie sagen, er ist wahrscheinlich schon öfter von diesen Jungen geschlagen worden?«
»Das hat er jedenfalls gesagt. Übrigens wollte er auf keinen Fall, dass ich Sie beunruhige, das hat er extra betont. Und ich denke, um seinen körperlichen Zustand müssen Sie sich auch tatsächlich keine Sorgen machen. Es wird ihm bald wieder gut gehen.«
»Aber wenn das schon öfter passiert ist …« Britta Stadler beendete ihren Satz nicht.
»Wir sehen uns gleich in der Klinik, Frau Stadler.«
Nachdenklich machte sich Antonia auf den Weg. Es gab einiges, das sie klären musste.
*
»Das haben wir gleich«, sagte Eckart Sternberg, der sich selbst um den verletzten Jungen kümmerte, den Antonia ihm kurz zuvor angekündigt hatte. Er nähte die Wunde, nachdem er sie betäubt hatte, mit ein paar kleinen Stichen, so dass die Narbe später kaum zu sehen sein würde.
Er hatte beim Anblick des Jungen einen Schrecken bekommen, denn die Wunde hatte stark geblutet. Dennoch kam ihm Peter Stadler erstaunlich gelassen vor. Dabei hatte Antonia doch erwähnt, dass er von vier Jungen geschlagen und getreten worden war und das offensichtlich nicht zum ersten Mal. Aber weder weinte er, noch beklagte er sich. Er war zwar still und in sich gekehrt, aber er hatte Kinder schon ganz anders reagieren sehen in vergleichbaren Situationen.
Schwester Marie hatte geholfen, die Wunde zu säubern, und sie hatte dem Jungen sehr sanft das Gesicht abgewaschen und ihm außerdem etwas zu trinken gegeben und ihm ein Stück Schokolade zugesteckt. Wieder einmal stellte Eckart fest, dass allein Maries Anwesenheit sich positiv auf die Patienten auswirkte. Sie hatte in ihrem Leben schon viel gesehen und erlebt, so dass sie auch in kritischen Situationen ruhig blieb. Diese Ruhe übertrug sich offenbar auf andere. Außerdem verstand sie es, jedem Menschen, um den sie sich kümmerte, das Gefühl zu geben, dass auf jeden Fall alles wieder in Ordnung kommen würde.
»So, das war’s schon«, sagte Eckart, als er die Wunde genäht hatte. »Ist dir noch schwindelig?«
»Ein bisschen«, gab der Junge zu.
»Ich schätze, du hast eine leichte Gehirnerschütterung, du solltest ein paar Tage im Bett bleiben. Treibst du Sport?«
Ein verlegenes Lächeln antwortete ihm. »Nicht so gern, weil ich so schlecht sehe, ich bin stark kurzsichtig und trage eine dicke Brille. Aber wenn ich älter bin, kann ich operiert werden, dann brauche ich die Brille nicht mehr.«
Antonia erschien an der Tür. »Oh, du siehst ja schon ganz anders aus«, sagte sie zu dem Jungen. »Sei froh, dass Dr. Sternberg dich genäht hat, er macht die schönsten Nähte, hinterher sieht man fast nichts mehr.«
»Magst du einen Becher Schokolade mit Sahne?«, fragte Marie.
Peter nickte. »Hier sind alle so nett zu mir«, sagte er, als die Schwester gegangen war.
»Du bist unser Patient, wir wollen, dass es dir ganz schnell wieder besser geht.«
Als Britta Stadler kam, merkte man ihr nichts davon an, wie aufgewühlt sie war. Antonia konnte sie für ihre Selbstbeherrschung nur bewundern. Sie begrüßte ihren Sohn ohne erkennbare Aufregung, nahm die genähte Wunde und sein langsam anschwellendes Gesicht zur Kenntnis, ohne ein Wort darüber zu verlieren, und bedankte sich dann bei Antonia, weil sie Peter zu Hilfe gekommen war.
»Das war ich nicht allein«, erklärte Antonia, »ein Herr Ammerdinger hat einen von den Jungen festhalten und der Polizei übergeben können. Ich nehme an, er wird die Namen seiner Freunde verraten, wenn er merkt, dass er sich sonst in noch größere Schwierigkeiten bringt.«
»Die haben dich schon öfter belästigt?«, fragte Britta ihren Sohn.
Peter nickte. Ihm war anzusehen, dass er über das Thema nicht reden wollte – jedenfalls nicht jetzt und hier. Seine Mutter begriff das sofort und stellte keine weiteren Fragen. Sie konnten zu Hause darüber reden, in aller Ruhe und unter vier Augen.
»Kann ich meinen Sohn mitnehmen?«, fragte sie.
»Ja«, antwortete Eckart Sternberg. »Aber er sollte sich noch schonen, stecken Sie ihn zwei oder drei Tage ins Bett, sein Kopf braucht Ruhe. Außerdem wird er spätestens morgen ein ziemlich buntes Gesicht haben. Legen Sie Kühlkissen auf die Schwellungen, und ich gebe Ihnen noch eine Salbe mit, die verhindert, dass die Blutergüsse allzu schlimm ausfallen. Viel mehr können Sie nicht tun.«
»Ich will lieber in die Schule gehen«, ließ sich Peter vernehmen.
»Du hast gehört, was der Herr Doktor gesagt hat. Drei Tage Bettruhe wirst du schon aushalten. Ich kann deine Lehrer ja fragen, was du in dieser Zeit im Unterricht versäumst.«
Peter schüttelte leicht den Kopf. Er wandte sich an Antonia. »Vielleicht kann Kyra mir schreiben«, schlug er schüchtern vor, »was durchgenommen wird und welche Aufgaben wir bekommen.«
Antonia fiel aus allen Wolken. »Ihr geht in eine Klasse, Kyra und du?«
»Ja. Ich weiß das aber erst, seit ich Ihren Namen gehört habe«, erklärte der Junge.
Auch seine Mutter reagierte überrascht. »Ich wusste nicht, dass Sie eine Tochter haben, Frau Dr. Laurin.«
»Zwei sogar – und zwei Söhne«, erklärte Antonia mit einem Lächeln. »Kyra ist unsere Jüngste. Sag mir, wie sie dich erreichen kann, Peter. Oder weiß sie das?«
»Nein. Haben Sie was zu schreiben?«
Und so verabschiedete sich Antonia wenig später mit einem Zettel in der Tasche, auf dem zwar nichts stand als eine Telefonnummer und eine Mail-Adresse, aber etwas an Peters Gesichtsausdruck hatte ihr verraten, dass sich dahinter so etwas wie eine erste schüchterne Liebeserklärung versteckte.
Kyra und Peter waren elf! Aber sie erinnerte sich, dass es auch in ihrem Leben eine Kinderliebe gegeben hatte und wenn sie sich nicht täuschte, war sie seinerzeit sogar noch etwas jünger gewesen. Und noch etwas fiel ihr ein: dass Kyra an ihrem Geburtstag erklärt hatte, noch habe sie keinen Freund, aber vielleicht bald.
Ob sie da von Peter Stadler gesprochen hatte?
*
Als Florian nach Hause kam, war die Wohnung leer. Er hatte vom ersten Moment an ein komisches Gefühl, das er sich nicht erklären konnte. Ella war öfter nicht zu Hause, wenn er aus dem Büro kam, aber es dauerte dann nie lange, bis sie auftauchte. Mal war sie einkaufen gewesen, mal bei einer Freundin, gelegentlich allerdings auch bei Dr. Laurin …
Er verzog das Gesicht. Frau Dr. Laurin war ihm auf Anhieb sympathisch gewesen, nicht nur, weil sie sofort gesehen hatte, dass ein Kind in Not war, während die übrigen Passanten blind und taub für das Geschehen um sie herum weitergegangen waren. Nein, sie hatte insgesamt sehr umsichtig reagiert, war nicht hektisch oder panisch geworden, sondern hatte getan, was getan werden musste. Er konnte nur hoffen, dass man die anderen Jungen ausfindig machte und empfindlich bestrafte.
Der Anblick des Jungen, der so tapfer gewesen war und nicht einmal geweint hatte, verfolgte ihn. Dieses blutverschmierte Gesicht, die zerbrochene Brille und dann noch die Bitte, seine Mutter nicht zu beunruhigen – er hatte mit den Tränen kämpfen müssen, und er wusste auch, warum. Er hatte sich selbst in diesem Jungen wiedererkannt.
Er ging in die Küche, um festzustellen, was Ella zum Abendessen eingekauft hatte, aber der Kühlschrank war ziemlich leer. Wenn sie jetzt erst zum Einkaufen gegangen war, würde es spät werden mit dem Abendessen.
Das Wohnzimmer war so aufgeräumt, dass er irritiert die Stirn runzelte. Es sah irgendwie … unbewohnt aus. So, als hätte Ella alles, was an sie erinnerte, fortgenommen. Kein Buch mit Lesezeichen lag herum, keine Strickjacke, kein Schal, keine Rezeptsammlung.
Einer plötzlichen Eingebung folgend ging er ins Schlafzimmer und öffnete ihren Schrank. Fassungslos starrte er auf die fast leere Kleiderstange und die Fächer, in denen vorher kaum noch Platz für etwas Neues gewesen war. Jetzt lagen dort noch ein paar vereinzelte T-Shirts und ein leichter Sommerpulli, alles andere war weg. Genau so war es bei den Schuhen, und als er schließlich im Wandschrank nachsah, wo ihre Koffer standen, wurde aus seinem Verdacht Gewissheit: Ella hatte ihn verlassen.
Er lief durch die ganze Wohnung, suchte nach einem Brief von ihr, der eine Erklärung enthielt, fand aber nichts. Sie war ohne ein Wort gegangen.
Panik stieg in ihm auf. Er liebte Ella, er konnte sich ein Leben ohne sie nicht vorstellen, aber bei ihr war es offenbar anders. Sie schien es sich vorstellen zu können, ohne ihn zu leben, weil er sich weigerte, ihr ihren sehnlichsten Wunsch zu erfüllen. Wie oft hatte er sich schon gefragt, ob er nicht nachgeben und endlich einwilligen sollte, mit ihr eine Familie zu gründen, aber sofort kehrte die Panik zurück, und er wusste, er würde es nicht über sich bringen.
Er begann zu telefonieren, rief alle Leute an, von denen er sich vorstellen konnte, dass sie vielleicht wussten, wo Ella sich jetzt aufhielt, aber niemand konnte ihm helfen. Oder wollte ihm niemand helfen?
Er versuchte, sich zu beruhigen, schließlich war niemandem geholfen, wenn er jetzt durchdrehte. Er musste Ella finden und ihr sagen, wie sehr er sie liebte und dass er überzeugt davon war, mit ihr auch ohne Kinder ein glückliches Leben führen zu können. Vielleicht würde er ihr sogar endlich erzählen, warum er keine Kinder haben wollte, und dann würde sie erkennen, dass sie ihn in diesem Punkt nicht länger unter Druck setzen durfte.
Als ihm niemand mehr einfiel, den er anrufen konnte, verließ er die Wohnung. Es gab einen Menschen, dem er jetzt unbedingt die Meinung sagen musste.
*
»Bist du böse auf mich?«, fragte Peter.
»Höchstens, weil du mir nicht von diesen Jungen erzählt hast. Ich dachte immer, wir beide könnten über alles reden.«
»Können wir ja auch. Aber du hattest doch sowieso schon Stress in deinem neuen Job – und ich dachte, ich komme schon irgendwie damit klar.«
»Wie lange geht das schon so?«
»Paar Wochen«, nuschelte Peter.
»Aber es war nicht von Anfang an so schlimm wie heute?«
»Nee, am Anfang haben sie mir nur blöde Sachen hinterher gerufen. Dann haben sie angefangen, mich zu schubsen und zu treten. Ich sollte ihnen Geld geben, damit sie aufhören.«
»Geld geben?«, rief Britta entsetzt. »Sie haben dich erpresst?«
»Sie haben es versucht, ich habe ihnen ja nichts gegeben. Aber dadurch ist es immer schlimmer geworden. Zum Schluss – na ja, ich hatte echt Angst.«
»Sie waren zu viert und älter als du. Was für eine feige Bande!«
»Das habe ich mir auch immer gesagt, aber geholfen hat es leider nicht. Zum Schluss haben sie gedroht, mir mein Handy wegzunehmen.«
»Wir werden Anzeige erstatten«, sagte Britta.
»Ich bin froh, dass du jetzt Bescheid weißt, Mama. Tut mir leid, dass ich dir nicht schon früher davon erzählt habe.«
»Wenn wieder mal etwas ist, was dir zu schaffen machst, redest du mit mir, versprich mir das.«
»Ich verspreche es.«
»Und jetzt erzähl mir von Kyra Laurin. Sie ist also nett?«
»Ja«, antwortete Peter. »Sie ist überhaupt nicht albern, sie kichert auch nicht dauernd wie die anderen Mädchen, und sie trägt nicht so blöde Klamotten. Sie ist ziemlich schüchtern, aber sie ist mir gleich aufgefallen. Ich dachte nur …«
Er verstummte.
Britta wartete geduldig, bis er weitersprach. »Ich dachte, sie findet nur größere Jungen toll, weil sie manchmal mit einem auf dem Schulhof geredet hat. Aber dann habe ich gehört, dass das einer ihrer Brüder war.« Jetzt glühte sein Gesicht rosig.
Britta versagte sich jeden weiteren Kommentar. Sie sagte nur: »Dann hoffen wir mal, dass sie dir schreibt, wenn ihre Mutter ihr erzählt, was passiert ist.«
Peter verzog das Gesicht. »Ich hoffe, sie erzählt nicht zu viel, das fände ich blöd.«
»So, wie du Kyra beschreibst, würde sie es doch eher für sich behalten, meinst du nicht?«
»Das stimmt«, sagte Peter. Er klang erleichtert. »Sie redet eigentlich nie über andere.«
»Na, siehst du. Soll ich uns mal was zu essen machen? Worauf hättest du denn Appetit?«
»Spaghetti«, antwortete Peter.
»Als hätte ich’s geahnt!«
*
»Florian Ammerdinger?«, fragte Leon ungläubig. Antonia war überraschend in seinem Büro aufgetaucht und hatte ihm erzählt, was passiert war. »Du und er, ihr beide zusammen habt diesem Jungen geholfen?«
»Ja, und er war wirklich reizend. Ganz einfühlsam und liebenswürdig ist er auf den Jungen eingegangen. Aber als ich gefragt habe, ob er mich in die Klinik begleitet, hat er gesagt, lieber nicht, du würdest seine Frau gegen ihn aufhetzen. Ist sie etwa die Patientin, von der du mir erzählt hast, die sich ein Kind wünscht, während ihr Mann keine Kinder möchte?«
»Du weißt, dass ich dir, streng genommen, auf diese Frage nicht antworten darf.«
»Ja, ich weiß, aber ich habe es ja selbst erraten. Und ich weiß, wie dich dieser Fall beschäftigt.«
Leon nickte. »Mittlerweile ist sie völlig verzweifelt, ich habe mich sogar gefragt, ob sie imstande wäre, sich etwas anzutun. Ich kann diesen Konflikt nicht lösen. Meine Patientin wird so oder so unglücklich werden, dabei liebt sie ihren Mann.«
»Das ist eine seltsame Geschichte«, sagte Antonia. »Und sie passt überhaupt nicht zu dem Florian Ammerdinger, den ich heute kennengelernt habe. Er hat sofort den richtigen Ton getroffen bei Frau Stadlers Sohn – weißt du, nicht so übertrieben mitleidig, sondern ganz ruhig und unaufgeregt. Mir war er auf Anhieb sympathisch.«
»Ich kenne ihn ja nicht«, erwiderte Leon. »Wie oft habe ich meiner Patientin schon gesagt, dass ich gern mal ein Gespräch mit ihrem Mann führen würde, aber er hat sich geweigert, und zwingen kann ich ihn ja nicht.«
»Was denkst du, steckt hinter seinem Verhalten?«
»Ich kann gar nicht mehr zählen, wie viele Theorien ich schon aufgestellt habe, aber ich kann sie ja nicht auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen. Jedenfalls denke ich, dass er etwas Schreckliches …«
Die Tür wurde aufgerissen, sie hörten Moni Hillenberg rufen: »So warten Sie doch, Sie können hier nicht einfach so durchmarschieren!«+
Ein junger Mann stand in der Tür, sichtlich erregt.
»Herr Ammerdinger!«, sagte Antonia überrascht. Und, an Moni Hillenberg gewandt: »Lassen Sie nur, es ist schon in Ordnung.«
Daraufhin schloss die Sekretärin die Tür.
Leon hatte sich erhoben. »Ich bin Dr. Laurin«, sagte er und streckte die Hand aus. »Ich habe schon gehört, dass Sie heute gemeinsam mit meiner Frau einem Jungen zu Hilfe gekommen sind. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen.«
Florian Ammerdinger übersah die ausgestreckte Hand. Sein Blick war anklagend, als er sagte: »Meine Frau hat mich verlassen, und das ist Ihre Schuld, Herr Dr. Laurin!«
*
Ella bezahlte den Taxifahrer, der ihr die schweren Koffer bis in das kleine Haus getragen hatte, und schloss die Tür hinter sich. Den Schlüssel hatte sie unter einem Geranientopf gefunden, der neben der Eingangstür stand.
Das Haus lag in den Bergen, sie hatte es im Internet gefunden und sofort gebucht. Es war ein wenig altmodisch und bot nicht den Komfort, den Touristen heute verlangten, sie nahm an, dass es deshalb noch zu haben gewesen war – und zudem bezahlbar. Hier würde sie eine Weile bleiben können und die Muße haben, in Ruhe über ihre Zukunft nachzudenken. Denn dass es nicht so weitergehen konnte wie bisher, war ihr immerhin klar geworden. Auf Dauer würde das Leben, das sie jetzt mit Florian führte, sie unglücklich machen.
Sie sah sich zunächst im Haus um, dann begann sie, einen ihrer Koffer auszupacken und die Sachen in dem winzigen Schlafzimmer in einen Schrank zu räumen. Den anderen Koffer würde sie zunächst einmal unausgepackt lassen.
Eine Stunde später verließ sie das Haus, um sich im Ort umzusehen und einzukaufen, was sie fürs Frühstück brauchte. Heute Abend würde sie essen gehen. Ihr Vermieter hatte eine Mappe mit Empfehlungen für Lokale, aber auch mit Tipps für Ausflüge bereitgelegt.
Sie traf auf freundliche Menschen, und ihre Stimmung hob sich. Als jedoch ein junger Mann versuchte, mit ihr zu flirten, trat sie den Rückzug an.
Als sie zum Haus zurückkehrte, stand eine ältere Frau davor, die an die Tür klopfte.
»Suchen Sie jemanden?«, fragte Ella.
Die Frau drehte sich zu ihr um. »Sind Sie Frau Ammerdinger?«
»Ja, ich war einkaufen«, antwortete Ella. »Frau Süder?«
»Ja, ich wollte fragen, ob alles in Ordnung ist oder ob Sie noch etwas brauchen.« Sie hielt eine Suppenkelle hoch. »Und die habe ich Ihnen mitgebracht. Die, die hier in der Küche war, ist spurlos verschwunden.« Ein Schatten lief über ihr Gesicht. »Ständig verschwindet etwas, aber es lohnt sich nicht, den Leuten wegen jeder Kleinigkeit hinterher zu laufen. Ich frage mich immer, wieso jemand hier Urlaub machen kann, aber dann kein Geld hat, um sich zu Hause eine Suppenkelle zu kaufen.«
»Wahrscheinlich geht es gar nicht ums Geld«, erwiderte Ella. »Es ist eher eine Art Sport, vermute ich: Was kann ich mitgehen lassen, ohne dass mir etwas passiert.«
»Komischer Sport«, seufzte Frau Süder.
»Wollen Sie nicht einen Kaffee mit mir trinken?«, fragte Ella. »Wir können uns doch hier draußen vors Haus setzen, die Sonne scheint so schön.«
Frau Süder war nicht abgeneigt, und so begann Ellas ›Auszeit‹, wie sie ihren Aufenthalt in den Bergen bei sich nannte, auf die denkbar angenehmste Weise.
*
»Was war das denn?«, fragte Antonia entgeistert, als Florian Ammerdinger nach einer Flut von Anschuldigungen so schnell und unvermittelt wieder aus Leons Büro gestürmt war, wie er es zuvor betreten hatte.
»Ich weiß es nicht, aber der Mann ist ja völlig außer sich, und er hat sich offenbar in die Idee verrannt, dass ich an seinem Unglück die Schuld trage.« Leon sah beunruhigt aus. »Es ist nicht gut, dass er in diesem Zustand allein ist.«
»Hast du eine Mobilfunknummer seiner Frau?«
»Ja, aber sie wird auf Anrufe nicht reagieren. Du hast doch gehört, was Herr Ammerdinger gesagt hat: Da läuft die Mailbox, sie selbst geht nicht ans Telefon.«
»Aber man kann sie auf diese Weise finden«, sagte Antonia. »Man könnte sie orten.«
»Nicht einfach so. Frau Ammerdinger ist erwachsen, sie darf sich aufhalten, wo sie möchte. Und so lange man nicht befürchten muss, dass Gefahr im Verzug ist …« Leon schüttelte den Kopf. »Sie hat zwei Koffer gepackt und ihren Mann verlassen, Antonia. Das ist ihr gutes Recht.«
»Was für eine verfahrene Geschichte«, murmelte Antonia. »Herr Ammerdinger hat jedenfalls mehrere Gesichter. Der, den ich jetzt eben erlebt habe, hat keinerlei Ähnlichkeit mit dem Mann, der Peter Stadler zu Hilfe gekommen ist.« Sie stand auf. »Ich fahre nach Hause, Leon, ich bin schon wieder viel zu spät dran. Wie sieht es bei dir aus?«
»Wenn kein Notfall dazwischenkommt, werde ich zum Abendessen zu Hause sein.«
Alle Kinder waren bereits da, als Antonia das Haus betrat, und es lag offensichtlich kein Streit in der Luft, alles war friedlich. Konstantin und Kevin lümmelten auf dem Sofa im Wohnzimmer herum und waren mit ihren Handys beschäftigt, Kaja und Kyra waren nicht zu sehen, also offenbar oben in ihren Zimmern.
Sie ging nach oben und klopfte an Kyras Tür.
»Jaha!«
Antonia schloss die Tür hinter sich. »Ich habe etwas für dich«, sagte sie und reichte ihrer Jüngsten den Zettel, den Peter bekritzelt hatte.
Kyra sah zunächst verständnislos darauf, dann las sie den Namen in der Mail-Adresse. Interessiert beobachtete Antonia ihre Reaktion darauf: Sehr, sehr langsam wurde Kyra rot, während sie noch immer auf den Zettel starrte. Ihre Hand zitterte leicht.
»Soll ich dir erzählen, was passiert ist?«, fragte Antonia.
Kyra nickte, sah ihre Mutter aber noch immer nicht an.
Das änderte sich jedoch, als Antonia die Szene schilderte, deren Zeugin sie geworden war, bevor Florian Ammerdinger und sie eingegriffen hatten. Kyras Kopf flog in die Höhe, fassungslos hörte sie dem weiteren Bericht ihrer Mutter zu.
»Er hat geblutet und musste in die Klinik?«, fragte sie entsetzt, als Antonia geendet hatte.
»Ja, Eckart hat die Wunde genäht, daraufhin hat Frau Stadler mit Peter die Klinik verlassen. Er soll ein paar Tage im Bett bleiben, weil er eine leichte Gehirnerschütterung hat. Er meinte, du würdest ihm vielleicht schreiben, was ihr in der Schule durchnehmt und welche Aufgaben ihr bekommt. Es hat ihm, glaube ich, nicht gefallen, dass er nicht zur Schule gehen darf.«
»Klar schreibe ich ihm«, sagte Kyra eifrig. »Ich schreibe ihm jetzt gleich.«
»Tu das. Und … Kyra?«
»Ja?«
»Vielleicht erzählst du das, was du jetzt von mir gehört hast, in der Schule nicht weiter. Ich glaube, das hätte Peter nicht so gern.«
Kyra sah ihre Mutter aufrichtig verwundert an. »Manchmal hast du aber auch Ideen, Mami! Ich bin doch keine, die herumtratscht!«
»Nein, natürlich nicht. Entschuldige bitte, ich wollte nur sichergehen, dass das unter uns bleibt«, sagte Antonia.
Als sie sich zum Gehen wandte, saß Kyra bereits an ihrem Laptop. Lächelnd schloss Antonia die Tür hinter sich.
*
Florian versuchte vergeblich, sich zu beruhigen, als er aus der Kayser-Klinik rannte, denn er wusste, dass er sich unvernünftig verhielt. Es war schon unvernünftig gewesen, Dr. Laurin in seinem Büro zu überfallen und ihn mit Vorwürfen zu überziehen. Letzten Endes, das wusste Florian im tiefsten Inneren, lag das Problem bei ihm. Er musste es lösen, wenn er nicht sich – und Ella – ins Unglück stürzen wollte.
Aber allein die Aussicht, sich mit jener Zeit auseinanderzusetzen, in der er sich selbst oft wie der ärmste Mensch auf dieser Welt vorgekommen war, versetzte ihn in Panik. So war es schon immer gewesen, wenn er an diesen Punkt gelangt war, denn es war ja nicht das erste Mal: Schon öfter hatte ihm klar vor Augen gestanden, dass es an ihm lag, sein Leben zu verändern, dass er es war, der etwas tun musste und dass er nicht weiterkam, wenn er stur an seinem vor langen Jahren gefassten Entschluss festhielt, niemals Vater zu werden. Das allein brachte nichts in Ordnung, gar nichts, auch wenn es ihm lange Zeit gelungen war, sich das einzureden.
Aber nun war Ella weg – sie hatte ihn verlassen, eben wegen dieses Entschlusses, mit dem sie offenbar nicht leben konnte. Mit ihrem Weggang hatte sie ihm die Hoffnung genommen, dass es ihm mit ihr zusammen irgendwann doch gelingen würde, die Dämonen der Vergangenheit zu bannen. Sie war gegangen, vielleicht für immer.
Wieder schwappte die Panik in ihm hoch, er bekam Atemnot, ihm wurde schwarz vor Augen, das kannte er schon. Dass er den nächsten Schritt auf die Straße machte, war ihm nicht bewusst. Er hörte etwas quietschen, er hörte eine Hupe, so laut, dass es ihm beinahe das Trommelfell zerriss – und er spürte einen schrecklichen Schlag im Rücken, als hätte ein Riese eine Betonwand nach ihm geschleudert.
Er stürzte ins Bodenlose, und noch im Fallen dachte er: Vielleicht sterbe ich jetzt – und dieser Gedanke schreckte ihn nicht einmal.
*
»Sie müssen sofort kommen, Chef«, rief Schwester Marie außer Atem. »Ein Notfall – schwerer Verkehrsunfall, ganz hier in der Nähe. Der Mann ist gerade in die Notaufnahme gebracht worden, Herr Dr. Sternberg sagt, er hat innere Verletzungen. Er wird Ihnen assistieren, ein OP steht schon bereit.«
Ade, Abendessen mit der Familie, dachte Leon. »Moni, rufen Sie bitte bei mir zu Hause an und sagen meiner Frau, dass wir einen Notfall haben und ich nicht vorhersehen kann, wie lange ich bleiben muss.«
»Wird sofort erledigt«, versprach seine Sekretärin.
Leon eilte in die Notaufnahme, wo zwei Pfleger den Verletzten gerade aus dem Behandlungsraum zum nächsten Fahrstuhl schoben. Leon sah das Gesicht des Mannes und wandte sich seinem Kollegen zu. Sein Entschluss stand sofort fest, er musste nicht einmal darüber nachdenken.
»Du wirst operieren, Eckart«, sagte er. »Ich bin in diesem Fall befangen.«
»Befangen? Wieso das denn?«
»Der Patient ist Florian Ammerdinger, der Mann, der auf keinen Fall Vater werden will – ich habe dir doch neulich von ihm erzählt. Er war eben noch bei mir im Büro und hat mich wüst beschimpft, weil seine Frau verschwunden ist. Ich assistiere dir. Glaub mir, es ist besser so.«
Eckart Sternberg nickte nur. Während sie sich steril wuschen, informierte er Leon über die bisherigen Ergebnisse seiner Untersuchung. »Er hat auf jeden Fall innere Verletzungen, ich habe Angst, dass er uns verblutet, bevor wir ihn überhaupt auf dem OP-Tisch haben, aber ich wollte es nicht riskieren, ihn in der Notaufnahme zu operieren.«
Sie betraten den OP, in dem bereits mehrere OP-Schwestern und eine Anästhesistin bereitstanden. Als Eckart den Bauchraum eröffnete, schoss eine Blutfontäne heraus, die die beiden Ärzte über und über besudelte. Sie blieben ruhig, es war nicht die erste kritische Situation, die sie gemeinsam meisterten.
»Blutdruck fällt«, sagte die Anästhesistin.
Du wirst nicht in meiner Klinik sterben, dachte Leon, während er nach der Ursache der Blutung suchte.
»Mehr Tücher, wir sehen ja nichts. Und wir brauchen weitere Blutkonserven. Schnell, viel Zeit, um den Mann zu retten, bleibt uns nicht!«
Konzentriert suchte Leon den Bauchraum ab, er blendete die Umgebung vollkommen aus. Endlich spürte er ein Sprudeln unter seiner rechten Hand. Er kniff zu, und zumindest eine Blutungsquelle versiegte, aber jetzt sahen sie, dass es noch mindestens eine andere geben musste. »Klemme«, sagte Leon. »Hier, ja, genau hier.«
Der Bauchraum füllte sich jetzt langsamer mit Blut, und wenig später hatte er auch das zweite verletzte Gefäß gefunden und abgeklemmt. Er blickte hoch, sah Eckart kurz lächeln.
»Blutdruck steigt wieder«, sagte die Anästhesistin.
Im Operationssaal war danach nichts mehr zu hören außer gelegentlichen leisen Kommandos der beiden Ärzte und dem Surren der Maschinen. Der Patient bekam Blutkonserve um Blutkonserve, mehr als einmal sah es so aus, als würden alle Bemühungen vergeblich bleiben, aber jedes Mal erholte sich Florian Ammerdinger in letzter Sekunde wieder. Einmal setzte sein Herz aus, aber sie konnten es wieder zum Schlagen bringen und schließlich, nach einer Zeitspanne, die ihnen wie eine Ewigkeit vorkam, war es doch so weit, dass Eckart Sternberg sagte: »Ich glaube, wir können schließen.«
Leon und ihm standen Schweißperlen auf der Stirn. Der Patient hatte die Notoperation überlebt, aber sie wussten, dass Florian Ammerdingers Leben noch mindestens in der folgenden Nacht, wahrscheinlich sogar noch länger, an einem seidenen Faden hängen würde.
*
»Sie hat mir geschrieben, Mama«, sagte Peter. »Kyra, meine ich. Sie will mir alle Aufgaben schicken und mir genau aufschreiben, was sie durchgenommen haben. Und …« Er stockte.
»Und?«, fragte Britta.
Sie saßen am Küchentisch, um die Spaghetti zu essen, die Peter sich gewünscht hatte. Er war ein bisschen unsicher auf den Beinen, aber sonst schien es ihm schon wieder recht gut zu gehen. Britta hatte seine Brille bereits zum Optiker gebracht, jetzt saß eine ziemlich unförmige Ersatzbrille auf seiner Nase.
»Und sie hat gefragt, ob sie mal vorbeikommen soll.«
»Klar soll sie. Oder nicht?«, fragte Britta.
»Von mir aus schon, aber ich wollte dich zuerst fragen, ob du was dagegen hast.«
»Was könnte ich denn dagegen haben?«
»Weiß ich auch nicht, ich wollte jedenfalls fragen.«
»Ich könnte morgen früher nach Hause kommen und unterwegs etwas Kuchen kaufen für uns«, schlug Britta vor. »Keine Sorge, ich habe nicht vor, bei euch zu sitzen und euch zu stören. Aber natürlich würde ich Kyra Laurin gerne kennenlernen. Nach dem Kuchen würde ich mich dann diskret zurückziehen.«
»Ich frage sie, ob es ihr morgen passt«, sagte Peter.
Britta schwieg eine Weile, bevor sie beiläufig bemerkte: »Diese Jungs müssen dir ziemlich zugesetzt haben, du wirkst wie befreit – und ich mache mir natürlich Vorwürfe, dass ich nichts gemerkt habe.«
»Ich habe mir ja auch große Mühe gegeben, damit du nichts merkst. Ich wollte dir einfach nicht noch mehr Stress machen.«
»Das ist zwar lieb von dir, aber glaub mir: Ich kann Stress aushalten. Und ich fühle mich wohler, wenn ich nicht das Gefühl haben muss, dass du mir etwas vorspielst, wenn es mal schwierig wird.«
»Ist gut, ich mache es nicht mehr, okay?«
»Okay.« Sie wusste, dass sie jetzt nichts mehr zu sagen brauchte. Wenn Peter etwas versprach, hatte er vor, sich an dieses Versprechen auch zu halten, sie kannte ihn.
»Willst du noch Spaghetti?«
»Nein, mehr kann ich nicht essen, mir wird sonst schlecht. Ich lege mich wieder hin – und ich schreibe Kyra noch.«
»Soll ich dir noch einen Tee kochen?«
»Nein, danke.« Er stand auf und umarmte Britta. Das tat er nicht mehr so oft wie früher, deshalb empfand sie jede Umarmung als Geschenk.
Sie erwiderte die Umarmung. »Ich bin so froh, dass heute nicht noch Schlimmeres passiert ist«, sagte sie. »Wenn ich nur daran denke …«
»Tu’s nicht«, sagte er. »Ich denke auch nicht mehr dran, Mama. Aber ich hoffe, dass sie ordentlich bestraft werden und in Zukunft nicht andere Kinder fertig machen.«
»Du bist ein tapferer Junge«, murmelte sie. »Ich bin stolz auf dich, dass du ihnen kein Geld gegeben hast, damit sie dich in Ruhe lassen.«
Er zögerte, bevor er gestand: »Ich habe aber darüber nachgedacht, weil ich gemerkt habe, dass ich richtig Angst vor ihnen hatte. Ich habe ja versucht, sie auszutricksen, bin auf andere Straßen ausgewichen, aber sie haben mich immer gefunden.«
Sie gab ihm einen Kuss. »Es ist vorbei, Peter.«
Er nickte, löste sich aus ihren Armen und verließ die Küche.
Britta blieb noch sitzen und trank ein Glas Wein, während sie über die letzten Stunden nachdachte. Was für ein seltsamer Zufall, dass sie für eine Frau arbeitete, mit deren Tochter sich ihr Sohn gern befreunden wollte. Sie war sehr neugierig auf Kyra Laurin. Ob sie ihrer Mutter ähnlich war?
Endlich erhob sie sich, räumte die Küche auf und ging hinüber ins Wohnzimmer. Zum Lesen war sie zu müde, also würde es auf Fernsehen hinauslaufen. Aber sie kam nicht dazu, den Fernseher einzuschalten, denn ihr Telefon meldete sich und Antonia Laurin fragte: »Störe ich Sie, Frau Stadler?«
»Überhaupt nicht, im Gegenteil.«
»Wie geht es Peter?«
»Er hat sich gerade wieder ins Bett gelegt, nachdem er ein paar Spaghetti gegessen hat. Aber groß war sein Hunger nicht. Es geht ihm so weit gut, vor allem ist er natürlich erleichtert, dass die Jungen ihn nicht mehr belästigen werden.«
»Die Polizei hat gerade angerufen, ich muss noch einmal eine Aussage machen. Es scheint so, dass der Junge, den Herr Ammerdinger festhalten konnte, sein Schweigen nicht lange durchgehalten hat, das heißt, die Namen der anderen drei sind schon bekannt. Die Eltern werden sich einige unangenehme Fragen gefallen lassen müssen.«
»Ich frage mich natürlich, warum ich nicht gemerkt habe, dass Peter in solchen Schwierigkeiten steckt. Und warum er nicht mit mir darüber gesprochen hat. Er hat das zwar erklärt, aber …«
»Er wollte Sie nicht belasten, weil er weiß, dass Sie es im Augenblick eher schwer haben. Das war ungefähr das erste, was er gesagt hat, als er wieder zu sich gekommen ist.«
»Ja, so hat er es mir auch gesagt. Trotzdem beschäftigt es mich. Ihre Tochter hat ihm übrigens geschrieben, er hat ihr gleich geantwortet. Mir scheint, er hat sie sehr gern.«
»Und sie ihn. Ich finde das schön.«
»Ich auch«, sagte Britta.
»Oh, bevor ich es vergesse: Sie können die Praxis als Gemeinschaftspraxis planen, Frau Stadler, mein Mann hat spontan positiv reagiert. Ihm gefällt die Vorstellung, dass die ganze Last einer Praxis nicht allein auf meinen Schultern ruhen wird. Also werde ich ab sofort nach einer Partnerin suchen.«
»Ach, das freut mich«, sagte Britta. »Meine Kollegen im Büro werden Augen machen.«
»Aber nicht, dass sie Ihnen den Auftrag daraufhin wegnehmen wollen! Ich möchte, dass wir beide das zusammen machen, Sie und ich. Ich habe das Gefühl, wir sind ein gutes Team.«
Diese Worte begleiteten Britta noch lange nach dem Gespräch. Sie waren ein schöner Abschluss für einen wenig schönen Tag.
*
Es klopfte an Kyras Tür. Sie antwortete nicht, denn sie las gerade, was Peter ihr geschrieben hatte. Die Tür wurde trotzdem geöffnet.
»Störe ich?«, fragte Kaja.
»Ja«, antwortete Kyra. Sie drehte sich immerhin um. »Was ist denn?«
Kaja hatte mit einer anderen Antwort gerechnet und war deshalb einigermaßen perplex.
»Och, nicht so wichtig, ich wollte eigentlich nur ein bisschen quatschen.«
»Später vielleicht«, sagte Kyra und wandte sich wieder ihrem Laptop zu. »Jetzt kann ich nicht.«
Kaja schloss die Tür wieder. Ihre kleine Schwester hatte sie noch nie abgewiesen. Erst jetzt, in diesem Moment, begann sie zu begreifen, wie Kyra sich in den vielen Situationen gefühlt haben musste, da sie, Kaja, sich geweigert hatte, mit ihr zu reden – und sie war dabei auch noch unfreundlich gewesen, was man von Kyra nicht behaupten konnte.
Es war eine unbequeme und nicht sehr angenehme Erkenntnis.
Sie ahnte nicht, dass ihre Mutter die kleine Begebenheit beobachtet hatte. Schon beim Abendessen hatte Antonia ein paar interessante Erkenntnisse gewonnen. Kaja war in sich gekehrt gewesen, Kyra jedoch richtig aus sich herausgegangen – ungewöhnlich für sie. Doch Antonia hütete sich, dazu etwas zu sagen, als Kaja eine Viertelstunde später unten im Wohnzimmer erschien. »Hat Papa sich noch einmal gemeldet?«
»Nein, bislang nicht. Aber du weißt ja, wie das bei Notfällen ist, da kann es immer zu Komplikationen kommen, die niemand vorhergesehen hat.«
»Wenn du in Zukunft auch öfter Notfälle hast …«, begann Kaja, biss sich dann aber auf die Lippen, offensichtlich bestrebt, ihrer Mutter nicht schon wieder Vorwürfe zu machen.
»Ich bin keine Chirurgin, ich arbeite nicht in einer Notaufnahme«, erwiderte Antonia ruhig. »Das soll nicht heißen, dass es bei Kinderärzten keine Notfälle gibt, aber sie treten nicht täglich auf, zumal sich Eltern dann auch oft an Krankenhäuser und Kliniken wenden. Außerdem haben sich meine Pläne noch einmal ein bisschen geändert, das habe ich euch ja beim Essen erzählt.«
»Aber du musst erst einmal eine Kinderärztin finden, mit der du gut zusammenarbeiten kannst.«
»Das ist richtig, aber da bin ich eigentlich guten Mutes. Und ich habe es ja auch nicht eilig. Der Umbau wird ein paar Wochen in Anspruch nehmen, und ich werde in den nächsten Tagen Anzeigen schalten. Außerdem wäre es nicht schlimm, wenn ich zunächst allein anfinge, obwohl es mir anders natürlich lieber wäre.«
Kaja setzte sich in einen Sessel. Es war offensichtlich, dass sie etwas auf dem Herzen hatte, aber nicht wusste, wie sie anfangen sollte.
Als Antonia merkte, wie sie sich quälte, fragte sie ganz ruhig: »Was ist los, Kaja?«
Kaja biss sich auf die Lippen. »Ich … also, ich hatte einen Freund. Jedenfalls dachte ich das.«
»Was ist passiert?«
Kaja fing an zu weinen, und in einem wilden Schwall von Wörtern und Schluchzen kam die altbekannte Geschichte vom attraktiven Jungen heraus, der sich nicht entscheiden konnte und wie ein Schmetterling von einem schönen Mädchen zum nächsten flatterte.
»Ich dachte echt, er mag mich, und dann schickt er mir eine blöde Nachricht, dass es aus ist. Eine Nachricht! Er hat sich nicht mal die Mühe gemacht, mich anzurufen. Ich komme mir so blöd vor, so … so …«
Antonia saß längst auf der Sessellehne und hatte Kaja in ihre Arme gezogen. In diesem Moment verzieh sie ihr das zickige Verhalten der letzten Wochen, denn natürlich erinnerte sie sich noch sehr gut an ihren ersten Liebeskummer und an die Sicherheit, mit der sie damals gewusst hatte, dass ihr Herz für immer gebrochen war und dass sie sich nie, nie wieder verlieben würde.
Kaja weinte noch lange, und Antonia ließ sie gewähren. Sie sagte auch keine Sätze wie: ‚In ein paar Wochen wirst du den Jungen vergessen haben’ oder ‚Die Zeit heilt alle Wunden’. Das half einem nicht, wenn man überzeugt davon war, dass das eigene Leben gerade in Scherben lag. Das Einzige, was sie sich erlaubte, war ein deutliches Urteil über den in Frage stehenden jungen Mann.
»Er hat keinen Charakter und kein Benehmen, wenn er sich so verhält«, sagte sie mit großer Bestimmtheit. »Und er hat dich nicht verdient, Kaja. Mach dir klar, dass er ein Würstchen ist, denn sonst hätte er zumindest den Mut gehabt, dir ins Gesicht zu sagen, dass es aus ist zwischen euch.«
Kaja hob ihr verschmiertes Gesicht. Da sie, im Gegensatz zu ihrer Mutter, jeden Tag reichlich Wimperntusche benutzte, sah sie eher komisch als tragisch aus, aber Antonia erlaubte sich nicht einmal die Andeutung eines Lächelns.
»Ein Würstchen?« Kajas Stimme klang atemlos.
»Was denn sonst?«, fragte Antonia. »Jemanden, der zu feige für eine direkte Ansprache ist, kann man nur mit Verachtung strafen. Er hat wahrscheinlich kein Selbstbewusstsein, deshalb braucht er immer neue Freundinnen.«
Sie sah, dass Kaja schon nicht mehr ganz so verzweifelt aussah wie zuvor.
»Alle haben mich vor ihm gewarnt«, sagte sie. »Aber ich dachte, bei mir meint er es ernst.«
»Das nächste Mal siehst du genauer hin«, riet Antonia.
»Das nächste Mal?«, fragte Kaja.
»Es wird ein nächstes Mal geben, glaub mir. Und jetzt wasch dir das Gesicht!«
Sie bekam noch einen sehr nassen Kuss auf die Wange, dann verschwand Kaja.
Und Leon war immer noch nicht nach Hause gekommen.
*
Mitten in der Nacht wachte Ella auf, mit klopfendem Herzen. Sie hatte von Florian geträumt, ihm war in ihrem Traum etwas passiert, etwas Schlimmes.
Sie schaltete das Licht der Nachttischlampe ein und setzte sich auf. Noch immer schlug ihr das Herz bis zum Hals, also stand sie auf, ging die Küche, holte Milch aus dem Kühlschrank und goss ein wenig davon in einen kleinen Topf, um sie zu erwärmen. Es war kein Laut zu hören. Verkehr gab es in der Nähe des Hauses ohnehin nicht, aber auch sonst war alles still. Sie trank die Milch und dachte nach, wie es weitergehen sollte mit ihrer Ehe. Sie liebte Florian ja, und sie zweifelte nicht an seiner Liebe zu ihr. Aber sie mussten eine Lösung für ihr Problem finden.
Wenn sie ihm sagte, dass sie ihn verlassen würde, falls er nicht bereit war, mit ihr eine Familie zu gründen, würde er das als Erpressung auffassen – und das wäre es ja auch. Aber ihr schien, als hätte sie keine Wahl.
Was sollte sie anderes tun? Bei ihm bleiben und sich ihr Leben lang mit dem unerfüllten Kinderwunsch quälen? Mit Florian glücklich und unglücklich zugleich sein? Sie kannte sich: Irgendwann würde das Unglück siegen, ihre Liebe zu Florian würde sterben.
Der Traum, der sie geweckt hatte, fiel ihr wieder ein, und sie beschloss, nachzusehen, was für Nachrichten auf ihrem Handy eingegangen waren. Florian hatte ganz bestimmt versucht, sie zu erreichen.
Sie schaltete es ein: Wie erwartet hatte Florian mehr als ein Dutzend Mal versucht, sie zu erreichen, aber er war nicht der Einzige. Abgesehen von etlichen Freundinnen und Freunden, die sich Sorgen um sie machten, weil Florian bei ihnen angerufen und nach ihr gefragt hatte, waren auch mehrere Anrufe von Dr. Laurin dabei.
War Florian auch bei ihm gewesen oder was sonst hatten diese Anrufe zu bedeuten?
Da er Nachrichten hinterlassen hatte, hörte sie die erste davon ab. »Frau Ammerdinger, hier ist Dr. Laurin. Ihr Mann hatte einen schweren Unfall, wir müssen ihn operieren. Es wäre gut, wenn Sie so schnell wie möglich kommen könnten.«
Die zweite Nachricht lautete: »Frau Ammerdinger, noch einmal Laurin. Wir haben Ihren Mann operiert, er lebt noch, aber er ist nicht stabil. Ich denke, Ihre Anwesenheit würde ihm helfen.«
Die dritte Nachricht: »Noch einmal Laurin. Der Zustand Ihres Mannes stabilisiert sich nicht, Frau Ammerdinger. Wenn Sie ihm helfen wollen …«
Sie schaltete das Handy aus und begann, sich anzuziehen.
*
»Seine Frau meldet sich nicht«, sagte Leon leise zu Eckart Sternberg, als sie im Aufwachraum am Bett von Florian Ammerdinger standen. Der Zustand des jungen Mannes war noch immer kritisch, daran würde sich vermutlich im Verlauf der Nacht auch nichts mehr ändern. »Sie hat ihr Handy ausgeschaltet, wahrscheinlich sieht sie nicht einmal nach, wer sie angerufen oder ihr Nachrichten geschickt hat. Dabei könnte ihre Anwesenheit unserem Patienten das Leben retten.«
Eckart nickte. Leon hatte ihm mittlerweile mehr über die Hintergründe erzählt. »Ich glaube, das war die schwierigste Operation, die ich bisher durchgeführt habe«, sagte er.
»Und du hast das sehr gut gemacht«, stellte Leon fest. »Ich hätte es selbst nicht besser machen können.«
»Wer weiß?«, fragte Eckart. »Aber ich verstehe, dass du es nicht machen wolltest. Es war die richtige Entscheidung.«
»Geh nach Hause, Eckart, ich bleibe noch ein bisschen hier. Nicht, dass ich denke, ich könnte etwas für Herrn Ammerdinger tun, aber mir geht sein Schicksal nahe.«
»Er muss etwas Schreckliches erlebt haben.«
»Ja, aber was? Das ist die große Frage.«
Eckart verabschiedete sich wenig später, Leon blieb, verließ den Aufwachraum aber ebenfalls, um Antonia anzurufen. Trotz der späten Stunde meldete sie sich bereits nach dem ersten Klingeln. In wenigen Worten erzählte er ihr, um wen es sich bei dem Notfall, der ihn in der Klinik festhielt, handelte.
»Herr Ammerdinger?«, rief sie erschrocken. »Oh, Leon, das ist furchtbar!«
»Ja, der Unfall hat sich kurz nach seinem Besuch bei uns ereignet. Wie es aussieht, ist er einfach auf die Straße gelaufen.«
»Denkst du, er wollte sich umbringen?«
»Nein, ich glaube, dass er so durcheinander und aufgewühlt war, dass er einfach losgestürmt ist. Wenn ich nur wüsste, wie ich seine Frau erreichen könnte. Er hat die OP überlebt, aber es kann durchaus sein, dass wir ihn trotzdem verlieren. Er ist instabil, und da ich weiß, dass er verzweifelt ist, habe ich keine große Hoffnung. Die Anwesenheit seiner Frau würde ihm helfen. Aber sie hat ihr Handy immer noch ausgeschaltet.«
»Dann lass sie orten«, schlug sie noch einmal vor.
»Ja, darüber denke ich mittlerweile ernsthaft nach. Hör mal, ich glaube, ich komme heute Nacht nicht nach Hause, ich will hier sein, falls etwas ist.«
»Das verstehe ich. Dann gehe ich jetzt schlafen.«
Er schickte ihr einen Kuss durchs Telefon und kehrte zu seinem Patienten zurück, dessen Zustand sich nicht verändert hatte.
»Herr Ammerdinger«, sagte er leise, »Ihre Frau liebt Sie, und Sie lieben Ihre Frau. Kämpfen Sie um Ihr Leben, und erzählen Sie ihr, was Ihnen geschehen ist. Lassen Sie sich helfen, damit Sie beide noch lange ein unbeschwertes gemeinsames Leben führen können.«
Der Alarm ging so plötzlich los, dass Leon erschrocken zusammenfuhr. Er sah auf den Monitor über dem Bett des Patienten und begann umgehend mit einer Herzmassage. Im nächsten Moment kam der diensthabende Arzt mit Schwester Sofie herein.
»Herzstillstand«, sagte Leon. »Wir brauchen einen Defibrillator, schnell!«
Schwester Sofia stürzte aus dem Raum und kehrte gleich darauf mit dem Elektroschockgerät zurück.
*
Ella betrat die Kayser-Klinik. Intensivstation, hatte Dr. Laurin gesagt. Sie folgte den Schildern und hatte die Station bald erreicht, doch eine verschlossene Tür verwehrte ihr den Eintritt. Sie klingelte, plötzlich von namenloser Angst erfüllt. Ich komme ja, Florian, dachte sie, ich bin schon fast bei dir.
Eine Schwester erschien. »Ja, bitte?«
»Ich bin Ella Ammerdinger, mein Mann liegt hier. Herr Dr. Laurin hat mich angerufen und gesagt, dass ich dringend kommen muss.«
Die Schwester zögerte, öffnete dann aber die Tür, aus einem der Räume waren aufgeregte Stimmen zu hören.
»Sie müssen Schutzkleidung anziehen, hier bitte.«
»Wie geht es meinem Mann?«, fragte Ella, während sie sich die Plastikkleidung überstreifte. »Bitte, sagen Sie es mir.«
»Sprechen Sie mit Dr. Laurin, aber Sie müssen einen Augenblick hier warten – und jetzt entschuldigen Sie mich bitte.«
Die Schwester eilte zu dem Raum, aus dem Ella die Stimmen gehört hatte. Wie eine Schlafwandlerin folgte sie ihr, dass sie warten sollte, hatte sie bereits vergessen.
Sie sah Dr. Laurin, einen ihr unbekannten Arzt und zwei Schwestern. Und sie sah ihren Mann, bleich und still in seinem Bett, an zahlreiche Geräte angeschlossen. Dr. Laurin rief: »Achtung!«, und presste Florian zwei Platten auf die Brust, woraufhin sein Körper sich aufbäumte.
Unwillkürlich schrie Ella: »Florian! Florian!«
Vier Köpfe wandten sich erschrocken zu ihr um und gleich wieder dem Patienten zu. Ein leises Piepsen war zu hören, Dr. Laurin sagte: »Wir haben wieder einen Puls. Guten Abend, Frau Ammerdinger, bitte, treten Sie doch näher.«
Ella ließ ihren Mann nicht aus den Augen. Mit langsamen, vorsichtigen Schritten näherte sie sich dem Bett. Der ihr unbekannte Arzt und die beiden Schwestern verließen den Raum, nur Dr. Laurin blieb.
»Was ist passiert?«, fragte sie. »Jetzt eben, meine ich?«
»Ihr Mann hatte einen Herzstillstand. Es war bereits der zweite, während der Operation ist das schon einmal passiert, aber dieses Mal war es schlimmer. Sie sind zur rechten Zeit gekommen. Ich glaube, er hat Sie gehört.«
Sie stand jetzt direkt neben dem Bett, streichelte zärtlich Florians linken Arm. »Flo«, sagte sie, »ich bin ja jetzt da, hörst du mich? Ich bin hier, und ich bleibe auch hier. Also schlaf ruhig und ruh dich aus.« Sie küsste ihn auf die Stirn und die Wangen.
Es wunderte Leon nicht, dass sich in der nächsten Stunde Florian Ammerdingers Werte stabilisierten. Er blieb trotzdem in der Klinik, um zur Stelle zu sein, falls es noch einmal zu einer Krise kam. Aber diese blieb aus. Er fand sogar ein paar Stunden Schlaf, obwohl er regelmäßig nach seinem Patienten sah und bei der Gelegenheit auch immer mit dessen Frau sprach.
Unter anderem erzählte er ihr, dass seine Frau und ihr Mann gemeinsam einem Jungen zu Hilfe gekommen waren, der von einer Gruppe größerer Jungs bedrängt worden war – er versäumte es nicht, darauf hinzuweisen, wie besonders einfühlsam sich Florian Ammerdinger bei dieser Gelegenheit verhalten hatte. Ella hörte ihm aufmerksam zu, er konnte sehen, wie seine Worte ihr zu denken gaben.
Sie blieb, wie versprochen, die ganze Nacht wach und sprach mit ihrem Mann.
*
Florian hörte Ellas Stimme, er bildete sich sogar ein, dass sie ihn berührte. Aber hatte sie ihn nicht verlassen? Er meine jedenfalls, sich daran zu erinnern. Und wenn es so war, hieß es, dass er träumte. Ein schöner Traum, der zerplatzen würde, sobald er die Augen öffnete. Also hielt er sie lieber geschlossen.
»Flo«, hörte er Ellas leise, zärtliche Stimme, »ich liebe dich doch, obwohl ich weggelaufen bin. Und ich weiß, dass du mich auch liebst. Wir beide müssten es doch schaffen können, glücklich miteinander zu werden, denkst du nicht auch? Hab Vertrauen zu mir und rede mit mir – über alles, was du bis jetzt für dich behalten hast. Ich will ja gar nicht ohne dich sein, ich habe nur keinen anderen Ausweg gesehen, als wegzugehen, damit ich in Ruhe nachdenken kann. Verstehst du das? Ich bin nicht gegangen, weil ich dich nicht mehr liebe, das musst du mir glauben.«
War es vielleicht doch kein Traum? Ihm kam das alles so real vor, und er spürte ja ganz deutlich ihre Hand, die über seinen Arm und auch über sein Gesicht strich. Jetzt küsste sie ihn sogar, ganz zart, auf die Stirn.
Er beschloss, das Wagnis einzugehen und öffnete die Augen. Ella saß neben ihm, schön wie immer, wenn auch sehr blass und ängstlich aussehend. Ihre Augen waren voller Liebe, so wie ihre Stimme, die er die ganze Zeit gehört hatte, voller Liebe gewesen war. Ihre Augen füllten sich mit Tränen, als sie seinem Blick begegnete, ihre Lippen begannen zu zittern. »Guten Morgen, Liebster«, flüsterte sie.
»Ella«, sagte er, mehr brachte er nicht heraus, nur diese beiden Silben, und die kosteten ihn schon enorme Anstrengung. Aber er sagte sie gleich noch einmal: »Ella.«
Wieder küsste sie ihn, dieses Mal auf den Mund. Ihm war, als durchströmte ihn neue Kraft, und schlagartig erkannte er, dass er alles tun wollte, um Ella nicht zu verlieren. Ihr zuliebe würde er sogar über die Vorfälle reden, die aus ihm den Mann gemacht hatten, der sich geschworen hatte, niemals Kinder zu zeugen
*
Leon fuhr in den frühen Morgenstunden nach Hause, um zu duschen und wenigstens mit seiner Familie zu frühstücken. Er sah natürlich übernächtigt aus, aber ihm war zugleich eine Last von der Seele gefallen: Florian Ammerdinger würde überleben, und es sah danach aus, als bekäme seine Ehe doch noch eine Chance. Wenn er sich nicht täuschte, war der junge Mann endlich bereit, seiner Frau das Geheimnis anzuvertrauen, das er bis jetzt so sorgfältig vor ihr gehütet hatte.
Wie üblich ging es beim Frühstück turbulent zu, so lange die Kinder noch im Haus waren. Ihm fiel auf, dass Kyra erstaunlich vergnügt wirkte, während Kaja blass und niedergeschlagen aussah. Die Jungen kamen ihm vor wie immer, sie alberten herum und schienen guter Dinge zu sein.
Sie fragten, warum er nicht nach Hause gekommen war, und er gab ihnen allgemeine Antworten, ohne auf Einzelheiten einzugehen, wie immer, wenn es um seine Patienten ging.
Er konnte erst mit Antonia reden, als sie unter sich waren. Es tat ihm gut, ihr zu erzählen, was in der Nacht geschehen war. »Frau Ammerdinger ist also doch noch von sich aus gekommen!«, rief sie.
»Ja. Sie muss von ihrem Mann geträumt und daraufhin ihre Nachrichten abgehört haben. Das Verrückte ist: Sie traf ein, als wir ihn schon drei Mal geschockt hatten und beim vierten Mal hat sie seinen Namen gerufen. Daraufhin hat sein Herz wieder angefangen zu schlagen.« Leon schwieg einen Moment. »Ich habe so etwas noch nie erlebt, es hat mir beinahe ein bisschen Angst gemacht.«
»Weil es wie Zauberei gewirkt hat?«
»Ja, wahrscheinlich. Dabei ist ja allgemein bekannt, dass Menschen, auch wenn sie bewusstlos sind oder im Koma liegen, mitbekommen können, was um sie herum geschieht. Dass sie hören, was man zu ihnen sagt, dass sie spüren, wenn ein geliebter Mensch bei ihnen ist. Und so war das sicher bei Herrn Ammerdinger: Er hat die Stimme seiner Frau gehört, und im selben Moment ist sein Lebenswille wieder erwacht. Aber wenn man es miterlebt, ist es zunächst ein wenig unheimlich.«
»Aber auch schön, oder?«
»Ja, natürlich, ich war unglaublich erleichtert, als ich merkte, dass sein Herz wieder schlug.«
»Wie gut, dass du in der Klinik geblieben bist. Hättest du nicht gleich mit der Herzmassage begonnen …«
Leon nickte. »Ich brauche noch einen Kaffee, bevor ich zurückfahre. Aber heute komme ich früher, ich werde zusehen, dass wir ein paar Nachmittagstermine verlegen. Eine Operation steht heute zum Glück nicht an. Und jetzt erzähl mir, warum Kyra so munter war – und Kaja so still.«
»Oh, bei uns war auch einiges los«, sagte Antonia.
»Sieh mal an«, sagte Leon nachdenklich, als sie ihren Bericht beendet hatte, »unsere Kleine scheint einen Freund gefunden zu haben, während unsere Große einen verloren hat.«
»Eine, um den es offenbar nicht schade ist. Ich habe versucht, sie ein bisschen aufzustacheln. Wut ist besser als Kummer, mit Wut im Bauch wird man mit einer solchen Enttäuschung schneller fertig.«
»Sprichst du aus Erfahrung?«, neckte er sie.
»Ich war auch mal sechzehn und habe mich in den falschen Jungen verliebt, was denkst du denn?«
Er küsste sie und entschied sich, ein weiteres Brötchen zu essen, um das Frühstück mit seiner Frau noch ein bisschen in die Länge zu ziehen.
*
»Kyra mag am liebsten Obstkuchen«, sagte Peter, als sich Britta von ihm verabschiedete, um ins Büro zu fahren. »Sie kommt nach der Schule her.«
»Ist gut, ich werde pünktlich mit Obstkuchen hier sein, versprochen«, erwiderte Britta. »Aber sollte vorher etwas sein, rufst du mich bitte an, ja?«
»Mir geht’s gut, Mama, echt. Ich wärme mir die restlichen Spaghetti auf und bleibe sonst im Bett.«
»Gut«, sagte Britta. »Das ist mir auch am liebsten. Vielleicht wird deine Brille heute schon fertig, die haben mir versprochen, sich zu beeilen. Die kann ich dann auch mitbringen, dieser dicke Balken, den du da jetzt im Gesicht hast, ist wirklich ein zu schrecklicher Anblick.«
Er grinste sie an mit seinem blauen Auge und der geschwollenen Wange, und das war der Grund dafür, dass sie sich trotz der Aufregungen des vergangenen Tages recht unbeschwert auf den Weg ins Büro machte. Dort berichtete sie bei der täglichen Zusammenkunft von der Vergrößerung ihres Auftrags und freute sich über die Überraschung, aber auch die Glückwünsche ihrer Kollegen, die großenteils ehrlich gemeint zu sein schienen.
Sie hatte viel zu tun, deshalb verging die Zeit schnell. Sie war direkt erstaunt, als sie feststellte, dass sie sich schon beeilen musste, wenn sie zur versprochenen Uhrzeit zu Hause sein wollte. Also verließ sie das Büro, fuhr beim Optiker vorbei, um Peters Brille abzuholen und kaufte Obstkuchen, der so appetitlich aussah, dass ihr bei seinem Anblick das Wasser im Mund zusammenlief.
Sie war wirklich neugierig auf Kyra Laurin!
Diese war schon da, wie sie feststellte, als sie die Wohnungstür aufschloss, denn sie hörte eine helle Mädchenstimme etwas sagen und Peter daraufhin lachen – so unbeschwert und vergnügt, dass sie Kyra schon mochte, bevor sie auch nur den ersten Blick auf sie geworfen hatte.
»Ich bin wieder da!«, rief sie.
Daraufhin wurde die Tür von Peters Zimmer geöffnet, und ein hübsches Mädchen mit halblangen dunklen Haaren, großen braunen Augen und schüchternem Lächeln erschien. »Ich bin Kyra«, sagte sie. »Guten Tag, Frau Stadler. Ich bin etwas früher gekommen, weil unsere letzte Stunde ausgefallen ist, Frau Honigmeier ist krank geworden.«
»Guten Tag, Kyra, schön, dich kennenzulernen. Ich habe Stachelbeertorte und Apfelkuchen gekauft.«
Kyra strahlte. »Stachelbeertorte ist mein absoluter Lieblingskuchen!«
Britta warf einen Blick in Peters Zimmer. Er lag angezogen auf seinem Bett. Die schreckliche Brille lag auf seinem Nachttisch, er nahm seine Umgebung also allenfalls verschwommen wahr.
Sie ging zu ihm. »Hier, deine Brille«, sagte sie. »Sie haben sich extra beeilt.«
Mit erleichtertem Lächeln schob er sie sich auf die Nase. »Danke!«, sagte er. »Mann, endlich kann ich wieder sehen!«
»Siehst du denn gar nichts ohne Brille?«, wollte Kyra wissen.
»Na ja, jedenfalls kann ich nichts klar erkennen«, gab Peter zu.
Kyra wies auf das unförmige Gestell auf dem Nachttisch. »Und warum hast du die nicht aufgesetzt? Ich habe mich schon gefragt, wieso du so komisch gehst, als du mir die Tür aufgemacht hast.«
Schweigend setzte Peter seine reparierte Brille ab und die Ersatzbrille auf und wandte sich Kyra zu. »Deshalb!«, sagte er mit todernstem Gesicht.
Kyra brach in helles Gelächter aus. »Du siehst furchtbar aus!«, rief sie.
Peter fiel in das Lachen ein, und Britta eilte in die Küche, um den Kuchen auszupacken und für sich einen Kaffee zu kochen. Peter kam ihr wie verwandelt vor. Das lag sicherlich zum Teil daran, dass er keine Angst vor diesen großen Jungs mehr haben musste, aber sie vermutete, dass es vor allem die beginnende Freundschaft mit Kyra Laurin war, die ihn so fröhlich sein ließ.
*
Ella war nach Hause gefahren, um ein paar Stunden zu schlafen, denn Dr. Laurin hatte ihr gesagt, dass Florian den Tag ebenfalls weitgehend verschlafen würde.
»Ich vermute, gegen Abend werden Sie schon mit ihm reden können, vorher sicherlich nicht.«
Sie hatte einige Stunden Tiefschlaf hinter sich, als sie in die Klinik zurückkehrte und erfuhr, man habe ihren Mann bereits auf eine normale Station verlegen können, da es ihm viel besser gehe. Und tatsächlich: Wie Dr. Laurin vorhergesagt hatte, war Florian wach und ansprechbar. Seine Augen leuchteten auf, als er sie hereinkommen sah.
»Wie schön, dass du wach bist«, sagte sie, nachdem sie ihn mit einem zärtlichen Kuss begrüßt hatte.
»Und wie schön, dass du jetzt kommst«, erwiderte er.
»Wie fühlst du dich?«
»Müde, aber sonst fehlt mir eigentlich nichts. Ich bekomme ja etwas gegen die Schmerzen. Es scheint, als wäre ich dem Tod ziemlich knapp entkommen.«
Sie sah ihn nachdenklich an. »Hast du dich umbringen wollen?«
»Nein, ganz bestimmt nicht, obwohl ich verzweifelt war, weil ich dachte, du hast mich für immer verlassen. Aber irgendwie ist mir schwarz vor Augen geworden. An den Unfall kann ich mich überhaupt nicht erinnern, ich habe keine Ahnung, wie es dazu gekommen ist.«
»Ich war in den Bergen«, sagte Ella. »Ich wollte nachdenken – über uns beide. Ich habe einfach nicht mehr gewusst, wie es weitergehen soll mit uns.«
»Und weißt du es jetzt?«
Sie nickte. »Ich möchte, dass du offen mit mir redest, dass du mir nicht mehr ausweichst, wenn ich dich frage, warum du solche Angst hast, Vater zu werden. Weißt du, ich habe ja letzte Nacht öfter mit Herrn Dr. Laurin gesprochen. Er ist hier geblieben, um zur Stelle zu sein, falls es kritisch würde. Das ist dann ja auch passiert. Er hat mir erzählt, dass du zusammen mit seiner Frau einem Jungen geholfen hast, der von Größeren geschlagen und geschubst und bedroht worden ist. Und er hat mir beschrieben, wie du mit dem Jungen umgegangen bist. Es ist nicht so, dass du mit Kindern nichts anfangen kannst, Flo.«
»Ich habe in ihm mich selbst gesehen«, erwiderte er. »Das ist eigentlich schon alles.«
»Das ist es sicher nicht«, sagte sie sanft. »Erzähl mir deine Geschichte.«
Sie hatte mit Widerstand gerechnet, doch er nickte nur. »Es wird wohl allmählich Zeit«, sagte er.
»Ja, das denke ich auch.«
Es dauerte einige Moment, bis er anfing zu sprechen, und zunächst tat er es stockend. Immer wieder entstanden längere Pausen, aber sie drängte ihn nicht. Sie hatte Jahre auf dieses Gespräch gewartet, da kam es auf ein paar Minuten mehr oder weniger nicht mehr an.
»Als mein Vater uns verließ, war ich sieben Jahre alt, aber die Szenen mit ihm, an die ich mich erinnere, habe ich gestochen scharf vor Augen. Ich zittere innerlich, wenn ich nur an ihn denke. Er hat nicht nur meine Mutter geschlagen, sondern auch mich. Oft hat er einen Gürtel genommen, er wusste ziemlich gut, wo und wie es besonders weh tat. Er war Alkoholiker, ein sogenannter Quartalssäufer: Manchmal ließ er uns wochenlang in Ruhe, aber dann ging es wieder los, und jedes Mal war es schrecklich. Deshalb habe ich heute, als ich sah, wie diese großen Jungen sich an einem Jüngeren vergriffen und ihn gequält haben, sofort mich selbst gesehen, wie ich damals, hilflos und starr vor Angst, immer nur gehofft habe, dass es bald vorbei ist.«
Ella wandte den Blick nicht von ihrem Mann, sie hielt seine Hand, während sie versuchte, ruhig weiter zu atmen. Aber wie atmete man ruhig, wenn einem eine unsichtbar Hand aus Eisen die Kehle zusammendrückte?
»Man könnte nun denken«, fuhr Florian nach einer Weile fort, »dass meine Mutter und ich zusammengehalten hätten, gegen ihn, aber so war das nicht: Sie liebte ihn – oder jedenfalls hielt sie ihre Gefühle für ihn für Liebe, also hat sie alles getan, um ihm zu gefallen. Ab und zu war er deshalb nett zu ihr, und dann war sie ein paar Tage lang glücklich.
Zu mir war er nie nett. Ohne Ausnahme nie. Und meine Mutter war es auch nicht. Im Gegenteil, oft hat sie mich beschuldigt, dass ich meinen Vater gereizt hätte und deshalb die Schuld an seinen Ausfällen trug.
Und eines Tages war er dann weg. Er hatte uns verlassen. Statt erleichtert zu sein, dass unser Martyrium zu Ende war, gab meine Mutter mir die Schuld, und von da an war sie es, die mir das Leben zur Hölle machte. Zwar schlug sie mich nicht, wie er, aber an jedem einzelnen Tag machte sie mir klar, dass sie mich für ihr Unglück verantwortlich machte und ich ihr deshalb eine Last war. Immer wieder hat sie mir gesagt, wie froh sie wäre, wenn ich endlich aus ihrem Leben verschwände.
Ich muss etwa zehn gewesen sein, als sie selbst anfing zu trinken, und von da an wurde es noch schlimmer, denn nun wandelte sich ihre Liebe zu meinem Vater in blanken Hass, und auf einmal war sie überzeugt, dass ich werden würde wie er. Es verging kein Tag mehr, an dem sie mir nicht eingebläut hat, dass ich nichts tauge und dass ich bloß nicht auf die Idee kommen solle, meine schlechten Gene an eigene Kinder weiterzugeben.«
Abgründe taten sich vor Ella auf, während sie ihrem Mann zuhörte. Sie konnte nicht fassen, dass er ihr das alles erst jetzt erzählte.
»Ich bin gegangen, sobald ich die mittlere Reife hatte, da war ich sechzehn. Trotz allem war ich nämlich ein guter Schüler, weil die Schule für mich so etwas wie das Paradies war. Andere haben sich über ungerechte oder gemeine Lehrer aufgeregt, ich konnte darüber nur müde lächeln, und habe oft gedacht: Wenn ihr so leben müsstet wie ich, würdet ihr euch über die Schule nicht beklagen.
Immerhin in einem Punkt hatte ich Glück: Ich hatte eine tolle Klassenlehrerin, die an mich geglaubt hat. Sie war die Einzige, die geahnt hat, wie es bei uns zu Hause zuging. Sie hat mir jedenfalls geholfen, die Schule abzuschließen. Danach habe ich ihr genug erzählt, um sie davon zu überzeugen, dass sie die gesetzliche Vormundschaft für mich übernimmt. Ich hätte gern studiert, aber dann hätte ich noch zwei Jahre länger zur Schule gehen müssen, das wollte ich nicht. Außerdem fehlte es mir natürlich an Selbstbewusstsein.
Und dann hatte ich noch einmal Glück: Ich habe eine Lehre in einer Autowerkstatt bei einem Mann gemacht, mit dem ich mich von Anfang an gut verstanden habe. Er ist dann gestorben, aber bei ihm habe ich so viel gelernt, dass ich nach der Ausbildung keine Probleme hatte, eine gute Stelle zu finden. Aber das weißt du ja, denn dann sind wir uns ja schon bald begegnet.«
»Und deine Mutter? Ist sie wirklich gestorben?«, fragte Ella.
»Ja, ein Jahr, bevor ich dir begegnet bin. Ich konnte nicht um sie trauern, und ich habe andere Leute gebeten, ihre Wohnung auszuräumen. Es war mir unmöglich, dorthin zurückzukehren. Von da an habe ich versucht, alle Erinnerungen an die Zeit mit ihr und mit ihr und meinem Vater einfach auszulöschen.«
»Aber das ist dir nicht gelungen.«
»Nein, es ist mir nicht gelungen, die Vergangenheit hat mich immer wieder eingeholt.«
Florian schloss die Augen. Es hatte ihn angestrengt, so lange zu reden, aber zugleich fühlte er sich von einer großen Last befreit. Aber etwas musste noch gesagt werden. »Ich liebe dich, Ella, von ganzem Herzen, das musst du mir glauben.«
Sie küsste ihn. »Aber das weiß ich doch, Liebster.«
Er schlief ein, aber sein Gesicht wirkte wie verwandelt: Da war keine Spur von Anspannung mehr, von Unruhe, Angst und Verzweiflung. Selbst die Falten zwischen Mund und Nase schienen weniger scharf geworden zu sein, und seine Mundwinkel zeigten im Schlaf nach oben.
Als sie sich das Kind vorstellte, das er einmal gewesen war, liefen ihr Tränen über die Wangen. Zugleich fühlte auch sie sich ruhig und zuversichtlich. Sanft strich sie über seine Wange und seine Stirn. Sie würden Zeit brauchen, sie und er, bis die Wunden der Vergangenheit verheilt waren, aber zum ersten Mal seit längerer Zeit glaubte sie wieder daran, dass sie es schaffen konnten.
*
»Gute Neuigkeiten?«, fragte Antonia, als sie ihrem Mann einige Tage später einen Besuch in seinem Büro abstattete, nachdem sie mit Britta Stadler die neuen Pläne für ihre Praxis durchgegangen war.
»Herr Ammerdinger ist bereit, sich einem Psychologen anzuvertrauen«, berichtete Leon. »Seine Frau ist überglücklich, wie du dir vorstellen kannst.«
Sie kannten Florian Ammerdingers Geschichte mittlerweile, denn der junge Mann hatte sie noch ein zweites Mal erzählt. »Sie haben ein Recht darauf, Sie beide«, hatte er zu Antonia und Leon gesagt, »und meine Frau hat gemeint, es würde mir gut tun, sie auch Ihnen anzuvertrauen.«
Sie waren beide erschüttert gewesen, als er seinen Bericht beendet hatte, und seitdem hatte Antonia ihm jeden Tag einen Besuch abgestattet.
»Ich war gerade bei ihm«, sagte sie jetzt mit einem Lächeln, »aber er hatte Besuch, da bin ich wieder gegangen.«
»Bisher hat ihn nur seine Frau besucht, so viel ich weiß, er wollte das so.«
»Peter Stadler war bei ihm, und ich kann dir verraten, dass die beiden sich sehr angeregt darüber unterhalten haben, ob Florian Ammerdinger ein guter Vater sein kann oder nicht.«
»Das glaube ich dir nicht, Antonia!«
»Es stimmt aber. Peter Stadler ist ein bemerkenswerter Junge, schließlich ist unsere Kyra ein bisschen in ihn verliebt, wie du weißt, und das will schon etwas heißen. Er hat jedenfalls ziemlich logisch dargelegt, dass ein Mann, der einen elfjährigen Jungen vor vierzehnjährigen Rüpeln rettet und es dann noch schafft, Ruhe und Gelassenheit zu verbreiten, ziemlich gute Voraussetzungen dafür mitbringt, zumindest ein akzeptabler Vater zu werden. So ungefähr hat sich das angehört, was ich aufschnappen konnte. Herr Ammerdinger schien durchaus nicht abgeneigt, dem Jungen zu glauben.«
Es klopfte kurz, dann wurde die Tür auch schon geöffnet, und Ella Ammerdinger stürzte herein. Sie umarmte erst Antonia, dann Leon und rief: »Das musste jetzt einfach sein, weil ich so glücklich bin. Und Sie beide haben sehr viel zu meinem Glück beigetragen. Bitte, entschuldigen Sie die Störung!«
Und weg war sie wieder. Moni Hillenberg erschien an der Tür. »Sie war zu schnell«, sagte sie, »tut mir schrecklich leid, dass sie hier einfach so hereingeplatzt ist.«
»Das war völlig in Ordnung!«, erwiderte Leon mit breitem Lächeln.
Als die Sekretärin die Tür wieder geschlossen hatte, fragte Antonia: »Und? Glaubst du mir jetzt?«
»Ja, und ich möchte diesen Peter Stadler bald einmal kennenlernen.«
»Ich schätze, das wird sich machen lassen«, lachte Antonia.