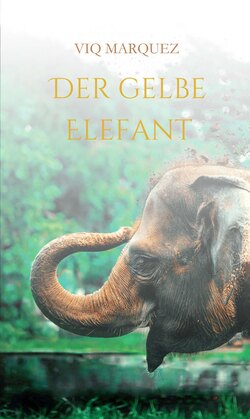Читать книгу DER GELBE ELEFANT - VIQ MARQUEZ - Страница 10
ОглавлениеEpisode 2 – ErdRutsch
Nach diesem Erlebnis – sicher auch schon davor –wünschte ich mir heiß und innig, meine ganze Sippe würde sich einfach in Nichts auflösen…
Oder wäre tot! Autounfall. Banküberfall, Einbrecher, was auch immer. Egal. Danach habe ich mich für diese Tagträume geschämt und lautlos in mein Kissen geweint. Ich meine, wer wünscht seiner Familie so etwas. Die meiste Zeit lief ich mit diesen Schuldgefühlen und dieser inneren Zerrissenheit durch´s Leben. Die Wut hatte seit jenem Tag am See einen beträchtlichen Teil meiner Seele okkupiert.
Aber dann wiederum habe ich mir vorgestellt, wie ich meine Familie vor Unheil retten würde. Bildlich malte ich mir die Szenen bis ins kleinste Detail aus. Wie wir in einer dunklen Gasse überfallen werden und ICH mit Kung Fu Bewegungen allein die Bösewichte in allerletzter Sekunde in die Flucht schlage. Meinen Eltern endlich die Augen geöffnet werden. Sie mich schluchzend in den Arm nehmen, mir über den Kopf und Rücken streicheln und mein Gesicht liebkosen. Immer wieder sagen, wie leid ihnen all das tut. Dass sie mich doch unsagbar lieb haben. Das ganze emotionale Auf und Ab kostete mich sehr viel Energie und Lebenskraft.
Ich habe mir so sehr gewünscht, dass wir auch im Inneren jene Familie werden würden, wie wir es im Äußeren bereits bei jeder Gelegenheit bei Unbekannten zur Schau gestellt hatten. Eine heile Familie!
Verrückt! Nie hörte ich auf zu hoffen!
Die Stimme, die mir zuflüsterte, blieb bei mir. Ich fühlte mich von etwas Höherem geliebt, wenn auch nicht von meiner Familie. In dieser Zeit verbrachte ich viele Stunden beim einsamen Streunen im Wald, bei meiner Freundin oder manchmal bei meinen Großeltern. Bei Menschen, die mich überwiegend so annahmen, wie ich war. Auch das machten mir meine Eltern zum Vorwurf. Oft war ich restlos überfordert und wusste meist nicht, was ich tun musste, damit jeder zufrieden mit meinem Verhalten war.
Die Schule war der einzige Bereich in meinem Leben, der eine zeitlang wirklich funktionierte und sich sicher anfühlte. Über meine benoteten Leistungen baute ich mir meine Wertigkeit auf, verschenkte freigiebig Freundlichkeit, Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft an meine Klassenkameraden. Ich lief jahrelang unter dem Synonym “Everybody´s Darling“. Eine Eigenschaft, die ich später immer wieder von selbst torpedierte. Eine Lehrerin hatte mich stilles Schulmädchen irgendwann auf den Kieker, provozierte und schikanierte mich vor der gesamten Klasse. Sie wollte, dass ich mehr aus mir herauskomme, Reden schwinge und geselliger bin. Mehr Biss bekomme. Irgendeinem Ideal entspreche. Der Startschuss für jahrelanges Mobbing! Durch Menschen, mit denen ich bereits fünf Jahre die gleiche Klasse teilte. Menschen, die mich kannten, von denen ich bisher geschätzt wurde. Das galt plötzlich nichts mehr. Jetzt war ich die, die einfach nur ANDERS war. Wenn schwächere Mitschüler von den sogenannten Influencern gehänselt wurden, stand ich wie eine Wand vor ihnen, ohne Rücksicht auf mich selbst. Doch niemand stand für mich ein und setzte diesem selbstgerechten Schwachsinn ein Ende. Zu groß war ihre Angst, selbst Opfer zu werden. Wieder fühlte ich mich ohnmächtig und machtlos. Ich versteckte mich meist auf der Schultoilette, drückte mich vor den langen Pausen im Schulhof. Fing an, Stunden zu schwänzen, in denen es besonders schlimm wurde. Zuhause setzte es dafür natürlich: eine Tracht Prügel. Es war ein Spießrutenlauf.
Ungerechtigkeit und Willkür wurden mir immer mehr zuwider. Genauso wie sogenannte Autoritätspersonen und Institutionen. Lehrer des Vertrauens gab es für mich nicht. Überhaupt hatte ich mit Vertrauen in Menschen so meine Not. Meine Probleme machte ich letztendlich lange mit mir selbst aus. Von den Zuständen in meiner Familie erzählte ich niemanden etwas. Es hätte mir auch sowieso niemand geglaubt.
Bis ich mir beim Toben mit meiner Freundin Charlotte an einem herabhängenden Ast im Wald die Schulter verletzte. Vor ihrer Mutter sollte ich mir den engen Pullover ausziehen, damit sie die blutende Wunde ärztlich versorgen konnte. Als sie die vielen Blutergüsse sah, atmete sie scharf ein. Mit zusammengezogenen Augenbrauen hörte sie meine tapferen Ausflüchte an, kniete sich vor mich nieder und umschlang mich weinend mit ihren Armen. Stocksteif stand ich da, bis bei mir ebenfalls alle Dämme brachen und ich heulend an ihrer Schulter lehnte und mich tief in ihre Umarmung verkroch. Ich hauchte kaum hörbar in ihre Halsbeuge, ob sie nicht meine Mama sein könnte? Sie hatte genau erkannt, was bei mir zuhause los war. Es gab von ihr nicht nur einen Versuch, das Jugendamt einzuschalten und gegen meine Eltern anonym eine Verfügung zu erlassen. Doch ein Mitarbeiter vom Jugendamt ließ sich von meinen Eltern so massiv unter Druck setzen, dass er ihnen schließlich ihren Namen nannte.
Die Mobbing-Aktionen an der Schule verliefen teilweise subtil, teilweise offen. Unbeteiligte Mitschüler wurden aktiv mit eingebunden. Die Lehrer blieben passiv oder kriegten es nicht mit. Zu physischer Gewalt wie in meinem Elternhaus kam es in der ersten Zeit nicht. Auch wenn ich persönlich behaupten würde, dass psychische Gewalt in jeder Form genauso schlimm, wenn nicht sogar schlimmer sein kann. Sie ist geballte Energie, die sich im Körper des Betroffenen einspeichert und tiefe körperliche als auch seelische Wunden reißt und die Zerstörung von Identität und Würde zum Ziel hat. Jeden Tag immer ein bisschen. Der psychische Terror über diesen langen Zeitraum hinweg hat mir vollkommen ausgereicht.
Den Höhepunkt der Erniedrigung und den Einsatz physischer Gewalt erreichten meine Mitschüler im Sommer 1991 - auf einer gemeinsamen Klassenfahrt. Morgens vor der Abfahrt machten sich bei mir bereits fürchterliche Bauchweh und erhöhte Temperatur bemerkbar. Ich weinte und bettelte, zuhause bleiben zu dürfen. Meiner Mutter war das egal. Für sie war das Geld bezahlt. Also hatte ich zu fahren.
„Tanya, gib endlich Ruh. Du bist unmöglich! Immer hat man nur Scherereien mit dir.“ Ich hatte den Fehler gemacht, ihr von meinen Problemen in der Schule zu erzählen. „Kein Wunder, dass dich niemand mag. Du kannst auch einfach mal nett zu den Leuten sein. Du bist selbst schuld! Und friss dort nicht zu viel. Schau dich mal an. Du bist Schneckenfett“, zischte sie mir zum Abschied unweit des wartenden Busses zu.
Hinter mir kicherten einige Mitschülerinnen. Als meine Mutter mit ihrem roten Ford hinter der Straßenbiegung verschwand, raffte ich mich auf, um zum Bus zu gehen. Die Bauchschmerzen waren unerträglich. Jemand stellte mir ein Bein und ich fiel hart auf den Asphalt. Au… Ich presste die Zähne fest zusammen bis es schmerzte und unterdrückte jede weitere Gemütsregung. Das Kichern schwoll zu einem lauten Gelächter an. Die Stimme in mir flüsterte eindringlich, ich solle auf keinen Fall in diesen Bus steigen. Lass mich in Ruh, flüsterte ich gedanklich zurück. Ich stand auf, klopfte den Gehwegstaub von meinem ausgefransten Jeansrock, betrachtete leidenschaftslos meine blutenden Knie und stieg hoch erhobenen Hauptes in den stickigen Bus. Ich vertraute nichts und niemandem mehr – auch nicht mehr meiner inneren Stimme. Mitunter hatte ich schon Befürchtungen, dass ich total am Rad drehte.
Der Bus brachte uns zu einer großen Seenlandschaft. Ein riesiges Wald- und Feuchtgebiet. Allein die flüchtigen Blicke auf das Wasser verursachten in mir aufsteigende Übelkeit. Mein Atem beschleunigte sich schlagartig. Mir wurde heiß und eiskalt. Auf meiner Stirn zogen die ersten Schweißperlen ihre Bahn. Ich bekam keine Luft mehr. Neben und vor mir saß niemand, wofür ich in diesem Moment sehr dankbar war. Neben der stinkenden Schnappschildkröte wollte sowieso niemand sitzen. Bis heute weiß ich nicht mal, wie sie auf die Idee kamen, das stinkend noch davor zu setzen. Wahrscheinlich klang es dann abstoßender. Immer wenn jemand furzte oder die Luft einfach nur stank, zeigten alle auf mich und riefen im Chor: „Schnappi, Schnapp, Stinkkröte ist hier und vergast die Luft. Geh in dein Loch zurück, Kröte. Wir wollen dich nicht.“ Lautlos atmete ich aus, um meinen Puls zu beruhigen und mir innerlich gut zuzureden. Das miese Gefühl aber blieb. „Na Schnappi, hier musst du dich doch pudelwohl fühlen“, dröhnte es hinter mir aus den letzten Reihen.
Es war am letzten Tag vor unserer Heimreise. Sie rissen mich gewaltsam aus dem Schlaf. Ich versuchte mich mit Händen und Füßen zu wehren. Bäumte mich auf und rang mit ihnen. Zwecklos. Es waren zu viele. Die nackte Angst stieg in mir auf. Meine Pupillen weiteten sich, als mir jemand das grelle Licht seiner Taschenlampe direkt ins Gesicht leuchtete. Sie waren zwar vermummt, die Stimmen hätte ich jedoch überall wieder erkannt. Dann stopften sie mir ein nasses Tuch in den Mund und banden mir die Hände hinter dem Rücken zusammen. Hatte ich kurz vorher noch geglaubt, dass sie mich scheinbar zur Abwechslung mal in Ruhe lassen würden, belehrte mich dieser nächtliche Überfall eines Besseren. Mit kurzen Shorts und einem Top bekleidet, stolperte ich barfuß und an den Händen gefesselt meinen Entführern hinterher. Über Stock und Stein ging unsere Reise ins Unbekannte. Von irgendeinem Erziehungsberechtigten keine Spur. Sie hatten sich die letzte Nacht so volllaufen lassen und schlummerten nun selig ihren Rausch aus. So viel zu Verantwortung. Etwas Spitzes bohrte sich mir in den rechten Fuß. Ich spürte wie die Haut meiner Fußsohle aufriss. Im nächsten Moment federte ein Zweig zurück und erwischte mich frontal. Mein Gesicht brannte wie Feuer. Was für ein Glück für mich, dass sie mir bei ihrer Verschnürungsnummer das Sichtfeld nachträglich auch mit abgedichtet hatten, sonst wäre der Zweig sprichwörtlich ins Auge gegangen.
Die hohen Bäume rauschten wild im Wind, schwangen ihre Häupter vor und zurück wie auf einem Heavy Metal Konzert. Das einsame Tönen eines Kauzes war zu hören, Knacken im Unterholz und weitere Geräusche, die ich nicht einzuordnen vermochte. Nachts wirkt alles sehr viel bedrohlicher. Das fanden offenbar auch meine Klassenkameraden. Quiekend sprangen sie zusammen, wenn sich seitlich von ihnen etwas bewegte. Von weiter her hörte ich herannahendes Donnergrollen. Na toll… Gewitter, dachte ich mir. Was auch immer sie mit mir vorhatten, ich ahnte nichts Gutes und begriff schnell, wie Recht meine innere Stimme mit ihrer Warnung hatte. Wir blieben stehen. Um uns herum knarrten die Bäume. Es war echt gruselig, vor allem wenn man nichts außer einem Fetzchen Stoff am Leib trägt, die Blase zum Zerplatzen voll ist, der Fuß mörderisch brennt und sich nirgends eine Fluchtmöglichkeit bietet. Sie zerrten mich zu einem dicken Baumstamm und banden mich dort zu allem Überfluss kopfüber fest. Die Augenbinde und das Tuch entfernten sie. Ich sollte ja keine Sekunde verpassen und winseln wie ein räudiges Tier. In mir brodelte es, die Wut und der Schmerz kochten züngelnd an mir hoch. Wieso immer ich? Sie vollführten wilde Tänze um mich herum, zündeten Fackeln und trockene Holzstücke an und hielten sie mir an die Beine, den Bauch, an den Hals. Ich heulte auf und schrie, was das Zeug hielt. Aber hier hörte mich niemand. Für sie war das nur ein Abenteuer – für mich die Hölle. Wieviel kann ein Mensch eigentlich ertragen? ging es mir durch den Kopf, der inzwischen immer schwerer wurde. Kraftlos ließ ich irgendwann alles über mich ergehen. Meine Blase erkannte ihre Chance und entleerte sich in einem Schwung. Dank der Schwerkraft bekam ich schnell meinen eigenen Saft zu schmecken. Es war ekelhaft und zutiefst demütigend. Die tanzende Menge finsterer Gesellen johlte bei diesem triumphalen Anblick. Ein monsunartiger Regen setzte unerwartet ein. Schnell stopften sie mir das Tuch lose zurück in den Mund, um dann fluchtartig und unter vielem Geschrei den Ort des Geschehens zu verlassen. In ihrer überstürzten Eile überließen sie mich meinem Schicksal. Die übriggebliebenen Fackeln verglommen.
Finsternis umfing mich. Der Wind tobte zornig zwischen den Wächtern des Waldes und riss ihnen dreist die Blätter vom Geäst. Irgendwo schlug ein Blitz ein. Völlig durchnässt, bibberte ich wie Espenlaub. Es roch nach warmer feuchter Erde und Moos. Die Temperaturen aber waren merklich kühler geworden. Die Fesseln schnitten mir in die Handgelenke und ich würgte an dem schweren Stofftuch, das sich mehr und mehr mit Regenwasser vollsog. Mühsam und mit schmerzverzerrtem Gesicht versuchte ich meine Handfesseln zu lockern. Das nasse Tuch bewegte ich im Mund nach vorne. Schließlich gelang es mir, es auszuspucken. Ich bemühte mich verbissen, meine Handgelenke bewusst zu entspannen und drehte sie hin und her, vor und zurück. Ich war so unendlich müde, nickte kurz weg. Nach langen Minuten (oder Stunden? - ich wusste es nicht), wiederholte ich das Drehen der Handgelenke.
Es nieselte leicht und der Wind hatte inzwischen die Richtung gewechselt. Der Mond ließ nur hin und wieder seinen fahlen Schein für mich leuchten. Das Seil lockerte sich minimal. Ein lautes Rascheln im Gebüsch. Ich horchte auf. Was…? Versuchte den Kopf zu drehen. Das klang definitiv größer als eine Feldmaus. Verzweifelt rüttelte ich an meinen Fesseln. Das Weinen war vergessen.
„Scheiße“, fluchte ich laut. Eine freie Hand folgte der anderen. Sie waren geschwollen und taten echt weh. Das Rascheln näherte sich. Mein Herz setzte für einige Takte aus, bevor ich hochschwang, den Baumstamm umfasste und wie ein Berserker an meinen Fußfesseln rüttelte. Mit bebenden Händen ertastete ich den aufgeweichten Knoten, der sich auf der Rückseite des Stammes befand. Ein deutliches Knacken - ganz nah. Die Ohren aufgestellt und mit geweiteten Augen starrte ich wie ein verängstigtes Kaninchen auf das zuckende Blattwerk rechts neben mir. Ich ließ mich lautlos mit dem Kopf voran wieder nach unten gleiten und hing mucksmäuschenstill und völlig regungslos am Baum wie eine dicke, halbnackte Spinne. Nur das dort drüben eine sehr viel größere Gefahr lauerte. Ein Geruch von nassem Hund zog an meiner empfindlichen Nase vorbei, nur etwas strenger. Etwas schnüffelte am Boden entlang und kam schätzungsweise eine Handbreit vor mir zum Stehen. Stumm klebte ich rücklings am Baumstamm. Gefangen und hilflos. Was auch immer das war, ich kam hier nicht weg. Es stupste mich mit seiner Nase in den Bauch, zog tief meinen Geruch ein und arbeitete sich weiter runter zu meinem Gesicht. Entsetzt hielt ich den Atem an. Was ist das? Ich halt das keine Sekunde länger aus, brüllte es in mir. Ich drehte mein Gesicht zur Seite und kniff fest die Augen zu, halbherzig davon überzeugt, gleich aufzuwachen und mich auf der unbequemen quietschgelben Isomatte in meinem Zelt wiederzufinden.
Seine Pfoten scharrten im Boden. Eine raue Zunge leckte mir zweimal über meine salzigfeuchte Wange. Das Fell fühlt sich nass, aber weich an. Dann ließ das Tier von mir ab, trat zurück und stand einfach nur still da. Ich öffnete vorsichtig meine Augen und konnte nun seine Silhouette sehen. Viel zu groß für einen Hund. Der Mond setzte sich sekundenlang durch und plötzlich hatte ich tatsächlich Ähnlichkeit mit einer Schnappschildkröte, wobei ich vermutlich auch nicht mehr ganz so frisch roch. Ein glucksendes Lachen stieg bei diesem Gedanken in meiner Kehle auf und blieb mir dort auch gleich direkt stecken. Denn vor meiner Nase stand ein junger grauweißer Wolf und blickte mir ruhig und fest in die Augen. Ich war so sprachlos, wie man es in einem solchen Augenblick nur sein konnte. Fantasiere ich… nein, das hier ist etwas Echtes. Die Zeit schien stillzustehen. Ich starrte ihn gebannt an und verschluckte mich fast an meiner eigenen Spucke. Dann dreht er plötzlich abrupt ab, als hätte er genug gesehen und entschwand wieder in die Dunkelheit.
Einige Sekunden verharrte ich an Ort und Stelle. In völliger Ungläubigkeit. Eine große innere Ruhe erfasste mich mit einem Mal. Das war ein Wolf, Tanya. Ein richtiger Wolf. Der an dir geschnüffelt und geleckt hat. Der dich nicht gefressen hat. Wenn du das hier überlebt hast, dann überlebst du diese feigen Spinner in deiner Klasse erst recht!
Ich atmete tief aus, holte Schwung, um erneut an meine durchgeweichten Fußfesseln zu gelangen und entwirrte sie nach und nach. Zuversichtlicher als noch Minuten zuvor. Innerlich fühlte ich mich wie ein Guppy auf LSD. Ich löste die letzte Fessel und plumpste erleichtert auf den matschigen Boden. Todmüde, verletzt, verdreckt und halberfroren brachte ich es dennoch irgendwie fertig, mich in weitestgehend völliger Finsternis zu unserem Zeltlager zurück zu kämpfen, nur noch meinem Instinkt folgend.
Ich hatte keine Gelegenheit mehr, es meiner Lotti zu erzählen. Achthundertzweiunddreißig Kilometer südlich von mir loderte in jenen Morgenstunden ein verheerendes Feuer und verschlang die beiden Menschen, die ich am Meisten liebte.
Es war der Morgen des 14. Juni 1991 um 4: 14 Uhr.
Die Ursache der Explosion im Haus meiner Freundin und ihrer alleinerziehenden Mutter sei ein defekter Gasherd im Haus gewesen, sagte man mir. Sie hätten keine Chance gehabt. Ich war unendlich traurig. Meine beste Freundin - WEG. Einfach WEG. Ihr glockenhelles, breites Lachen, ihre Unerschrockenheit und Aufrichtigkeit und der Glaube an das Gute – WEG. Aber ich behielt dies alles in meinem Herzen, ebenso wie ihre Mama, die mir so viel Liebe und Verständnis entgegengebracht hatte. Zum ersten Mal fühlte ich mich von Menschen verlassen, denen etwas an mir gelegen hatte. Ich fühlte mich aus irgendeinem Grund so schuldig. Ich war nicht da gewesen. Stattdessen musste ich meine Zeit an einem anderen Ort verbringen. Was für ein Albtraum! Vielleicht hätte ich es verhindern können oder wäre wenigstens mit Lotti zusammen gestorben. Dass meine Familie gewusst hatte, wer das Jugendamt einschaltet hatte, erfuhr ich erst sehr viel später. Derweil versuchte ich meine Kindheit zu überleben. Der Gedanke, dass die beiden Ereignisse zusammenhängen könnten, jagt mir bis heute einen eiskalten Schauer über den Rücken.
Eine Schamanin, die ich als Erwachsene auf einer meiner vielen Reisen traf, erzählte mir, wofür der junge Wolf in jener Nacht gestanden haben könnte. Es half mir sehr, dieses schmerzliche Kapitel anzunehmen. Tief verletzte Seelen erkennen einander, egal in welchem Leben, egal in welcher Gestalt. Das traf sowohl auf die Mutter von Charlotte zu als auch auf den Wolf. Und viele weitere Wesen, die im Laufe der Jahre noch meinen Lebensweg kreuzen sollten.