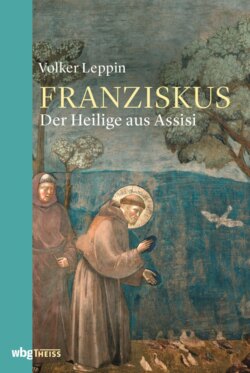Читать книгу Franziskus von Assisi - Volker Leppin - Страница 8
Der Weg zu Franz
ОглавлениеNah scheint er.
Durchdringend liegen seine Augen auf denen, die ihn betrachten.
Man meint noch, den Gesichtszügen und dem Körper die harte Askese ansehen zu können, mit der er sich quälte.
So zeigen ihn zahlreiche Abbildungen seit dem Mittelalter, am bekanntesten darunter die berühmten Fresken Giottos († 1337) in der Grabeskirche in Assisi. Nicht zufällig begann die Renaissance mit den Darstellungen des Poverello, so hat es um 1900 Henry Thode (1857–1920) in genialer Zuspitzung beschrieben. Ein neuer Blick auf den Menschen, gerade dort, wo ein Mensch sich tief vor Gott demütigte. In dem einen Franz scheint sich alles Menschliche zu konzentrieren – und so schaut er uns noch Jahrhunderte nach der Entstehung jener frühen Bilder an, sehr direkt, mitten hinein in unsere Gegenwart.
Ein Vertrauter.
Bruder Franz.
So wie ihm die Sonne eine Schwester war – oder eben, in seiner Sprache, ein Bruder: „lo frate Sole“.1
Die Nähe ist verführerisch, und sie täuscht. Natürlich sind die alten Bilder keine Porträts im eigentlichen Sinne. Sie stellen das Ideal des freiwillig Armen dar, der der Welt als kleines Mönchlein gegenüberstand und durch Gott selbst ausgezeichnet wurde. Als Giotto die Fresken in der Kirche über seinem Grab schuf, war Franz schon seit siebzig Jahren verstorben, kaum jemand dürfte noch in Assisi gelebt haben, der ihn gekannt hatte, von genauer Erinnerung an sein Antlitz ganz zu schweigen. Giotto folgte mit der Ausgestaltung dem, was die Biographen der Zeit über Franz zu berichten wussten, und dabei nicht unbedingt den genauesten Äußerungen zu Franz’ Äußerem. Sie finden sich in der Chronik eines englischen Benediktiners, Roger von Wendover, verfasst wenige Jahre nach Franz’ Tod. Zum Jahre 1227, als Franz’ Heiligsprechung vorbereitet wurde, die dann am 16. Juli 1228 erfolgte, flicht er einen Exkurs zu dem umbrischen Armen und seiner Bruderschaft ein. Darin zeichnet er ein weit weniger romantisches Bild des Heiligen: Nicht der schmale Asket steht hier anlässlich seiner Begegnung mit Papst Innozenz III. im Vordergrund, sondern der wilde Outlaw:
Die Oberkirche von San Francesco nach der Restaurierung.
Blick in das Querhaus nach Norden mit Chorgestühl.
„Der Papst betrachtete daher an dem erwähnten Bruder sorgfältig das ungestalte Aussehen, das verächtliche Antlitz, den wallenden Bart, die verwilderten Haare, die herabhängenden schwarzen Augenbrauen“.2
Da wird Franz schon etwas fremder als in den Bildern Giottos, in welchen sich der Meister maßgeblich an der Lebensbeschreibung orientierte, die der Generalminister des Franziskanerordens, Bonaventura († 1274), in Lang- und Kurzfassung (Legenda maior und minor) verfasst hatte.
Jahrhundertelang prägten dessen Schilderungen das Bild des Heiligen aus Assisi, bis die moderne Forschung, angestoßen vor allem durch den evangelischen Historiker Paul Sabatier (1858–1928), dieses Bild und noch manch andere lieb gewordene Tradition in sich zusammenstürzen ließ. So entstand die brisante „franziskanische Frage“3: eine hochkomplexe wissenschaftliche Debatte um die Zuverlässigkeit der frühen Quellen, an der keine Franz-Biographie vorbeigehen kann. Sie ergibt sich aus der Einsicht, dass die frühen Viten immer schon ein bestimmtes Interesse verfolgten. Dass Bonaventura auf anderen aufbaute, war und ist offensichtlich, ebenso auch der Umstand, dass er in einer heiklen Phase der Ordensgeschichte versuchte, das Bild des Gründers so zu zeichnen, dass er die auseinanderstrebenden Zweige der Franziskaner zusammenhalten konnte: Seine Lebensbeschreibung diente sehr offensichtlich nicht in erster Linie einer historischen Erzählung über das Leben des Franz von Assisi, sondern den aktuellen ordenspolitischen Anliegen des bedeutenden Verfassers.
Doch nicht allein Bonaventuras Lebensbeschreibung ist mit Vorsicht zu gebrauchen. Die franziskanische Frage setzt gewissermaßen schon mit dem Tod des Heiligen ein, der den Beginn seiner Verehrung darstellte – wenn man Helmut Feld, dem Autor der für die heutige Forschung wichtigsten deutschsprachigen Einführung in die Anfänge der franziskanischen Bewegung, folgen will, war dies der Beginn seiner Vereinnahmung: Es gab, so Feld, nicht nur körperliche Totengräber, sondern auch geistliche. Feld nennt hier Papst Gregor IX. (1227–1241), der Franz heiligsprach, ebenso wie die franziskanische Führungsgeneration der ersten Stunde.4 Man muss sich dieses scharfe Urteil nicht zu eigen machen, um zu sehen, dass tatsächlich von Beginn an das Gedächtnis an Franz nicht einfach der möglichst genauen Erinnerung diente, sondern den jeweiligen Interessen der Zeitgenossen.
Ebenjener von Feld namhaft gemachte Papst Gregor IX. war es, der schon kurz nach dem Tod des Franz dessen älteste Lebensbeschreibung bei Thomas von Celano († 1260) in Auftrag gab. Er initiierte damit ein Werk, das auch seinem eigenen Ruhm diente, war doch Gregor selbst in der Biographie eine nicht ganz unwichtige Nebenfigur: Noch als Kardinal Hugolin von Ostia war er Protektor des neuen Ordens gewesen und hatte Franz von Assisi nachhaltig gefördert. Ein Teil des Glanzes, den die Lebensbeschreibung des Franz ausstrahlte, fiel auch auf den Auftraggeber. Der Autor selbst, Thomas von Celano, war auch nicht gerade jemand, von dem Distanz und Nüchternheit zu erwarten gewesen wäre – eine Erwartung, die ohnehin an dem vorbeiginge, was man im Mittelalter mit einer Vita verband. Celano gehörte schon zu dessen Lebzeiten zu den Anhängern von Franz von Assisi und wirkte seit 1223 als Kustos der franziskanischen Gemeinschaften im Rheingebiet.5 Sein Werk diente dazu, die Verehrung des rasch, schon zwei Jahre nach seinem Tod am 3. Oktober 1226, heiliggesprochenen Ordensgründers zu begründen und zu propagieren, und hatte durchaus im Blick, die Nachfolge im Orden attraktiv zu machen. All dies lässt somit schon die älteste Vita des Franz mindestens ebenso zu einem Dokument der Interessen ihres Autors werden wie zu einem Zeugnis für das Leben, das darin geschildert werden soll, und darin drückt sich die Spannung aus, die für die franziskanische Frage so charakteristisch ist. Es ist offenkundig, dass die frühen Quellen über das Leben des Franz von Assisi von anderen Absichten geprägt sind als denen, die heutige Historikerinnen und Historiker verfolgen. Sie wollen nicht eine Biographie im modernen Sinne schreiben, sondern eine Heiligenlegende – nicht moderne Wissenschaft ist das Ziel, sondern mittelalterliche Hagiographie. Das macht ihre Nutzung für Geschichtsrekonstruktionen schwierig, aber, auch darin ist sich die Forschung einig, nicht unmöglich. Während man für die geistlichen Anliegen des Franz durch vereinzelte von ihm selbst verfasste Gebete und Schriften eine einigermaßen6 sichere Grundlage hat, kann eine Biographie sich heute nur auf den schwankenden Grund der frühen Viten beziehen, muss abwägen und gewichten. Wie eng Lebensbeschreibung und Verehrung bei Celano miteinander verbunden waren, zeigt sich daran, dass er schon bald nach Abfassung der Vita ein Werk verfasst hat, das die „Legende“ im Namen trägt: die Legenda ad usum chori7. „Legenda“ stellt dabei nicht wie im heutigen Sprachgebrauch eine Aussage über die (zweifelhafte) Zuverlässigkeit dar, sondern besagt ganz wörtlich, dass der Text zum Lesen bestimmt war: Die Kurzvita war in neun Lesungen eingeteilt. So sollte sie dem neuerlichen, diesmal von Benedikt von Arezzo, dem Leiter der Ordensprovinz in Rumänien und Griechenland, ausgegangenen Auftrag entsprechen, dass jeder Bruder die Möglichkeit habe, die Kurzfassung von Franz’ Leben in seinem Brevier, der üblichen kurz gefassten Sammlung liturgischer Texte, mit sich zu führen.8 So konnten die Brüder sich auch auf Reisen das Leben des Ordensgründers vergegenwärtigen, das Thomas von Celano für diesen Zweck auf Grundlage der zuvor verfassten Vita dicht zusammengefasst hat. Selbstverständlich wurden solche Texte nicht allein für den individuellen Gebrauch genutzt, sondern auch für die gemeinsame Liturgie. Einen Eindruck hiervon kann man aus der Chronik des Thomas von Eccleston († nach 1258) über die Anfänge der Franziskaner in England gewinnen. Für das Jahr 1235 berichtet er:
„Bruder Augustinus (…) berichtete öffentlich im Konvent von London, er sei am Fest des heiligen Franziskus in
Assisi gewesen. Und dort war Papst Gregor, und als dieser nach vorne zum Predigen ging, sangen die Brüder:
‚Diesen hatte der Heilige zum Vater erwählt‘ etc., und der Papst lächelte.“9
Der Papst hatte einigen Grund zu lächeln, denn der, von dessen Erwählung zu Franz’ geistlichem Vater hier die Rede war, war wiederum eben er selbst – jener einstige Kardinal Hugolin. Der Vers stammte aus dem Officium Sancti Francisci10, das in den frühen dreißiger Jahren des 13. Jahrhunderts der ehemalige französische Hofkapellmeister Julian von Speyer († um 1250) gedichtet hatte. Nun diente er statt dem König den Minderbrüdern, und zwar nicht nur als Musiker: Etwa zur selben Zeit wie das Officium verfasste er auch eine Lebensbeschreibung des Ordensgründers. Als Grundlage hierfür diente ihm weitgehend jene Vita aus der Feder Celanos.
Dieser blieb allerdings auch selbst weiter literarisch tätig. Erst seit wenigen Jahren weiß man aufgrund einer Entdeckung von Jacques Dalarun, dass Celano eine Kurzfassung seiner Vita verfasste11 – wichtiger allerdings bleibt die zweite große Vita, die Celano Anfang der vierziger Jahre schrieb. Auf dem Generalkapitel der Franziskaner am 4. Oktober 1244 hatte der Ordensgeneral Crescentius von Jesi (General 1244–1247) dazu aufgerufen, „Zeichen und Wundertaten des überaus seligen Vaters Franziskus“ zu sammeln12 – und Celano erhielt nun vom Ordensgeneral den neuen Auftrag, „dass wir die Geschicke oder auch Aussprüche unseres ruhmreichen Vaters Franziskus (…) den gegenwärtig Lebenden zum Trost und den Künftigen zum Gedächtnis niederschreiben“.13 Wiederum stellt sich für die heutige Geschichtsschreibung die Frage nach dem Umgang mit dem so entstandenen Text: Der Aufruf des Crescentius, Erinnerungen zu sammeln, mag auf den ersten Blick die Hoffnung wecken, dass sich in der zweiten Vita neue Erkenntnisse finden, und das ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Aber man befindet sich nun doch fast zwanzig Jahre nach dem Tod des Heiligen, die Erzähltraditionen dürften verändert und gewachsen, die Erinnerung verdunkelt oder vermutlich gerade im Gegenteil: aufgehellt sein. Man weiß ja nun, dass man sich nicht einfach an einen jungen Mitbürger erinnert, sondern an einen verehrten und verehrungswürdigen Heiligen. Zudem verfolgte der Aufruf des Crescentius ganz offenkundig das Ziel, die Gärungen, in die der Orden durch den Streit um das Erbe des Franz und auch durch apokalyptische Naherwartung geraten war,14 zu beschwichtigen – der Erinnerungsauftrag diente nicht der Klärung der Vergangenheit, sondern der Orientierung in der Gegenwart. So liest sich diese zweite Vita über weite Strecken geradezu wie ein Kommentar zur gültigen Regel der Franziskaner: Der Franziskus der zweiten Vita lebt vor, wie diese zu erfüllen ist. Der Trost der Zeitgenossen sollte sehr konkrete Auswirkungen im inneren Ordensfrieden haben. So gilt wiederum: Man muss diese Vita vielleicht nicht mit spitzen Fingern anfassen, aber doch mit historischer Vorsicht nutzen. Der „Schleier der Erinnerung“ (Johannes Fried)15 dürfte sich auch hier über manches gelegt, die konkrete ordenspolitische Absicht manches gefärbt haben.
Diese Vorsicht gilt leider auch für ein weiteres Werk, das mit dem Aufruf des Crescentius verbunden ist. Genau genommen handelt es sich hier um zwei Schriftstücke, die gemeinsam überliefert sind: Zunächst geht es um einen Brief dreier früher Gefährten des Ordensgründers namens Leo, Rufin und Angelus.16 Darin künden sie an, sie wollten, dem Aufruf des Crescentius folgend, Wundertaten und Anzeichen des heiligen Lebenswandels von Franz zusammentragen, nicht im Sinne einer ausführlichen Legende, sondern wie „ein paar Blumen von einer lieblichen Wiese“.17 Überliefert ist dieser Brief in den Handschriften gemeinsam mit einem zweiten Text, der nun doch eine umfassende Lebensbeschreibung bietet. Wenn beides zusammengehört, und die Überlieferungslage jedenfalls spricht deutlich dafür, dann hätte man hier in mancher Hinsicht den authentischsten Bericht über den Poverello vorliegen, geschrieben von Menschen, die ihm seit den Anfängen nahestanden. Doch ist auch dies so einfach nicht – Leonhard Lehmann, selbst als Kapuziner Angehöriger der franziskanischen Tradition und herausragender Kenner der Quellenprobleme, hat die Schwierigkeiten der Dreigefährtenlegende treffend zusammengefasst. Man diskutiere hinsichtlich der Dreigefährtenlegende,
„ob sie vollständig ist oder ‚verstümmelt‘ (…), ob sie zu dem von den drei Gefährten Leo, Rufin und Angelus unterzeichneten Brief, geschrieben am 11. August 1246 in Greccio, gehört oder nicht; ob die genannten drei wirklich die Verfasser sind oder nicht; ob das Werk zum 11. August 1246 abgeschlossen war oder später ergänzt wurde; ob es erst in den 60er Jahren des 13. Jahrhunderts oder gar erst Anfang des 14. Jahrhunderts geschrieben wurde“.18
Derzeit hat sich eine Tendenz eingependelt, nach welcher die deutschsprachige Forschung etwas zuversichtlicher hinsichtlich der Authentizität des Textes ist als die sonstige internationale19 – was angesichts der komplexen Diskussionslage allerdings nur begrenzt weiterhilft. Letztlich kommt man ohnehin nicht umhin, die Dreigefährtenlegende, selbst wenn man sie, wofür in der Tat einiges spricht, auf Leo und die beiden anderen Freunde des Franz zurückführt, mit derselben Vorsicht zu nutzen wie alle anderen Quellen. Dass sie manch eigene Information gegenüber Celano enthält, dürfte unstrittig sein, aber auch für sie gilt: Sie ist mit zwanzig Jahren Abstand nach dem Tod des Franziskus entstanden. Selbst Freunde können da unter Gedächtnislücken leiden oder manches allzu sehr ausschmücken – und gerade Freunde mögen in ihren biographischen Beschreibungen dazu neigen, das Vorteilhafte ihres einstigen Gefährten stärker herauszustreichen, als es ein nüchterner Betrachter täte. Kurzum: Die franziskanische Frage bleibt offen, und jeder Biograph muss sich aufs Neue mit ihr auseinandersetzen. Das gilt auch für eine weitere hochspannende Quelle, die möglicherweise noch zu Lebzeiten Gregors IX. entstanden ist,20 also vor 1241: die Aufzeichnungen des sogenannten „Anonymus Perusinus“, den man heute wohl identifizieren kann. Johannes von Perugia scheint hier Erzählungen über Franz gesammelt zu haben – der lange verschollene und wenig beachtete Text gehört damit in die Reihe der ganz frühen Zeugnisse, die noch recht nah an die Phase persönlicher Erinnerung an Franz selbst führen. Vielleicht diente er, so vermutet es Leonhard Lehmann, sogar der Dreigefährtenlegende als Vorbild beziehungsweise als eine hilfreiche Sammlung.21 Wenn dem so ist, wirft dies allerdings auch ein Licht auf das, was als Erinnerung gelten kann: Wenn die drei Gefährten selbst (angenommen sie waren die Autoren der nach ihnen benannten Legende) eine Vorlage benutzt haben, so haben sie eben nicht einfach vollständig ihrer Erinnerung getraut. So führt auch der Bericht des Johannes von Perugia aus dem Quellendickicht keineswegs heraus, sondern eher tiefer hinein.22
In dieser hochkomplexen Quellenlage, die durch die hagiographischen Bemühungen der ersten Generationen nach dem Tod von Franziskus entstanden ist, scheint es einen sicheren Anker zu geben, nämlich die erhaltenen Schriften von Franz selbst. Schon 1981 machte Anton Rotzetter die Beobachtung einer damals „neuen Orientierung der Forschung“, die „dem authentischen Werk“ von Franz „einen selbständigen und vorrangigen Wert“ gegenüber den hagiographischen Texten gibt.23 Diese Gewichtung ist seitdem zu Recht erhalten geblieben. Besonders fruchtbar sind Franz’ eigene Schriften natürlich für eine Rekonstruktion seiner inneren Biographie, seiner Spiritualität.
Dieser Erkenntnis gemäß gewinnt in den folgenden Seiten die innere Biographie besonderes Gewicht: Die geistige und geistliche Welt des Franziskus bildet ihr Rückgrat, auf sie wird immer wieder zurückzukommen sein. Aber man kann die innere Biographie ohne die äußere nicht erzählen. Auch für diese ist es hilfreich, die eigenen Zeugnisse von Franz heranzuziehen, freilich gilt hier gleichfalls eine gewisse Vorsicht. Denn wir besitzen kaum Briefe, wie sie in anderen Fällen als relativ zuverlässige Zeugnisse gelebten Lebens zugänglich sind, sondern das wichtigste Zeugnis von eigener Hand über Franz’ Biographie ist seinerseits bewusst geformt: Kurz vor seinem Tod im Jahre 1226 hat er sein sogenanntes Testament verfasst,24 einen Text, der eine – allerdings sehr knappe – Rückschau auf sein Leben und eine Deutung der Gegenwart seines Ordens mit Mahnungen an die Brüder verbindet. Die autobiographischen Anteile darin sind pointiert und folgen einer klaren Gewichtung. Franz nennt einige wenige Episoden und verkürzt diese summarisch. Allein schon diese klare Auswahl macht deutlich, dass auf modifizierte Weise auch für autobiographische Zeugnisse gilt, was allgemein über die Erinnerung von Menschen gesagt wurde: Auch die Erinnerung an mich selbst verschiebt sich, auch sie folgt dem jeweils gegenwärtigen Wunsch, sich in der Erinnerung so gespiegelt zu sehen, wie man sich in der Gegenwart gerne verstanden wissen will. Konkret heißt dies: Franz schrieb das Testament nicht zur Sammlung von Erinnerungen, sondern um sein eigenes Leben als Vorbild für die gegenwärtige Gemeinschaft seiner Brüder darzustellen. Eine solche Absicht kann Erinnerungen verfärben.25 So ist das Testament ohne Zweifel das wichtigste Zeugnis für Franz’ Biographie, aufgrund seiner Knappheit und seiner eben doch vorhandenen Tendenz aber auch eingefärbt – die entscheidende Lösung für die Probleme einer Biographie des Franz von Assisi bietet es, leider, nicht.
So gilt bei einem genauen Blick auf die Quellen: Wer sich heute daranmacht, das Leben des Franz von Assisi zu erzählen, steht, ob er will oder nicht, in einer doppelten Tradition. Ihn prägt zum einen die hagiographische Tradition, auf die jeder angewiesen bleibt, der das Leben von Franz erzählen will, und zum anderen die Tradition einer intensiven Forschung, für die ein kritischer Umgang mit ebendiesen Quellen selbstverständlich geworden ist – und die viel dafür getan hat, unsere Augen für deren Probleme zu öffnen. Kritik heißt nicht, dass man die Angaben der Hagiographen in Bausch und Bogen verwirft – sie sind, wie sich gezeigt hat, zeitlich nah am Geschehen und oft mit einem Erinnerungsgewebe verflochten, das sehr nahe an den Gegenstand der Erzählung, an Franziskus selbst, heranführt. Aber man muss sie achtsam benutzen und gegeneinander abwägen. Der Weg von der Hagiographie zum historischen Geschehen ist, wie Felice Accrocca, einer der herausragenden Quellenkenner, hervorgehoben hat, schwierig, aber nicht unmöglich.26
Konsequent weitergedacht wird man sich die Frage stellen müssen, ob man die eine Geschichte des Mannes aus Assisi überhaupt erzählen kann, ob am Ende einer Franz-Biographie überhaupt ein Fazit stehen kann, das es erlaubt, das Leben dieses Mannes in einem Satz, gar in einem Wort zusammenzufassen. Und es sei gleich vorab gesagt: Genau das ist auch nicht das Ziel dieses Buches. Es ist eine Biographie – und doch könnte man ebenso gut sagen, es ist ein Buch über die Schwierigkeiten, eine Biographie zu schreiben, ganz speziell: eine Biographie des Franz von Assisi. Eine radikale Position müsste wohl lauten: Das einzige, was etwas Gewissheit gibt, sind die paar Erinnerungsfetzen im Testament, und selbst die sind, wie oben ausgeführt, nicht einfache Widerspiegelungen von Realität. Alles andere stammt aus zweiter Hand und folgt den jeweils unterschiedlichen Interessen der Autoren, „ihren“ Franz zu bilden. Wollte man dieser radikalen Position folgen, wäre das Vergnügen, eine Franz-Biographie zu schreiben oder zu lesen, rasch beendet. Lässt man es aber hiermit nicht bewenden, sondern lässt sich auf das Wagnis ein, doch auch anderes wenigstens für einen Reflex von Franz’ Leben zu halten, so bedeutet dies, dass man immer wieder um die Einschätzung der Quellen ringen und zwischen unterschiedlichen Überlieferungen abwägen muss.
Dass die Biographien hagiographischen Zwecken folgen, heißt ja nicht, dass sie gar kein historisch auswertbares Material enthielten.27 Vieles an ihnen ist literarische Gestaltung, aber nicht nur Erfindung: Ihr Interesse ließ sich auch durch die Weise umsetzen, wie sie vorhandenes Material neu und in ihrem Sinne arrangierten. Und der Grad an Hinzugedichtetem dürfte in denjenigen Texten höher sein, die noch dicht am Geschehen sind – allein schon, weil man die mittelalterlichen Menschen nicht unterschätzen darf. Denn auch im 13. Jahrhundert gab es Zweifel an wunderhaften Berichten, und die Franz-Biographen wussten darum, auch wenn man solche Zweifel auf den Teufel zurückführen mochte.28 Der Phantasie waren Grenzen gesetzt – und der Erzählung stand nicht nur durch Erfindungen, sondern auch durch Berichte und Erinnerungen Material zur Verfügung, das dann in eine neue Ordnung gebracht wurde. Das heißt: Wo eine Erzählung offenkundig dem Gesamtduktus einer Biographie dient, ist höhere Skepsis angebracht als dort, wo sie bei- oder gar gegenläufig zu diesem Duktus erscheint.
Die geringste Verfremdung wird man nach den vorgetragenen Überlegungen neben dem Testament von Franz selbst in der ersten Vita Celanos und der Dreigefährtenlegende finden.29 Sie werden daher im Folgenden zusammen mit den wenigen sonstigen Zeugnissen, die Franz selbst hinterlassen hat – Gebete, Briefe, Regeln –, die wichtigsten Quellen sein. Für jede Etappe im Leben des Franz ist dennoch neu danach zu fragen, wie zuverlässig wir über sie Bescheid wissen. Und das ernüchternde Ergebnis bleibt: Sehr genau wissen wir nicht Bescheid. Die folgenden Seiten werden viele Episoden aus dem Leben von Franziskus nur mit einem dicken Fragezeichen versehen können, ja es wird – sei es im Blick auf den Auftrag, den Franz vom Kreuz in San Damiano erhalten haben soll, sei es hinsichtlich des Ablaufs der ersten Begegnung mit Papst Innozenz III. – immer wieder deutlich werden, dass manche wichtige Erzählung, zumal wenn sie Geschehnisse durch übernatürliche Eingriffe in die irdische Wirklichkeit legitimieren soll, eher auf die Konstruktion ihrer Erzähler zurückgeht als auf Erinnerung. Das bedeutet nicht, dass daran gezweifelt würde, dass für mittelalterliche Menschen die Welt vom Walten Gottes durchwirkt war und er sich in Visionen, Träumen und Offenbarungen den Menschen öffnen konnte – solche Geschichten würden ja nicht funktionieren, wenn sie nicht geglaubt würden. Vielmehr legt die komplexe Quellenlage immer wieder den Verdacht nahe, dass etwas, was als Wahrheit empfunden wurde, durch zugefügte Episoden noch deutlicher als Ausdruck göttlicher Leitung beschrieben wurde, als dies in den frühesten Schichten der Fall war: Ebendas ist das typische Vorgehen hagiographischer Erzählungen. Diese literarischen Beobachtungen sorgen dann dafür, dass gelegentlich aus dem Fragezeichen hinter der einen oder anderen Geschichte die Konsequenz folgt, auf diese zu verzichten. Es sind allerdings, das sei hier auch betont, tatsächlich rein literarische Einsichten. Es geht nicht darum, vor der Folie moderner Wirklichkeitsvorstellungen mittelalterlichen Glauben an Wunder zurechtzurücken – im Gegenteil: Zu einem vollen Verständnis von Franz’ Biographie gehört auch, dass er, unabhängig davon, wie wir die Vorgänge heute deuten mögen, als Wundertäter wahrgenommen und verehrt wurde, und dass das, was hier erzählt wurde, nicht einfach Erfindungen sind. Da aber, wo die Geschichte der Texte den Eindruck erweckt, dass eine Erzählung nach und nach gestaltet wurde, gibt es gute Gründe, diese Episoden als Erfindungen aus der historischen Rekonstruktion herauszunehmen. Fromme Erfindungen, gewiss, aber eben Erfindungen.
Solche Interpretationen sind das übliche Geschäft der historischen Arbeit, die die Konsequenzen aus der langen, intensiven Forschungsgeschichte zu Franz zieht, und viele Forscherinnen und Forscher haben hier und da ähnliche Skepsis an den Tag gelegt. Sie dienen, das dürfte beim Lesen der folgenden Seiten deutlich werden, nicht dazu, die Bedeutung von Franz zu schmälern, sondern dazu, seine menschliche Größe herauszuarbeiten. Dabei gilt die Schwierigkeit, eine konsistente Biographie zu schreiben, nicht nur für Franz, sondern generell für jedes gelebte Leben. In Auseinandersetzung mit der Moderne hat der evangelische Theologe Henning Luther den Gedanken entfaltet, dass das Leben letztlich ein Fragment sei30: Wir leben und erleben unsere Biographie immer wieder momenthaft, geprägt durch Früheres, und doch nicht einfach anhand eines roten Fadens, der am Ende von sich aus den Sinn unseres Lebens aufzeigen würde. Der Sinn unseres Lebens geht nicht einfach aus dem Leben hervor, sondern wird ihm zugeschrieben – wir versuchen erzählend und deutend den Sinn unseres Lebens für uns und für andere zu bestimmen, und andere bestimmen ebenfalls in gewisser Weise über den Sinn unseres Lebens, indem sie die Fragmente zu einem Ganzen zusammenführen.
So verstanden, haben auch jene frühen Biographen vor allem eines versucht: das in Fragmenten gegebene und überlieferte Leben des Franz sinnvoll zu deuten. Dass sie dies in dem Horizont seiner Heiligkeit taten, war für sie selbstverständlich und macht ihre Nachrichten nicht ohne Weiteres historisch unbrauchbar. Wäre dem so, könnte man das Unterfangen einer Franz-Biographie aufgeben, ehe man mit ihr begonnen hat. Aber die frühen Hagiographen betrachteten die Überlieferungen, die ihnen zur Verfügung standen, unter einer bestimmten Perspektive31 – es ist die Perspektive von Licht und Finsternis, von Hell und Dunkel: Der Heilige, der zum Glanz der himmlischen Herrlichkeit aufgestiegen ist, wird so geschildert, dass ebendiese Herrlichkeit schon hier auf Erden wenigstens als Abglanz sichtbar ist. Umso finsterer erscheint in dieser Perspektive dann das Gegenbild – oft schlicht „die Welt“ mit ihren Verführungen, oder gerade bei Franz oft auch biographisch sehr konkret der Vater, von dem er sich in vermutlich für beide Seiten mühsamen Auseinandersetzungen löste. Nicht allein die Niederschrift der Viten und Legenden ist von diesem Hell-Dunkel-Gegensatz geprägt, sondern schon die Sammlung des Materials, ja seine Entstehung: Die Mirakelbücher über Franz von Assisi, von denen eines schon von Thomas von Celano stammt, legen hiervon Zeugnis ab. Die Phantasie der Zeitgenossen fügte immer noch eine und noch eine Geschichte hinzu, oft liebevoll erzählt und nicht mit der Absicht, Unwahres zu erfinden, sondern das, was man als tiefere Wahrheit im Leben des Heiligen empfand, immer besser erzählend auszudrücken.
Dass man diesen Schilderungen nicht einfach folgt, ist für die moderne Forschung selbstverständlich, und gerade die Forschung des Franziskanerordens selbst hat hier Maßstäbe gesetzt. Dass man sie umgekehrt nicht in Bausch und Bogen verwirft, gilt aber ebenso: Moderne Deutung kann sich über die frühen Schilderungen nicht einfach hinwegsetzen, sondern hat die Aufgabe, durch sie hindurch nach jenen Fragmenten zu suchen,32 die vielleicht in der Lage wären, eine andere Geschichte zu erzählen als die, die zu der über Jahrhunderte hinweg prägenden geworden ist. Doch sie fügen sich keineswegs von selbst zu einer anderen Geschichte zusammen und der moderne Deuter wäre nicht gut beraten, aus solchen gegenläufigen Fragmenten gleich ein ganzes Gegenbild zu machen. In ihrer Zusammenfügung folgt die Deutung dem, was aus heutiger Sicht wahrscheinlich erscheint, genauer: wovon man sich vorstellen kann, dass es im 13. Jahrhundert passiert sein könnte. Auch die moderne Biographie schafft so gesehen eine Konstruktion von Sinn aus den Fragmenten und muss damit leben, dass diese hinterfragbar bleibt.
Aus der Zwickmühle kommt man allerdings heraus: In dem Wissen, selbst nicht herausfinden zu können, wie es sich tatsächlich mit dem Leben des Franz verhalten hat, wird im Folgenden ein solches Leben erzählt, wie es nach heutiger kritischer Sicht der Quellen verantwortbar scheint. Das heißt auch, dass viele feste Stücke der kulturellen Erinnerung an Franz in Zweifel gezogen werden müssen. Diese Biographie folgt damit der methodischen Einsicht in jene Spannungen der Quellen: Sie zeigen an, dass Franz zumindest zuweilen ganz anders war, als die Heiligenlegende es brauchen und haben konnte. Als Heiliger war er ein Narr in Christus – aus der Sicht seiner Zeitgenossen vielleicht manchmal einfach nur ein verwirrter Kopf. Wo ihn die frühen Biographen gerne als gütigen Leiter seiner Brüdergemeinschaft sehen, könnte auch mancher Konflikt verborgen liegen. Und vielleicht legten die Biographen gerade deswegen so großen Wert auf den geistlichen Charakter seiner Beziehung zu Chiara di Offreduccio, weil das Verhalten der beiden für die Normen des Umgangs zwischen jungen Frauen und Männern anstößig war.
Gerade das letztgenannte Beispiel zeigt die Grenzen dieser Suche nach Lebensfragmenten jenseits der Heiligenlegende auf: Die Hinweise in den frühen Biographien reichen nicht immer aus, um mit großer Sicherheit eine Alternativbiographie zu den frühen Viten zu behaupten – die komplizierte Überlieferungslage führt nicht zu neuen Eindeutigkeiten, sondern zu einem Geflecht von Andeutungen und Ambivalenzen. Genau das ist das Ziel dieses Buches: die vielen möglichen Facetten im Leben des Franz von Assisi aufzuweisen, anzudeuten, welche Möglichkeiten die Fragmente eines Lebens und vor allem der Berichte darüber eröffnen. Die Vorstellung, der Historiker oder die Historikerin könnte erzählen, „wie es wirklich gewesen ist“, hat die Geschichtswissenschaft schon lange aufgegeben, die beeindruckende Geschichte der Erforschung der „franziskanischen Frage“ hat dies für den Fall des Mannes aus Assisi nachdrücklich unterstrichen. Hinter dem einen Gesicht aber, das man immer wieder zu zeichnen versucht hat, kann historische Forschung den vielen Gesichtern nachspüren, die ihn auch abbilden könnten. Und vielleicht wird sie damit der Fragmentarität des Lebens stärker gerecht als jeder Versuch, ihn auf nur eines der vielen Gesichter festzulegen. Ganz ergebnislos bleibt die Suche nach dem Menschen hinter den vielen Gesichtern indes nicht: So vielfältig die Möglichkeiten sind, Franz zu zeichnen, so gewiss mag doch manche Zeichnung ihn besser treffen als die andere. Ein Gedanke, der sich dabei als leitend für die folgenden Darstellungen herausgestellt hat, ist, dass das oft in der Forschung beschriebene lange Suchen von Franz nach seinem Weg bedeutet, dass ihm zuerst die Absage, der Bruch mit dem Elternhaus klar wurde. Am Anfang steht nicht die klare Orientierung an Christus, sondern die klare Absage an den Vater. Erst nach und nach empfand er in Christus das Gegenbild zu dem abgelehnten Elternhaus, aus dem Bruch wurde ein Aufbruch und schließlich die Sendung in die Welt, ja sogar bis an die Enden der Welt, zum Sultan. Darin spiegelt sich wider, dass aus dem Kaufmannssohn aus Assisi eine Figur der Weltgeschichte geworden war – und es eröffnet, im vierten Kapitel, den Blick auf das Gegenüber zum Stellvertreter Christi, dem Papst. Aber seine Botschaft war, immer klarer und deutlicher, eine, die ihn aus der Welt hinausführte – das sollte seine letzten Lebensjahre füllen. So wird aus den vielen Fragmenten dann doch eine Erzählung, die mit allen Erzählungen über das Leben des Franz ein Wagnis bleibt, und die ihren sichersten Grund dort hat, wo die erhaltenen Originaltexte von seiner Hand etwas von Franz selbst und seiner tiefen, stets nach Gott schauenden und suchenden Frömmigkeit erkennen lassen. Blickt man auf den darin erkennbaren intensiven Christusglauben und seine Liebe zur Bibel, hätte ihm vielleicht gerade das Bekenntnis zur Fragmentarität des Lebens auf dieser Erde gefallen, entspricht es doch dem, was der Apostel Paulus sagte: „Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht“ (1 Kor 13,12).
Karte Italiens um 1200.